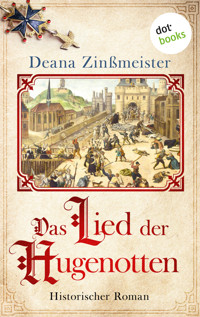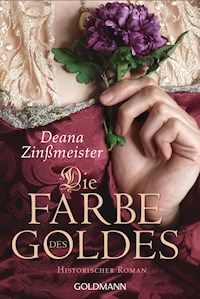8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Pesttrilogie
- Sprache: Deutsch
Der schwarze Tod kehrt zurück …
Trier 1652: Auch vier Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg kommen die Menschen in Kurtrier nicht zur Ruhe. Ein geheimnisvoller Reiter verbreitet Angst und Schrecken, angeblich bringt er die Pest zurück. Der junge Schweizer Urs versucht deshalb verzweifelt, ein Heilmittel gegen die Krankheit zu finden. Währenddessen hofft seine Freundin Susanna, die aus ihrer Heimat im Saarland flüchten musste, mit seiner Hilfe die Schrecken ihrer Vergangenheit hinter sich lassen zu können. Doch dann scheint Urs plötzlich nichts mehr von ihr wissen zu wollen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Trier im Jahr 1652: Der Dreißigjährige Krieg ist seit längerer Zeit beendet – doch die Menschen in Kurtrier finden noch immer keinen Frieden. Ein geheimnisvoller Reiter verbreitet Angst und Schrecken in der Gegend, und es geht das Gerücht um, dass er die Pest zurückbringt. Der junge Schweizer Urs versucht alles, um ein Heilmittel gegen die Krankheit zu finden. Seine Freundin Susanna hofft währenddessen auf eine gemeinsame Zukunft mit ihm. Nach ihrer Flucht aus dem Saarland möchte sie sich ein neues Leben in Trier aufbauen und die Schrecken der Vergangenheit hinter sich lassen. Doch plötzlich scheint Urs ein Geheimnis zu haben, das ihn von Susanna entfernt …
Weitere Informationen zu Deana Zinßmeister
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
DEANA ZINSSMEISTER
Der Pestreiter
Roman
Zitat von Antonio Pucci aus Klaus Bergdolt,
Der Schwarze Tod: Die Große Pest und das Ende des Mittelalters,
C. H. Beck Paperback, Berlin, 5. Aufl. 2003 (erstmals erschienen 1994/95).
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung November 2014
Copyright © 2014 by Deana Zinßmeister
Copyright © dieser Ausgabe 2014
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagmotiv: © The Bridgeman Art Library / The Birth of Venus,
c.1485 (tempera on canvas) (detail of 412); Columbine (oil on canvas);
Eleonora da Toledo (1519–74) (oil on panel); akg-images / Jérôme da Cunha
Redaktion: Eva Wagner
AG · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
Karte: Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-641-13155-5V003
www.goldmann-verlag.de
Gewidmet meinen beiden Lektorinnen
Andrea Groll und Eva Wagner
Personenregister
Die mit einem * versehenen Personen
haben tatsächlich gelebt.
Susanna Arnold, Vollwaise aus dem Land an der Saar
Arthur, Susannas Vetter
Familie Blatter aus der Schweiz
Jaggi, Vater; Soldat unter Karl Kaspar von der Leyen
Barbli, Mutter
Urs, ältester Sohn, Susannas Freund
Leonhard, jüngerer Sohn
Vreni, Nesthäkchen
Bendicht, Jaggi Blatters Bruder; Heiler
Elisabeth, Bendichts Helferin im Pesthaus
Nathan Goldstein, Goldhändler jüdischen Glaubens
Karl Kaspar von der Leyen* (1618–1676), Kurfürst und Erzbischof in Kurtrier
Philipp Christoph von Sötern* (1567–1652), sein Vorgänger im Amt
Ferdinand III.* (1608–1657), römisch-deutscher Kaiser
Johann Philipp von Schönborn* (1605–1673), Bischof von Mainz
Paul von Aussem* (ca. 1616–1679), ab 1654 Domkapitular im Kölner Dom
Eberhard Dietz*, Hauptmann unter Karl Kaspar von der Leyen
Ignatius, Jesuitenmönch
Thomas Hofmann, Ignatius’ Beschützer
Friedrich Spee* (1591–1635), Jesuitenmönch; Gegner der Hexenverfolgungen
Christ Preußer*, Unterschultheiß in Mensfelden
Agnes Preußer, seine Frau
Johann Wilhelm Walrabenstein*, Amtmann
Scheider/Schaider Mergh*, 1614 der Hexerei bezichtigt und zum Tode verurteilt
Walter Bickelmann, Zinßmeister bei Karl Kaspar von der Leyen
Anna Maria Bickelmann, seine Frau
Peter Hönes, Wohnungsvermittler
Dietrich, sein Saufkumpan
Heute verlässt einer seinen leiblichen Bruder,
der Vater sein Kind, wenn er es in Gefahr sieht,
damit ihn selbst nicht die Krankheit ereile.
Viele sterben so dahin, von Hilfe und Rat verlassen,
auch Sarazenen, Juden und Abtrünnige.
Sie dürfen niemals im Stich gelassen werden!
Oh ihr Ärzte, um Gottes Willen, und ihr Priester
und Bettelbrüder, besucht doch aus Nächstenliebe
die, welche nach euch verlangen,
Zeigt an ihnen eure Güte,
denkt an eure Seelen
und schaut jetzt nicht auf den Gewinn!
Und ihr, Verwandte, Nachbarn und Freunde,
wenn ihr seht, dass einer zu euch flieht,
bei Gott, zögert nicht!
Seid hochherzig und tröstet ihn!
Antonio Pucci(1310–1388), Dichter in Florenz,
der sich mit diesem bewegenden moralischen Appell
an seine Mitbürger wandte.
Prolog
Susanna stolperte durch die anbrechende Dunkelheit. Als sie eine Furche im Acker übersah, stürzte sie und schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf. Sie wollte sich aufrichten und spürte Blut an ihrer Schläfe. Stöhnend legte sie sich auf den Rücken und wischte es fort. Jetzt spürte sie einen stechenden Schmerz in den Knien. Die junge Frau blickte gepeinigt zum Himmel, als die Stimmen ihrer Verfolger an ihr Ohr drangen.
»Sie muss hier irgendwo sein!«, rief ein Mann wütend.
»Seht zu, dass ihr das Miststück findet, bevor sie im Wald verschwindet«, brüllte ein anderer.
Susanna ignorierte das Pochen im Schädel und den Schmerz in den Knien. Sie rappelte sich auf und rannte um ihr Leben. Erst am Waldesrand blieb sie stehen und drehte sich atemlos um. Als sie sah, wie die Männer Fackeln entzündeten, lief sie zwischen den Bäumen hindurch, um tief ins Gehölz zu gelangen. Mit beiden Händen versuchte sie, herunterhängende Äste zur Seite zu schieben, doch immer wieder peitschten ihr Zweige ins Gesicht. Als sie glaubte, tief genug in den Wald eingedrungen zu sein, lehnte sie sich entkräftet gegen einen Baumstamm und lauschte angestrengt. Nur ihr eigener Herzschlag und die Geräusche des Waldes waren zu hören.
Erleichtert beugte sie den Oberkörper nach vorn und legte ihre geschundenen Hände auf die schmerzenden Knie. Dabei fiel ihr Blick auf den Ring an ihrem linken Mittelfinger. Sie strich mit der Fingerspitze über den roten Stein, den sie von Urs als Zeichen seiner Liebe erhalten hatte.
»Ich werde ihn nie wiedersehen!«, schluchzte sie und wischte sich mit den aufgekratzten, brennenden Handrücken die Tränen fort. »Was wollen diese Männer von mir?«, wisperte sie und schaute sich angstvoll um. In der Dunkelheit konnte sie nichts erkennen.
Sie spürte, wie ihr speiübel und der Kopfschmerz stärker wurde. Gequält schloss sie die Augen, als sie erneut die tobenden Stimmen hörte, die näher zu kommen schienen. Sie werden mich finden, fürchtete sie und versuchte ruhig durchzuatmen, damit das Pochen im Schädel nachließ. Ich muss tiefer in den Wald flüchten, dachte sie.
Dann sah sie zwischen den Baumstämmen den Schein der Fackeln. Sie bewegten sich von ihr weg. Erleichtert atmete das Mädchen aus und stand mühevoll auf. Sie tastete sich von Baum zu Baum weiter. Susanna wusste nicht, wohin sie sich bewegte.
In der Nähe hörte sie das Schnauben eines Pferdes. Mit heftig pochendem Herzen blieb sie stehen und ließ ihren Blick umherschweifen. Nichts war zu erkennen. Sie wartete einige Augenblicke. Alles blieb ruhig.
Plötzlich knackte Holz, Laub raschelte. Panik erfasste Susanna. Das Hämmern in ihrem Kopf wurde stärker, die Übelkeit schlimmer. Wankend presste sie die Fingerspitzen gegen ihre Schläfen, als eine Stimme dicht neben ihr raunte:
»Hab keine Angst und bleib ruhig!«
Susanna erstarrte.
Dann drehte sie langsam den Kopf zur Seite. Eine Hand legte sich über ihren Mund. In diesem Augenblick schien der Schmerz in ihrem Kopf zu explodieren. Susannas Sinne schwanden.
Kapitel 1
Trier, im November 1652
Der Bader blickte von der Tür seiner Kammer auf die Truhe, die neben seiner Schlafstatt stand. Sofort spürte er eine Unruhe, die sich schleichend in seinem Körper ausbreitete. Es war dieses ungewöhnlich brennende Verlangen, das ihm gleichzeitig Vergnügen bedeutete. Wie gebannt starrte er auf das Möbelstück.
Es ist zu früh. Ich muss warten, bis Ruhe eingekehrt ist, dachte er. Doch die Erregung trieb ihn an. Er öffnete die Kammertür, streckte den Kopf auf den Gang hinaus und hielt sein Ohr in Richtung der Badestätte. Er lauschte angespannt und konnte Gesprächsfetzen und Lachen hören. In der Badestube herrschte reges Treiben. Lehrlinge kümmerten sich dort um das Wohl der Gäste. Alles lief wie an jedem anderen Tag in seinem Geschäft. Nichts, was ihn beunruhigte. Es war unwahrscheinlich, dass sich um diese Uhrzeit noch ein Badegast anmeldete.
Der Blick des Baders wanderte erneut zur Truhe. Niemand würde ihn stören. Er schloss die Tür. Langsam ging er auf das Möbelstück zu und öffnete den Deckel. Mit beiden Händen schob er seine persönlichen Sachen zur Seite. Als seine Finger einen harten Gegenstand ertasteten, seufzte er tief und murmelte: »Da bist du, mein Schatz!«
Dann holte er seine Geldschatulle hervor und setzte sich auf das Schlaflager. Er stellte das Kästchen auf die Knie und nahm langsam den Deckel ab. Fast liebevoll betrachtete er die vielen Münzen, die er während des Jahres seinen Gästen heimlich gestohlen hatte. Er griff hinein und ließ das Geld zwischen den Fingern hin und her wandern. Dann kippte er den Inhalt auf seiner Matratze aus und kniete sich davor. Mit spitzen Fingern nahm er ein Geldstück nach dem anderen auf und roch an jeder einzelnen Münze. Süchtig nach dem Geruch des Metalls, rieb er jedes Geldstück zwischen den Händen, damit seine Haut den ungewöhnlichen Duft aufnehmen konnte. Dann stapelte er jeweils zehn Münzen zu einem Turm auf.
Als alle Geldstücke vor ihm aufgereiht waren, setzte er sich auf den Boden und betrachtete seinen Schatz. Er schnupperte immer wieder an seinen Händen.
Die Glocke über der Eingangstür der Badestube schellte. Erschrocken schaute er auf und schob hastig die kleinen Türme in die Schatulle. Er verschloss die Kassette mit dem Deckel und legte sie zurück in die Truhe. Erst nachdem er das Kästchen unter seinen Sachen versteckt hatte, stand er auf und ging nach vorn zur Tür, um den Ankömmling zu begrüßen.
»Seid willkommen«, rief der Bader, kaum dass der Fremde den Raum betreten hatte. »Ich habe zu dieser späten Zeit mit keinem weiteren Gast gerechnet«, erklärte er und lächelte.
Der Mann, der in die dunkle Kutte eines Mönchs gekleidet war, zog seine Kapuze vom Kopf und grüßte mit einem Nicken.
Der Bader musterte den Mann, der weit gereist zu sein schien. Sein Gesicht war faltenlos, doch der Kranz grauer Haare verriet, dass er kein Jüngling mehr war. Mit seinen braunen Augen erwiderte er den Blick des Baders, ohne eine Miene zu verziehen. Die dunkle Kutte des Mannes war durchnässt und hing schwer an seinem Körper. Zahlreiche Dreckspritzer, mit denen der Stoff bis zu den Schultern bedeckt war, zeugten von einem harten Ritt.
Der Blick des Baders wanderte zu den Wasserpfützen, die sich um das Schuhwerk des Fremden bildeten. »So nass, wie Ihr seid, müsst Ihr länger unterwegs gewesen sein«, stellte er fest und schaute dem Gast neugierig in die Augen. Als der Fremde nichts erwiderte, fragte der Bader: »Woher kommt Ihr?«
Erneut blieb der Mann stumm. Der Bader kratzte sich verunsichert über das kurz geschorene Haar.
»Ich möchte ein Bad nehmen«, erklärte der Gast schließlich mit tiefer Stimme. Seine Haltung und der abweisende Blick zeigten, dass er kein Interesse an einer Unterhaltung hatte.
Der Bader verstand und besann sich seiner Aufgabe. »Damit Ihr keine Erkältung bekommt, solltet Ihr Euch zusätzlich eine Sitzung im heißen Dampf gönnen. Dadurch wird auch das Ungeziefer auf Eurem Körper abgetötet«, erklärte er geflissentlich. Es war ihm nicht entgangen, dass der Mann sich mehrmals im Nacken und auf dem Kopf kratzte. »Danach bereite ich Euch ein Bad in warmem Wasser, dem ich wohlduftende Kräuter beimengen lasse, und Ihr werdet Euch wie neugeboren fühlen. Gegen einen Aufpreis wird meine Tochter Euren Umhang trocknen, und mein Sohn wird Eure Bissstellen nach dem Bad mit Ringelblumensalbe einreiben. Sicher seid Ihr hungrig. Auch dem kann ich abhelfen. Mein Lehrling wird Euch während des Badens Käse, Brot und heißen Würzwein reichen. Ich verspreche Euch, dass solche Dienste in keinem anderen Badehaus der Stadt angeboten werden«, versicherte er geschäftstüchtig und blickte den Mann erwartungsvoll an, der nur nickte.
»Ihr müsst im Voraus bezahlen«, erklärte der Bader und nannte die Summe.
Der Fremde gab sie ihm ohne Murren.
Hätte ich einen höheren Preis genannt, hätte er diesen sicher ebenfalls bezahlt, ärgerte sich der Bader im Stillen und ließ die Münzen in seiner Jackentasche verschwinden.
»Folgt mir«, bat er und wies dem Gast den Weg zum hinteren Teil seines Badehauses.
Er brachte den Mann in die Umkleidekammer, wo mehrere Männer zusammenstanden und sich angeregt unterhielten.
»Ich sage euch, dass die alte Mina Schuld trägt. Sie ist ein herrschsüchtiges und unehrliches Weib, das nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Seit Jahren hatten wir keinen solch milden und nassen November. Dabei bräuchten wir dringend Frost, damit das Ungeziefer kaputtgeht. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass die Alte Schadenszauber über unsere Stadt gelegt hat«, ereiferte sich einer der Männer und streifte sein Beinkleid ab.
Während sich ein anderer ein Tuch um den vorgewölbten Bauch schlang, meinte ein älterer Mann mit grauen Haaren: »Ich erinnere mich, dass es während des langen Kriegs ebenfalls verregnete und milde Winter gegeben hat, sodass die Stechmücken uns schon im Januar aufgefressen haben. Auch damals war die Ursache ein Fall von Schadenszauber gewesen, den Weiber, die vom Glauben abgefallen waren, über uns gebracht hatten. Erst als sie auf den Scheiterhaufen brannten, wurde es besser.«
Der Bader erkannte am Blick des Mönchs, dass ihm das Gerede missfiel. Mit Gesten und Blicken bedeutete er den Männern, dass sie verschwinden sollten.
Erst jetzt schienen die Gäste den Fremden zu bemerken. Sie nickten dem Mönch knapp zu und verließen den Raum durch eine zweite Tür, die zum Baderaum führte.
Der Bader reichte dem Gast ein wollenes Tuch und erklärte: »Ihr könnt Euch hier entkleiden und Eure Sachen in diese Kiste sperren.« Mit dem Zeigefinger wies er auf eine kleine Truhe, die neben anderen Holzbehältern aufgereiht an der Wand stand. »Den Schlüssel bindet mit dem Band um Euer Handgelenk. So kann kein anderer die Kiste öffnen, denn wir sind ein ehrliches Haus«, versicherte er und blickte den Mönch erwartungsvoll an.
Als der Gast die Bemerkung überging, konnte er sich die Frage nicht verkneifen: »Ihr redet wohl nicht gern?«
Im gleichen Augenblick erschrocken über seine eigene Dreistigkeit, blickte er den Fremden an.
Der sah ihn mit seinen dunklen Augen böse an und antwortete erst nach einigen Herzschlägen barsch: »Nein!«
Dann öffnete der Mönch das Zingulum, den groben Strick um seine Hüfte, und legte es auf eine der Bänke, die zwischen den Kisten standen.
Bevor der Bader ihn allein ließ, wies er ihn an: »Lasst Euren Umhang liegen. Meine Tochter wird ihn säubern und trocknen. Sobald Ihr bereit seid, klopft an diese Tür, ich bringe Euch dann in den Schwitzraum.«
Der Fremde blickte dem Bader nach, bis die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Welch neugieriger Mensch, dachte er und schälte sich aus seinem Habit. Er war froh, sich der nassen Kleidung entledigen zu können. Seit Stunden spürte er die Kälte im Körper, die seine Knochen schmerzen ließ. Frierend schlang er sich das weiche Tuch um den Leib. Der Ritt war zu anstrengend gewesen.
Ich bin nicht mehr der Jüngste, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, dachte er. Zwar hätte er in der Abtei seines Ordens ein heißes Bad nehmen können, zumal das Kloster nicht mehr als eine Stunde entfernt lag. Doch er wollte nicht verschmutzt und nass vor seinen Superior treten. Außerdem brauchte er Zeit, um nachzudenken und sich auf manche Frage, die der Klostervorsteher ihm sicher stellen würde, eine unverfängliche Antwort überlegen zu können. Er seufzte leise und murmelte: »Warum nur habe ich mich dazu überreden lassen?«
Er kannte die Antwort auf diese Frage. Sein Blick wurde starr, und seine Gedanken quälten ihn. Doch er wollte sich nicht daran erinnern und klopfte gegen das Türblatt.
Der Bader öffnete die Tür zur Schwitzkammer, und sogleich schlug ihnen heißer Wasserdampf entgegen.
»Setzt Euch auf das Brett und lasst den Dampf in die Haut einwirken, damit er die Kälte aus Eurem Leib vertreibt. Sobald der Sand durch die Uhr gelaufen ist, kommt mein Lehrling und wird Euch mit einer weichen Bürste den Schmutz vom Körper schrubben.« Der Blick des Baders wanderte über den nackten Oberkörper des Mannes, der mit roten Pusteln übersät war. »Das Bürsten wird den Juckreiz lindern«, versprach er. »Genießt das Bad und Euer Essen. Sobald Ihr Euch abgetrocknet habt, wird mein Sohn heilende Salbe auf die Bissstellen reiben. Danach werdet Ihr Euch wie ein anderer Mensch fühlen.« Mit diesem Versprechen ließ er ihn allein in der Schwitzkammer zurück.
»Welch seltsamer Kauz«, sagte er leise zu sich selbst und schloss die Tür.
Der Mönch beugte sich nach vorn, da unter den Sitzgelegenheiten heiße Schwaden aufstiegen, die den Raum vernebelten. Neugierig besah er sich die Öffnungen im Boden unter den Bänken. Solch eine Vorrichtung war ihm neu. In den Badestuben außerhalb und in den Klöstern wurden Kieselsteine erhitzt und mit Wasser übergossen, damit sie dampften. Hier stieg der Dampf aus dem Boden auf.
Der Qualm wurde dichter. Schweißperlen sammelten sich auf seiner Stirn, und er ließ sich auf einer Bank nieder, die inmitten des schmalen Raumes stand. Durch die Wärme juckten die Flohbisse, die entzündet waren, stärker, sodass er sich heftig mit der flachen Hand über Beine und Arme rieb. Als das Beißen nachließ, seufzte er erleichtert und stieß ein Dankgebet aus. Seine Haut war durch das Kratzen und die feuchte Hitze gerötet und glänzte vom Schweiß, den er mit der Handkante wegstrich. Er spürte, wie er müde wurde. Tief atmend legte er sich auf die Bank, schloss die Augen und entspannte sich endlich.
Derweil war der Bader durch den schmalen Spalt der offenen Tür in den Umkleideraum geschlüpft. Mit einem Schlüssel, den er hinter seinem Gürtel hervorzog, öffnete er eine der Kisten seiner Gäste. Hastig kramte er in den Sachen, bis er die Geldkatze fand. Er blickte sich um und lauschte. Doch außer seinem eigenen Herzschlag, der dumpf in seinen Ohren dröhnte, war nichts zu hören. Mit gierigem Blick in den Augen streckte er die Finger nach dem Beutel aus, öffnete die Kordel und sah hinein. Enttäuscht stellte er fest, dass er wegen des mageren Inhalts nur eine Münze entwenden konnte.
Mit der Geldkatze aus der zweiten Kiste hatte er mehr Glück. Sie wog schwer in seiner Hand, und er entnahm ihr drei Geldstücke.
Als er die Holzkiste des Mönchs öffnete, zögerte er. Noch nie hatte er einen Gottesmann bestohlen. »Die meisten baden in ihren Klöstern und verirren sich nicht hierher«, nuschelte er und spürte, wie die Gier ihn besiegte. Er holte den Beutel hervor und merkte sofort, dass er reichlich mit Silbermünzen gefüllt war. »Der Mönch wird nicht merken, wenn ich ihm eine wegnehme. Außerdem sollen Ordensbrüder barmherzig sein und dazu gehört, dass sie teilen sollen«, lästerte er leise und ließ die Silbermünze von einer Hand in die andere wandern. Mit geschlossenen Augen schnupperte er daran und sog den Geruch des Metalls wie einen Blumenduft ein. »Komm zu mir, mein Schatz!«, murmelte er und versteckte das gestohlene Geld hinter seiner Bauchbinde.
Nachdem er alle Kisten wieder sorgfältig verschlossen hatte, ging er in seine Kammer und versteckte die Beute in der Geldschatulle.
Der Mönch spürte inzwischen, wie die feuchte Hitze ihn unruhig werden ließ, und setzte sich wieder auf. Um sich abzulenken, blies er die Wangen auf und atmete stoßweise aus. Dann fächelte er sich mit beiden Händen Luft zu. »Lange halte ich es nicht mehr aus«, japste er.
In diesem Augenblick versiegte der aufsteigende Dampf, und die Tür wurde geöffnet.
»Mein Herr, bitte streckt Euch auf der Bank aus, damit ich Euch abbürsten kann«, bat ein Bursche mit einem Eimer in der Hand, der befangen zu Boden blickte.
Der Mönch schätzte den Knaben nicht älter als zehn Jahre. »Du bist wohl der Lehrling, von dem der Bader gesprochen hat?«, fragte er, während er sich auf der Bank ausstreckte.
Als er platt auf dem Bauch lag, goss ihm der Junge mehrere Kellen des warmen und wohlduftenden Wassers über den Körper.
»Ich habe schon viele Badehäuser besucht, aber solch eine Dampfvorrichtung habe ich nirgends gesehen«, erklärte der Geistliche und schloss die Augen.
Der Junge tauchte die Bürste in das Wasser und begann den Rücken des Mönchs mit gleichmäßigen Bewegungen abzureiben. »Unser Badehaus wurde auf der Ruine einer Badeanstalt aus der Zeit der Heiden gebaut. Im Fundament liegen zahlreiche Rohre, durch die das heiße Wasser fließen kann, das im Keller in einem riesigen Kessel erhitzt wird.«
»Das dachte ich mir«, nuschelte der Mönch, der wusste, dass Trier eine der ältesten Städte im Reich und von den Römern erbaut worden war. An vielen Stellen der Stadt konnte man ihre Ruinen finden.
Nachdem der Knabe den Körper des Mönchs gründlich mit der weichen Waschbürste bearbeitet hatte, glänzte die Haut des Mannes.
»Das hat gutgetan, auch wenn ich jetzt die Farbe eines Ferkels habe«, bedankte er sich lächelnd. Er erhob sich und schlang dabei sein Tuch fest um den Leib. Dann folgte er dem Jungen durch den Gang in die Badestube, wo lautes Stimmengewirr den Raum erfüllte.
In der Mitte stand ein riesiger Zuber, in dem mehrere Personen gleichzeitig baden konnten. Die Männer aus dem Umkleideraum und zwei weitere saßen im Wasser, jeder einen Becher in der Hand, und führten ein angeregtes Gespräch. Sie verstummten, als sie des Mönches gewahr wurden. Doch kaum drehte er ihnen den Rücken zu, schienen sie ihn zu vergessen und begannen erneut zu debattieren.
»Wir müssen etwas gegen das falsche Weib unternehmen«, erklärte einer der Männer.
»Wir sollten mit dem Stadtrat sprechen. Ich bin überzeugt, dass er unsere Meinung teilt«, antwortete ein anderer.
»Das denke ich nicht«, erwiderte ein dritter Mann. »Heutzutage werden Hexen nicht mehr schnell auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Keiner der Stadträte wird sich deshalb zu weit aus dem Fenster lehnen. Außerdem will der Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen über jede Hexenanklage benachrichtigt werden.«
Der Mönch wurde hellhörig, doch der Knabe lenkte ihn ab. »Mein Herr, der Bader hat Euch einen eigenen Zuber mit heißem Wasser füllen lassen«, erklärte er und zeigte auf die Bütte. »Sobald Ihr Platz genommen habt, werde ich Euch Speisen und Wein bringen.«
Der Mönch nickte dankend, ließ das Tuch zu Boden gleiten und stieg in den Bottich. Als das warme und wohlduftende Wasser seinen Körper umschloss, spürte er, wie kalt es ihm auf dem Weg von der Schwitzkammer zu der Badestube geworden war. Er streckte sich aus und schloss die Lider.
Er musste kurz eingenickt sein, denn als ihn jemand anstupste, riss er erschrocken die Augen auf.
»Mein Herr! Euer Mahl!«, sagte der Knabe und legte ein Brett quer über den Zuber. Er stellte einen Krug mit kaltem Würzwein sowie eine Platte mit zwei breiten Stücken Käse und frischem Brot darauf.
»Danke, mein Junge! Gott wird es dir vergelten«, sagte der Mönch freundlich und nahm einen Schluck.
»He, Lukas, bring uns mehr Wein. Aber rasch! Oder bist du nur für den späten Gast zuständig?«, rief einer der Männer im großen Zuber dem Knaben zu, der daraufhin eilig den Raum verließ.
Da der Mönch mit dem Rücken zu den anderen Gästen saß, konnte er denjenigen, der ihn beleidigt hatte, nicht sehen. Der Tonfall seiner Stimme ließ jedoch vermuten, dass er nicht mehr nüchtern war. So überhörte der Mönch die Unhöflichkeit. Er brach sich ein Stück Brot ab und spülte es mit Wein hinunter.
»Habt ihr von dem Pestreiter gehört? Er verbreitet Angst und Schrecken«, sagte eine Stimme und durchbrach die angenehme Stille, die für eine Weile geherrscht hatte. »In jeder Spelunke hört man die Menschen hinter vorgehaltener Hand über ihn sprechen, aus Angst, er könnte zu ihnen kommen«, fügte der Redner hinzu.
»Die Hufe seines Schlachtrosses sollen so groß sein wie zwei Hände. Es heißt, er steige nachts durch die Fenster der Pestkranken und hole sie – einen nach dem anderen«, erklärte der Mann, der den Jungen zurechtgewiesen hatte, mit schwerer Zunge.
»Das ist eines dieser Ammenmärchen, die sich die alten Tratschweiber beim Wäschewaschen erzählen«, spottete ein anderer.
Der Mann senkte die Stimme und fuhr fort: »Aber ich kenne eine Geschichte, die kein Ammenmärchen ist.« Als er der Aufmerksamkeit seiner Badekameraden gewiss war, verriet er: »Ein bettelarmes Mädchen soll einen Schatz gefunden haben, der so wertvoll ist, dass sie jetzt eine der reichsten Frauen Triers sein soll. Angeblich war es die Hinterlassenschaft eines Klosterbruders, der ihr als Untoter den Weg zu dem Gold gewiesen haben soll.«
»Wo hat sie ihn gefunden? In der Stadt?«, fragte einer der Männer mit bebender Stimme.
»Wo sie den Schatz fand, ist ein Geheimnis. Sie soll nicht von hier stammen. Man sagt, sie käme aus dem Land an der Saar …«
Mit weit geöffneten Augen saß der Mönch in seinem Bottich. Ungewollt hatte er den Männern zugehört und jedes Wort verstanden. Sein Herzschlag beschleunigte sich ebenso wie sein Atmen.
Die Hand mit dem Stück Käse, die er gerade zum Mund führen wollte, fiel ins Badewasser. Unfähig, sich zu bewegen, wusste der Mönch, dass seine Erstarrung nichts mit der Erwähnung des unheimlichen Pestreiters zu tun hatte.
Kapitel 2
Trier, wenige Wochen zuvor
Der Nachthimmel war wolkenlos. Sterne funkelten in der Schwärze. Eine Maus spitzte unter dem Hoftor hervor. Ihr Näschen kräuselte sich. Das Tier huschte zur Scheune. Alles war ruhig. Die Menschen auf dem Bauernhof schliefen. Auch das Vieh im Stall und der Hofhund. Nichts war zu hören. Alles schien friedlich.
Wie durch einen Nebelschleier konnte Susanna den Bauernhof ihrer Eltern erkennen. Als sich der Dunst langsam lichtete, hatte sie das Gefühl, wie ein Vogel über dem Gelände zu schweben und von oben herabzublicken. Sie sah das Wohnhaus, die Scheune, den Stall, den Garten ihrer Mutter, den schlafenden Hofhund.
Sie konnte alles deutlich erkennen, und sie wusste, was jetzt geschehen würde. Seit Wochen hatte sie denselben Traum, sah dieselben Bilder – und konnte nichts dagegen tun.
Leichter Wind trug schwache Geruchsschwaden heran. Der Hund hob den Kopf und schnupperte mit geschlossenen Augen in alle Richtungen. Er schien nichts Ungewöhnliches zu wittern. Schmatzend leckte er sich über die Lefzen und legte den Kopf auf die ausgestreckten Vorderpfoten.
Als plötzlich fremde Gestalten auf den Hof schlichen, schien der Hund leise Stimmen und fremde Geräusche wahrzunehmen. Erneut hob er den Kopf, als seine Schnauze gepackt und zusammengedrückt wurde. Angstvoll riss das Tier die Augen auf und versuchte sich zu befreien. Der Hund winselte unter dem Druck der Pranke. Seine Zähne bohrten sich in die Zunge. Blut tropfte ihm aus dem Maul. Panisch warf das Tier den Kopf hin und her. Doch die Hand hielt seine Schnauze fest umklammert. Der Hund versuchte aufzuheulen. Durch das geschlossene Maul drang nur ein unterdrücktes Winseln. Eine Klinge blitzte im Schein der Sterne auf. Das Messer bohrte sich tief in den Tierkörper.
Eine Blutlache breitete sich um den Kadaver aus.
Susanna riss den Mund weit auf. Sie schrie, aber es kam kein Laut aus ihrer Kehle. Als sie sah, wie die Gestalten die Haustür öffneten und in ihr Elternhaus schlichen, wollte sie hinlaufen, um sie aufzuhalten. Doch ihre Beine gehorchten ihr nicht. Sie wollte schreien. Erneut brachte sie keinen Ton heraus.
Ihr Mund wurde trocken. Sie bekam keine Luft mehr. Du musst ins Haus laufen, sie warnen und sie beschützen, schossen ihr die Gedanken durch den Kopf. Aber vor wem und wie?
Der Traum! Dieser verfluchte Traum! Susanna fasste sich verzweifelt an den Kopf, riss sich an den Haaren. Es ist ein Traum!, versuchte sie sich zu beruhigen. Nur ein Traum, der sich jede Nacht wiederholte. Und diesen Traum musste sie aushalten.
Susanna ahnte, was jetzt kommen würde. Sie wollte wegschauen, doch ihr Blick war wie gebannt auf den Hof gerichtet.
Zwei Gestalten, die Susannas Vater an den Armen festhielten, schleiften ihn aus dem Haus und stießen ihn im Hof zu Boden. Ein anderer Mann, der sein Schwert vor sich mit der Spitze in den Boden rammte, schaute mit grimmigem Blick auf den Bauern herunter, ohne ein Wort zu sagen.
Ihr Vater sah zu dem Fremden auf. Er schien etwas sagen zu wollen.
In dem Moment wurden die Mutter, Susannas kleine Schwester Bärbel und ihr Bruder Johann sowie die Magd und der Knecht aus dem Haus gezerrt. Nun schrie der Vater auf. Er streckte seine Hände dem Fremden entgegen, doch dieser brüllte ihn an. Immer wieder schüttelte der Bauer den Kopf, worauf der Fremde vor den Bauersleuten und ihrem Gesinde auf und ab marschierte.
Susanna konnte die Worte nicht verstehen, doch sie ahnte, was die fremden Männer suchten. Sie forderten die Herausgabe von magischen Schriften, von Zauberformeln, mit denen man Geister beschwören musste, die einen Schatz bewachten.
»VATER! Gib ihnen die Schriften!«, wollte Susanna schreien, aber sie brachte keinen Laut hervor. Sie spürte, wie sie müde wurde. Das Gefühl von Hilflosigkeit überwältigte sie.
Dann sah sie, wie ihr großer Bruder Johann sich losriss und in den Garten rannte.
Sie wollte ihm zuschreien, er solle das sein lassen. Doch zu spät! Einer der Verbrecher warf ihm die Axt ins Kreuz. Johann schrie, torkelte und fiel zu Boden. Er drehte den Kopf seinen Eltern zu, dann erlosch sein Blick.
Der Vater wollte zu seinem Sohn laufen, doch er wurde auf den Boden zurückgestoßen. Die Mutter, die Magd und der Knecht weinten und schrien. Doch als der Schurke die Schwertspitze auf sie richtete, verstummten sie. Nur die achtjährige Bärbel brüllte wie am Spieß und ließ sich nicht beruhigen. Einer der Männer zerrte das Kind in die Höhe und rüttelte es, doch die Kleine schrie und schrie. Da erschlug er das Kind.
Susanna bäumte sich auf, presste sich die Hände auf die Ohren und die Ellenbogen vors Gesicht. Nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Doch die schrecklichen Bilder blieben in ihrem Kopf, wollten nicht schwinden, das Geschrei nicht verhallen.
Sie musste die Augen wieder öffnen. Susanna sah sich in der Scheune stehen und konnte das Bild nicht verscheuchen. Dasselbe Bild wie damals, als sie ihre Eltern und die Magd entdeckt hatte: Arme und Beine des gefolterten Vaters waren an Pfählen, die im Boden steckten, festgebunden. Auf dem Boden lag der nackte Leichnam ihrer Mutter. Ihre Glieder waren verdreht. Die Magd hatte man an einem Strick erhängt. Ihre Leiche baumelte über der toten Mutter.
Susanna hörte Feuer knistern und glaubte, Rauch zu riechen. Jemand rief ihren Namen, und endlich wachte sie auf.
Als sie die Lider aufschlug, blickte sie in die bernsteinfarbenen Augen von Urs, der sie besorgt ansah.
Kapitel 3
Bendicht lag auf seiner Schlafstatt und starrte mürrisch in die Dunkelheit. Obwohl er abends das Zubettgehen so lange wie möglich hinauszögerte und sich als Letzter niederlegte, erwachte er lange vor den anderen. Ich werde alt, mutmaßte er, und seine nach unten gezogenen Mundwinkel hoben sich. Du wirst nicht alt, du bist bereits alt, griente er. Bendicht erinnerte sich, dass einst sein Vater ebenfalls über Schlafmangel geklagt hatte, da er jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe erwacht war. Damals meinte der Vater: »Das ist ein sicheres Zeichen, dass man alt wird.« Bendicht rechnete nach und erkannte, dass sein Vater damals im gleichen Alter gewesen sein musste wie er heute.
»Ach, was soll ich grübeln? Heißt es nicht ›Morgenstund’ hat Gold im Mund‹?«, fragte sich Bendicht leise und schwang die Beine aus dem Bett. Sofort spürte er die morgendliche Kälte. »Es dauert nicht mehr lang, und der Winter ist da«, murmelte er und kleidete sich rasch an.
Er setzte sich an den schweren Holztisch in der Küche. Es war der wärmste Raum im Haus, da das Herdfeuer nie ausging.
»Der Vorteil, wenn man als Erster erwacht, ist die Stille im Haus«, murmelte er und genoss die Ruhe, den heißen Morgensud, den er sich aufgebrüht hatte, und das Buch, das aufgeschlagen vor ihm auf der blankgescheuerten Holzplatte lag. Da das Licht der Talglampe nur schwach die Buchseite beschien, kniff er die Augen leicht zusammen und fuhr mit dem rechten Zeigefinger die Zeilen entlang.
Bendicht wusste nicht, wie oft er diese Seiten schon gelesen hatte. Manche Abschnitte konnte er auswendig aufsagen. Trotzdem fürchtete er, etwas Entscheidendes überlesen, einen Hinweis übersehen zu haben. Auch heute las er Wort für Wort die Sätze – manche mehrmals. Er war so sehr in die Schriften vertieft, dass er nicht bemerkte, wie seine Schwägerin Barbli hinter ihn trat.
»Das müssen aber wichtige Schriften sein, wenn du schon vorm Morgengrauen darin liest.«
Mit einem Ruck wandte Bendicht den Kopf der Schwägerin zu und blickte sie erschrocken an. »Barbli«, sagte er mit vorwurfsvollem Ton und klappte das Buch zu. »Wie kannst du mich so erschrecken?«
»Was liest du?«, wollte sie wissen und kam einen Schritt näher. »Ist das das Buch von Urs?«, fragte sie.
Bendicht nickte. »Ich habe es deinem Sohn vor eurer Abreise aus unserer Heimat geschenkt. Es ist das Buch des Paracelsus, in dem er seine Ansichten, Lehren und Erkenntnisse niedergeschrieben hat.« Als er den fragenden Blick seiner Schwägerin sah, erklärte Bendicht: »Paracelsus hat vor mehr als einhundert Jahren gelebt und war Arzt, Astrologe, Mystiker, Alchimist, Philosoph und Laientheologe.«
»Er scheint ein vielseitiger und weiser Mann gewesen zu sein«, sagte Barbli und blätterte in dem Buch.
»Nicht nur das! Er soll sogar Schweizer gewesen sein – jedenfalls die eine Hälfte von ihm«, verriet Bendicht der Schwägerin.
Sie blickte überrascht auf. »Wie das?«
»Angeblich kam sein Vater aus dem Reich, und seine Mutter aus dem Ort Einsiedeln im Kanton Schwyz. Wie es heißt, hat Paracelsus an der Universität in Basel Medizin studiert.«
»Offenbar kommen aus unserer alten Heimat nicht nur die besten Soldaten, sondern auch hervorragende Gelehrte«, bemerkte Barbli.
»Dasselbe habe ich damals auch zu deinem Sohn Urs gesagt, als er mich über Paracelsus ausfragte«, schmunzelte Bendicht, doch dann wurde seine Miene ernst. »Du weißt, Barbli, dass dein Sohn Arzt und nicht Soldat werden möchte?«
Seine Schwägerin seufzte vernehmlich. »Nicht schon wieder dieses Thema!«, bat sie. Doch als sie den sturen Blick ihres Schwagers sah, erklärte sie: »Natürlich weiß ich vom Verlangen meines Sohnes, in deine Fußstapfen zu treten. Ich bin ja nicht blind! Jeder kann sehen, wie viel Zeit Urs mit dir verbringt und wie er dein Wissen regelrecht in sich aufsaugt. Aber du kennst die Ansichten deines Bruders, und Jaggi möchte, dass sein Sohn ihm nacheifert!«
Nun seufzte Bendicht. »Ja, ich kenne seine Ansichten. Jaggi ist wie ein sturer Esel. Er weicht nicht eine Handbreit von seiner Meinung ab.«
»Es ist eure Familientradition, dass die Söhne Soldaten werden«, versuchte Barbli den Wunsch ihres Mannes zu verteidigen.
»Unfug«, ereiferte sich Bendicht. »Ich bin kein Soldat geworden.«
»Was dein Bruder dir nach so vielen Jahren noch immer verübelt.«
»Nicht jeder taugt fürs Soldatenleben. So wie Jaggi mit Leib und Seele seine Uniform trägt und in Kriege zieht, so bin ich Arzt und versuche, Leben zu retten. Und mit ebensolcher Inbrunst ist euer Sohn der Medizin zugetan. Urs ist wissbegierig, kann Zusammenhänge schnell erfassen und folgerichtig denken. Es wäre eine Schande, wenn er diese Talente auf dem Schlachtfeld vergeuden würde.«
»Bendicht! Zügle deine Worte! Schließlich geben Soldaten auf dem Schlachtfeld ihr Leben, damit Bürger wie wir überleben können.«
»Zum Glück sind nach diesem unsäglich langen Krieg friedliche Zeiten angebrochen. Ich hoffe, dass sie ewig dauern und wir niemals mehr Soldaten in den Kampf schicken müssen«, brummte Bendicht.
»Du weißt, mein lieber Schwager, dass man Soldaten auch benötigt, um den Frieden zu sichern«, wies ihn Barbli lächelnd zurecht.
»Natürlich weiß ich das!« Bendichts Stimme klang verärgert. »Aber Urs ist nun mal für das Soldatenleben ungeeignet – ebenso wie ich es bin. Mein Vater hat dies erkannt und mich ziehen lassen. Ich wünschte, Jaggi würde das bei seinem Sohn ebenfalls erkennen.«
Barbli blickte nachdenklich auf das Buch. Um Bendicht abzulenken, bat sie: »Erzähl mir mehr von diesem Paracelsus, der dich so sehr beeindruckt, dass du schon vor dem Tageserwachen in seinem Buch liest.«
Bendicht forschte im Gesicht seiner Schwägerin. Als er ehrliche Neugier darin erkannte, erklärte er: »Paracelsus war seiner Zeit weit voraus. Seiner Meinung nach ist ein Arzt erst dann ein vollendeter Arzt, wenn er verstanden hat, dass die Übereinstimmung von Natur- und Gotteserkenntnis der Schlüssel der Medizin ist. Die Betrachtung des Großen und Ganzen ist notwendig, ebenso der ganzheitliche Blick. Paracelsus war davon überzeugt, dass die wechselseitige Übereinstimmung zwischen der Welt als Makrokosmos und dem Menschen als Mikrokosmos …« Bendicht musste über Barblis verwirrten Gesichtsausdruck schmunzeln und erklärte ihr: »Er greift bei dieser Aussage zum Beispiel auf äußere Eigenschaften wie Form und Farbe von Pflanzen zurück. So führt er auf, dass stachlige Disteln gegen Stechen in der Brust, herzförmige Blüten gegen Herzkrankheiten und höckrige Wurzeln gegen Geschwülste des Aussatzes helfen. Darüber hinaus befürwortete er die medizinische Lehre der Benediktinerin Hildegard von Bingen, die sich schon im elften Jahrhundert mit Pflanzen- und Heilkunde und vielem mehr beschäftigt hat. Ihre Lehre zu erklären würde jedoch zu weit führen. Paracelsus’ Erläuterungen sind nicht einfach zu verstehen. Seit Jahren lese und erforsche ich seine Schriften.«
»Bist du auch seiner Meinung?«
Bendicht überlegte und wackelte zaghaft mit dem Kopf.
»Manchem vertraue ich, manchem nicht. Aber vor allem hoffe ich, einen Hinweis zu erkennen, wie man die Pest heilen kann.«
»Die Pest?«, fragte Barbli erschrocken. Ihr Schwager konnte sehen, wie ein Schauer durch ihren Körper lief.
Bendicht nickte. »Vor vielen Jahren – ich war noch ein Jüngling – half ich meinem damaligen Lehrmeister Sebastian Feldmann und dem Jesuiten Friedrich Spee, Soldaten, die von der Pest befallen waren, zu versorgen. Mein Meister und der Jesuitenpater starben damals am schwarzen Tod. Seitdem will ich wissen, warum ich nicht von der Pestilenz befallen wurde, obwohl ich die Kranken gepflegt und versorgt hatte.«
»Vielleicht hat Gott noch etwas mit dir vor und hat dich deshalb nicht zu sich gerufen«, meinte Barbli mit ernster Miene.
»Von der Seite habe ich es nicht betrachtet. Mag sein, dass du recht hast, liebe Schwägerin. Vielleicht ist meine Zeit auf Erden noch nicht abgelaufen, damit ich ein Heilmittel gegen die Pestilenz finde«, überlegte Bendicht. Bei diesem ungewohnten Gedanken spürte er ein Kribbeln durch seinen Körper strömen und seinen müden Geist beleben.
Barbli erkannte das Leuchten in seinem Blick. »Wenn dir das tatsächlich gelingt, würdest du der Menschheit einen großen Dienst erweisen«, erklärte sie.
»Seit Jahren versuche ich, eine Lösung zu finden, doch mein Vorgehen war erfolglos, weshalb ich neue Wege beschreiten muss.« Bendicht schielte unsicher zu seiner Schwägerin und ärgerte sich über sich selbst, da er sich zu dieser Äußerung hatte hinreißen lassen. Er hoffte, dass Barbli nicht weiter darauf eingehen würde.
Doch seine Schwägerin war nicht dumm. Sie betrachtete ihn nachdenklich. Er konnte ihrem forschenden Blick nicht standhalten und wandte sich räuspernd ab.
»Sag, dass der Teufel meine Gedanken fehlgeleitet hat«, flüsterte sie mit bleichem Gesicht.
»Wie meinst du das?«, fragte Bendicht und erhob sich.
»Hast du vor, Pestkranke zu untersuchen?«
»Nein«, kam seine Antwort so schnell wie der Schuss aus einer Flinte.
»Schwöre es beim Leben meiner Kinder!«, forderte sie.
Bendicht blickte seine Schwägerin bestürzt an. »Das kannst du nicht von mir verlangen!«
»Doch, das kann ich! Ich traue dir zu, dass du dein Schicksal erneut herausfordern würdest. Aber wer sagt dir, dass du dich dieses Mal nicht anstecken wirst? Deshalb will ich jeden Gedanken von dir daran im Keim ersticken. Schwöre!«
Bendicht verzog das Gesicht, aber er fügte sich. »Ich schwöre, dass ich keine pestkranken Menschen untersuchen werde.«
Barbli schien zufrieden zu sein, denn sie nickte. »Ich vertraue dir, Bendicht!«, erklärte sie mit einem zaghaften Lächeln. »So habe ich heute doppelten Grund zur Freude. Jaggi ist auf dem Heimweg«, verriet sie ihm.
»Das ist wundervoll«, erwiderte Bendicht.
»Weiß dein Mann von unserem Familienzuwachs?«, lenkte er rasch die Schwägerin ab.
Sie schüttelte den Kopf. »Wenn er kommt, erfährt er es früh genug!«
»Er wird es hinnehmen«, meinte Bendicht zuversichtlich.
»Dein Wort in Gottes Ohr«, sagte sie und blickte ihn fröhlich an.
Bendicht war das Lachen vergangen. Auch wenn er Barbli nicht angelogen hatte, so hatte er ihr doch nicht ganz die Wahrheit gesagt.
Kapitel 4
Der Krieg hatte dreißig Jahre lang im Reich deutscher Nation gewütet. Erst der Westfälische Friede beendete 1648 die Kämpfe, die unzählige Menschenleben gefordert hatten. Zerstörung, Elend, Hunger und Leid waren die Hinterlassenschaften. Aber auch nach Kriegsende litten, hungerten und starben die Menschen. Die Pest und andere Seuchen forderten zahlreiche Opfer, sodass Felder nicht bestellt werden konnten, Ernten mager ausfielen, Männer, Frauen und Kinder verhungerten. Viele Gebiete des Reichs waren menschenleer, Dörfer und Gehöfte verwaist.
Um das Land neu zu besiedeln, lockten die Landesherren Menschen aus umliegenden Ländern ins Reich. Sie versprachen den Fremden, dass sie sich in den leerstehenden Häusern und Höfen niederlassen und das Land bewirtschaften durften.
Die Familie Blatter aus der Schweiz war diesem Aufruf gefolgt, denn ihr Leben in Uri war karg und an Entbehrungen reich. Da sich der Soldat Jaggi Blatter für seine Frau Barbli und seine Kinder Urs, Leonhard und Vreni ein besseres Leben im deutschen Reich erhoffte, hatte er sich vom Kurfürsten und Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen anwerben lassen und war mit seiner Familie in die Kurpfalz gereist.
Kurz nachdem Jaggi Blatter mit dem Heer des Kurfürsten nach Coblenz gezogen war, wurde seiner Familie ein eigenes Haus zugewiesen. Die Unterkunft wäre für die beiden Erwachsenen und ihre drei Kinder groß genug gewesen. Aber seit Blatters Bruder Bendicht, die Vollwaise Susanna und ihr Vetter Arthur bei ihnen lebten, musste die Familie enger zusammenrücken. Urs, der älteste Sohn der Blatters, teilte sich deshalb die Schlafstatt mit seinem achtjährigen Bruder Leonhard sowie dem zwölfjährigen Arthur. Seine kleine Schwester Vreni schlief mit der achtzehnjährigen Susanna in einer Kammer.
Urs ging vor Susannas Kammer ungeduldig auf und ab. Er lehnte sich gegen die Wand und dachte an den Schrei, der ihn in aller Frühe geweckt hatte. Da seine Kammer und die Kammer der Mädchen Wand an Wand lagen, wusste er, dass Susanna geschrien hatte. Als sie sich nicht beruhigte, hatte Urs sich leise, um Leonhard und Arthur nicht zu wecken, aus dem Bett und aus dem Raum geschlichen und ebenso geräuschlos die Türklinke zu Susannas Kammer heruntergedrückt. Zum Glück schlief seine kleine Schwester so tief, dass sie weder den Schrei gehört hatte noch seinen nächtlichen Besuch bemerkte.
Er hatte sich vor ihrer Schlafstatt niedergekniet und voller Zuneigung ihr Antlitz betrachtet, das im Schlaf traurig und kummervoll wirkte. Ihr gequälter Gesichtsausdruck schmerzte ihn, denn er ahnte, dass Susanna erneut einen Alptraum hatte. Der Traum, der sie das Schreckliche immer wieder durchleben ließ. Der Traum, der bittere Realität gewesen war.
Monate zuvor hatten Söldner Susannas elterlichen Hof überfallen und dort alles Leben ausgelöscht. Das Mädchen war zu dieser Zeit nicht zuhause gewesen, da sie ihrer Muhme im Haushalt geholfen hatte. Als sie nach einer Woche ins heimatliche Köllertal zurückkehrte, war der elterliche Hof niedergebrannt. Ihre Mutter, die Geschwister, Magd und Knecht und das Vieh waren getötet worden. Ihren Vater fand Susanna gefoltert und schwer verletzt in der Scheune. Mit letzter Kraft hatte der Sterbende seiner Tochter das Versteck der magischen Schriften verraten, die den Weg zu einem vergrabenen Schatz wiesen.
Susanna war mit den Papieren geflohen. Doch die Söldner nahmen die Verfolgung auf und schossen auf sie. Schwer verletzt hatte sich Susanna in den Saarbrücker Wald retten können, wo der junge Schweizer Urs sie fand, als er mit seiner Familie auf dem Weg nach Trier war.
Anfangs misstraute sie ihrem Retter. Doch als auch Urs beinahe Opfer der Meuchelmörder geworden wäre, rettete sie ihn. So kamen sich die beiden jungen Menschen näher. Urs nahm Susanna mit zu seiner Familie nach Trier. Auch Susannas Vetter Arthur, den die Tante in Susannas Obhut gegeben hatte, wurde von der Schweizer Familie aufgenommen.
Urs seufzte lautlos. Er konnte sich ein Leben ohne Susanna nicht mehr vorstellen. Doch er zögerte, ihr seine Zuneigung zu gestehen. Urs fürchtete, Susanna mit seiner Liebe zu verschrecken. Es war ihm zudem bewusst, dass er erst mit seinem Vater sprechen musste.
Die Tür der Kammer öffnete sich, und Susanna erschien mit Urs’ dreijähriger Schwester an der Hand im Türrahmen. Ihre Augen waren vom Weinen gerötet und verquollen. Traurig blickte sie ihn an.
»Lauf zu Mutter, Vreni. Sie hat warme Milch mit Honig für dich«, sagte Urs zu seiner Schwester, die freudig zur Treppe hüpfte. Nun war er mit Susanna allein.
»Wie geht es dir?«, fragte er und betrachtete forschend ihr bleiches Gesicht.
Stumm blickte sie ihn an. Ihre Augen glänzten von den Tränen, die sie mühsam zurückhielt.
Urs machte einen Schritt auf sie zu und zog sie an sich. Liebevoll strich er ihr über den Scheitel.
»Wann werden diese Träume aufhören? Wann werde ich Frieden finden?«, weinte sie und lehnte sich an seine Brust.
»Du musst dir Zeit geben, Susanna. Das Schreckliche ist erst vor Kurzem geschehen«, erklärte Urs und küsste sie auf das kastanienbraune Haar.
»Es tut so gut, dass ich nicht allein bin«, wisperte sie und streckte ihm ihr Gesicht entgegen.
Sein Blick versank in ihren rehbraunen Augen, als seine Lippen sich den ihren näherten. »Ich werde mit meinem Oheim sprechen. Vielleicht kennt er eine Pflanze, die dich von den Alpträumen befreit«, flüsterte er und küsste Susanna.
Der Morgen graute, als Bendicht über den Hinterhof des kleinen Anwesens zum Viehverschlag ging. Susannas Pferd Dickerchen, fünf Hühner, eine Kuh und ein Schwein mussten versorgt werden, was ebenso zu seinen Pflichten gehörte wie das Einsammeln der Eier, das Melken der Kühe, das Füttern der Tiere und das Misten der Ställe. Es waren keine Aufgaben, die Bendichts Leben erfüllten. Vielmehr war die Heilkunde seine Berufung und Leidenschaft, und dem wollte er in Trier nachgehen.
Als Bendicht seinen Verwandten aus der Schweiz gefolgt war, war es seine Absicht, nur für kurze Zeit bei ihnen zu wohnen. Er wollte nur so lange bei ihnen bleiben, bis er ein eigenes Heim gefunden hätte: eine kleine Wohnung mit einem separaten Raum, in dem er Kranke behandeln konnte. Da aber sein Bruder Jaggi sofort nach seiner Ankunft in Trier vom Erzbischof und Kurfürsten Karl Kaspar von der Leyen nach Coblenz beordert worden war, wagte Bendicht nicht, seine Schwägerin und die Kinder allein zu lassen. Nun wartete er ungeduldig auf Jaggis Rückkehr, um sich endlich eine eigene Wohnstatt zu suchen.
Natürlich liebte Bendicht die Familie seines Bruders. Sie war der Grund, warum auch er die Heimat verlassen hatte. Doch wie wollte er seinen Plan umsetzen und ein Mittel gegen die Pest finden, wenn er mit so vielen Menschen eng unter einem Dach lebte? Bendicht hatte sich diese Lebensaufgabe gestellt, und um seinen Plan umzusetzen, musste er allein sein. Er hatte sich bereits heimlich nach einer Wohnung umgesehen.
Wieder spürte er das Kribbeln in der Magengegend, als es an der Haustür schellte. »So früh am Morgen schon Besuch?«, murmelte er erstaunt, doch dann erhellte ein Lächeln sein Gesicht. »Das wird Jaggi sein«, frohlockte er und leerte rasch den Eimer mit den Essensresten in den Schweinetrog. Während er zur Tür eilte, wischte er sich die feuchten Händen an den Hosenbeinen ab.
Bendicht öffnete lächelnd die Haustür. Aber nicht sein Bruder stand vor ihm, sondern ein Knabe, der nicht älter als zwölf Jahre zu sein schien.
»Bist du der Heiler?«, raunte der Junge ihm zu und blickte sich dabei nach allen Seiten um.
Bendicht sah den Knaben ungläubig an.
»Wer hat gesagt, dass hier ein Heiler wohnt?«, fragte er leise.
Als der Junge nicht antwortete, nickte er zögerlich. Der Knabe zog daraufhin einen Brief aus seinem Hosenbund und streckte ihn Bendicht entgegen. »Ihr sollt ihn sofort vernichten, wenn Ihr ihn gelesen habt«, flüsterte er.
Bevor Bendicht den Burschen fragen konnte, von wem die Nachricht kam, rannte er davon.
Bendicht blickte verwirrt zu der Stelle zwischen den Häuserzeilen, wo der Junge verschwunden war. Kopfschüttelnd schloss er die Tür und betrachtete den Umschlag. Das rote Wachssiegel war glatt und zeigte weder das Zeichen eines Ring- noch eines anderen Abdrucks, der auf den Absender schließen ließ. »Sehr merkwürdig! Was kann da wohl geschrieben stehen? Und von wem?«, murmelte Bendicht und überlegte, ob er die Nachricht lesen oder gleich vernichten sollte. Doch seine Neugierde war stärker als sein Misstrauen.
Er wollte gerade das Siegel aufbrechen, als Urs vor ihn trat. Hastig versteckte Bendicht den Umschlag hinter seinem Rücken, wo er ihn unter das Hemd schob.
»Habe ich dich gestört?«, fragte Urs und blickte seinen Oheim fragend an.
»Red keinen Unsinn!«, entgegnete Bendicht.
Im selben Augenblick ärgerte er sich über sein unbedachtes Verhalten. Dem Neffen aber schien die Unruhe seinen Oheims aufzufallen.
»Wie kann ich dir helfen?«, fragte Bendicht etwas freundlicher und hoffte, dass Urs ihn bald wieder allein lassen würde.
»Susanna plagen seit Tagen dieselben Alpträume, Onkel. Fast jede Nacht träumt sie von der Ermordung ihrer Familie. Kennst du ein Kraut, das sie von diesen Alpträumen befreit?«, fragte sein Neffe.
Bendicht atmete tief ein und aus, um ruhiger zu werden und seine Gedanken zu sammeln. Er dachte nach und riet dann: »Sie soll sich ein Kräuterkissen mit Baldrian, Hopfen, Kamille, Pfefferminze und Rosmarin füllen und ihren Kopf darauf betten.«
Kaum hatte er das letzte Wort gesprochen, wandte er sich zum Gehen, doch Urs hielt ihn am Arm fest. »Ist das alles?«, fragte der Junge zweifelnd.
Bendicht schüttelte die Hand ab, als ob sie eine lästige Fliege wäre. »Was willst du mehr?«
Urs zuckte mit den Schultern.
»Du liebst das Mädchen?«, forschte Bendicht mit mürrischem Gesichtsausdruck.
Erschrocken über diese Frage, nickte Urs und senkte den Blick.
»Dann heirate sie und mach ihr ein Kind. Dann ist sie abgelenkt und vergisst ihre Trauer.«
Nun riss Urs ungläubig die Augen auf, und er rief peinlich berührt: »Oheim!«
»Schau nicht so entgeistert!«, erwiderte Bendicht ungerührt. Der Brief unter seinem Hemd scheuerte auf der Haut und machte ihn nervös. Er konnte sich jedoch nicht kratzen, da dann das Papier knistern und ihn verraten würde.
»Das kann nicht dein Ernst sein, Onkel«, murmelte Urs mit feuerroten Wangen und wagte nicht, ihm in die Augen zu sehen.
Bendicht erkannte die Scham seines Neffen und bedauerte sein unwirsches Verhalten. Betroffen entschuldigte er sich. »Es tut mir leid, Urs. Ich hätte nicht so plump auf dein Problem antworten dürfen. Ich werde heute noch auf den Markt gehen und einen Amethyst suchen, den Susanna als Schmuckstein an einer Kette tragen kann. Dieser Mineralstein soll Alpträume vom Träger fernhalten. Ich bin sicher, dass ihr das helfen wird.«
Nun blickte Urs auf, und er strahlte Bendicht an. »Ich danke dir, Oheim! Susanna und ich könnten dich zum Markt begleiten«, sagte er.
Bendicht nickte lächelnd.
Urs ging eilends den Gang entlang und rief nach Susanna.
Bendicht atmete laut aus und lehnte sich gegen die Wand. Der Brief raschelte, und er zog ihn unter dem Hemd hervor. »Ich bin gespannt, was darin steht«, flüsterte er und verschwand in seiner Kammer.
Kapitel 5
Am selben Tag
Der Erzbischof und Kurfürst Karl Kaspar von der Leyen stand vor dem Fenster seines Regierungszimmers im Kurfürstlichen Palais in Trier und blickte hinaus. Am Tag zuvor war er aus Coblenz angereist, wo er auf Schloss Philippsburg lebte – so wie sein Vorgänger Philipp Christoph von Sötern. Der frühere Regent hatte das bastionierte Residenzschloss am Rhein während des Dreißigjährigen Krieges unterhalb der Festung Ehrenbreitstein als Regierungssitz erbauen lassen, da ihm Trier nicht sicher genug erschien. Es stellte sich als weise Entscheidung heraus, denn die Stadt wurde mehrmals angegriffen und schwer beschädigt. Weil Schloss Philippsburg als Amtssitz beibehalten werden sollte, musste Nachfolger Karl Kaspar von der Leyen nach seiner Amtswahl nach Coblenz umziehen.
Allerdings behagte ihm das riesige Schloss nicht. Zwar genoss er seine Stellung als Kurfürst und Erzbischof, aber nicht den Prunk, den diese Positionen mit sich brachten. Jedes Mal, wenn er von den Privatgemächern in die Amtsräume ging, fürchtete er, sich zu verlaufen. Auch mochte er es nicht, ständig von Bediensteten umgeben zu sein, die ihn auf Schritt und Tritt beobachteten. Obwohl er nun der mächtigste Mann im Erzstift und Kurfürstentum Trier war – sein Privatleben war ihm heilig. Aus diesem Grund plante von der Leyen, nur so lange auf Schloss Philippsburg zu wohnen, bis sein mehrstöckiges Haus am Fuße der Festung gebaut sein würde. Bereits in den nächsten Wochen sollte der erste Stein gelegt werden.
Auch das kurfürstliche Palais in Trier war ihm zu groß und zu unpersönlich. Allerdings musste er seinen Vorgängern ein Kompliment aussprechen, denn sie hatten mit diesem Gebäude ein Werk für die Ewigkeit erbaut.
Kurfürst Lothar von Metternich hatte 1615 den Grundstein für das Palais gelegt. Bis zu seinem Tod 1623 war der Nordflügel vollendet und der Ostflügel begonnen worden. Metternichs Nachfolger Philipp Christoph von Sötern stellte das Schloss fertig und begann den Bau des Niederschlosses. Da von Sötern während des Kriegs von den Habsburgern zehn Jahre lang gefangen gehalten worden war, stockten damals die Arbeiten. Doch kaum war der damalige Kurfürst wieder auf freiem Fuß, ließ er das Niederschloss vollenden. 1647 wurde der Rote Turm fertiggestellt, ein mächtiger Kanzlei- und Archivbau im Nordwesten des Schlosses.
Auch Karl Kaspar von der Leyen hatte sich vorgenommen, das Palais weiter auszubauen. Schließlich sollte jeder Regent einen sichtbaren Stempel hinterlassen, dachte er und verschränkte die Hände auf dem Rücken.
Er ließ seinen Blick über die grüne Fläche des Parks wandern. Auch wenn die Anlage von zahlreichen Gärtnern gepflegt wurde, sah sie um diese Jahreszeit trostlos aus. Der Springbrunnen versprühte kein Wasser mehr, und die schnatternden Enten schwiegen. Die Bäume hatten das Laub abgeworfen und erinnerten an Skelette. Nirgends blühte eine Blume und brachte Farbe ins Bild. Alles wirkte grau. Aber von der Leyen genoss den Anblick. Jahrelang hatte er davon geträumt, hier zu stehen – als Erzbischof und Kurfürst von Trier. Es war ein schwieriger Weg gewesen, denn sein Vorgänger von Sötern hatte ihn als Nachfolger abgelehnt. Doch nicht nur Kaiser Ferdinand III. unterstützte ihn. Sogar Papst Innozenz X. hatte seine Wahl bestätigt. Am 12. März dieses Jahres hatte er die Nachfolge von Söterns angetreten, und am 15. September war er zum Erzbischof geweiht worden.
Von der Leyen war dort angekommen, wo er sein wollte, und hatte sich für seine Amtszeit viel vorgenommen.
Bedauerlich, dass mein Vater das nicht erlebt, dachte er wehmütig. Bereits 1639 war der kurtrierische Amtmann Damian von der Leyen im Alter von 56 Jahren verstorben. Es hätte ihm gefallen, dass ich beabsichtige, Trier wieder aufzubauen, war sich der Sohn sicher. Auch, dass ich die Landwirtschaft ebenso fördern will wie die Rechtspflege, wäre in Vaters Sinne gewesen, tagträumte er.
Der Erzbischof hielt in seinen Gedanken inne und rieb sich nachdenklich mit der Hand über den Oberlippenbart. Sein Blick wanderte zum Himmel, der mit grauen Wolken verhangen war. »Vater, bitte verzeih mir dieses eine Vorhaben, von dem ich weiß, dass du es nicht billigen würdest. Aber ich habe keine andere Wahl. Unser Land versinkt im Chaos, wenn ich nicht dagegen angehe«, flüsterte der Regent. Den Blick starr zum Himmel gerichtet, versprach er leise: »Wenn du mir ein Zeichen sendest, dass du mich deshalb nicht verdammst, verspreche ich, dass ich die Mitglieder unserer Familie fördern werde. Als Erstes werde ich meinen Bruder Damian Hartard zum Propst und sogar zum Archidiakon von Karden ernennen.«
Karl Kaspar von der Leyen schaute erwartungsvoll zur grauen Wolkendecke hoch. Kein Zeichen war zu sehen. Er seufzte, und sein Blick glitt enttäuscht zu Boden. Doch dann hatte er eine Eingebung, und seine Augen bekamen einen besonderen Glanz. Wieder schaute er zum Himmel und murmelte: »Vater, wenn du mir deinen Segen für das eine Unterfangen gibst, werde ich deinen Herzenswunsch erfüllen, den ich dank meiner Stellung jetzt durchsetzen kann.« Er lächelte in sich hinein.
Kaum hatte er das Versprechen gegeben, sah er aus den Augenwinkeln, wie aufkommender Wind Laub vor sich hertrieb. Er schloss erleichtert die Augen.
»Danke für deine Zustimmung, Vater. Nun werde ich dir deinen Wunsch erfüllen und meinen Plan mit leichtem Herzen umsetzen.«
»Oheim«, rief Urs ungehalten. »Warte auf uns!«
Bendicht war so sehr in seine Gedanken vertieft, dass er nicht bemerkt hatte, wie sein Gang stetig schneller wurde. Erst als sein Neffe ihn am Kittel zog, hielt er inne.
»Susanna ist vollkommen außer Atem!«, schimpfte Urs verhalten.
Bendicht blickte erschrocken das Mädchen an, das japsend neben ihm stand. »Entschuldigt«, murmelte er. »Ich werde meinen Gang zügeln«, versprach er.
Urs sah den Oheim forschend an. »Geht es dir nicht gut?«, fragte der Junge besorgt.
»Mir geht es prächtig! Mach dir keine Sorgen«, erklärte Bendicht nuschelnd und ging weiter.
In gemäßigtem Tempo besah er sich die Marktstände und ihre Auslagen. Als er an einem Stand mit Kräutern vorbeikam, blieb er stehen und prüfte die Ware.
»Was darf es sein?«, fragte ein zahnloses Mütterlein.
Bendicht nickte ihr grüßend zu und roch an den Pflanzen. »Deine Ware scheint frisch und keine verstaubte vom letzten Jahr zu sein«, stellte er anerkennend fest.
»Den Lavendel hat mein Sohn von einem Kaufmann aus Frankreich erst letzte Woche erworben«, erklärte sie und lachte mit breitem, zahnlosem Mund.
»Ich nehme zwei Büschel, außerdem je eine Handvoll Hopfen, Kamille, Baldrian und Pfefferminze. Hast du auch Rosmarin?«
Das Mütterlein durchsuchte ihre Ware und schüttelte den Kopf. »Nein, Rosmarin ist keiner da.«
»Das macht nichts. Der Lavendel gleicht das aus.«
Bendicht griff in seine Geldkatze und entnahm ihr einige Münzen.
Die Alte bedankte sich überschwänglich. »Wenn Ihr in zwei Tagen wiederkommt, werde ich Rosmarin dahaben«, versprach sie.
ENDE DER LESEPROBE