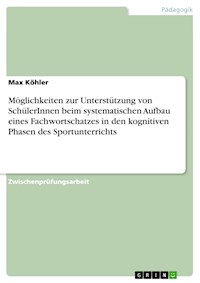Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Fotograf, Journalist, Maler und Autor Max Köhler nimmt uns mit in eine Welt, die er sehr gut kennt. Am Beispiel seines Protagonisten Peter Sohla beschreibt er das Leben eines Kunstschaffenden in einem badischen Provinzstädtchen und lässt an seinen Gedanken teilhaben. Ihm ist damit ein ironisch-amüsantes, aber auch nachdenklich stimmendes Buch gelungen, das viel Insiderwissen über die Geschichte sowie Land und Leute zwischen Schwarzwald und Vogesen vermittelt. Außerdem taugt das Buch auch gut als Reiseführer für kulturelle Ausflüge. Es ist aber wirklich keine Auto-Biografie, ehrlich!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Diese Novelle ist meiner Frau gewidmet. Ich bin meiner Lektorin, klugen Antreiberin und Kritikerin zu großem Dank verpflichtet. Ohne sie wäre dieses Werk nicht entstanden.
Wobei wir die Möglichkeit nicht außer Acht lassen wollen, dass sie das alles nur getan hat, um mich aus der Küche herauszuhalten, denn ich bin ein ebenso leidenschaftlicher wie erfolgloser Hobbykoch. Außerdem halte ich meine Frau fürs Aufräumen zuständig, was sie jedes Mal, wenn dieser Fall in der Küche eingetreten ist, ziemlich wortreich von sich wies.
Um Gerüchten vorzubeugen: Zur Scheidung hätte das aber in keinem Fall auch nur ansatzweise gereicht.
Max Köhler
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort des Autors Max Köhler
Kapitel 1 – Peters Heimat
- Baden und Elsass
- Kaiser, Könige, Heilige und die Religion
Kapitel 2 – Peter
- und die Familie
- der Heimatmaler und Heimatschriftsteller und seine Erfahrungen mit dem Kunstmarkt, den Medien, dem Buchhandel, der Gesellschaft und ihrer Moral
- die Frauen und sein Leben in der badischen Provinz
- Opa Peter
Kapitel 3 - Dichter und Denker
- Moscherosch und Grimmelshausen und der Versuch, den
„Simplizissimus“
verständlicher zu machen
Kapitel 4 - meine Sicht
- meine Gedanken
Roman - Der Sumpf
von Peter Sohla
Über den Autor Max Köhler
- Biografie
- Erinnerungen der Weggefährten
Danksagung
Verzeichnis der Abbildungen
Vorwort
Ich, der Autor dieses Buches und Autodidakt, also von keinerlei Schule gebrochen oder voreingenommen, habe viele Artikel von Wikipedia bzw. im Internet gelesen, aber nicht alle halfen mir weiter. Ich musste noch andere Quellen aufarbeiten, unter anderem mein ungeheures Wissen abrufen, das ich mir aus tausenden Büchern im Laufe meines Lebens angeeignet habe.
Da ich Zeitungs-Redakteur war wie Peter Sohla, habe ich mir das Lügen abgewöhnt. Und ich bin Künstler wie er. Vielleicht konnte ich ihm auch deshalb in seine psychologischen Abgründe folgen.
Ich saß ihm 12 Jahre lang gegenüber und habe ihn deshalb ganz gut kennengelernt. Die Arbeitsbedingungen waren nicht besonders günstig. Zwei Redakteure mussten täglich sieben Zeitungsseiten im Großformat herstellen, das heißt redigieren, also druckfertig machen, was bedeutet, dass sie Dutzende Artikel zumindest lesen mussten. Allein schon das Lesen von drei kompletten Zeitungsseiten, um Fehler und stilistische Schwächen zu beseitigen, ist ein unglaubliches Pensum. Dazu sollten die Redakteure noch Eigenberichte verfassen, also selbst recherchieren und schreiben.
Ich glaube dem Verleger gerne, dass er nicht anders handeln konnte, als diese Sklavenarbeit zu verlangen, sonst hätte sich der „Kirchbacher Bote“ finanziell nicht getragen. Aber eben wegen dieser Arbeitsbedingungen bekam der „Kirchbacher Bote“ in Kirchbach auch keine richtigen Redakteure, sondern nur Anzeigenvertreter, die einmal ein Narrenblatt geschrieben und redigiert hatten. Oder abgebrochene Germanistikstudenten. Oder ältere Damen, die sich zu früh nach Südfrankreich abgesetzt hatten und langsam bemerkten, dass sie zu wenig Geld hatten, um dort leben zu können. Auf jeden Fall waren die Qualität der Redakteure in Kirchbach und die Flucht dieser Leute aus dem Ort die Antwort der Branche auf die dort vorherrschenden Arbeitsbedingungen. Es war deshalb kein Wunder, dass der „Kirchbacher Bote“ nicht auf die Beine kam: Schlechte Arbeitsbedingungen ziehen nur schlechte Redakteure an, die woanders keine Stelle bekommen und schlechte Redakteure machen eine schlechte Zeitung, die keiner lesen will. Es ist kein Teufelskreis, aber ein mauseschlechter Kreis.
Im Herbst meines Lebens und schon lange pensioniert, wunderte ich mich immer mehr über Peter Sohla, sein Leben und seinen Instinkt, dieses Leben zu „begleiten“, zu seinem Kompagnon zu machen. Denn von Leben „führen“ kann bei ihm kaum die Rede sein. Er ließ sich treiben. Genau das scheint mir aber nicht die schlechteste Art zu sein, das Leben hinter sich zu bringen. Gegen das Leben anzukämpfen, dem Schicksal die Zähne zu zeigen - das war Peters Sache nicht. Und wenn man es recht bedenkt, nimmt man sich auch zu viel vor, wenn man das Leben beeinflussen will. In ein gewaltiges Geschehen außerhalb unserer Nichtigkeiten verwoben, tun wir gut daran, bescheiden zu bleiben.
Ich weiß, dass es auch eine andere Schule gibt, die behauptet, man müsse sich immer mehr vornehmen, als man erreichen könne, sonst erreiche man nicht einmal das Wenige, das einem möglich sei. Das halte ich für einen schlechten Witz. Es steckt zu viel Ehrgeiz in dem Satz, auch lugt daraus der Gedanke hervor, dass man der Herr seines Geschickes sei.
Ich beschreibe eine Familie um die Jahrtausendwende und gehe zu diesem Zweck erst mal 1200 Jahre zurück? Warum das? Warum nicht, denn im Jahr 800 wurde unser Europa geschaffen. Und die Region Baden/Elsass, in der Peter Sohla sich bewegte, war und ist das Herz Europas.
Viele Dynastien haben sich in den Jahrhunderten hier niedergelassen und die Gegend geprägt. Auch die Sohlas hatten Ahnen, müssen Ahnen gehabt haben, die bis ins Jahr 800 zurückreichen. Was sie wohl damals gemacht haben? Sicher scheint, dass sie keine herausragende Stellung eingenommen haben, sonst wüsste man davon. Erst im 19. Jahrhundert ging der Stern der Sohlas ein wenig auf.
Ich schreibe die Ereignisse auf, wie sie mir einfallen. Das heißt natürlich, dass ich nicht sehr chronologisch berichte, aber vielleicht doch nach innerer Wichtigkeit (chronologisch würde mir ein Maß von Logik abverlangen, dessen ich nicht fähig bin). Ich habe den meisten Teil meines Lebens damit verbracht, Bilder zu machen. Und Bilder haben so ihre eigene Logik. Ich habe den Verdacht, dass ich mit meinen Bildern in der Vergangenheit gründele. Wolkenformationen, die ich als Zehnjähriger auf irgendeiner Reproduktion eines alten Meisters in unserem Wohnzimmer gesehen habe, tauchen 50 Jahre später in meinen Bildern wieder auf. Fotos einer bestimmten Kopfhaltung meiner Brüder, die ich als 15jähriger gemacht habe, erleben ihre Wiedergeburt als Bollenhut- oder Trachtenbilder mit genau derselben Kopfhaltung und dem gleichen Augenaufschlag. Oder ist es ein Bild aus einem 60 Jahre alten, längst vergessenen Kunstband, das mich zur Nachahmung zwingt? Die Ähnlichkeit ist jedenfalls verblüffend. Ich bin unsicher. Es scheint, dass ich so lange an einem Gemälde herumbossele, bis es irgendetwas aus meiner Vergangenheit gleicht. Fluch oder Segen eines bildhaften Gedächtnisses, das ich vermutlich von meinem Vater geerbt habe?
Wie auch immer, das hier ist keine Autobiografie sondern eine Novelle. Nicht jeder Person, die Sie zu erkennen glauben, steht eine im realen Leben gegenüber und nicht jede Handlung ist so geschehen. Kunst, Literatur? Oder nur erfunden und ironisch übersteigert?
Abb. 1
Kapitel 1
Baden und Elsass, Peters Heimat
Seit Menschengedenken haben sich die verschiedensten Völker um dieses Land gestritten, mal die Kelten mit den Germanen, dann die Römer mit den Kelten oder Galliern, Germanen, Ostfranken, Westfranken, Alemannen, Deutsche, Franzosen. Warum nur? Was hatte das Elsass, dass darüber ständig Streit entstand? War es die Lage zwischen zwei Völkern? Oder war es, weil das Elsass so reich und noch dazu schön war, sodass jeder es haben wollte? Guter Wein, guter landwirtschaftlicher Boden, viel Wald, viel Holz, viele Bodenschätze: Eisen, Silber, Kupfer, dazu eine Autobahn der Frühzeit, der Rhein. Es war alles da, was Einnahmen versprach und was ein begabter junger Elsässer wie Barbarossa brauchte, um tüchtig Kriege führen oder die Kriegsparteien bestechen zu können.
Barbarossa war im Elsass zu Hause. Aus der Familie der Etichonen, der Herzöge des Elsass (Hugo von Tours), stammte seine Urgroßmutter, Hildegard von Egisheim. In Hagenau wuchs er auf. Nicht weit von Hagenau, in Walburg, gibt es eine Benediktiner-Abtei aus dem 11. Jahrhundert, in der der Vater Barbarossas begraben liegen soll, jedenfalls trägt dieses Kloster sein Wappen, das Wappen Friedrich des Einäugigen, der mit Judith Welf verheiratet war. Barbarossa war also ebenso Welfe (süddeutsches Adelsgeschlecht) und Salier, das erleichterte ihm gewiss das Regieren in dem heillos zerstrittenen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Was für ein bombastischer Name! Und er vereint Unvereinbares, als ob man sagen würde: der festgemauerte Wackelpudding in einer Schüssel aus Papier.
Karl der Große baute seine Herrschaft auch auf Strukturen auf, die die Merowinger geschaffen hatten, er bediente sich des merowingischen Hochadels für Spitzenstellungen im Reich. Nachkommen der Merowinger-Herzöge im Elsass wurden Grafen des Nord- und Südgaus. Karl der Große war mit ihnen auf vielfältige Weise versippt, weil seine Familie ja schon unter den Merowingern eine große Rolle gespielt hatte. Karls Sohn Ludwig der Fromme agierte nicht ganz so glücklich wie der große Karl, vor allem nicht bei der Teilung des Reiches, bei der er seinen Sohn aus zweiter Ehe, Karl den Kahlen, bevorzugen wollte, was zu erbitterten Kämpfen mit seinen älteren Söhnen führte. Lothar I., der älteste Sohn aus erster Ehe, setzte sich mühevoll durch und erhielt neben dem Kaisertitel einen schmalen Streifen zwischen West- und Ostfranken, das „Mittelreich“, zu dem das berühmte und später noch so heiß umkämpfte Lothringen gehörte, eben „Lothars Land“, Lotharingen, Kernland der Merowinger und Karolinger. Beides nicht ganz zufällig, denn hier hatten sie Eigenbesitz, also Privatbesitz, der nicht der Krone gehörte und deshalb relativ unantastbar war.
Mir erschien diese Reichsteilungen stets als ein Symbol für die geistigen Gebiete, die meine Eltern nach ihrem Tod hinterließen und die auf eine weitere Beackerung durch ihre Kinder warteten. Karl, mein älterer Bruder, wurde deshalb Physiker, weil mein Vater zwar sehr gescheit war, im Gegensatz zu meiner Mutter aber nicht kaufmännisch rechnen konnte oder wollte. Ich wurde letztendlich Maler-Fotograf-Journalist, weil meine Mutter zu zeichnen versuchte, und sich kein größerer Gegensatz zwischen dem genial und streng logisch rechnenden Bruder und meinen schludrigen Äußerungen, die man in der Familie großzügig „künstlerische Begabung“ zu nennen pflegte, finden ließ. Der jüngste, Georges, schwankte lange zwischen diesen beiden Extremen und wählte schließlich als bequemen Mittelweg die Biologie, ein weiches Lernfach, in dem man sprunghafte künstlerische Ambitionen ebenso leicht unterbringen kann wie streng Logisches.
Peters Vater war streng gläubiger Europäer. Kunststück, ist man versucht zu sagen: wenn man wie er aus Böhmen kam, dadurch drei oder vier Länder und Nationalitäten gestreift hatte, oder besser, in der Geschichte durch sie hindurchgewirbelt wurde, ferner eine Französin geheiratet hatte, deren Herkunft aus Katalonien auch noch Spanien mit einbezog, blieb einem wohl gar nichts anderes übrig, als europäisch zu denken. Glaubt man seinen Intentionen, hat er seine drei Kinder auch nach europäischen Gesichtspunkten benannt. Man kann ihm glauben oder nicht, Tatsache bleibt, dass seine Söhne Namen trugen, die in allen europäischen Ländern leicht auszusprechen waren und heute noch sind: Emil, Peter und Georg.
Kaiser, Könige und Heilige
Erstein - die Kaiserresidenz. Hier wurde einmal große Politik gemacht. Kaum zu glauben, wenn man heute dieses charmant windschiefe französische Städtchen besucht. Liebenswerte französische Provinz sicherlich. Aber was ist das gegen den Glanz, den Erstein im Mittelalter hatte? Kaiser und Könige gaben sich hier die Klinke in die Hand wie in den Hauptstädten des Karolingerreichs, in Metz, Reims, Paris und Aachen. Der König des Mittelreiches, Lothar der Zweite, war hier zu Hause. Seine Mutter, die Kaiserin Irmgard, hatte das Kloster in Erstein gegründet, seine Schwester war die Äbtissin, hier lebten seine Familie, seine Frau Waldrada und seine Kinder Hugo, Gisela und Berta.
Nach Erstein kam der König von seinen Regierungsreisen zurück, hier sammelte er die Kraft, gegen die Machtintrigen seiner Verwandten anzugehen (ich lebe heute nur zehn Kilometer Luftlinie von Erstein entfernt). Letztlich hat es nichts genutzt. Lothar verlor sein Königreich an Deutschland und Frankreich. Das war das Ende der Vision von einem Bindeglied zwischen den großen Völkern. Vielleicht war es wirklich nur ein Traum, denn, kann man zwischen den Völkern leben, ohne zu einem zu gehören?
Welche Menschen leben da? Sind es Deutsche? Sind es Franzosen? Sind es Kelten oder Germanen? Ja, gewiss, es sind Elsässer. Aber haben sie eine eigene Sprache? Eine eigene Grammatik? Eigene Schulen? Oder sollte es so eine Art Liechtenstein oder Monaco sein?
Abb. 2 Erstein heute
Schröder und Chirac haben den Eurodistrikt Straßburg/Erstein/Lahr/Kehl ins Leben gerufen. Diese Erfindung der Staatsmänner und Referenz an das Elsass tut sich indes schwer, weil sie kein Geld hat, nicht einmal eine solide Rechtsgrundlage, aber der geplante Eurodistrikt könnte vielleicht doch das Mittelreich werden, von dem Hugo einmal geträumt hat. Die Elsässer haben ein starkes Unabhängigkeitsgefühl und die Badener sind es auch leid, nach Stuttgart, Berlin oder Brüssel zu reisen, wenn sie eine Entscheidung in dieser oder jener lokalen Frage haben wollen. Basel und Straßburg sind ihnen näher. Und leben wir nicht alle in Europa, das die großen Fragen entscheidet und den Regionen ihre Eigenständigkeit belassen will? Grenzregionen haben nun mal ihre eigenen Bedürfnisse. Die Polizei will einen flüchtenden Räuber auch ins Nachbarland verfolgen dürfen, der Krankenwagen will sein Martinshorn nicht abschalten müssen, wenn er in das Krankenhaus des Nachbarlandes fährt, weil dieses besser ausgerüstet ist; der Patient will problemlos die Koryphäen der weltberühmten Straßburger medizinischen Fakultät in Anspruch nehmen, für die Straßenbahn soll nicht an der Grenze Endstation sein und so weiter und so fort.
Mit den Schattenseiten einer solchen Politik hatten die Regierenden auch ohne Hugo oft genug zu kämpfen. Verwandten im Heimatland gefiel es natürlich nicht, wenn ihre Tochter in dem fremden Land (wohin sie verheiratet worden war, um dessen Güter zu kassieren), beiseitegeschoben wurde, weil der fremde Fürst eine andere ins Bett holte. Man denke nur an die arme Lieselotte von der Pfalz, die Schwägerin des glorreichen Ludwig des Vierzehnten, die ihre Lage am französischen Königshof nur mit einem gewissen Galgenhumor meistern konnte, während sich ihr herzoglicher Ehemann auf den Schlachtfeldern Europas, womit bei dessen Lebensweise oder Charakter durchaus auch Federbetten gemeint sind, unsterbliche Verdienste erwarb. Die Universitätsstädte Offenburg (tut mir herzlich leid, liebe Freiburger, auch die Hochschule Offenburg ist tatsächlich schon seit einiger Zeit promotionsberechtigt) und Heidelberg trauern noch heute um ihre Altstadt, die im Pfälzischen Erbfolgekrieg eingeäschert wurden. Das hat natürlich auch Vorteile, man denke nur an den Zweiten Weltkrieg, der den Weg freimachte für die autogerechte Stadt und die rechtwinklige Bauweise, für die wir uns heute so anhaltend schämen, ohne dass wir deswegen unsere Architekten wie im Mittelalter in einen Käfig sperren und so lange in verdreckte Flüsse tauchen könnten, bis sie gestehen würden, dass sie einfach keine menschenfreundlichen Sachen zeichnen können.
Man kann wohl annehmen, dass König Lothar II. sehr unglücklich war, fast so unglücklich, wie es sein Sohn Hugo werden sollte. Lothar war noch keine zwanzig Jahre alt, als sein Vater, der Kaiser des Mittelreiches, starb, und er ein Königreich antreten musste, das von Friesland über Holland und Belgien, die Pfalz und Lothringen mit dem Elsass bis nach Burgund reichte. Lothar junior musste regieren, musste Politik im Sinne der Familie, der Karolinger, machen, und das hieß auch und gerade durch eine Heirat den politischen Besitz zu mehren, den Einfluss zu vergrößern, den die Karolinger hatten. Man suchte ihm eine italienische Prinzessin aus, denn die Karolinger versuchten Italien mit Rom fester an sich zu binden; wie wichtig das war, werden wir später noch erklären. Lothars persönliche Verhältnisse interessierten dabei nicht. Seine regierenden Verwandten in West- und Ostfranken kümmerte es nicht, dass Lothar schon mit einer Elsässerin in Erstein zusammenlebte, die er über alles liebte; es interessierte nicht, dass er mit dieser Frau bereits Kinder hatte, darunter unseren Hugo, der so unglücklich enden sollte.
König Lothar liebte also seine Waldrada und nicht die Italienerin. Um seinen Kindern eine standesgemäße Erbschaft zu ermöglichen, suchte er die Ehe mit Tietberga, so hieß unsere Italienerin, ungeschehen zu machen, zu annullieren, und seine Elsässerin zu heiraten. Das war nicht so einfach, wie es sich anhört. Der Papst musste einverstanden sein und er war es keineswegs, wohl beeinflusst von den Verwandten Lothars im Reich, die ihre politischen Felle davonschwimmen sahen. Zwar waren ihm ein paar Bischöfe im Elsass und in Lothringen gewogen, aber das reichte nicht, um seine wilde Ehe mit Waldrada zu legalisieren. Schließlich starb Lothar, erst 34 Jahre alt, ohne in der Sache seiner Ehe offiziell etwas erreicht zu haben. Seine junge Frau Waldrada stand mit den Kindern mit leeren Händen da und ging vor Kummer über den Tod ihres Mannes in ein Kloster, da sie Elsässerin war, nach Remiremont in den Vogesen. Oder wurde sie dorthin verbannt? Karl dem Dicken, der das Elsass nach Lothars Tod in seine Gewalt bekam, ist alles zuzutrauen. Er war es ja auch, der den wahren Erben des Elsass, Hugo, blenden ließ.
Aber gewiss hatte Karl der Dicke seine Finger im Spiel, als Waldrada im Kloster Remiremont verschwinden musste, denn naheliegender wäre doch gewesen, dass sie sich in der Klosterschule Erstein um ihren erst zwölfjährigen Sohn Hugo, seine vielleicht neunjährige Schwester Berta und seine sechsjährige Schwester Gisela gekümmert hätte. „Vielleicht“ müssen wir bei der Festlegung des Alters der Kinder sagen, denn genaue Daten über sie gibt es nicht, auch dies ein Zeichen, dass sie in der offiziellen Politik nicht erwünscht waren, dass sie keine Rolle spielen sollten, sie waren es nicht einmal wert, dass man Aufzeichnungen über sie machte, zumindest in den offiziellen Archiven und Staatskanzleien nicht. Lothars uneheliche Kinder galten von Anfang an als überflüssig. Sie standen zwei gewaltigen Königreichen im Weg, und für Sentimentalitäten wie Familienglück hatte man keinen Sinn.
Karl der Dicke hatte übrigens auch kein Glück mit seiner Ehe. Der schwer gestörte und willensschwache Epileptiker verbannte seine Frau, eine Verwandte der badisch-schwäbischen Zähringer wohl, weil er wegen seiner Krankheiten nicht so recht mit ihr zusammenleben konnte, sagen wir mal reichlich hilflos, weil die Quellen nicht viel hergeben, außer dass er dick war, dass er schwach war, Epileptiker war und andere für sich regieren ließ, dass er gern in Klöstern lebte und am liebsten Mönch geworden wäre. Karl der Dicke also verbannte seine Frau auch in ein elsässisches Kloster, nach Andlau an den Osthang der Vogesen, dorthin, wo schon seit den Römerzeiten die herrlichsten Weine wachsen.
Das hatten auch vorher schon die Karolinger erkannt, nachdem sich die Merowinger mehrmals die Finger speziell im Elsass verbrannt hatten.
Heilige Odilie – ist die Legende eine Verschlüsselung für das Leben?
Man denke nur an einen der ersten Herzöge im Elsass, Eticho, der unstreitbar zur obersten fränkischen Führungsschicht zählte und trotzdem große Schwierigkeiten mit seinen eigenen Kindern hatte. Nicht einmal die konnte er richtig beherrschen. Das drückte sich in der Legende um die blinde Odilie aus, die wohl stellvertretend für das von den Franken unterjochte und schmachtende alemannische Volk stand und heute noch steht.
Die Tochter dieses frankoburgundischen Herzogs Eticho, Odilie, wurde im 7. Jahrhundert blind geboren und deshalb vom Vater verstoßen. Menschen mit körperlichen Gebrechen durften damals nicht regieren und wurden allgemein als minderwertig und nicht brauchbar empfunden. Man behandelte sie nahezu als Sünder, die wenig zum Gedeihen der Gesellschaft beitragen konnten, und die sich ihre Krankheit durch ein spezielles Sündenregister zugezogen hatten. Der das Herrschen gewohnte Eticho wollte sie sogar ermorden lassen. Odilie wurde aber von ihrer Mutter in ein Kloster in Burgund (in der heutigen Franche-Comté) gebracht, überlebte dort trotz geglückter christlicher Erziehung und erlangte der Legende nach durch die Taufe eines Wanderbischofs sogar ihr Augenlicht, sie wurde „sehend“, was man auch im übertragenen Sinne verstehen kann.
Ihr Vater wollte die Franche-Comté, wo Odilie ihre glückliche Jugend verbrachte, erobern, scheiterte aber, als er erfuhr, dass Odilie wieder sehen konnte. Das alles rührte den Merowinger Herzog nicht, er wollte wohl nicht verstehen, sondern ergab sich seinen Machtgelüsten, die oft in furchtbaren Grausamkeiten endeten.
Diese Legende beschreibt wohl allegorisch die brutale oder gewaltsame Christianisierung der Alemannen im Elsass durch die siegreichen Franken, wobei Odilie für die Alemannen steht. Sie wurde blind (geistlich blind) geboren, wurde im kultivierteren Ausland, im Burgund, sehend (also Christin). Wir begreifen Legenden jetzt als die damaligen Zeitungen des Volkes. Zeitungen, die wegen der Rache der grausamen Fürsten verschlüsselt geschrieben werden mussten.
Die Geschichte erzählt auch, dass Odilies Bruder sie später an den elsässischen Herzogshof in Obernai am Fuße des heutigen Odilienberges zurückholen wollte (Obernai hieß früher Oberehnheim, Obernai ist die französische lautmalerische Form des im elsässischen Dialekt ausgesprochenen Oberehnheim, Oberehne). Das erzürnte den blind-gewalttätigen Herzog so, dass er seinen Sohn so heftig schlug, weil er seinen Befehl, Odilie in der Verbannung zu belassen, missachtet hatte, dass dieser unglücklich stürzte und an seinen Verletzungen starb. Odilie erweckte ihn wieder zum Leben, musste dann aber, weil sie ja mit dieser guten Tat erneut gegen den Vater rebelliert hatte, in den Schwarzwald fliehen. Übersetzt heißt das, dass die Alemannen vor dem grausamen Machtmenschen, der ihnen das römisch-katholische Christentum gewaltsam aufzwingen wollte, auf die andere Seite des Rheins zogen.
Viele Alemannen waren Arianer, das ist zwar auch eine Art Christentum, aber anders, als es die römisch-katholische Lehre erlaubte. Die Arianer glauben nicht an die heilige Dreifaltigkeit, sondern hielten Christus für einen Menschen, wenn auch einen weisen, was ihm auch eine herausragende Stellung sicherte. Im Glauben der Arianer steht er zwischen dem Schöpfer und den Menschen, ist also eine Art Halbgott. Heute würden wir über Christus sagen, dass er ein begabter Philosoph war, der auch praktische Hinweise geben konnte. Religion hat ja lange das tägliche Leben geordnet, was wir heute noch sehen, wenn den Mohammedanern vorgeschrieben wird, ihre Füße zu waschen und keinen Alkohol zu trinken. Schon daran kann man erkennen, wie weit wir uns von den Legenden des Neuen Testaments entfernt haben, wie viele frühere Aufgaben der Religion nun der Staat oder die Bürger selbst übernommen und sie in Gesetze gegossen haben. Schon aus diesem Grunde ist es dumm und verkehrt, Religionen zu belächeln. Sie sind noch in mindestens der Hälfte der Gesetze verankert, nach denen wir heute leben. Und nicht schlecht leben.
Der Vater Odiliens also, Herzog Eticho, besah sich endlich das, was er so alles angerichtet hatte. Er nahm sich eine Bedenk- oder Besinnungszeit, was ganz ungewöhnlich für einen Jähzornigen ist. Er hörte auf, auf seine Kinder und die Alemannen einzuprügeln. Für die katholische Kirche bedeutete das: Jetzt begriff der Stier Eticho den Inhalt des Christentums richtig. Eticho ebnete Odilie den Weg zurück in ihre Heimat Elsass. Eine Weile lebte sie bei ihrem Vater am Hofe in Obernai, dann stand sie dem Kloster auf dem Odilienberg vor. Von der Legende in die damalige Wirklichkeit übersetzt soll das wohl heißen: Der Herzog wurde milder, er hatte verstanden, dass man gerade das Christentum anders vermitteln musste als durch Kopfabschlagen und sonstige Gewalttaten. Die Alemannen wurden von nun an verständnisvoller behandelt. Was man ja unter anderem auch an den Klosterneubauten heute noch sehen kann.
Abb. 3 Blick vom Odilienberg in die Rheinebene
Der Herzog ließ Odilie sogar zwei Klöster errichten, eines davon auf dem später so genannten Odilienberg in den Vogesen, von wo aus man weit ins Land Elsass sehen und sehr gut erkennen kann, wie die Landschaft kultiviert wurde. Ludwig (Chlodwig) der Vierzehnte soll dort begeistert ausgerufen haben: „Was für ein schöner Garten!“
Odilie wirkte als Äbtissin in diesen Klöstern. Sie initiierte viele Wunder, oder sagen wir nüchterner, Heilungen, weil sie auch Ärzte oder Heilkundige im Kloster und an der Herzogsburg unten in Obernai beschäftigte. Manchmal betrafen diese Heilungen Augenkrankheiten. Deshalb wird sie bis heute als Schutzpatronin des Elsass und der Blinden verehrt. Legionen von Elsässern zapfen heute noch die Quellen rund um den Odilienberg an, weil sie glauben, dass es Wunderwasser sei. Sie füllen das Wasser bestimmter Quellen in Flaschen und bringen es nach Hause. Vielleicht trinken sie es, vielleicht waschen sie damit ihre Augen, Wunden oder Krankheiten. Angeblich ist es gut gegen Augenkrankheiten. Ich habe es nicht recherchiert, weil ich dafür mit diesen Menschen sprechen müsste und das fällt mir schwer. Aber dass viele die Quellen nutzen, ist sicher. Ich habe das selbst gesehen, als ich eine Kollegin begleitete, die über Odilie schrieb und Führungen auf dem schon in grauer Vorzeit bekannten und bewohnten Odilienberg veranstaltete. Der Odilienberg verzeichnet gewaltige Besucherzahlen und war schon früher eine sehr beliebte Pilgerstätte. Odilie liegt in einer Kapelle neben dem eigentlichen Kloster begraben. Ihr steinerner Sarg ist eine speziell hervorgehobene Pilgerstätte neben dem Kloster und dem heiligen Berg.
Abb. 4 „Heidenmauer“ am Odilienberg
Interessant ist auch, dass der Odilienberg schon eine Fluchtburg der Kelten oder sogar in der Steinzeit war. Man hatte rund um den Berg eine Mauer errichtet, die so gewaltig ist, dass man meint, Riesen hätten sie aufgeschichtet. Im 7. Jahrhundert, also zur Zeit Odilies, wurde diese Mauer verstärkt. Man hat das erst vor kurzem herausgefunden, als man mit modernsten Mitteln die Holzklammern untersuchte, mit denen diese riesigen Mauerbrocken zusammengehalten wurden. Die Besichtigung dieser im Volksmund so genannten „Heidenmauer“ lohnt sich. Man sieht genau, wie die mittelalterlichen oder steinzeitlichen Baumeister die natürlichen Felsen des Berges geschickt in die gewaltige Mauer integrierten. Oder, eben umgekehrt: Wie die Felsen in die Mauer integriert wurden. Das Ganze sieht aus wie das Werk eines Zyklopen.
Die Frauenklöster im Mittelalter darf man sich nicht als total unwirtliche christliche Gefängnisse vorstellen, das wäre mitten im lebensfrohen Elsass sowieso undenkbar, sie waren im Grunde mehr Schulen für höhere Töchter, eben Orte, an denen ein Teil des Geisteslebens im Mittelalter stattfand. Aus ähnlichen Einrichtungen gingen viel später die Universitäten hervor. Das ist übrigens auch ein Indiz dafür, dass sich die Karolinger zersplitterten in tausend Kleinreiche. Die Frauen der Karolinger, also die ersten Damen des Reiches, residierten im späten 9. Jahrhundert oft in Klöstern über das ganze Reich verstreut. Vielleicht ging Karls Frau freiwillig dorthin, weil es dort schöner und vor allem bequemer war als am brutalen, stets in Machtkämpfen verstrickten Hof, der sich meist auf Reisen befand und nirgends richtig zu Hause war. Der Königshof war nur Gast in Klöstern oder auf zugigen Gutshöfen in den fremden Betten befreundeter Fürsten. Da fühlt sich keine Frau auf längere Zeit wohl, auch der lustigste Reisevogel nicht, wohl auch dann nicht, wenn diese ambulante Residenz „Kaiserpfalz“ hieß.
Wir müssen festhalten, dass Richardis, so hieß die Frau Karls des Dicken, des letzten Kaisers des Gesamtreiches der Franken, der ein unvorstellbar großes Reich zu regieren versuchte, das fast mit dem heutigen Europa identisch ist, dass also seine Frau Richardis in Andlau Ländereien von ihrem Vater, einem elsässischen Grafen, geerbt hatte, auf denen sie dann ihr Kloster erbaute oder betrieb. Das ist wichtig zu wissen, weil die Elsässerin Irmgard, die Frau des Kaisers Lothar, ja auch im Elsass ein Kloster gegründet hatte, in Erstein, vermutlich ebenfalls auf Eigenbesitz. Auf Eigenbesitz ließ sich besser schalten und walten. Man brauchte niemanden zu fragen, wie man dieses und jenes zu bewerkstelligen habe, man holte eigentlich nur die Erlaubnis des Papstes ein, das Kloster gründen zu dürfen, und handelte dann nach Gutdünken auf eigenem Land, wie man es gewohnt war. Der Papst und der Klerus mischten sich natürlich anfangs nicht besonders ein, man ließ die stolzen Hochadligen gewähren, ließ sie eine Schule für ihre Verwandten einrichten, christlich geprägten Unterricht erteilen, was wollte man mehr. Später dann, wenn Erbschaftsfragen zu klären waren, meldete man seine Ansprüche schon etwas deutlicher an, aber nicht zu sehr, um die Adligen, die schließlich dieses Land gestiftet und die Gebäude errichtet hatten, nicht zu erschrecken. Hier lugt schon das noch zarte Pflänzchen Investiturstreit hervor, der als späterer Riesenbaum das Reich erschüttern sollte.
Der Dank der Kirche bestand in der Regel darin, dass die Stifter heiliggesprochen wurden: Irmgard und Richardis, die zwei elsässischen Kaiserinnen, die ihr Hausgut der Kirche gaben, spielen im Heiligenkalender der katholischen Kirche eine große Rolle. Ihr Leben ist dort mit frommen, das heißt mit äußerst respektvollen Worten verzeichnet.
Andlau hat was, das muss jeder sagen, der mal dort war. Es ist in sanfte Rebhänge eingebettet und ältere Reisende beschließen beim Anblick dieses französischen Provinzstädtchens sofort, den Rest ihres Lebens dort zu verbringen, denn der reichlich vorhandene Wein könnte, das ahnen oder hoffen sie doch zumindest, ihre ebenso reichlich vorhandenen Alterszipperlein mildern und die schmerzlichen seelischen Wunden, die ihnen das Leben geschlagen hat, im Trottennebel verschwinden lassen.
Wie es im Karolinger-Kloster Andlau tatsächlich ausgesehen hat, wissen wir nicht, es ist fast nichts mehr von damals vorhanden. Dennoch munkeln die Historiker von ziemlich primitiven Holzbauten. Die Klöster damals müsse man sich vorstellen wie die Forts im Wilden Westen. Oder gilt das nur für die Klöster, die 200 Jahre früher gebaut wurden, um 600 herum? Ich bin unsicher, glaube nicht an Holzbauten, sondern an schöne, wenn auch schlichte Steinhäuser, wobei die vorhandenen Gutshöfe sicher in die Klostergründung mit einbezogen wurden.
Abb. 5 Blick über die Weinberge nach Andlau
Karl der Dicke nahm sich zunächst scheinbar freundlich der Kinder seines Vetters Lothar in Erstein an, nachdem er ihre Mutter ins Kloster geschickt hatte oder sie freiwillig dorthin ging. Karls Vater, Ludwig der Deutsche, hatte ja seinem Neffen König Lothar versprochen, sich um dessen Kinder zu kümmern. Aber der kleine Hugo, der bei seines Vaters Tod etwa zehn oder zwölf Jahre alt war, hatte schon zu viel gehört von seinem Erbe und dem ganzen Drama um die „wilde“ Ehe seiner Mutter mit seinem Vater, um noch lenkbar im Sinn seiner Verwandten in West- und Ostfranken zu sein. Zu dumm, dass man auch schon vor dem Tod Lothars beschlossen hatte, sein Reich unter sich aufzuteilen, dass es also auf seine Witwe und ihre Kinder gar nicht mehr ankam, dass sie sich eigentlich nur noch, ohne Ärger zu machen, in Luft aufzulösen hatten. Machtpolitik à la Mittelalter eben. Da wurde im Wochenrhythmus geblendet und erschlagen, vergiftet und erstochen, exkommuniziert und erwürgt. Verbannung in ein Kloster war da noch die zarteste Variante.
Religion war oft Antrieb in Politik und Gesellschaft. Doch was ist Religion überhaupt?
Könnte sein, dass sie die lang und sehnsüchtig von allen Geisteswissenschaftlern und Esoterik-Sympathisanten erwartete disziplin- und fächerübergreifende Antwort auf die Frage ist, wie man das Leben am besten bewältigt. Das heißt, wie man glaubt, dass man das Leben am besten zu bewältigen. Denn der Glaube spielt dabei eine große Rolle. Fast eine übergroße.
Klar: Je mehr daran glauben, dass dies die Form ist, mit der man das Leben am besten hinter sich bringt, desto treffsicherer ist die jeweilige Religion. Deshalb die oft grotesken Missionierungsbemühungen. Es müssen möglichst viele ins Boot gezogen werden, dann funktioniert die jeweilige Religion viel besser.
Von der Logik her ist gegen dieses Verfahren wenig zu sagen. Von der menschlichen Seite aber kommt es dabei bestimmt zu Härten, weil Individualisten, die sich ungern zu etwas bekehren lassen, was sie für Quatsch halten, einer gewissen Vereinsamung ausgesetzt werden. Deshalb beeilen sich alle, zu irgendeiner Religion zu gehören.
Aber auch die, die sich ins Boot ziehen lassen, um endlich ihre Ruhe zu haben, erhalten beim Ziehen und Zerren über die Bordkante (Konfirmation, Taufe, Kommunion, Heirat) Schrammen. Aber so ist es eben. Im Kommunismus hatte die Partei immer Recht, bei den Religionen ist es die Mehrheit der Gläubigen und ihre Vordenker, die Priester und Pastoren.
Religion hat also einen ganz und gar irdischen und praktischen Sinn. Alles Geschwafel über Geister und Götter ist Quatsch und vernebelt nur die guten Absichten der Religionen. Auch glaubt kein Mensch mehr an Geister und Götter, wohl aber an Gut und Böse und unser Gedächtnis. Gut und Böse haben kluge Leute, die besser denken können, oder die glauben, dass sie besser denken können als wir, voneinander geschieden oder meinetwegen dem Leben abgelauscht (ich finde das gut, dann brauche ich nicht jedes Mal, wenn ich einen Apfel klauen will, darüber nachzudenken, ob das auch richtig ist).
Manchmal könnte man allerdings misstrauisch werden. Es ist nämlich denkbar und auch wahrscheinlich, dass sich Leute, die sowieso schon oben sitzen, oder sich mit nicht ganz koscheren Mitteln nach oben gekämpft haben, eine Methode ausgedacht haben, wie man die anderen Leute weiter unten ruhig hält. Das wäre irgendwie menschlich. Solchen Religionen ist also nicht zu trauen. Aber welche sind es? Eigentlich ist das ganz einfach zu beantworten. Tut mir die Religion gut oder duckt sie mich bloß? Wenn sie mich nur duckt, tut sie mir nicht so gut. Wenn ich aber spüre, dass sie mir guttut, ist sie gut.
Leider ist das Gefühl, ob etwas gut oder böse ist, nur eine Scheinlösung, denn mir kann etwas weh tun, was der Gemeinschaft gut tut. Also müssen wir letztendlich wieder den Priestern glauben. Dazu gehört viel Vertrauen.
Wer seine Eltern und Geschwister als lieb, nett und fürsorglich erlebt hat, hat viel Vertrauen und Zutrauen zu der Welt. Das ist eine der Schwachstellen der Religionen, denn was kann ich dafür, dass meine Eltern mich geprügelt haben, als ich unschuldig war und mich gestreichelt, nachdem ich meinen Bruder verprügelt hatte und ich so kein Urvertrauen in die Gerechtigkeit dieser Welt entwickeln konnte. Aber stimmt schon: Dadurch, dass meine Eltern Flaschen waren, habe ich auch eine gewisse Schuld geerbt. Ich bin also nicht prädestiniert, sagen die Calvinisten. Da habe ich einfach Pech gehabt. Ich muss mich nun anstrengen, gut zu sein, dann kann ich meinen Kindern auch gut sein und die sind dann hoffentlich prädestiniert.
Die meisten Religionen wollen Frieden verbreiten, weil der Mensch als Egoist auf die Welt kam. Egoisten sind aber für die Gemeinschaft nicht besonders günstig. Man muss die Menschen also umerziehen zu Gemeinschaftswesen. Sie sollen nicht so sehr an sich, sondern auch an die Gemeinschaft denken. Hier hat die Religion ein weites Feld. Klar, dass sich auch Soziologen und Psychologen darum kümmern, weil die Religionen langsam einsehen, dass sie nicht alles alleine schaffen: Naturwissenschaften, Psychologie, Soziologie können sie nicht mehr alleine überblicken wie im Mittelalter. Alle spezialisieren sich. Da können die Religionen nicht beiseite stehen, sonst machen sie sich lächerlich.
Den Menschen einen Großteil ihres Egoismus’ auszutreiben, könnte man leicht verwechseln mit der Aberziehung ihres Ehrgeizes. Ehrgeiz ist ja nötig, um überhaupt am Leben zu bleiben. Zu viel Ehrgeiz macht aber nur unruhig: Was soll ich denn mit zehn Mercedessen oder zwanzig Häusern? Ist überhaupt ein Mercedes nötig? Vielleicht brauche ich doch besser einen Elektro-Smart. Hier das Gleichgewicht zu finden, ist Sache der Religionen. Sie sind gewiss eine nützliche Sache, wenn auch volkswirtschaftlicher Blödsinn, weil sich bald, wenn man die meisten Religionen ernst nimmt, keiner mehr anstrengt „Butter zu machen“, wie meine Mutter immer sagte, wenn sie Bestrebungen meinte, aus der Scheiße zu gelangen.
Wir sehen also, Religionen sind ein schwieriges Feld. Auf jeden Fall kein einfaches. Es ist gar nicht so dumm, dieses schöne Feld Leuten, die es gewohnt sind darüber nachzudenken, zu überlassen: Priestern. Sie haben auch die Zeit dafür. Sie wurden sozusagen zum Nachdenken über uns freigestellt. Wir müssen nur aufpassen, dass sie andere Religionen nicht diffamieren, denn auch dort glauben die Leute an ihre Priester.
Wenn sich Religionen aber widersprechen? Das kann schon vorkommen, denn bisher wurden Religionen eher für Provinzen gemacht, nicht fürs Ganze. Wenn die Welt sich aber zunehmend globalisiert, sage ich mal recht dümmlich, denn die Welt ist ja schon ziemlich global, reichen Provinz-Religionen nicht mehr aus. Im Moment sehe ich keinen, der alle Provinzen umfassen würde. Außer Barack Obama. Denn der ist von Natur aus eine Mischung, umfasst also Afrika, und als Weißer auch Amerika und Europa und mit seiner Religion auch Asien.
Leider mögen manche Obama nicht. Das liegt daran, dass er in Amerika erzogen worden ist. Sowas mögen Chinesen nicht. Aber die werden schon noch drauf kommen, dass so einer wie Obama gut für sie ist. Wir werden aber nicht missionieren. Da müssen die Chinesen selbst draufkommen. Oder wir kommen auf einen Asiaten, Tibeter. Wen haben die da drüben? Mir fällt im Moment keiner ein außer dem lächelnden Dalai Lama. Der zieht sich aber nicht richtig an. Wenn ich ihn sehe, habe ich immer Angst, dass er friert. Ich muss da wieder an meine Mutter denken, die immer gesagt hat: „Zieh dich richtig an!“ Vielleicht ist der stets grinsende Tenzin Gyatso doch nicht der Richtige für unsere Breitengrade. Gibt es denn keinen echten Chinesen? Wir fragen mal drüben nach. Mao? Gut, gut. Passt er zu uns? Wir sind schließlich kein unterentwickeltes Bauernvolk. Aber egal, glauben wir ihm mal. Wir müssen ja nicht alles glauben, sondern nur das, was uns gefällt. Wir nehmen von Obama das, was uns gefällt und von Mao das, was uns guttut und von den Priestern ebenfalls. Wer sagt uns aber, was uns guttut? Na ja, da sind wir wieder bei unseren Priestern. Zu schade. Jetzt habe ich mir diese ganzen Gedanken umsonst gemacht. Das passt mir auch wieder nicht. Deshalb nehme ich Sloterdijk. Obwohl der stottert und schwafelt. Er findet immer für ganz einfache Sachverhalte komische und schwierige Wörter. Gut, das muss man auch erst mal können. Aber vielleicht scheidet er deshalb als Menschheitsbeglücker aus. Mir muss man etwas flüssig und mit einfachen Worten erzählen. Sonst denke ich beim Erzählen an was anderes. Wer übersetzt mir Sloterdijk? Martin Walser? Nu hör aber auf! Der hat ja überhaupt kein Priesterdiplom. Der ist doch Germanist oder Studienrat. Aber immerhin Doktor. Nee, aber Walser, nee. Reich-Ranicki? Ein Jude? Nee. Er müsste schon Christ sein. Junge, Junge, ist das schwierig. Soll sich doch der Papst damit befassen. Aber der ist schon alt. Außerdem scheint er keine Eile zu haben, die Welt zu einen. Vielleicht ist das auch gut. So weit ist die Globalisierung schließlich doch noch nicht fortgeschritten.
Jetzt also zu Karl dem Großen.
Nicht, dass ich etwas mit ihm zu tun hätte oder gar mit ihm verwandt wäre (jedenfalls nicht mehr oder weniger als die meisten Deutschen). Oder weil mein Vater Karl hieß; aber ich finde, dass mein Interesse für Geschichte und die Art darüber zu schreiben, sehr viel über mich und mein Leben aussagt.
Die Erbregelungen, die Karl der Große erlassen hatte und mehr noch sein Sohn Ludwig der Fromme mit Zustimmung der Großen des Reiches, waren der Grund für die erneute Zersplitterung Europas. Es wurde zerstört, was Merowinger und Karolinger mühevoll aufgebaut hatten. Freilich durch Kriege „aufgebaut“ und deswegen vielleicht auch wenig haltbar, oder, um ein modernes Wort zu gebrauchen, wenig nachhaltig, aber man könnte das Ergebnis höher bewerten als den Weg.
Prinzipiell darf einmal die Frage aufgeworfen werden, ob die Realteilung des Reiches unter den Söhnen eines Herrschers nicht die Schaffung eines einheitlich großen Reiches, die Schaffung Europas, verhindert hat. Das Reich immer wieder unter den Söhnen zu teilen, musste eines Tages dazu führen, dass es zu einem Splitterhaufen wurde, auch wenn Teilreiche beim Fehlen eines Erben wieder dem Ganzen zugefügt wurden. Die Ottonen haben klugerweise die Schwächen dieser Realteilung erkannt und ihr Reich nur im Gesamten vererbt. So entstand Deutschland und auf der anderen Rheinseite ganz ähnlich Frankreich.
Die Merowinger und auch noch die Karolinger waren mit ihren Gefolgsleuten eine Kriegerkaste, wie es ja die germanische Tradition verlangte. Erst die Berührung mit dem gebildeten Südwesten Europas, mit den Nachkommen der Gallorömern und dem in ihren Verbreitungsgebieten schon kräftig wachsenden Christentum, änderte langsam ihre Gewohnheiten.
Schulen entstanden, am Hofe und in Klöstern. Die Idee eroberte führende Leute im Karolinger-Reich, dass Allgemeinbildung vielleicht auch zur geglückten Lebensführung von Verwaltungsbeamten nützlich sein könnte und nicht nur ausschließlich als Mittel zur Eroberung fremder Gebiete und Untertanen, die dann freilich fleißig Steuern abliefern und somit ihren neuen Herren weitere Kriegszüge ermöglichen konnten.
So ist ja Rom groß geworden: Durch Raubzüge, die als edle Kriege getarnt wurden, weil Rom angeblich um Hilfe gerufen wurde. Die Bezahlung dieser Hilfe sah dann so aus, dass diejenigen, denen geholfen wurde, ewig Tribut an Rom entrichten mussten und mehr oder weniger Untertanen des römischen Kaisers wurden. Und das nicht etwa, um eine Bildungsidee der Antike zu verwirklichen, sondern um die so entstandenen Provinzen bis aufs Hemd auszuziehen.
Wie sagte Clinton, als er gefragt wurde, warum er als „Linker“ die Wahlen gewonnen habe: „Es ging um Wirtschaft, Dummkopf!“ Ja, Wirtschaft bewegt die Welt, Dummkopf. Und ein gebildeter Mensch kann die anderen viel besser lenken. Das erkannten nach und nach auch die Karolinger.
Karl der Große und sein Sohn Ludwig gingen mit ihrer Bildungsidee voran. Karl war umfassend an Bildung im weitesten Sinne interessiert. Er verstand sicher auch Latein, eine Sprache, die an seinem Hof in Aachen fast zwangsläufig gesprochen wurde, weil Kleriker und Gelehrte aus ganz Europa dort lebten und arbeiteten. Schreiben konnte er Latein allerdings nicht, weil er ein Schulabbrecher der Klosterschule St. Denis bei Paris war. Er ging damals, als er zur Schule gehen sollte, lieber jagen oder mit seinem Vater Pippin dem Kurzen auf Beutezüge durch ganz Europa. Und es stimmt: Ein ordentlicher Krieg verlangt ja auch gewisse Fertigkeiten und Kenntnisse.
Karl führte Kriege, um haltbare Verwaltungsstrukturen aufzubauen. So sagte er. Wahrscheinlich aber lag ihm das Kriegshandwerk viel mehr als trockene Lateinstudien. Später dann, als alter und satter Kaiser, erkannte er den Wert der Bildung. Er bereute, dass er in seiner Jugend so wenig Wert auf Latein gelegt hatte und verlangte von seinen Verwaltungsbeamten lateinische Schriftlichkeit. Sie wurde in Klosterschulen hergestellt, die er gegründet und aufgebaut hatte. Mit diesen lateinischen Schrifterzeugnissen zementierte er seine Herrschaft.
Karls Vater, Pippin der Kurze - er hieß übrigens nicht der Kurze, weil er so klein war, sondern weil er seinen Untergebenen gegenüber häufig „kurz angebunden“ gewesen sein soll - er zeichnete sich sogar durch Körper- und Geisteskraft aus, muss aber scheinbar seinem Wesen nach ziemlich unhöflich, unwirsch und verletzend gewesen sein. Es ist vielleicht auch kein zwingender Beweis, aber sowohl Pippins Großvater und Großmutter, als auch sein Vater und seine Mutter, sowie sein Sohn Karl der Große waren Riesen. Warum sollte ausgerechnet er klein gewesen sein? Es findet sich kein Kleiner in seiner Verwandtschaft. Oder doch? Wir wissen eben noch nicht viel über diese Zeit, weil sie nur selten oder gar nicht „schriftlich“ war (wer schreibt, bleibt).
Karls Sohn, Ludwig der Fromme, legte, wie schon der Name sagt, viel Wert auf lateinische, das hieß damals kirchliche Bildung. Er wurde im Südwesten des heutigen Frankreichs von Geistlichen erzogen. Er sprach Altfranzösisch, Aquitanisch und Latein. Das Fränkische mochte er nicht so sehr, obwohl er es gut verstand; die Kriegergesellschaft Karls des Großen blieb ihm auch deshalb zeitlebens fremd. Er nahm wohl an vielen Kriegszügen seines Vaters teil, sowie an Synoden, die der Verbreitung von Bildung dienten, ebenso an Reichsversammlungen, aber sein Zuhause blieb Aquitanien.
Er war, wie wir in einem heutigen Zeitungsartikel sagen würden, „ein Franzose“. Und der tat sich natürlich unter Deutschen schwer, die eher grinsten, wenn von Bildung die Rede war.
Als sein Vater, Karl der Große, starb, war Ludwig 36 Jahre alt. Er hatte schon Kinder, die ihm später viel Kummer bereiten sollten: Lothar, der das gesamte Reich als Oberkaiser erben sollte, Pippin, der für Aquitanien als Unterkönig vorgesehen war und Ludwig, der Deutschland als König bekommen sollte. Eine zweite Heirat, weil seine erste Frau gestorben war, verkomplizierte alles. Karl, so hieß auch der Junge, den ihm seine Frau, eine hochadelige Welfin geschenkt hatte, sollte auch was erben, aber es war ja nichts mehr da. Seine drei Söhne aus erster Ehe hatten schon alles besetzt. Nun begann ein Eiertanz, der sich auch schon in meiner Wortwahl ausdrückt: Einer soll Oberkaiser werden, andere Unterkönige. Durfte nun der Kaiser Lothar seinen Brüdern Anweisungen geben oder nicht? Eher nicht, sagten seine Brüder. Das aber widersprach dem Reichsgedanken, der ein einiges Reich vorsah. Das war wichtig, auch wegen des Heeresaufgebotes. Ein Gesamtkaiser konnte eine viel größere Streitmacht aufstellen als ein schmächtiger Unterkönig. Diese weigerten sich aber, dem Kaiser zu folgen.
Nun versprach Ludwig seinem jüngsten Sohn Karl Westfrankreich. Das erbitterte die Erstgeborenen. Streit ohne Ende war die Folge. Das Reich zerbrach und der gute Kaiser Ludwig sah zu. Nicht umsonst wird er in Frankreich auch „Ludwig der Gutmütige“ genannt. Gutmütigkeit ist nicht gerade eine Eigenschaft, die für einen Kaiser nötig ist. Vielleicht war er auch zu gebildet, um mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Die Großen des Reiches, also die Hochadeligen, die Karl dem Großen geholfen hatten, das riesige Reich zu gewinnen, stellten auch ihre Forderungen. Sie wollten in ihren Besitztümern unabhängiger werden. Eine starke Hand wurde gebraucht.
Der folgende Ludwig der Fromme hatte sie nicht.
Kapitel 2 - Peter
Ein hartes Leben, psychisch meine ich
Kein gefährliches Wort und kein unangebrachtes Gefühl drangen aus den Wohnungen dieses wunderschönen Prager Jugendstilhauses. Es war Krieg und man musste vorsichtig sein. 1943 hatten Deutsche die schönsten Häuser im tschechoslowakischen Prag belegt. Die Tschechei hieß jetzt Sudetengau oder so ähnlich. Blockwart Swoboda war Herr über die Bewohner des Jugendstil-Hauses und hatte Sorgen, weil die Gestapo schon lange nichts mehr von ihm gehört hatte. Vermutlich würde er bald abgelöst werden und ein anderer, linientreuerer Blockwart mit deutschen Wurzeln und mehr Erzählfreude würde den Posten bekommen. Ein Posten, der seinen Inhaber davor bewahrte, zur Wehrmacht eingezogen zu werden.
Jeder Blockwart in Prag spitzte die Ohren, wenn das Bum-bum-bum-booom der BBC im Radio ertönte. Die meisten hatten beim Abhören des englischen BBC-Senders eine Decke über das Radio und den Kopf gezogen, damit nichts nach außen dringen konnte. Der Blockwart horchte ins Treppenhaus, wenn die BBC für Deutsche sendete. Er wollte die Verräter am Deutschtum auf frischer Tat ertappen. Wenn man keine Gummisohlen hatte, knallte und zischte jeder Schritt auf den Marmorstufen des Treppenhauses wie der Wischbesen eines Schlagzeugs. Das Echo der Tritte kam von den hohen Stuckdecken zurück. Manchmal schlich der Blockwart die Treppen hinauf und lauschte an den Türen.
Eines Nachmittags - es hatte gerade ein wenig geschneit - klingelte er bei den Sohlas, weil er den Duft von „echtem Bohnenkaffee“ gerochen hatte. Er wusste, dass Frau Sohla Französin war und von ihrer Schwester hübsch verschnürte Pakete mit ausländischen Leckereien bekam. Hausgehilfin Rosa machte die Tür auf und Swoboda fragte auf Tschechisch: „Haben Sie BBC gehört?“ Rosa drehte sich halb um und rief mit ihrem merkwürdigen Deutsch (die Tschechen sagen nicht „Welt“, sondern Wääld“) in den dunklen Wohnungsflur: „Madame Sohla, haben Sie wieder Englisch-Radio gehört?“ Denise kam aus dem Wohnzimmer und strahlte den Blockwart an: „Aber nein! Kommen Sie doch herein! Wir trinken gerade eine Tasse Kaffee!“
Blockwart Swoboda war ein alter Mann. Er ächzte sich in das Wohnzimmer und sagte: „Mein Sohn ist gefallen. In Stalingrad!“ Denise, ihr Mann Karl und der Blockwart weinten ein bisschen, ohne sich zu sehr gehen zu lassen. Als der Blockwart ging, stand der dreijährige Sohn der Sohlas neben der Tür, schob die Füße zusammen, schleuderte den rechten Arm steil nach oben und krähte: „Heil Hitler!“ Der Blockwart sah den schwarzhaarigen Knirps Emil lange nachdenklich an, ehe er die schwere Eichentür zusammen mit Rosa aufstemmte. Emil hüpfte zurück ins Wohnzimmer.
Ungeachtet der Tatsache, dass Denise einen Deutschen geheiratet hatte, war sie eine patriotische Französin, wenn auch etwas kommunistisch angehaucht. Sie war, wie soll man das nur einigermaßen wohlwollend nennen, aus Prinzip querläuferisch. Fast wie eine Querulantin. Ihre Schwester war Berufsschullehrerin und hatte einen Mann aus der Normandie geheiratet, der zwar intelligent, in den Augen von Denise aber ein Dummkopf war, weil er aus Überzeugung Fließbandarbeiter und ein kompromissloser Kommunist war und vielleicht deshalb keinen wirklichen Ehrgeiz hatte. Es fiel ihr gar nicht auf, dass sie selber Kommunistin war und außerdem Fließbandarbeiter in diesem idealistischen System als Höhepunkt der Menschheitsentwicklung angesehen wurden. Sie hielt sich für etwas anderes. So richtig konnte sie es nicht formulieren, aber im Grunde lief ihre Weltanschauung darauf hinaus, dass sie etwas Besseres war. Sie war die Tochter eines reichen Kaufmanns, die intellektuelle Neigungen entwickelt hatte. Das hatte ihrem Vater den Wutschaum in die Mundwinkel getrieben. Er verstand nicht so recht, dass man in Frankreich nur dann als Intellektuelle galt, wenn man Kommunistin oder zumindest Sozialistin war wie Simone de Beauvoir.
Also wurde Denise auch ein wenig kommunistisch, nicht ganz überzeugt, sonst hätte sie nach dem Krieg nicht de Gaulle gewählt, aber immerhin, in der Zeit, als es chic war, Kommunistin zu sein, war sie es. Vielleicht hatte sie auch später noch sozialistische Anwandlungen, aber in erster Linie verfolgte sie im reifen Alter das Älterwerden gleichaltriger Schauspielerinnen im Fernsehen. Die großdeutsche Ungarin Marika Rökk und die kommunistische Widerstandkämpferin Simone Signoret wurden von Denise politisch vollkommen gleichberechtigt behandelt und mussten sich je nach Faltenstand bewundernde oder entsetzte Ausrufe gefallen lassen.
„Alouette“, die Lerche, war der Deckname ihres Schwagers im Krieg gewesen, weil er so schön mit der Gitarre zwitschern und dazu Volkslieder singen konnte. Sein Kommunismus färbte fast zwangsläufig auf seine Frau Alice ab, weil sie immer aufpassen musste, dass er keine Dummheiten im Vichy-Frankreich und auch nachher noch machte.
Nach ungenehmigten Demonstrationen wurde er regelmäßig von Polizisten auf der Wache verprügelt, weil er mit seinem Kommunismus einfach nicht aufhören wollte, obwohl doch de Gaulle an der Regierung war. Ich nehme an, dass Alouette deshalb Kommunist geworden ist, weil er klug war und trotzdem nicht so reich werden wollte, wie es die Familie seine Frau schon war. Ich weiß nicht, wie er sich fühlte, wenn er die luxuriöse weiße Villa am Stadtrand von Toulouse betrat, die ihr Heim darstellte. Dachte er dabei an Stalin und die Gulags? Tat es ihm leid, dass er kein Abweichler war und nicht im Gulag verschwinden musste, wie jeder anständige Kommunist, der ein bisschen selbstständig denken konnte?
Der Gulag war für einen edlen, intellektuellen Kommunisten sozusagen der Ritterschlag, während er in einer luxuriösen Villa im Süden Frankreichs schmachten musste. Schande über Schande! Manchmal traute er sich kaum zu den Zusammenkünften seiner Kameraden in deren Wohnlöchern, obwohl er wusste, dass diese Wohnungen verwanzt waren und von der Geheimpolizei abgehört wurden. Abgehört werden! Das war das Höchste, was ein Kommunist in den sechziger Jahren in Frankreich erreichen konnte. Als Alouette erfuhr, dass die Wohnungen seiner Kameraden mit Mini-Mikrofonen der Politischen Polizei gespickt waren, weinte er vor Glück. Gegen den Staat sein! Gegen die Kapitalisten sein! Gegen alle sein! Gegen alles sein! Ach, es war in den Sechzigern eine Lust zu leben.
Man wusste einfach, warum man auf der Welt war. Die Revolte!
Später schliffen sich die Fronten leider etwas ab, weil die Arbeiter im Rahmen des Kapitalismus ziemlich wohlhabend wurden und der Arbeiterstand wegen der Vollautomatisierung immer weniger auf die Basis zurückgreifen konnte, weil gar keine Arbeiter mehr da waren, sondern nur Aufpasser über Maschinen. Man überlegte, von den vollautomatischen Maschinen auch den vollen Gewerkschaftsbeitrag zu verlangen. Der Plan wurde wieder aufgegeben, weil sich niemand fand, der mit den Maschinen reden wollte. Schon die Anrede bereitete Schwierigkeiten. „Genosse Maschine!“ Konnte man das sagen? Eine Maschine hatte allerdings auch ihre Vorteile. Sie meckerte nicht, wenn auf Versammlungen der Vorsitzende des Betriebsrats seine Vierstundenbeiträge zur Architektur der Weltrevolution ablieferte.
Die junge, leicht kommunistische Denise folgte also mit ihrem kleinen Sohn Emil (was sich Deutsche für Namen ausdenken!) ihrem 42jährigen Mann in die Tschechei, oder besser gesagt in das „Reichsprotektorat Böhmen und Mähren“, Unterabteilung Sudetengau des Großdeutschen Reiches, und wurde dort sogleich von ihren nationalsozialistisch oder hitlerverehrerisch gestimmten Schwägerinnen mit Naziparolen zugemüllt, selbst für eine laue Kommunistin eine Zumutung. Besonders eine Schwägerin tat sich dabei hervor. Deren Mann war im Krieg, wie fast alle Brüder von Vater Sohla. Warum er selbst nicht in den Krieg ziehen musste, bleibt sein Geheimnis. Aber klar: Spione müssen nicht in den Krieg, Spione sind schon seit ihrer Geburt in irgendeinem Krieg.
Sie werden deshalb vom richtigen Krieg verschont. Das würde erklären, warum er mit seinen zwei Söhnen nie über diese Zeit sprach. Er durfte nicht. Spione müssen schweigen, für immer.
Anzumerken ist hier natürlich, dass Karl Sohla auch leicht in Toulouse bei seiner Frau und seinem kleinen Sohn hätte bleiben können. Die Gestapo hätte ihm vermutlich keine Steine in den Weg gelegt, nachdem er sein Geschäft in Paris aufgelöst hatte oder es einfach Pleite ging, weil er interniert war. Immerhin war er mit einer Französin verheiratet, das war doch für die Deutschen ein schöner Beweis, dass sie nicht von allen Franzosen gehasst wurden. Die Verwandten von Denise hätten ihm sogar geholfen, eine Existenz in Südfrankreich aufzubauen. Aber er zog es eben vor, in seine alte Heimat zu ziehen. Er freute sich sogar richtig darauf. Er wollte keine Rache an den Tschechen oder der Tschechoslowakei nehmen. Er freute sich darauf, heim zu kommen und doch unter Deutschen zu sein.
Ein weiterer Sohn wurde im Protektorat Prag geboren, Peter Sohla, dessen Lebensweg wir weiter verfolgen wollen. Er erblickte Anfang Dezember 1943 das „Licht der Welt“, was natürlich ein Euphemismus ist, denn es war ziemlich dunkel im verdunkelten Prag in Bahnhofsnähe. Stalingrad machte die Sache auch nicht besser. Alle liefen mit ziemlich langen Gesichtern umher. Die Nazigegner, weil die Geschichte so lange dauerte und die Nazis, weil sie langsam eine Ahnung beschlich, dass der Krieg verloren war.
Noch aber spuckte Hitler große Töne: ‚Ich bleibe an der Wolga, weil ich den Russen den Nachschub abschneiden will. Die Russen, so schlau bin ich, dass ich das schon lange weiß, transportieren ihre Waren, auch Kriegswichtiges, ja sogar Kriegsentscheidendes, die Wolga hinauf und hinunter, ganz besonders das Öl von den Ölfeldern im Kaukasus oder vom Toten Meer oder Bakusee oder äh….. Ich werde den Kaukasus und alles, was dahinter liegt, deutsch machen müssen. Meine Generäle verstehen das nicht, weil sie nicht denken können. Wer Krieg führt, muss möglichst schnell alle Energiequellen in seine Hand bringen. Die Eroberung des Kaukasus kostet mich eben mal die Sechste Armee unter dem Schwein Paulus, das nicht verstehen will, wozu Offiziere eine Pistole haben.
Meine Generäle können das nicht sehen, das kann nur ein Staatsmann wie ich, der auch Wirtschaft und insbesondere Kriegswirtschaft in Wien studiert hat. Ganz besonders im Ersten Weltkrieg habe ich mir als Meldegänger Kriegswirtschaft angeeignet. Geografie musste ich ein wenig vernachlässigen. Nun bin ich Kanzler und Führer von Großgermania!‘
Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, sagt heute, als Kanzler oder Ministerpräsident könne man sein persönliches geistiges Konto gar nicht auffüllen, weil man keine Zeit dafür habe. Es werde immer nur etwas von dem bestehenden abgehoben, bis nach zwei Jahren nichts mehr da sei, was man guten Gewissens als zukunftsgerichtetes oder innovatives Denken bezeichnen könne. Man verwalte sozusagen nur noch seine schrumpfenden Ideenvorräte, die sich in der Zeit des Nichtregierens angesammelt hätten. Auf neue Situationen könne man sich nicht mehr einstellen. Man nehme deshalb die alten Antworten auch für neue Situationen.
Eigentlich gefährlich, aber den Deutschen fiel nach dem Krieg nicht mehr ein, als die Amerikaner zu kopieren. Viel anderes hätten die Amerikaner wohl auch nicht geduldet.
Wirtschaftswunder!
Hitlers Offiziere, genauer die, die an der Eroberung der kaukasischen Ölfelder beteiligt waren, gestalteten in der Nachkriegszeit vieles, z.B. auch die Ausdehnung des Springer-Verlags. Sie waren tüchtig. Sehr tüchtig sogar. Diszipliniert bis zur Selbstzerfleischung. Wie sie es im großen Krieg gelernt hatten. Von den Generälen waren zwar nicht mehr viele da, die meisten hatten Selbstmord begangen oder waren an Altersschwäche gestorben. Ihre Witwen bekamen trotzdem fettere Pensionen als die Frauen der Frontschweine. Aber das ist ja gut so. Wir wissen schon von den Römern, dass man den Generälen, Kriegshauptleuten und Kaufmännern etwas von der Kriegsbeute abgeben muss, sonst machen sie nicht mit. Und je höher der Dienstrang, desto dicker die Beute, das ist ja klar, sonst wackelt das ganze Gefüge der Welt, die unter anderem auf einer klaren Rangordnung der Tüchtigkeit aufgebaut ist.
Mit den Obersten, Hauptleuten, Feldwebeln und Leutnants, die vom Krieg übrig geblieben waren, organisierten die Deutschen einen weiteren Teil der hitlerischen Kriegswirtschaft, den sie „Wirtschaftswunder“ nannten, weil man im Krieg so lange auf die „Wunderwaffe“ gewartet hatte. Peter war 1963 mit 20 Jahren Filialleiter des Ullstein-Verlages in Berlin. Der Ullstein-Verlag gehörte Springer. Die alten Offiziere und Peter mussten die Zusteller der Abonnentenzeitung „Morgenpost“ aussuchen, einstellen, instruieren und betreuen. Die jungen Damen in den Springer-Filialen nahmen Anzeigen für das Boulevardblatt „Berliner Zeitung“ (BZ) und die „Morgenpost“ auf. Peters Vorgesetzte, alle so um die Vierzig, Fünfzig, sprachen genauso weiter, wie sie es vom Krieg her gewohnt waren. Es war von einer „Verkaufsfront“ die Rede. Peter war „Unterleutnant“ in den Ullstein-Filialen in Neukölln, Kreuzberg und Spandau und somit „an der Front“, eben überall da, wo die „Front wackelte“ und ein „Fronteinbruch“ drohte, weil die Zeitungszusteller, also die „Frontsoldaten“, mal wieder schlapp machten und nicht aus ihren Unterständen, sprich ihren Betten, kamen, also dicht vor einer Meuterei standen. Diese „Strategie“ wurde in der Vertriebsabteilung gemacht, die „Taktik“ den Unterleutnants überlassen. Abonnenten zu werben, sie gut zu bedienen und Anzeigen zu verkaufen war eine „Verkaufsschlacht“, was auch sonst. Versagende Mitarbeiter wurden sofort von der Front abgezogen und degradiert. „Hauptsturmbannführer“ überlegten dann, ob diese Versager in der Etappe den Krieg erst mal von der Pike auf lernen mussten oder gleich in „Arbeitslager“ abgeschoben werden konnten, auch Arbeitsämter genannt. Insassen dieser „Lager“ mussten sich in regelmäßigen Abständen beim Chef des Lagers, dem Sachbearbeiter, melden. Dann wurden den Häftlingen zumeist niedere Arbeiten wie das Schanzen in Gartenanlagen zugewiesen, um nicht zu sagen, befohlen. Erfüllten sie auch diese Aufgaben nicht zur Zufriedenheit des Lagerleiters, wurden sie liquidiert: das heißt, sie bekamen keinen Pfennig Arbeitslosengeld mehr und galten fortan als „faule Schweine“, die „bei Hitler“ vergast worden wären. Aber man war ja jetzt eine Demokratie und deshalb zur Toleranz verpflichtet. Deshalb wurden die faulen Schweine nur zur „Vernichtung durch Arbeit vom Arbeitsamt“ verurteilt.
Die Deutschen blickten indes zu ihren neuen Führern, den Alliierten, gläubig auf. Die Adenauer-Parole „Befiel Amerika, wir folgen dir, wohin du willst, auch nach China, selbstverständlich nach Vietnam, und vielleicht auch nach Nicaragua, auf jeden Fall aber nach Serbien und in den Kongo“, wurde sehr populär, weil man die Melodie schon mal irgendwo gehört hatte. Als die Kriegsverbrechen der Amerikaner etwas bekannter wurden, zuckten die alten deutschen Frontschweine mit den Schultern.
In der jungen Bundesrepublik erkannten junge Leute bald die Schönheit von „Lagern“, wie es etwa auch die Kunsthochschulen waren, und studierten Kunst, weil dazu nicht die Ochsentour über das Abitur notwendig war. Sie machten es wie die SS-Männer und Oberdichter Grass im Westen und Heisig im Osten. In den Kunstakademien herrschte ein wunderbarer Ton. Man musste nicht einmal selbst in der Akademie erscheinen, denn Künstler kann man nicht einfach anbrüllen wie einen Soldaten oder Angestellten des Springer-Verlags. Künstler kamen und gingen, sie arbeiteten oder nicht, wie es ihnen ihre Kunst befahl. Herrlich, aber ohne die geringste Aussicht, jemals Geld damit zu verdienen. Die meisten Akademieschüler wurden deshalb nach ihrer Studienzeit mit einem bombastischen Diplom verziert und entweder Kunstlehrer, die ihren Schülern das Gleiche vermittelten, was sie in der Akademie gelernt hatten, nämlich das Nichts mit unverständlichen Texten zu begleiten, oder sie wurden Postbote. Leider bekamen sie dann wieder eine Uniform. Für das weite linke Feld waren die Möglichkeiten auf jeden Fall sehr groß.
Gute Wirkungen erzielten die Sozialisten auch in der Justiz. Ein linker Richter in meinem Alter sagte mir einmal, wenn sein Angeklagter einen „dicken“ Mercedes besitze, werde er von ihm „ohne Ansehen der Person“ (kicher, kicher) schuldig gesprochen und das Strafmaß verdoppelt. Klassenkampf im Amtsgerichtszimmer. Merkwürdig nur, dass der Vater dieses linientreuen linken Richters ein strammer Nazi war. Der „Marsch durch die Institutionen“ endete mit fetten Pensionen, einem Reihenhäuschen im Grünen und einem zufriedenen Lächeln während eines Fernsehberichts über die Demonstrationen am Stuttgarter Hauptbahnhof.
Einen Fahnenwechsel muss man jedem gönnen, jeder kann mal seine Meinung ändern, ganz besonders, wenn der Krieg selbst seine Meinung geändert hat. Man muss, das ist der Lauf der Welt, als Kleiner Mann sein Fähnchen nach dem Wind hängen. Peter nahm deshalb Grass gar nichts übel, nicht, dass er bei der SS war, nicht, dass dessen Verwandte Nazis waren bis auf seinen polnischen Alibionkel (er selbst hatte schließlich auch seine leicht kommunistische Mutter und einen vollkommunistischen Onkel). Er nahm also Grass auch nicht krumm, dass er seine Nazivergangenheit verschwiegen hatte, als er sich mit seinem Beitritt zur Gruppe 47 dem CIA zur Verfügung stellte. Diese SS-Endspurtkarriere 1944/45 wäre auch kaum ein Hindernisgrund für seinen Aufenthalt in dieser vom CIA gesponserten Künstlergruppe gewesen. Die CIA ist ja auch nichts Schlimmes, sie ist eben eine Kulturunterabteilung der amerikanischen Regierung und sorgt schlicht und einfach dafür, dass alle, und ganz besonders die Linken, ein wenig amerikanischer denken. Manchmal macht sie das raffiniert, indem sie Linke finanziert, aber trotzdem frei herumlaufen lässt, dann wieder etwas brutaler, indem sie muslimische Revolutionäre foltert. Besonders die Hoden waren dabei im Visier der Folterer, das wissen unsere Frontschweine noch von den Amerikanern in den Ardennen.
Als die ersten Berichte über Foltermethoden in amerikanischen Konzentrationslagern im Irak und sonst wo auf der Welt bekannt wurden, lächelten unsere alten Soldaten etwas gequält. Sie schämten sich ihrer leeren Hodensäcke, die ihnen von den Amerikanern im Kriegsverbrechergefängnis in Schwäbisch Hall geleert worden waren. Aber die Amerikaner waren ja nun die Guten, deshalb schwiegen sie, Proteste gegen die Amis waren im Nachkriegsdeutschland unpopulär. Man wollte doch endlich, endlich seine Ruhe haben vor Gedanken, die nicht die Familie oder einen sicheren Arbeitsplatz betrafen.