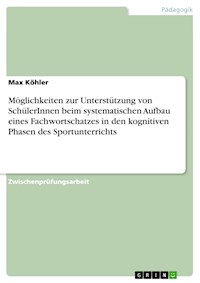Differenzielles Lernen im Sport. Ein Trainingskonzept zur Verbesserung der Passtechnik im Fußball? E-Book
Max Köhler
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stellt Differenzielles Lernen als Trainingsansatz im Fußball eine effektive Alternative zu klassischen Techniktrainingsmethoden dar? Führende Sportwissenschaftler stellen die traditionellen Trainingsansätze und Trainingsprinzipien im Hobby- und Leistungssport zunehmend in Frage. „Differenzielles Lernen“ rückt dabei vermehrt in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. Die vorliegende Masterarbeit stellt diese moderne Trainingsmethode in Bezug auf ihre Anwendbarkeit im Sport vor und beleuchtet sie kritisch. Theoretische Ansätze und Modelle werden dabei ebenso berücksichtigt wie empirische Forschungen zu dem Thema. Eine vom Autor durchgeführte Feldstudie gibt weiterhin Aufschluss darüber, ob differenzielle Trainingsmethoden zu einer Verbesserung der Passspieltechnik im Fußball führen. Allein im Fußballsport sind über eine Million Bürger ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzende, Physiotherapeuten oder Übungsleiter tätig. Sowohl der Deutsche Fußball Bund (DFB) im Allgemeinen als auch seine Landesverbände im Speziellen haben sich verpflichtet, das Ehrenamt aktiv und stetig zu fördern. Anzunehmen ist, dass ein stark überwiegender Teil der Übungsleiter in ihrer wöchentlichen Tätigkeit im Trainings- und Spielbetrieb die ihnen aus ihrer aktiven Zeit bekannten und als wirksam angesehenen Trainingsmethoden anwendet, um individuelle Verbesserungen ihrer Spieler zu erzielen. Haben sich in der Historie auf der einen Seite vereinzelte Aspekte des Fußballs, wie zum Beispiel die Spielsysteme, stets verändert und angepasst, so unterziehen sich auf der anderen Seite die traditionellen Trainingsansätze bzw. Trainingsprinzipien zunehmend einem umfangreichen, wissenschaftlichen Diskurs. Dieser Kritik werden auch die Standardwerke der Trainingslehre unterzogen. Bezogen auf den Fußballsport sehen Bisanz und Vieth (2000) in dem Festhalten an diesen vermeintlich patriarchalischen Lehren einen Grund für die technische Unterlegenheit deutscher Sportler in diesem Bereich. Abweichend von der traditionellen Trainingslehre rückt das „Differenzielle Lehren und Lernen im Sport“ (Schöllhorn et al., 2009, S.36) von Schöllhorn (1999) als alternativer Lernansatz in den Fokus. Im Rahmen einer Primäranalyse dies zu thematisieren, durch eine Sekundäranalyse den theoretischen Rahmen vorzustellen sowie bisherige Forschungsergebnisse zu präsentieren, die diesen Ansatz gegebenenfalls verifizieren oder entkräften, sind die Ziele dieser Arbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Problemabgrenzung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Bewegungssteuerung und Bewegungskontrolle
2.1.1 Das systemdynamische Modell
2.1.2 Weitere Modelle der Bewegungssteuerung und Bewegungskontrolle
2.2. Modelle des Bewegungslernens
2.2.1. Der systemdynamische Lernansatz
2.2.2. Weitere Modelle des motorischen Lernens.
2.3. Formen des Lehren und Lernens
2.3.1. Traditionelle Formen
2.3.2. Differenzielles Lernen
2.4. Empirische Ergebnisse zum differenziellen Lernen
2.4.1. Forschungsergebnisse aus dem Leistungs- und Breitensport
2.4.2. Differenzielles Lernen im Sportunterricht
2.5. Kritik
3. Praktische Untersuchung
3.1. Untersuchungsmethodik
3.2. Testanalyse
3.2.1. Ergebnisse
3.2.2. Auswertung
4. Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung und Problemabgrenzung
Mehr als jeder vierte Deutsche ist während seiner individuellen Freizeit in einer gemeinnützigen Organisation aktiv (Braun, 2011). In keinem anderen Bereich sind mehr Menschen ehrenamtlich und freiwillig engagiert als im Sport. Somit ist dieser Sektor der wichtigste und bedeutendste Träger bürgerlichen Engagements (Breuer, 2007). Der Mittelwert bezüglich des Alters dieser Ehrenamtlichen liegt je nach Funktion zwischen 35 und 53,7 Jahren (Breuer & Feiler 2015).
Allein im Fußballsport sind über eine Million Bürger[1] ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzende, Physiotherapeuten oder Übungsleiter tätig. Sowohl der Deutsche Fußball Bund (DFB) im Allgemeinen als auch seine Landesverbände im Speziellen haben sich verpflichtet, das Ehrenamt aktiv und stetig zu fördern (DFB, 2014; Berliner Fußball Verband, 2014).
Anzunehmen ist, ohne das verlässliche Zahlen diesbezüglich vorliegen, dass ein stark überwiegender Teil der Übungsleiter in ihrer wöchentlichen Tätigkeit im Trainings- und Spielbetrieb die ihnen aus ihrer aktiven Zeit bekannten und als wirksam angesehenen Trainingsmethoden anwendet, um individuelle Verbesserungen ihrer Spieler zu erzielen.
Haben sich in der Historie auf der einen Seite vereinzelte Aspekte des Fußballs, wie zum Beispiel die Spielsysteme, stets verändert und angepasst (Peter, 2007), so unterziehen sich auf der anderen Seite die traditionellen Trainingsansätze bzw. Trainingsprinzipien zunehmend einem umfangreichen, wissenschaftlichen Diskurs (Schöllhorn, 2009; Sechelmann & Schöllhorn, 2003; Schöllhorn, W., Beckmann, H., Janssen, D. & Michelbrink, M., 2009). Dieser Kritik werden auch die Standardwerke der Trainingslehre unterzogen (Verchoschanskij, 1998). Bezogen auf den Fußballsport sehen Bisanz und Vieth (2000) das Festhalten an diesen vermeintlich patriarchalischen Lehren einen Grund für die technische Unterlegenheit deutscher Sportler in diesem Bereich.
Abweichend von der traditionellen Trainingslehre rückt das „Differenzielle Lehren und Lernen im Sport“ (Schöllhorn et al., 2009, S.36) von Schöllhorn (1999) als alternativer Lernansatz in den Fokus. Im Rahmen einer Primäranalyse dies zu thematisieren, durch eine Sekundäranalyse den theoretischen Rahmen vorzustellen sowie bisherige Forschungsergebnisse zu präsentieren, die diesen Ansatz gegebenenfalls verifizieren oder entkräften, sind die Ziele dieser Arbeit.
Basierend auf dem ersten Werk Schöllhorns (1999), welcher erstmals das differenzielle Lernen und Lehren als theoretische Konse
quenz erwähnt, diese auf seine empirische Forschung stützt und in der Praxis unabdingbar sieht, erfolgt zu Beginn und dieser Einführung anschließend eine Darstellung der theoretischen Grundlagen. Zu dieser Publikation findet weitere vielfältigste Literatur Verwendung, um einen empirischen Diskurs zu ermöglichen.
Zu den Modellen der Bewegungssteuerung und des Bewegungslernens werden unterschiedliche Formen des Lehren und Lernens aufgezeigt, welche im aktiven Sport in Vereinen und Freizeitgruppen Anwendung finden. Im Zuge der Vorstellung des differenziellen Lernens (DL) werden bisherige Forschungsergebnisse aufgezeigt, die abseits des Fußballs auch in anderen Sportarten Erkenntnisse brachten.
Zuseiten dieser zu erörternden Themen sollen weitere Fragestellungen behandelt werden, um einen Einblick in dieses alternative sportliche Lernkonzept zu erhalten:
Inwiefern lässt sich das Konzept des differenziellen Lernens im Sportunterricht anwenden?
In welchem Umfang wird dieser Lernansatz wissenschaftlich kritisiert?
Lassen bisherige und die erfolgte Feldforschung Verallgemeinerungen auf die Wirksamkeit des Trainingsansatzes zu?
Der bisherigen Empirie anknüpfend folgt ein weiterer zentraler Teil dieser Arbeit. Untersuchungsgegenstand ist die Verbesserung der Passspieltechnik im Fußball. Hierzu wird in einem mehrwöchigen Feldversuch eine Gruppe von 16 Probanden differenziert nach traditionellen Lern- und Lehrformen und den Charakteristika des differenziellen Lernens trainiert. Mit Hilfe eines Post- und Pretest werden die Ergebnisse vor und nach diesem Trainingszyklus verglichen und erläutert. Diese Erläuterung der Untersuchungsmethodik und Auswertung der Ergebnisse stellen neben dem Aufzeigen des empirischen Diskurses einen Kern dieser Arbeit dar.
Abschließend folgen eine Zusammenfassung der Arbeit und eine Auswertung der Hypothesen, welche wie folgt lauten:
Hypothesen:
These 1:
Das differenzielle Lernen stellt als Trainingsansatz eine effektive Alternative zu den bisherigen klassischen Trainingsmethoden im Techniktraining dar, da es innerhalb eines festgelegten Zeitraums bei den Probanden zu einer substantiellen Verbesserung der Passtechnik führt.
These 2:
Probanden, welche differenziell trainiert werden, erlangen im Untersuchungszeitraum einen höheren Leistungsanstieg als die Probanden, welche mittels klassischer Trainingsmethoden trainieren.
Bezieht sich die erste These noch auf die zentrale Forschungsfrage, geht These 2 tiefer in ein einzelnes Detail und behandelt Aspekte, die mit dem Arbeitsthema in Verbindung gebracht werden müssen.
2. Theoretische Grundlagen
Die theoretischen Grundlagen bestehen im Vornherein aus der Darstellung der wichtigsten Auszüge bezüglich der Bewegungssteuerung und Bewegungskontrolle sowie des Bewegungslernens, um das Prinzip des DL zu verstehen. Birklbauer (2006) betont, dass beide Teilbereiche unabdingbar miteinander verknüpft behandelt werden müssen, da sie sich gegenseitig bedingen.
Hierbei wird der Fokus jeweils auf die systemdynamischen Modelle und Theorien gelegt, da sich das DL aus den entsprechenden Annahmen ableitet.
Größtenteils findet hier das Werk Birklbauers (ebd.) aufgrund der thematischen Dichte und des detailliert-strukturierten Inhalts Anwendung und wird durch unterschiedliche Publikationen ergänzt.
Alternierend werden die darauf aufbauenden traditionellen Lehr-Lernformen betrachtet. Diesen Erläuterungen folgend wird im Detail auf den wissenschaftlichen Hauptgegenstand der Arbeit, das DL, eingegangen und die Wirksamkeit auf Basis von Studien aufgezeigt, die sich auch auf den Einsatz im Sportunterricht beziehen. Des Weiteren werden Vorteile bei der Anwendung im Schulsport, aber auch Kritik am Modell des DL aufgezeigt.
2.1 Bewegungssteuerung und Bewegungskontrolle
Neben dem systemdynamischen Modell, welches beginnend erläutert wird, behandelt dieser Abschnitt die weiteren wichtigsten theoretischen Modelle der Bewegungssteuerung und Bewegungskontrolle vor, die zusammenfassend in ihren Grundzügen angesprochen werden.
2.1.1 Das systemdynamische Modell
Das systemdynamische Modell wird auch als ökologische Theorie oder Aktionstheorie benannt und beschreibt
„einen integrativen Ansatz, der menschliche Bewegungsrealisationen ganzheitlich als aktive, zielgerichtete Auseinandersetzung mit den unmittelbaren Umweltanforderungen und den zahlreichen, auf das Individuum einwirkenden emotionalen, individuellen sowie sozialen Faktoren betrachtet“ (Birklbauer, 2006, S. 116).
Loosch (1999, S. 98) sieht in der menschlichen Bewegung ein komplexes zu untersuchendes System, „welches sich weitab von Gleichgewichtszuständen bewegt“. Für die Steuerung und Kontrolle einer Bewegung in solch einem System wird nach dem systemdynamischen Modell angenommen, dass sie durch die vom entsprechenden Körperelement und der Umwelt eingegangene Wechselbeziehung entstehen. Im Vergleich zum Informationsverarbeitungsansatz liegt hierbei ein selbstorganisiertes System mit heterarchischer Struktur vor, in welchem Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten nicht in einem Über- oder Unterordnungsverhältnis, sondern gleichberechtigt wirken (Birklbauer, 2006.). Es liegt das Prinzip der Generalität vor, welches „Phänomene aus ganz unterschiedlichen Bereichen beschreiben und erklären zu können“ (ebd., S. 117) Vielerlei
Abb. 1: Übersichtsschema der Mutterwissenschaften (-disziplinen) systemdynamischer Motorikmodelle
Forschungsansätze in der Systemdynamik versuchen grundsätzlich summierend Selbstorganisationsprozesse bei einer menschlichen Bewegung als komplexes System zu beobachten und zu erklären. Doch diese lassen sich perspektivisch und inhaltlich oftmals kaum und wenn dann in Bezug auf ihre Methodik trennen (ebd.).
Eine Zuordnung zu den „Mutterwissenschaften“ (ebd., S. 119) zeigt Abbildung 1. Die Popularität hinsichtlich der Berücksichtigung des systemdynamischen Ansatzes in der sportmotorischen Forschung hat seinen Ursprung in den wissenschaftlichen Arbeiten zur Selbstorganisation und Selbststabilisierung zyklischer Bewegungen aus den 1980er Jahren, in denen die ständigen Abweichungen und die allgemeine Variabilität einer Bewegungsausführung als essentielle Voraussetzung für ein anpassungs- und lernfähiges System angesehen werden. Diese Relevanz verstärkte sich mit dem Beginn der 1990er Jahre (Schöllhorn, 1999; 2004). Begrifflich jedoch findet sich der Ausdruck „system dynamics“ (Schöllhorn, Eekhoff & Hegen, 2015, S. 127) als Weiterentwicklung der Kybernetik und Systemtheorie nach Bertalanffy (1969) bereits in den 1950er Jahren wieder. Diese beziehen sich bei weitem auf die allgemeine Systemdynamik (Schöllhorn et al., 2015).
Neben dem von Birklbauer (2006) genannten bewegungsphysiologischen Ansatz Bernsteins (1975), der das Problem der Freiheitsgrade auffasst, dem „Ecological Approach“ (Birklbauer, 2006, S. 164) und der Chaostheorie, steht exemplarisch für die Systemdynamik in der Bewegungswissenschaft im deutschsprachigen Raum das Experiment von Haken, Kelso und Bunz (1985) sowie weiterführend Schöner und Kelso (1988) für das Beispiel zyklischer Bewegungen im Vordergrund. Es wird in den Bereich der Synergetik eingruppiert, welche die „umfassendste Theorie der Selbstorganisation“ (Birklbauer, 2006, S. 237) darstellt. In diesem Forschungsbeitrag wurde eine rhythmische Fingerbewegung sukzessive beschleunigt, wobei ab einer bestimmten Frequenz ein Wechsel des Bewegungsmusters eintrat (Schöllhorn, 1999). Bei welcher Höhe der Frequenz ein Wechsel des Bewegungsmusters eintritt, ist von Person zu Person unterschiedlich. Darüber hinaus ist erst durch eine Verringerung der Frequenz eine Rückkehr in das erste Bewegungsmuster möglich (ebd.).