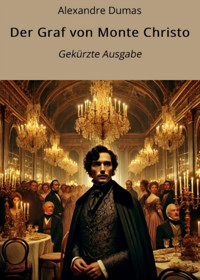
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: adlima GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch präsentiert den Klassiker der Weltliteratur in sorgfältig gekürzter Form. Der Text wurde in modernes Deutsch übertragen, wobei Stil, Ton und Ausdruck des Originals weitgehend beibehalten wurden. Für alle, die einen raschen Zugang zu diesem umfangreichen Klassiker erhalten möchten. „Der Graf von Monte Christo“ von Alexandre Dumas ist ein spannender Abenteuerroman über Verrat, Rache und Gerechtigkeit. Die Geschichte spielt im Frankreich des 19. Jahrhunderts und erzählt vom jungen Seemann Edmond Dantès, der unschuldig ins Gefängnis kommt. Edmond steht kurz vor seiner Hochzeit und wird bald Kapitän. Doch aus Neid und Angst verraten ihn vier Männer. Sie beschuldigen ihn fälschlich der Spionage. Dantès wird verhaftet und landet ohne Prozess in der düsteren Festung. Dort verbringt er viele Jahre. In der Haft trifft er einen Mitgefangenen, den alten Abbé Faria. Dieser wird sein Lehrer und Freund. Von ihm erfährt Edmond auch von einem riesigen Schatz auf der Insel Monte Christo. Nach vielen Jahren gelingt Dantès die Flucht. Er findet den Schatz, wird sehr reich und nennt sich fortan „Graf von Monte Christo“. Mit seinem neuen Namen kehrt er zurück und plant sorgfältig Rache an denen, die ihn verraten haben. Er benutzt sein Vermögen und seinen Verstand, um ihre Leben nach und nach zu zerstören. Dabei wird seine Rache immer kälter und härter. Doch Dantès erkennt schließlich, dass blinde Rache kein Glück bringt. Er lernt, dass Vergebung manchmal stärker ist als Vergeltung. Am Ende findet er neuen Frieden und verlässt Frankreich. Der Roman zeigt eindrucksvoll, wie Macht, Geld und Hass einen Menschen verändern können. Gleichzeitig erzählt er von Mut, Hoffnung und dem Wunsch nach Gerechtigkeit. „Der Graf von Monte Christo“ bleibt ein Klassiker, weil er Spannung und tiefe Gefühle vereint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alexandre Dumas
Der Graf von Monte Christo
Gekürzte Ausgabe
Erster Band. Marseille – Die Ankunft
Am 25. Februar 1815 lief das Handelsschiff „Pharao“ langsam in den Hafen von Marseille ein. Die Stimmung in Marseille war angespannt. Napoleon war seit Monaten auf Elba verbannt. Wer ihm gegenüber loyal war, musste vorsichtig sein.
Ein Mann in der Menge hielt es kaum aus vor Unruhe. Er stieg in eine Barke und ließ sich dem Schiff entgegenrudern. Als ein junger Seemann ihn sah, kam er an die Reling. Es war Edmond Dantès, etwa zwanzig Jahre alt, mit ruhigem und mutigem Auftreten.
„Ah, Sie sind es, Dantès! Was ist geschehen? Warum sieht das Schiff so traurig aus?“ fragte der Mann, Herr Morel.
„Ein großes Unglück“, antwortete Dantès. „Unser Kapitän Leclère ist gestorben.“
„Und die Ladung?“ fragte Morel besorgt.
„Die ist unversehrt, Herr Morel. Der Kapitän starb an einer Hirnentzündung. Wir haben ihn auf See bestattet.“
Dann gab Dantès seinen Leuten den Befehl zum Ankern. Morel wollte wissen, wie es dazu gekommen war. Dantès schilderte ruhig die Ereignisse.
Als das Schiff fast den Hafen erreichte, übergab Dantès das Gespräch an Danglars, den Rechnungsführer. Danglars war unbeliebt – im Gegensatz zu Dantès, der von allen geschätzt wurde.
„Nun, Herr Morel, Sie kennen ja das Unglück“, sagte Danglars.
„Ja, der arme Leclère. Ein guter, erfahrener Mann“, antwortete der Reeder.
Danglars lobte den verstorbenen Kapitän. Morel aber beobachtete Dantès und meinte, dass auch ein junger Mann wie er sein Handwerk ausgezeichnet verstehe. Danglars erwiderte mit bitterem Ton, Dantès habe nach Leclères Tod sofort das Kommando übernommen und anderthalb Tage auf Elba verbracht, ohne Rücksprache.
„Das war seine Pflicht als Sekond“, meinte Morel. „Und hatte das Schiff keinen Schaden?“
„Nein“, sagte Danglars. „Er wollte einfach an Land gehen.“
Morel rief Dantès zu sich. Der junge Mann war noch mit dem Ankern beschäftigt. Erst als das Schiff lag, kam er.
Morel fragte Dantès nach dem Aufenthalt auf Elba. Dieser erklärte, Kapitän Leclère habe ihm ein Paket für Großmarschall Bertrand gegeben.
„Sie haben ihn also gesehen?“
„Ja, ich habe sogar mit dem Kaiser gesprochen.“
Neugierig zog Morel ihn beiseite. „Wie geht es dem Kaiser?“
„Gut. Er fragte nach dem Schiff, der Fahrt, der Ladung. Ich sagte ihm, es gehört Ihnen. Da erinnerte er sich an Ihren Onkel, Policar Morel.“
Morel freute sich: „Das stimmt! Mein Onkel war mit ihm in Valence.“ Dann lobte er Dantès für seinen pflichtbewussten Auftrag. Doch er warnte: „Wenn jemand erfährt, dass Sie mit dem Kaiser gesprochen haben, könnte das gefährlich werden.“
Dantès war unbesorgt. Dann verabschiedete er sich, um mit den Zollbeamten zu sprechen. Kaum war er weg, trat Danglars näher. „Nun, hat er Sie überzeugt?“
„Vollkommen“, antwortete Morel.
„Hat Dantès Ihnen keinen Brief vom Kapitän Leclère gegeben?“ fragte Danglars.
„Nein. Hatte er denn einen?“
Danglars meinte, Leclère habe ihm neben einem Paket auch einen Brief übergeben. Morel wollte wissen, woher er das wisse. Danglars erklärte, er habe zufällig gesehen, wie Leclère Dantès in der Kabine etwas überreichte.
In diesem Moment kehrte Dantès zurück.
Morel lud ihn zum Essen ein, doch Dantès lehnte ab: „Mein erster Besuch gilt meinem Vater. Dann habe ich noch einen zweiten wichtigen Besuch – Mercedes.
„Natürlich!“, lachte Morel. „Sie war dreimal hier, um nach der „Pharao“ zu fragen. Sie haben eine schöne Braut.“
Dann fragte Morel, ob Leclère ihm vor seinem Tod einen Brief für ihn gegeben habe.
„Nein, er war dazu nicht mehr in der Lage.“
Dantès bat um ein paar Tage Urlaub – zum Heiraten und für eine Reise nach Paris. Morel erlaubte es: „Wir brauchen sechs Wochen zum Löschen und frühestens in drei Monaten segeln wir wieder.“
Dann sagte er, er wolle Dantès zum Kapitän ernennen. Dantès war überglücklich. Morel erklärte, er brauche noch die Zustimmung seines Partners, versprach aber, sich dafür einzusetzen.
Dantès bedankte sich tief gerührt. Auf die Frage, ob er Danglars für zuverlässig halte, antwortete Dantès, als Kamerad nicht – als Rechnungsführer aber durchaus.
„Und wenn Sie Kapitän wären – würden Sie Danglars behalten?“ fragte Morel.
„Ob Kapitän oder Sekond, ich achte jeden, dem Sie vertrauen“, antwortete Dantès.
„Sie sind ein anständiger Kerl“, sagte Morel. „Ich will Sie nicht länger aufhalten.“
„Auf Wiedersehen und vielen Dank!“
Dantès stieg in den Kahn. Morel sah ihm lächelnd nach, bis er in der Menge verschwand. Als er sich umdrehte, stand Danglars hinter ihm und blickte Dantès mit ganz anderem Ausdruck nach.
Vater und Sohn
Während Danglars dem Reeder misstrauische Gedanken über Dantès einflüsterte, machte sich dieser auf den Weg zur Wohnung seines Vaters in der Rue de Noilles. Er stieg schnell die Treppe in hinauf und blieb vor der halb geöffneten Tür stehen.
Drinnen saß sein Vater am Fenster. Als Edmond ihn plötzlich umarmte und rief: „Mein Vater, ich bin’s!“, drehte sich der Alte erschrocken um und fiel ihm zitternd in die Arme.
„Bist du krank?“ fragte Edmond besorgt.
„Nein“, antwortete der Vater. „Ich erwartete dich nicht und die Freude war zu groß.“
Edmond beruhigte ihn und berichtete vom Tod Leclères und seiner möglichen Beförderung.
„Mit zwanzig Jahren Kapitän, 100 Louisd’or Gehalt und ein Gewinnanteil – wer hätte das gedacht!“
„Das ist wirklich ein großes Glück“, sagte der Vater.
Edmond versprach, ihm ein Haus mit Garten zu kaufen. Doch der Vater wirkte schwach.
„Wo ist dein Wein?“ fragte Edmond und suchte in den Schränken.
„Es ist kein Wein mehr da“, sagte der Alte.
Erschrocken fragte Edmond nach dem Geld, das er hinterlassen hatte. Der Vater erklärte, er habe Caderousse 140 Franken gezahlt, weil dieser drohte, sich an Morel zu wenden.
„Du hast also von 60 Franken drei Monate gelebt?“ fragte Edmond fassungslos.
„Ich brauche nicht viel“, sagte der Alte lächelnd.
Edmond kniete sich nieder und leerte seine Taschen auf den Tisch.
Da klopfte es. Der Vater meinte, es sei Caderousse.
„Ein Mann, dessen Worte nicht mit dem Herzen übereinstimmen“, murmelte Edmond, „aber er war einmal unser Freund.“
Kaum hatte Edmond seinen Satz beendet, erschien Caderousse in der Tür – ein Schneider, etwa 35 Jahre alt, mit schwarzem Bart.
„Du bist also zurück?“ sagte er mit breitem Grinsen.
„Wie du siehst“, antwortete Dantès kühl.
Caderousse sagte: „Danglars erzählte mir im Hafen von eurer Rückkehr. Ich wollte dir gleich gratulieren. Du stehst wohl gut mit Herrn Morel?“
„Er war immer gütig zu mir. Ich hoffe, bald Kapitän zu sein.“
„Sehr schön“, meinte Caderousse. „Auch Mercedes wird sich freuen.“
Dantès bat seinen Vater um Erlaubnis, Mercedes zu besuchen.
„Geh, mein Sohn und Gott segne deine Frau.“
„Seine Frau?“ rief Caderousse.
„Noch nicht“, sagte Edmond, „aber bald.“
Caderousse meinte, Dantès tue gut daran, sich zu beeilen. Mercedes sei schön und habe viele Verehrer.
Edmond blieb ruhig: „Ich vertraue ihr. Sie liebt mich, egal ob ich Kapitän werde oder nicht.“
Edmond verabschiedete sich.
Caderousse ging wenig später zu Danglars, der an der Ecke wartete.
„Nun, hat er von seiner Kapitänsbeförderung gesprochen?“
„Er hat es eilig“, meinte Danglars. „Er tut so, als wäre es schon sicher.“
Die beiden beschlossen, Dantès unauffällig zu folgen. Sie setzten sich in den Garten der Reserve mit einer Flasche Wein.
Die Katalonier
Unweit des Gartens, wo Danglars und Caderousse Wein tranken, lag die kleine Ansiedlung der Katalonier. Seit Jahrhunderten lebten sie dort abgeschieden, heirateten unter sich und hielten an ihren alten Sitten fest.
In einer schlichten Hütte stand Mercedes, ein schönes junges Mädchen mit schwarzen Haaren und dunklen Augen. Auf einem Stuhl saß Fernand, ein junger Katalonier, der sie voller Spannung ansah.
„Mercedes, Ostern naht. Ist es nicht Zeit zu heiraten?“
„Ich habe dir hundertmal gesagt, dass ich dich wie einen Bruder liebe. Mehr kann ich dir nicht geben.“
„Dann sag es noch einmal, damit ich es glaube. Du schlägst meine Liebe aus. Ich träumte zehn Jahre lang davon, dein Mann zu werden!“
„Ich habe dich nie in dieser Hoffnung bestärkt, Fernand. Ich habe dir immer gesagt, dass mein Herz einem anderen gehört.“
Fernand erinnerte an die Tradition, dass Katalonier untereinander heiraten.
Mercedes entgegnete: „Das ist Gewohnheit, kein Gesetz. Du bist zum Militär eingezogen. Was soll aus mir werden, wenn du fort bist? Ich lebe in Armut.“
„Und wenn ich trotz deiner Armut nur dich will?“
„Fernand, wer einen anderen liebt, kann keine gute Ehefrau sein. Begnüge dich mit meiner Freundschaft.“
„Du liebst also einen anderen?“
„Ja“, rief Mercedes leidenschaftlich, „ich liebe ihn, den du meinst!“
Wütend sprang Fernand auf.
„Ich verstehe dich, Fernand“, sagte Mercedes. „Du willst dich rächen, weil ich dich nicht liebe. Doch was gewinnst du, wenn du Edmond herausfordert? Wenn du verlierst, verlierst du meine Freundschaft. Wenn du gewinnst, verwandelst du sie in Hass. Das ist kein Weg, mein Herz zu gewinnen.“
Sie bat ihn, sich mit ihrer Freundschaft zufriedenzugeben. Dann flüsterte sie mit tränenfeuchten Augen: „Er ist seit vier Monaten fort und ich habe viele Stürme gezählt.“
Fernand blieb kalt. Wütend lief er auf und ab, blieb dann stehen und fragte: „Ist das dein fester Entschluss?“
„Ich liebe Edmond Dantès“, antwortete Mercedes ruhig. „Kein anderer wird mein Mann.“
„Und wenn er stirbt?“
„Dann sterbe ich auch.“
„Und wenn er dich vergisst?“
Da ertönte draußen eine Stimme: „Mercedes!“
„Er ist es!“ rief sie glücklich und lief zur Tür. „Herein, Edmond, ich bin hier!“
Edmond trat ein und die beiden fielen sich überglücklich in die Arme. Für einen Moment vergaßen sie alles um sich. Doch dann sah Edmond Fernand, bleich, regungslos und mit der Hand am Messer.
„Oh, Verzeihung“, sagte Edmond und wandte sich an Mercedes. „Wer ist dieser Herr?“
„Es ist mein Vetter Fernand. Mein Bruder, mein Freund. Der Mensch, den ich nach dir am meisten liebe.“
Als Edmond den drohenden Blick von Fernand sah, verstand er sofort. „Ich wusste nicht, dass ich hier einem Feind begegne“, sagte er.
„Ein Feind?“ rief Mercedes empört.
Ihr Blick zwang Fernand, sich zu fügen. Zögernd trat er vor, reichte Edmond die Hand – und floh dann plötzlich aus dem Haus. Draußen rannte er wie ein Rasender davon.
„Wer wird mich von diesem Menschen befreien!“ rief er verzweifelt.
„He, Fernand! Wohin so eilig?“ rief Caderousse, der mit Danglars unter einer Laube saß.
Fernand blieb stehen.
„Komm zu uns“, sagte Caderousse.
Noch immer bleich, trat Fernand an den Tisch und ließ sich kraftlos nieder.
„Ich dachte schon, du springst ins Meer“, witzelte Caderousse. „Ein Freund muss doch einen Freund vor Dummheiten bewahren!“
Fernand seufzte schwer und vergrub den Kopf in den Armen.
„Du siehst aus wie ein abgewiesener Liebhaber“, spottete Caderousse.
„Ein junger Mann wie du – in der Liebe unglücklich?“, meinte Danglars zweifelnd.
„Sag doch was, Fernand!“, drängte Caderousse.
„Ich bin gesund“, murmelte Fernand, ohne aufzublicken.
„Der arme Fernand ist in Mercedes verliebt“, erklärte Caderousse, „aber sie liebt Edmond Dantès. Und der ist heute zurückgekehrt.“
„Was soll's?“, rief Fernand wütend. „Mercedes ist frei, zu lieben, wen sie will!“
„Schon gut“, sagte Caderousse. „Ich dachte nur, Katalonier geben nicht so leicht auf.“
„Armer Junge!“, sagte Danglars scheinheilig. „Er hatte wohl nicht mit Dantès’ plötzlicher Rückkehr gerechnet.“
„Und Fernand ist nicht der Einzige, den das ärgert, nicht wahr, Danglars?“ lallte der angetrunkene Caderousse.
„Stimmt“, murmelte Danglars, „ich glaube sogar, dass Dantès’ Glück im Unglück bringen wird.“
„Na ja“, sagte Caderousse, goss sich erneut ein, „er heiratet Mercedes, darauf kommt es ihm an.“
„Und wann ist die Hochzeit?“ fragte Danglars.
„Noch nicht bestimmt“, antwortete Fernand leise.
„Aber sie wird bald stattfinden“, meinte Caderousse. „Sobald Dantès Kapitän ist, oder?“
Danglars spürte den Stich und beobachtete Caderousse.
„Also gut“, sagte er, „stoßen wir auf Kapitän Dantès und seine schöne Braut an!“
Caderousse trank, Fernand warf sein Glas zu Boden.
„He! Sieh dort oben!“, rief Caderousse. „Zwei Liebende – sie gehen Hand in Hand und umarmen sich! Dantès und Mercedes, zweifellos.“
Danglars beobachtete genau jede Regung in Fernands Gesicht. „Sei still“, sagte er scheinbar tadelnd zu Caderousse, „lass sie in Frieden! Schau Fernand an – ein Vorbild an Ruhe!“
„Was soll ich mit solchen Einfältigen anfangen?“, murmelte Danglars. „Der eine säuft, der andere jammert. Wenn ich nichts unternehme, triumphiert Dantès.“
In diesem Moment kamen Dantès und Mercedes vorbei.
„Holla, Edmond!“, rief Caderousse. „Bist du schon zu stolz für uns?“
„Nein“, erwiderte Dantès lächelnd, „ich bin nur glücklich – und Glück macht blinder als Stolz.“
„Schönen Tag, Frau Dantès!“
„Noch heiße ich Mercedes“, entgegnete sie ernst.
„Also baldige Hochzeit?“ fragte Danglars.
„Sobald wie möglich“, sagte Dantès. „Heute die Verträge, übermorgen das Fest. Und ihr seid beide eingeladen.“
„Und Fernand?“, spottete Caderousse.
„Der Freund meiner Frau ist auch mein Freund“, sagte Dantès ruhig.
Fernand wollte etwas erwidern, brachte aber kein Wort hervor.
„Heute Vertrag, übermorgen Hochzeit?“, fragte Danglars. „Die „Pharao“ fährt doch erst in drei Monaten.“
„Man darf das Glück nicht warten lassen“, entgegnete Dantès. „Ich muss außerdem nach Paris – im Auftrag unseres verstorbenen Kapitäns.“
„Ah, geschäftlich in Paris?“, fragte Danglars scheinbar beiläufig. Dann dachte er: „Dieser Brief bringt mich auf eine Idee.“
Laut rief er: „Gute Reise, Dantès!“
„Danke!“, antwortete Edmond freundlich – und ging mit Mercedes weiter, ruhig und glücklich.
Das Komplott
Danglars beobachtete Edmond und Mercedes, bis sie hinter dem Fort Saint-Nicolas verschwanden. Dann wandte er sich zu Fernand.
„Diese Heirat macht nicht alle glücklich“, sagte Danglars.
„Sie treibt mich zur Verzweiflung“, antwortete Fernand.
„Und du tust nichts dagegen?“
„Was soll ich tun?“
„Das weiß ich nicht – aber handeln solltest du“, meinte Danglars.
Fernand erklärte, er habe Dantès töten wollen, doch Mercedes habe geschworen, sich dann selbst zu töten.
„Wenn nur Dantès nicht Kapitän würde“, murmelte Danglars.
„Bevor Mercedes stirbt, bringe ich mich selbst um“, sagte Fernand entschlossen.
„Das ist wahre Liebe“, lallte Caderousse.
„Ich wüsste etwas, das deine Pein beenden könnte“, begann Danglars.
„Was meinst du?“
„Nur, dass Dantès Mercedes nicht heiraten darf. Man kann sie auch trennen, ohne ihn zu töten.“
„Nur der Tod trennt sie“, beharrte Fernand.
„Unsinn!“, sagte Caderousse. „Danglars wird dir beweisen, dass es auch anders geht.“
Danglars meinte, ein Gefängnis könne ebenso trennen wie der Tod.
„Aber aus dem Gefängnis kommt man zurück“, warf Caderousse ein.
„Trotzdem – warum ihn töten?“, sagte Danglars. „Man müsste nur ein Mittel finden, ihn festnehmen zu lassen.“
„Aber hast du so ein Mittel?“, fragte Fernand.
„Wenn man gut suchte“, sagte Danglars, „könnte man ein Mittel finden. Aber warum sollte ich mich einmischen?“
„Weil du Dantès ebenso hasst wie ich“, entgegnete Fernand.
„Ich? Nein! Ich habe nur Mitleid mit deinem Kummer. Wenn du glaubst, ich handle aus Eigennutz – bitte sehr, dann mach allein weiter.“
„Nein“, sagte Fernand und hielt ihn zurück. „Ich hasse Dantès. Wenn du ein Mittel hast, das ihn trifft – nur nicht tötet –, dann sag es mir. Ich führe es aus.“
„Gut“, meinte Danglars. „Kellner, Papier, Tinte und Feder!“
Caderousse murmelte: „Eine Feder kann tödlicher sein als ein Schwert.“
„Schenk ihm noch ein“, sagte Danglars leise.
Als Caderousse wieder trank, fuhr Danglars fort: „Wenn man Dantès nach seiner Reise bei den Behörden als bonapartistischen Agenten anzeigte …“
„Ich würde es sofort tun!“, rief Fernand.
„Aber dann musst du unterschreiben. Und wenn Dantès freikommt … Mercedes wird dich hassen.“
„Stimmt“, sagte Fernand zögernd.
„Besser wäre es, die Anzeige anonym zu schreiben.“
Danglars schrieb in verstellter Handschrift: „Ein Freund des Thrones und der Religion meldet, dass Edmond Dantès, Sekond auf der „Pharao“, von Elba einen Brief vom Usurpator für das bonapartistische Komitee in Paris bringt.“
„So ist die Rache sicher“, sagte Danglars. „Und niemand wird dich verdächtigen.“
Dann fügte er die Adresse hinzu.
„Ja“, lallte Caderousse, der den Sinn des Briefs noch erfasste, „aber es wäre eine Schändlichkeit.“ Er griff nach dem Papier, doch Danglars schob es weg.
„Das war nur ein Scherz“, sagte er, „ich wünsche Dantès nichts Böses.“ Dann zerknitterte er den Brief und warf ihn in die Ecke.
„Gut so“, murmelte Caderousse, „Dantès ist mein Freund.“
„Niemand will ihm schaden“, sagte Danglars und blickte zu Fernand, der schweigend den Brief fixierte.
Danglars führte Caderousse fort. Als sie sich entfernten, sah er, wie Fernand das Papier an sich nahm und verschwand.
„Gut“, murmelte Danglars, „die Sache läuft.“
Das Verlobungsmahl
Am nächsten Morgen strahlte die Sonne über dem Meer. Das Verlobungsmahl war angerichtet. Mercedes saß in der Mitte der Tafel, neben ihr ihr Vater und Fernand. Gegenüber saß Dantès, flankiert von Herrn Morel. Auch Danglars und Caderousse waren anwesend, ebenso viele Freunde, Seeleute und Soldaten.
„Merkwürdig still für so viele Gäste“, meinte Dantès’ Vater.
„Ein Bräutigam ist nicht immer heiter“, scherzte Caderousse.
„Ich bin zu glücklich, um laut zu sein“, sagte Dantès.
Caderousse lachte: „Noch bist du nicht ihr Gatte!“
„Aber in anderthalb Stunden werde ich es sein“, erklärte Dantès. Mercedes lächelte, Fernand krampfte sich am Messergriff fest.
„Dank Herrn Morel sind alle Formalitäten erledigt. Um halb drei erwarten uns der Maire von Marseille“, sagte Dantès.
„Gestern angekommen, heute verheiratet!“, rief der Vater stolz.
„Und die Verträge?“, fragte Danglars.
„Gibt es nicht. Mercedes hat nichts, ich auch nicht – spart Papier und Geld!“ Das brachte Gelächter.
„Ist das dann schon das Hochzeitsmahl?“, fragte Danglars.
„Nein, keine Sorge“, sagte Dantès. „Ich reise morgen nach Paris und bin am 1. März zurück. Am 2. feiern wir richtig.“
Die Aussicht auf ein zweites Fest verdoppelte die Stimmung. Die Gesellschaft wurde laut und lebhaft. Fernand war bleich und verstört. Er lief im Saal umher. Caderousse war durch Wein und Dantès’ Freundlichkeit milde gestimmt und sagte, es wäre schade gewesen, Dantès zu schaden. Danglars behauptete, er habe den Plan aufgegeben und lobte Fernand dafür, dass er nun sogar als Brautführer auftrete.
Plötzlich trat Mercedes vor und sagte, es sei Zeit zur Trauung zu gehen. In dem Moment hörte man draußen schwere Schritte. Drei Schläge an der Tür erschreckten die Gäste. Dann trat ein Kommissar mit vier Soldaten ein und fragte: „Wer ist Edmond Dantès?“
Dantès trat ruhig vor. Der Kommissar verhaftete ihn im Namen des Gesetzes. Herr Morel versuchte, zu helfen, konnte aber nichts tun. Dantès’ Vater flehte um Gnade, doch vergeblich.
Caderousse, plötzlich nüchtern, fragte Danglars, ob das die Folge des „Scherzes“ sei. Danglars behauptete, das Papier sei zerrissen. Doch Caderousse erinnerte sich: „Du hast es nur in die Ecke geworfen.“ Fernand war verschwunden.
Während Dantès abgeführt wurde, verabschiedete er sich von seinen Freunden und sagte, es sei bestimmt nur ein Irrtum. Danglars versicherte scheinheilig, er komme sicher bald frei. Mercedes stürzte ans Fenster und rief: „Leb wohl, Edmond!“
Edmond hörte Mercedes’ Schrei, beugte sich aus dem Wagen und rief: „Auf Wiedersehen, Mercedes!“ Dann verschwand er.
Mercedes und der alte Vater standen sprachlos da, bis sie sich weinend in die Arme fielen. Fernand kehrte ruhig zurück, trank ein Glas Wasser und setzte sich abseits.
„Er war es“, flüsterte Caderousse. „Ich glaube es nicht“, entgegnete Danglars.
Einige Gäste vermuteten, Dantès habe Schmuggelware an Bord. Der Vater erinnerte sich an eine Kiste Kaffee und Tabak, was Danglars als Grund für die Verhaftung hinstellte. Mercedes glaubte das nicht. Sie brach in Tränen aus.
Ein Gast rief: „Ein Wagen!“ Es war Herr Morel. Mercedes und der Vater liefen ihm entgegen. Er war bleich. „Die Sache ist ernster, als wir dachten“, sagte er. „Dantès wird verdächtigt, ein bonapartistischer Agent zu sein.
Mercedes schrie auf. Der Vater sank nieder. Caderousse wollte alles gestehen, doch Danglars warnte: „Wenn ein Brief gefunden wird, gelten auch Mitwisser als schuldig.“
Caderousse verstand die Drohung. Angstvoll sagte er: „Ich gehe.“ Danglars folgte ihm zufrieden.
Nachdem die Gäste gegangen waren, führte Fernand Mercedes zu den Kataloniern zurück. Dantes’ Freunde begleiteten den alten Vater in die Stadt.
Herr Morel fragte Danglars, ob er so etwas erwartet hätte. Danglars antwortete, er habe den Aufenthalt auf Elba schon immer verdächtig gefunden, habe aber niemandem außer dem Reeder davon erzählt. Aus Rücksicht auf Morels Familie habe er geschwiegen.
Morel lobte Danglars und teilte ihm mit, er hätte ihn ohnehin als zweiten Offizier behalten, wenn Dantes Kapitän geworden wäre. Dantes habe ihm sogar gesagt, dass er Danglars vertraue.
Caderousse nannte Dantes einen anständigen Kerl. Morel meinte, die „Pharao“ habe jetzt keinen Kapitän. Danglars bot an, das Kommando vorübergehend zu übernehmen.
Morel wollte nun den Staatsanwalt Villefort sprechen und versuchen, Dantes zu helfen.
Als Morel ging, fragte Danglars Caderousse, ob er noch Mitleid mit Dantes habe. Caderousse verneinte, bedauerte aber die Folgen. Danglars behauptete, Fernand sei schuld, denn er habe das Denunziationspapier aufgehoben. Er selbst habe nur im Scherz gehandelt.
Caderousse fürchtete, dass das Ganze böse enden würde. Danglars meinte, solange sie schweigen, würde ihnen nichts geschehen.
Während Caderousse grübelnd verschwand, dachte Danglars zufrieden: „Ich bin jetzt Kapitän und werde es vielleicht auch bleiben – es sei denn, die Justiz lässt Dantes frei. Doch auf die Justiz kann man sich verlassen. Dann ließ er sich zur „Pharao“ rudern.
Der Staatsanwalt
In der Rue du Grand-Cours fand zur selben Stunde ein Verlobungsmahl statt, doch gehörten die Gäste der Aristokratie von Marseille an. Sie tauschten ihre Verachtung für Napoleon aus. Man sprach über Moskau, Leipzig, seine Scheidung von Josephine – und stieß auf Ludwig XVIII. an.
Der Marquis von Saint-Meran erhob das Glas. Die Marquise, stolz und scharfzüngig, rief: „Wenn die Revolutionäre sähen, wie wir hier feiern, müssten sie anerkennen, dass die wahre Ergebenheit auf unserer Seite war. Wir hielten zur Monarchie, als sie unterging, während sie ihr Glück mit dem Emporkömmling machten.“ Dann wandte sie sich an Villefort: „Nicht wahr, Villefort?“
Villefort erschrak: „Verzeihen Sie, ich war gerade abgelenkt.“
„Ah, lassen Sie die Kinder“, meinte der Marquis. „Diese Kinder sprechen wohl lieber von Liebe als von Politik.“
Renée, seine Tochter, sagte lächelnd: „Ich gebe Ihnen Herrn von Villefort zurück.“
Die Marquise begann erneut: „Ich sage, Villefort, die Bonapartisten besitzen nicht unsere Überzeugung.“
Villefort antwortete: „Sie haben wenigstens den Fanatismus. Napoleon ist ein Gesetzgeber und das Musterbild der Gleichheit.“
„Napoleon? Die Gleichheit?“, rief die Marquise. „Und Robespierre? Sie stehlen ihm den Platz!“
„Nein“, sagte Villefort. „Robespierre brachte Gleichheit durch das Schafott, Napoleon hob das Volk auf den Thron.“
„Das riecht nach Revolution!“, rief die Marquise. „Aber Sie sind der Sohn eines Girondisten – der Geruch bleibt.“
Villefort erwiderte ruhig: „Mein Vater stimmte nicht für den Tod des Königs. Er wurde von der Schreckensregierung geächtet, wie auch Ihre Familie.“
„Nur mit dem Unterschied“, sagte die Marquise, „dass mein Vater für seine Treue starb und Ihrer, Noirtier, später Senator wurde.“
Renée bat: „Sprechen wir nicht mehr davon.“
Villefort sagte: „Ich bitte um Vergebung. Ich bin Royalist und heiße von Villefort.“
„Bravo!“, rief der Marquis. „Gut geantwortet!“
„Ja, es ist gut“, sagte die Marquise. „Vergessen wir die Vergangenheit! Aber Villefort soll in Zukunft unbeugsam sein. Vergessen Sie nicht, dass wir uns bei Seiner Majestät für Sie verbürgt haben. Denken Sie daran, wenn ein Meuterer in Ihre Hände fällt, dass Sie unter Beobachtung stehen.“
„Mein Amt verlangt Strenge“, erwiderte Villefort. „Ich habe bereits politische Anklagen erhoben und meine Probe abgelegt.“
„Oh, Herr von Villefort“, rief die Tochter des Grafen von Salvieur, „sorgen Sie doch für einen spannenden Prozess, solange wir in Marseille sind! Ich möchte ein Schwurgericht sehen.“
„Sehr interessant“, antwortete Villefort. „Kein Schauspiel kommt dem gleich: echtes Drama, echte Schmerzen. Wenn sich Gelegenheit bietet, werde ich sie nutzen.“
„Oh Gott!“, rief Renée erschrocken. „Sprechen Sie im Ernst?“
„In vollem Ernst“, erwiderte Villefort. „Schöne Prozesse dienen ihrer Neugier und meinem Ehrgeiz. Diese Soldaten Napoleons zögern nicht, zu töten. Es ist wie ein Kampf: Ich greife an, er verteidigt sich. Und am Ende siegt einer.“
Renée schrie leise auf.
„Das letzte Mal haben Sie Ihre Sache vortrefflich gemacht, Herr von Villefort“, sagte einer der Gäste. „Sie haben den Vatermörder getötet, ehe der Henker ihn berührte.“
„Für Vatermörder finde ich das gerecht“, meinte Renée. „Aber für politische Angeklagte? Sie versprechen mir Nachsicht?“
„Natürlich“, antwortete Villefort lächelnd. „Wir formulieren die Anträge gemeinsam.“
„Kümmere dich lieber um deine Tiere“, sagte die Marquise. „Lasse Villefort seine Geschäfte selbst regeln.“
„Ich hätte Sie lieber als Arzt gesehen“, sagte Renée. „Der Würgeengel schreckt mich.“
„Gute Renée“, murmelte Villefort liebevoll.
„Villefort wird der politische Arzt dieser Provinz“, meinte der Marquis.
Ein Diener flüsterte Villefort etwas zu. Er ging, kam kurz darauf heiter zurück und Renée sah ihn erwartungsvoll an.
„Ich wurde wegen eines Kranken gestört“, erklärte er. „Ein schwerer Fall – die Krankheit führt zum Schafott.“
„Ein bonapartistisches Komplott?“, rief die Gesellschaft erschrocken.
Villefort las einen anonymen Brief vor.
„Aber der ist doch an den Ersten Staatsanwalt gerichtet“, warf Renée ein.
„Der ist nicht da“, sagte Villefort. „Ich habe den Fall übernommen. Der Angeklagte ist verhaftet.“
„Gehen Sie!“, sagte der Marquis. „Der König ruft.“
„Seien Sie nachsichtig“, bat Renée.
„Ich werde tun, was ich kann. Aber wenn die Anklage stimmt, muss das Kraut abgeschnitten werden.“
Renée erschrak.
„Hören Sie nicht auf dieses Mädchen“, sagte die Marquise und reichte Villefort die Hand. Er küsste sie, sah aber nur Renée an.
„Traurige Vorzeichen“, murmelte sie.
„Kindisch“, sagte die Marquise.
„Ich verspreche Strenge“, sagte Villefort, warf Renée jedoch einen liebevollen Blick zu.
Sie lächelte – und er ging mit Glück im Herzen.
Das Verhör
Kaum hatte Villefort den Speisesaal verlassen, legte er seine freundliche Miene ab und nahm die ernste Haltung eines Mannes an, der über Leben und Tod entscheidet. Es fiel ihm schwer, seine Freude zu verbergen: Mit 27 Jahren war er reich, hatte ein hohes Amt inne und stand vor der Hochzeit mit Renée.
Vor dem Haus wartete der Polizeikommissar. Villefort erklärte: „Ich habe den Brief gelesen. Gut, dass Sie den Mann verhaftet haben. Geben Sie mir alle Einzelheiten!“
„Viel wissen wir noch nicht“, antwortete der Beamte. „Alle Papiere sind in Ihrem Büro. Der Angeklagte heißt Edmond Dantès, ist Sekond auf der „Pharao“, einem Handelsschiff aus Marseille.“
„War er bei der Kriegsmarine?“
„Nein, er ist sehr jung.“
Da kam Morel, der Reeder, auf Villefort zu. „Herr von Villefort, man hat einen furchtbaren Fehler gemacht! Mein Sekond Dantès ist unschuldig! Er ist ein guter Mensch und der beste Seemann, den ich kenne. Ich bitte Sie von ganzem Herzen.“
Villefort sah Morel, der dem Bonapartismus nahestand, misstrauisch an. „Man kann in Beruf und Umgang ehrlich erscheinen und trotzdem politisch ein Verbrecher sein.“
Morel errötete. Doch er sagte nur: „Bitte seien Sie gerecht und geben Sie uns diesen armen Jungen zurück!“
Villefort antwortete: „Wenn er unschuldig ist, wird er freikommen. Wenn nicht, tue ich meine Pflicht.“
Im Justizpalast trat Villefort ein, grüßte kühl und ließ Dantès vorführen. Ein flüchtiger Blick auf den jungen Mann zeigte ihm Verstand, Mut und Aufrichtigkeit. Kurz darauf stand Dantès ruhig und höflich vor ihm – doch Villeforts strenger Blick ließ ihn erkennen, dass er nun einem Richter gegenüberstand.
„Wie heißen Sie?“ fragte Villefort.
„Edmond Dantès, Sekond auf der „Pharao“, antwortete der junge Mann.
„Was taten Sie bei Ihrer Verhaftung?“
„Ich war auf meinem Verlobungsmahl“, sagte Dantès bewegt.
Villefort war betroffen. Der Gedanke, Dantès’ Glück zu zerstören, rührte ihn.
„Man sagt, Sie hätten auffällige politische Ansichten.“
„Ich bin erst neunzehn“, entgegnete Dantès. „Ich habe keine politischen Ansichten.“
Villefort erkannte in Dantès’ Worten und Blicken Offenheit und Unschuld. Er erinnerte sich an Renées Bitte um Milde und dachte sich: „Ein guter junger Mann – das bringt mir sicher Pluspunkte bei ihr.“
„Haben Sie Feinde?“
„Nein, ich denke nicht. Ich bin zu jung und zu unwichtig.“
„Aber vielleicht Neider? Mit neunzehn bald Kapitän, eine schöne Verlobte – das kann Missgunst erzeugen.“
„Wenn sie zu meinen Freunden gehören, will ich sie lieber nicht kennen.“
Villefort zeigte Dantès den anonymen Brief.
Dantès las: „Ich kenne die Handschrift nicht. Aber sie wirkt absichtlich verstellt.“
Villefort sah, wie sich bei Dantès kurz die Wut in den Augen zeigte. Dann forderte er ihn auf, ehrlich alles zu berichten.
Dantès erzählte: „Der Kapitän ist bei der Rückreise gestorben und hat mich gebeten, einen Brief zur Insel Elba zu bringen. Dort hat mir ein Großmarschall ein Schreiben übergeben, das ich nach Paris bringen sollte. Nach der Rückkehr habe ich mein Verlobungsmahl gefeiert und bin verhaftet worden.“
Villefort nickte: „Das klingt glaubwürdig. Geben Sie mir den Brief, versprechen Sie, bei Vorladung zu erscheinen – und Sie dürfen zu Ihren Freunden zurückkehren.“
„Ich bin also frei!“, rief Dantès freudig.
„Ja – aber geben Sie mir den Brief“, entgegnete Villefort.
Dantès erklärte, der Brief müsse sich bei seinen beschlagnahmten Papieren befinden.
Als Villefort erfuhr, dass der Brief an „Herrn Noirtier, Rue Coq-Héron in Paris“ adressiert war, erschrak er heftig. Blass und zitternd erkannte er den Empfänger: seinen eigenen Vater.
Villefort las das Schreiben mehrfach, immer verstörter und dachte: „Wenn Dantès je erfährt, dass Noirtier mein Vater ist, bin ich verloren.“
Villefort behauptete nun, er müsse sich mit dem Untersuchungsrichter beraten. Die Anklage sei zu schwerwiegend. Dann warf er den Brief ins Feuer und ließ ihn vollständig verbrennen.
„Sie sehen“, sagte Villefort, „der Brief ist vernichtet. Nur wir beide wissen davon. Leugnen Sie alles, wenn jemand danach fragt.“
„Ich verspreche es“, sagte Dantès.
Villefort fragte, ob es weitere Briefe gebe.
„Nein“, antwortete Dantès. „Ich schwöre es.“
Villefort ließ den Kommissar holen und übergab Dantès wieder der Justiz. Der junge Mann ging dankbar.
Als Villefort allein war, sank er erschöpft auf einen Stuhl. Er dachte: „Hätte ein anderer das Verhör geführt, wäre ich verloren gewesen. Dieses verfluchte Papier hätte mich ruiniert.“
Dann aber kam ihm ein neuer Gedanke. Plötzlich hellte sich sein Gesicht auf. Er überprüfte, ob Dantès fort war – und ging dann rasch zu seiner Braut.
Das Kastell If
Der Polizeikommissar gab den Gendarmen ein Zeichen. Man öffnete eine Tür. Durch einen langen Gang ging es zum Gefängnis. Vor einer Eisentür klopfte der Kommissar dreimal mit einem Hammer. Die Tür öffnete sich und Dantès wurde mit Gewalt hineingeschoben. Es war vier Uhr nachmittags, der erste März. Schon bald wurde es dunkel. Dantès horchte bei jedem Geräusch, doch immer wieder kehrte Stille ein. Erst gegen zehn Uhr hörte er Schritte vor seiner Tür. Zwei Fackeln erhellten den Raum. Vier Gendarmen traten ein. Dantès fragte: „Wollt ihr mich holen?“
„Ja“, antwortete einer.
„Auf Befehl des Staatsanwalts?“
„Ich denke wohl.“
Dantès war bereit mitzugehen. Draußen wartete ein Wagen. Dantès wurde hineingeschoben. Der Wagen fuhr los. Die Fenster waren vergittert und Dantès konnte kaum hinausblicken. Er erkannte, dass sie zum Hafen fuhren.
Beim Hafen hielten sie an. Soldaten stellten sich in zwei Reihen auf. Für Dantès war nur ein schmaler Weg freigelassen. Man brachte ihn auf eine Barke. Sie fuhren hinaus aufs Meer.
Dantès atmete die frische Luft ein. Für einen Moment fühlte er sich frei. Doch dann erinnerte er sich an seine Festnahme. Er betete leise. Dantès fragte: „Wohin führt ihr mich?“ Einer antwortete: „Sie werden es sogleich erfahren.“
Dantès schwieg, doch viele Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Die Barke war klein, kein Schiff lag in ihrer Nähe vor Anker. Vielleicht wollte man ihn nur an einer entfernten Stelle der Küste absetzen und freilassen? Villefort hatte ihm doch gesagt, er habe nichts zu befürchten, wenn er den Namen Noirtier nicht erwähne. Der belastende Brief war verbrannt. Dantès hoffte.
Die Barke fuhr an der Insel Ratonneau vorbei, dann an der Bucht der Katalonier. Dort wohnte Mercedes. Ein einzelnes Licht brannte – es kam aus dem Zimmer seiner Braut. Er wollte rufen, doch Scham und Angst hielten ihn zurück. Die Barke fuhr weiter, das Licht verschwand, der Gedanke an Mercedes blieb.
Inzwischen hatten die Ruder Segeln Platz gemacht. Dantès näherte sich einem Gendarmen und bat ihn eindringlich, ihm zu sagen, wohin sie fuhren. Der Gendarm zögerte, doch schließlich sagte er: „Schauen Sie sich um!“ Dantès blickte nach vorne – da erhob sich düster und schwarz das Kastell If.
Er erschrak. „Das Kastell If! Warum bringt man mich dorthin? Ich habe kein Verbrechen begangen!“ Der Gendarm erklärte, das Kastell sei ein Staatsgefängnis. Man finde dort nur Mauern, Soldaten und Kerkermeister. Keine Richter, keine Untersuchung.“
„Trotz Villeforts Versprechen?“, rief Dantès. Der Gendarm zuckte nur mit den Schultern. In wilder Verzweiflung versuchte Dantès, sich ins Meer zu stürzen. Doch die Gendarmen hielten ihn mit vereinter Kraft zurück.
„Schön“, rief der Gendarm und drückte Dantès das Knie auf die Brust, „bewegen Sie sich nur noch einmal, dann schieße ich.“ Dantès spürte den Karabinerlauf an der Schläfe. Einen Moment dachte er wirklich daran, sich töten zu lassen. Doch der Tod durch eine Gendarmenhand erschien ihm abscheulich. Er ließ sich zurückfallen und schrie vor Wut.
In diesem Moment stieß die Barke gegen den Felsen. Die Gendarmen zogen Dantès ans Ufer. Er wehrte sich nicht. Alles um ihn herum erschien ihm nebelhaft. Er fühlte die Stufen, sah das Tor, das sich hinter ihm schloss – wie in einem bösen Traum.
Im Innenhof der Zitadelle wartete man zehn Minuten. Die Gendarmen ließen ihn los. „Geh“, sagten sie und schoben ihn weiter. Dantès wurde in ein feuchtes Kellerzimmer gebracht. Eine Lampe beleuchtete das nackte Gemach. Der Gefängniswärter, ein grober Mann, sagte: „Das ist dein Zimmer für die Nacht. Brot, Wasser und Stroh – mehr braucht ein Gefangener nicht.“ Dann nahm er die Lampe mit und ließ Dantès allein im Dunkeln zurück.
Als am Morgen Licht in die Zelle fiel, kam der Wärter mit dem Befehl, Dantès solle dortbleiben. Dieser hatte sich nicht bewegt, stand noch immer an derselben Stelle wie am Abend zuvor. Der Wärter sprach ihn an. Dantès reagierte kaum. Auf die Frage, ob er geschlafen oder Hunger habe, antwortete er nur: „Ich weiß es nicht.“ Schließlich sagte er: „Ich will den Gouverneur sprechen.“
Der Gefängniswärter zuckte nur die Schultern und ging. Dantès streckte noch die Hände zur Tür aus, doch sie schloss sich. Da brach er in Tränen aus, warf sich auf den Boden und betete. Er dachte an sein ganzes bisheriges Leben und fragte sich, welches Verbrechen er begangen hatte, um so hart bestraft zu werden.
Ein Gedanke ließ ihn nicht los: Während der Überfahrt hätte er fliehen können. Er konnte gut schwimmen, hätte unter Wasser entkommen und die Küste erreichen können. In Spanien oder Italien hätte er Arbeit gefunden. Doch stattdessen saß er im Kerker, weil er Villefort vertraut hatte.
Am nächsten Tag kam der Wärter wieder. „Sind Sie heute vernünftiger?“ Dantès antwortete nicht.
„Wollen Sie etwas?“
„Ich will den Gouverneur sprechen.“
„Das ist unmöglich“, sagte der Wärter ungeduldig. „Was erlaubt ist: besseres Essen gegen Geld, ein Spaziergang, manchmal Bücher.“
„Ich will nur den Gouverneur sehen.“
„Wenn Sie so weitermachen, bringe ich Ihnen nichts mehr zu essen“, drohte der Wärter.
„Dann sterbe ich“, erwiderte Dantès ruhig.
Der Wärter erschrak: Dantès war eine Einnahmequelle. Also sagte er freundlicher: „Seien Sie vernünftig, machen Sie einen Spaziergang. Vielleicht kommt der Gouverneur dann vorbei.“
„Und wie lange muss ich warten?“
„Einen Monat, drei, vielleicht ein Jahr.“
„Das ist zu lang. Ich will ihn jetzt sehen!“
„Wenn Sie so weitermachen, werden Sie verrückt – wie der Abbé vor Ihnen.“
„Was wurde aus ihm?“
„Er wurde in einen Kerker gebracht.“
Dantès bat den Gefängniswärter: Für 100 Taler soll er Mercedes in Marseille nur zwei Zeilen bringen. Doch der Wärter lehnte ab. Dantès drohte: „Wenn du weder dem Gouverneur von meinem Wunsch berichtest noch Mercedes benachrichtigst, zerschmettere ich dir den Schädel mit dem Schemel!“
Der Wärter wich zurück und sagte: Auch der Abbé wurde so verrückt. Dann rief er: „Gut, ich melde es dem Gouverneur.“
Dantès setzte sich wieder, starrte vor sich hin. Kurz darauf kam der Wärter mit vier Soldaten zurück. Sie brachten Dantès ein Stockwerk tiefer, „zu den Narren“. Dantès wehrte sich nicht. Er wurde in eine Zelle gesperrt, tastete sich zur Wand und blieb in einer Ecke sitzen. Langsam gewöhnten sich seine Augen an das Dunkel. Der Wärter hatte recht: Viel fehlte nicht und Dantès würde den Verstand verlieren.
Der Verlobungsabend
Villefort kehrte nach dem Verhör von Dantès zu seiner Verlobungsfeier zurück, wirkte aber abwesend und verabschiedete sich bald. Draußen erwartete ihn Mercedes, die ihn verzweifelt nach Edmond fragte. Villefort erkannte sie sofort. Ihre Schönheit und Würde beeindruckten ihn. Als sie bat, wenigstens zu erfahren, ob Edmond lebte, antwortete er ausweichend: „Ich weiß es nicht.“ Dann floh er in seine Kutsche, verfolgt von Gewissensbissen über die Verurteilung eines Unschuldigen.
Mercedes kehrte in tiefer Verzweiflung nach Hause zurück. Fernand folgte ihr, kniete an ihrem Bett und küsste ihre Hand, doch sie reagierte nicht. Die ganze Nacht blieb sie regungslos, blind vor Schmerz, sah nur noch Edmond vor sich.
Auch Herr Morel gab die Hoffnung nicht auf. Er erfuhr, dass Dantès ins Gefängnis gekommen war und versuchte mit allen Mitteln, seine Freilassung zu erwirken. Doch das Gerücht, Dantès sei Bonapartist, verbreitete sich schnell. Morel stieß überall auf Ablehnung, Furcht und Schweigen. Er kehrte resigniert heim und erkannte: Die Situation war aussichtslos.
Caderousse war voller Unruhe, tat aber nichts für Dantès. Stattdessen trank er zwei Flaschen Wein, um seinen Kummer zu vergessen. Danglars dagegen freute sich: Er hatte seinen Rivalen ausgeschaltet und hoffte auf dessen Posten. Für ihn zählten nur Zahlen und Gewinn. Dantès’ Schicksal war ihm gleichgültig. Dantès’ Vater jedoch litt furchtbar unter dem Verlust seines Sohnes und war dem Tod nahe vor Schmerz und Sorge.
Der korsische Werwolf
Drei Tage nach Villeforts Abreise berichtete der Herzog von Blacas König Ludwig XVIII., dass Napoleon bald von Elba fliehen werde. Der König wollte ihm zunächst nicht glauben. Erst als der Herzog erwähnte, dass die Nachricht von Villefort stamme, ließ sich der König überzeugen, diesen zu empfangen.
Villefort berichtete, er habe keine gewöhnliche Verschwörung entdeckt, sondern eine wirkliche Gefahr für den Thron. Napoleon habe drei Schiffe bemannt und wolle bald landen. Villefort stützte sich dabei auf das Verhör eines verdächtigen Seemanns aus Marseille. Dieser habe eine Botschaft vom Großmarschall überbracht: Man solle sich auf die baldige Rückkehr Napoleons vorbereiten.
Der König versuchte, die Gefahr zu relativieren. Er meinte, Bonaparte werde bei jeder Landung sofort auf Widerstand stoßen. Frankreich sei gewappnet. Villefort solle sich keine Sorgen machen, könne aber auf königliche Dankbarkeit zählen.
In diesem Moment trat Polizeiminister Dandré ein – bleich, zitternd, verstört. Der König forderte ihn auf, zu sprechen. Da gestand Dandré verzweifelt: Napoleon habe Elba bereits am 26. Februar verlassen und sei am 1. März in Frankreich gelandet.
„In Frankreich?!“ rief der König entsetzt. „Und Sie erfahren das erst heute?“ Wütend und schockiert warf Ludwig XVIII. dem Minister vor, entweder getäuscht worden zu sein oder unfähig zu sein. Dann rief er fassungslos: „Der Usurpator ist in Frankreich!“
Oh! Sire! rief der Herzog von Blacas, einen Mann wie Herrn Dandré kann man nicht des Verrats anklagen. Wir waren alle blind und der Polizeiminister teilte nur diese Blindheit.
Aber … sprach Villefort, dann innehaltend. Vergebung, Sire! Mein Eifer reißt mich fort. Eure Majestät wolle mir verzeihen.
Sprechen Sie offen, sagte Ludwig XVIII. Sie allein haben das Übel vorhergesehen. Helfen Sie mir, ein Mittel zu finden.
Sire, der Usurpator ist im Süden verhasst. Man kann die Provence leicht gegen ihn aufbringen.
Aber wenn er durch Gap und Sisteron vorrückt? warf der Minister ein.
Er rückt also gegen Paris vor! rief der König erschrocken.
„Und die Dauphiné?“, fragte Ludwig XVIII. Kann man sie zur Erhebung bringen?
„Sire, leider nein. Die Bergbewohner sind Bonapartisten.“
„Wie viele Männer hat er?“, fragte der König.
„Sire, ich weiß es nicht“, sagte Dandré.
„Wie? Sie haben keine Erkundigungen eingeholt?“
„Sire, die Depesche meldet nur seine Landung und die eingeschlagene Richtung.“
Ludwig XVIII. kreuzte die Arme. „Also sieben Heere haben diesen Mann gestürzt und nun soll ich wieder gestürzt werden? Ich will lieber wie mein Bruder aufs Schafott steigen, als so gedemütigt zu werden.“
Er wandte sich an Villefort. „Kommen Sie her und sagen Sie diesen Herren, dass man alles hätte wissen können!“
„Sire, es war unmöglich“, erwiderte Villefort. „Ich hatte nur Glück.“
„Unmöglich? Für einen Minister mit all seinen Mitteln? Hier steht ein einfacher Beamter, der mehr wusste!“
Villefort neigte bescheiden das Haupt. „Sire, bewilligen Sie mir nicht mehr, als ich verdiene. Ich habe nur einen Zufall genutzt.“
Der Polizeiminister bedankte sich wortlos bei Villefort, der erkannte, dass er einen nützlichen Verbündeten gewonnen hatte.
„Es ist gut“, sagte der König. „Meine Herren, Sie können sich entfernen.“
Blacas versicherte: „Zum Glück, Sire, können wir auf die Armee zählen.“
„Sprechen Sie mir nicht von Berichten!“, entgegnete der König. Dann wandte er sich an Villefort: „Ruhen Sie sich aus! Ich werde Ihre Dienste nicht vergessen.“
„Sire, Eure Güte übersteigt all meine Wünsche“, sagte Villefort gerührt.
Der König nahm das Kreuz der Ehrenlegion und überreichte es ihm. Villefort nahm es mit Tränen der Freude und küsste es.
„Und nun“, fragte er, „mit welchen Befehlen beehrt mich Eure Majestät?“
„Gönnen Sie sich Ruhe“, sagte der König. „In Marseille können Sie mir am nützlichsten sein.“
„Sire, in einer Stunde werde ich Paris verlassen.“
„Gehen Sie und scheuen Sie sich nicht, mich an Ihren Namen zu erinnern.“
Vor den Tuilerien sagte der Minister: „Ihr Glück ist gemacht.“
„Auf wie lange?“, murmelte Villefort.
Zuhause angekommen, bestellte er Pferde, frühstückte, doch wurde er gestört. Ein unbekannter Besucher wurde gemeldet – mittleren Alters, schwarzes Haar, mit dem Ehrenlegionsorden.
„Er ist es“, murmelte Villefort.
Der Mann trat ein: „Was für Umstände! Ist es hier Sitte, Väter warten zu lassen?“
„Mein Vater! Ich täuschte mich also nicht.“
„Wenn du es vermutetest, Gérard, war das Warten lassen wenig höflich.“
„Lasse uns allein, Germain“, sagte Villefort.
Vater und Sohn
Herr Noirtier schloss sorgfältig alle Türen, bevor er Villefort die Hand reichte. „Du wirkst nicht gerade begeistert, mich zu sehen“, sagte er lächelnd.
„Doch, Vater, aber ich habe Ihren Besuch wirklich nicht erwartet.“
„Interessant, du schreibst mir von deiner Verlobung am 28. Februar und bist am 3. März in Paris.“
„Ich bin Ihretwegen hier“, sagte Villefort ernst. „Meine Reise könnte Sie retten.“
„Wirklich? Das klingt spannend. Erzähl mir mehr.“
„Vater, Sie kennen den bonapartistischen Klub in der Rue Saint-Jacques?“
„Nummer 53? Ich bin Vizepräsident.“
„Sie lassen mich schaudern.“
„Ach, Gérard, wenn man wie ich einst von Robespierre verfolgt wurde, fürchtet man nichts mehr. Was ist mit dem Klub?“
„General Quesnel wurde eingeladen und zwei Tage später fand man ihn tot in der Seine.“
„Dann will ich dir auch eine Neuigkeit sagen: Der Kaiser ist gelandet.“
„Still, Vater! Ich wusste es schon vorher – durch einen Brief an Sie. Ich habe ihn abgefangen und verbrannt. Hätte ihn jemand anders gefunden, wären Sie vielleicht erschossen worden.“
„Erschossen? Du übertreibst. Wo ist der Brief jetzt?“
„Verbrannt. Er bedeutete Ihre Verurteilung.“
„Und den Verlust deiner Karriere“, sagte Noirtier kühl. „Aber da du mich beschützt, bin ich wohl sicher.“
„Ich rette Sie!“
„Wird ja immer dramatischer. Weiter!“
„Die Polizei ist dem Klub auf der Spur. Quesnel wurde getötet – das ist Mord!“
„Beweise gibt es keine. Vielleicht war es ein Unfall.“
„Vater, Sie wissen, er wurde ermordet.“
„In der Politik gibt es keine Menschen, nur Interessen. Man beseitigt Hindernisse. Er war ein Royalist, also ließ man ihn gehen. Und er kehrte nie zurück.“
„Das ist Mord!“
„Du siehst das zu juristisch.“
„Aber Vater, seien Sie vorsichtig. Unsere Vergeltung wird furchtbar sein!“
„Ich verstehe dich nicht.“
„Sie glauben an die Rückkehr des Usurpators? Er wird keine sechs Meilen weit kommen, ohne gefasst zu werden.“
„Lieber Freund, der Kaiser ist auf dem Weg nach Grenoble. Am 10. oder 12. ist er in Lyon, am 20. in Paris.“
„Die Bevölkerung wird sich erheben!“
„Um ihn zu begrüßen.“
„Er hat nur ein paar Männer bei sich – man wird Heere schicken!“
„Die ihn in die Hauptstadt begleiten werden.“
„Grenoble wird ihn stoppen!“
„Grenoble wird ihm jubelnd die Tore öffnen. Lyon ebenso. Unsere Polizei ist nicht schlechter als eure.“
„Wie gut informiert Sie sind, überrascht mich“, sagte Villefort.
„Ganz einfach. Ihr habt Geld, wir haben treue Freunde. Du hast deine Ankunft geheim gehalten, doch ich wusste eine halbe Stunde nach deiner Ankunft Bescheid.“
„Also gut. Aber noch eine Frage: Unsere Polizei kennt das Signalement des Mannes, der zuletzt bei Quesnel war.“
„Und wie lautet es?“
„Braune Haut, schwarze Haare und Augen, blauer Rock, Ordensrosette, breiter Hut, Rohrstock.“
„Und warum wurde er nicht verhaftet?“
„Weil man ihn an der Rue Coq-Héron aus den Augen verloren hat.“
„Dann ist eure Polizei also doch nicht so gut“, spottete Noirtier und begann sich zu verkleiden. Er rasierte sich, band sich eine neue Krawatte, zog Villeforts braunen Rock an und tauschte Stock und Hut.
„Und, erkennt man mich noch?“ fragte er triumphierend.
„Ich hoffe nicht, Vater.“
„Du hast mir das Leben gerettet. Ich werde es dir vergelten. Willst du als Prophet gelten, dann sag dem König: Die Soldaten des Usurpators mehren sich wie Schneeflocken und er marschiert wie der Adler. Sire, fliehen Sie! Und du, Gérard, rühme dich nicht. Fahr sofort nach Marseille zurück, halte dich verborgen. Diesmal kennen wir unsere Feinde. Und wenn sich das politische Gleichgewicht wieder wendet, kannst du mich vielleicht erneut retten.“
Mit diesen Worten ging Noirtier ruhig hinaus. Villefort sah ihm bleich nach. Eine halbe Stunde später reiste er nach Marseille ab – und hörte unterwegs, dass Napoleon in Grenoble eingezogen war.
Die hundert Tage
Herr Noirtier war ein guter Prophet gewesen. Napoleons Rückkehr verlief genauso, wie er es vorhergesagt hatte. Die Monarchie fiel bei der bloßen Ankunft des Kaisers zusammen.
Für Villefort wurde die einst so wertvolle Gunst des Königs nun gefährlich. Ohne Noirtier, der bei Hofe großen Einfluss hatte, wäre er entlassen worden. Villefort blieb im Amt. Seine Hochzeit wurde auf bessere Zeiten verschoben. Er war der wichtigste Richter in Marseille. Eines Morgens erschien Herr Morel. Er war gekommen, überzeugt, Villefort sei verzweifelt – doch fand er ihn kalt, ruhig und unnahbar.
Villefort blickte ihn schweigend an, dann sagte er: „Herr Morel, wenn ich mich nicht täusche?“
„Ja, mein Herr“, antwortete der Reeder.
„Treten Sie näher. Was führt Sie zu mir?“
„Einige Tage vor der Landung des Kaisers bat ich Sie um Gnade für einen Seemann. Ich frage: Was wurde aus ihm?“
Villefort zwang sich zur Ruhe. „Wie heißt er?“
„Edmond Dantès.“
Villefort blätterte in seinen Unterlagen. „Ah, ja. Seemann. Er wurde verhaftet, dann fortgebracht. Eines Tages wird er zurückkommen.“
„Seine Stelle bleibt für ihn offen. Doch warum ist er noch nicht zurückgekehrt?“
„Die Freilassung muss von oben kommen. Napoleon ist erst vierzehn Tage zurück. Die Begnadigungen brauchen Zeit.“
„Gibt es keinen Weg, das zu beschleunigen?“
„Es gab keine Verurteilung. Bei politischen Gefangenen existieren oft nicht einmal Listen. Man lässt sie verschwinden.“
„Das ist zu allen Zeiten so, Herr Morel“, sagte Villefort. „Eine Regierung folgt der nächsten, aber alle sind gleich.“
„Was raten Sie mir also?“ fragte Morel.
„Nur eine Bittschrift an den Justizminister kann helfen.“
„Und Sie würden sie überbringen?“
„Gerne. Damals war er vielleicht schuldig – heute ist er unschuldig. Ich bin verpflichtet, ihm zu helfen. Setzen Sie sich.“
Villefort verfasste ein Schreiben, in dem er Dantès’ angebliche Verdienste für Napoleon betonte. Es sollte wirken, als wäre Dantès ein Held. Morel fragte: „Geht die Eingabe heute noch ab?“
„Noch heute“, sagte Villefort und fügte seine Zustimmung bei. Morel war erleichtert, glaubte an Dantès’ baldige Freilassung und versprach seinem Vater Hoffnung. Villefort aber schickte die Eingabe nie ab. Er behielt sie bei sich – Dantès blieb im Kerker.
Die hundert Tage vergingen, Napoleon fiel. Morel bat zweimal bei Villefort um Hilfe – vergeblich. Nach Waterloo gab er auf. Ludwig XVIII. kehrte zurück, Villefort ließ sich nach Toulouse versetzen und heiratete Mademoiselle von Saint-Méran.
Während Dantès im Gefängnis vergessen war, verließ Danglars aus Angst Marseille und ging nach Madrid. Fernand wusste nichts vom Schicksal seines Rivalen. Dann musste er einrücken. Mercedes verabschiedete ihn traurig. „Mein Bruder, lasst Euch nicht töten!“
Diese Worte gaben Fernand Hoffnung. Vielleicht würde sie doch einmal die Seine. Mercedes aber blieb allein.
Auch Caderousse wurde einberufen, aber nur zum Küstendienst. Der alte Dantès starb fünf Monate nach der Verhaftung seines Sohnes – in Mercedes’ Armen. Herr Morel bezahlte seine Beerdigung und seine Schulden. Es war mutig – denn im Süden galt schon die Hilfe für Dantès’ Vater als Verbrechen.
Der wütende Gefangene und der verrückte Gefangene
Etwa ein Jahr nach der Rückkehr Ludwigs XVIII. besuchte ein Generalinspektor das Kastell If. Er befragte die Gefangenen nach ihrer Nahrung und ihren Wünschen. Alle antworteten gleich: Das Essen sei schlecht und sie wollten frei sein.
„Was sollten sie sonst verlangen?“ sagte er zum Gouverneur. „Haben Sie noch andere Gefangene?“
„Nur gefährliche oder Wahnsinnige.“
„Zeigen Sie sie mir“, sagte der Inspektor.
Zwei Soldaten begleiteten sie eine stinkende Treppe hinab.
„Wer wohnt hier?“ fragte der Inspektor.
„Ein Meuterer, gefährlich und verzweifelt.“
„Ist er verrückt?“
„Schlimmer – ein Teufel“, antwortete der Wärter.
„Wollen Sie, dass ich Klage führe?“ fragte der Inspektor.
„Nicht nötig. Sein Zustand grenzt an Wahnsinn. Bald wird er verrückt sein.“
„Dann leidet er wenigstens nicht mehr“, meinte der Inspektor.
„In der Nachbarzelle sitzt ein alter Abbé. Früher weinte er – jetzt lacht er.“
Als Dantès das Geräusch hörte, erkannte er die seltene Gelegenheit und warf sich mit gefalteten Händen vor. Die Soldaten hielten ihn mit Bajonetten zurück. Der Inspektor erschrak. Dantès sprach mit bewegenden Worten, flehte um Gerechtigkeit, rief Gott als Zeugen an.
„Er beginnt, fromm zu werden“, sagte der Inspektor leise. Dann wandte er sich an Dantès: „Was verlangen Sie?“
„Einen Richter. Einen Prozess. Freiheit oder den Tod.“
„Und das Essen?“
„Unwichtig. Wichtig ist, dass kein Unschuldiger vergessen bleibt.“
„Heute sind Sie demütig“, sagte der Gouverneur. „Früher wollten Sie Ihren Wärter töten.“
„Ich bitte ihn um Verzeihung“, sagte Dantès. „Ich war wahnsinnig.“
„Und jetzt nicht mehr?“
„Nein, die Haft hat mich gebrochen. Ich bin hier seit dem 28. Februar 1815.“
„Heute ist der 30. Juli 1816“, sagte der Inspektor. „Erst siebzehn Monate.“
„Siebzehn Monate! Herr, Sie wissen nicht, was das bedeutet“, rief Dantès. „Für jemanden, der sein Glück vor Augen hatte, eine geliebte Frau heiraten wollte, eine glänzende Laufbahn begann – und dem alles genommen wurde! Haben Sie Erbarmen. Ich verlange keine Gnade, sondern ein Gericht. Ich fordere Richter!“
„Es ist gut“, sagte der Inspektor. „Ich will sehen, was ich tun kann.“
„Ich weiß, Sie können mich nicht selbst freilassen. Aber Sie könnten meine Bitte weiterleiten. Die Ungewissheit ist schlimmer als jede Strafe.“
„Das leuchtet mir ein“, antwortete der Inspektor.
„Oh Herr, darf ich hoffen?“, fragte Dantès mit zitternder Stimme.
„Ich verspreche nur, Ihre Akten zu prüfen.“
„Dann bin ich gerettet!“ rief Dantès. „Wer hat mich verhaften lassen? Villefort! Sprechen Sie mit ihm!“
„Er ist seit einem Jahr in Toulouse“, erklärte der Inspektor.
„Dann wundert mich nichts mehr“, murmelte Dantès.
„Hatte er einen Grund, Sie zu hassen?“
„Nein, er war freundlich.“
„Dann kann ich seinen Aussagen trauen?“
„Ja, Herr.“
„Gut. Warten Sie!“
Dantès kniete nieder und betete. Die Tür schloss sich, aber seine Hoffnung blieb bei ihm.
„Wer kommt jetzt?“ fragte der Inspektor.
„Ein Narr“, sagte der Gouverneur. „Er bietet jedes Jahr mehr Millionen für seine Freiheit.“
„Wie heißt er?“
„Abbé Faria.“
Der Inspektor trat ein. Faria lag in einem mit Kreide gezeichneten Kreis, in Lumpen. Als er die Besucher sah, erhob er sich schnell, hüllte sich in eine Decke und sagte: „Ich bin der Abbé Faria. Man verhaftete mich 1811. Sie haben mich bei einer wichtigen Berechnung gestört. Könnten wir unter vier Augen sprechen?“
„Unmöglich“, sagte der Inspektor.
„Wenn ich Ihnen fünf Millionen anbiete?“
„Sie hatten recht“, sagte der Inspektor zum Gouverneur.
„Natürlich geht es wieder um seinen Schatz“, lachte dieser.
Faria blickte ernst: „Worüber soll ich sonst sprechen? Wenn ich hier sterbe, ist das Geheimnis verloren. Ich biete sechs Millionen! Lassen Sie mich frei!“
„Auf mein Wort“, sagte der Inspektor halblaut, „man könnte ihn für glaubwürdig halten.“
„Ich bin kein Narr, Herr“, entgegnete Faria. „Der Schatz existiert wirklich. Führen Sie mich an den Ort, graben Sie nach. Wenn ich gelogen habe, sperren Sie mich wieder hier ein.“
Der Gouverneur lachte: „Wenn jeder Gefangene seine Wächter auf Schatzsuche schickte, wären wir bald alle auf der Flucht.“
„Schwören Sie mir bei Christus, dass Sie mich freilassen, wenn der Schatz existiert und ich verrate Ihnen alles“, bat Faria.
Der Inspektor wich aus: „Sind Sie mit dem Essen zufrieden?“
„Fort mit Ihnen!“ rief der Abbé wütend. „Sie glauben mir nicht? Behalten Sie Ihr Mitleid! Gott wird mich befreien!“
Er setzte sich zurück in seinen Kreis. Die Tür schloss sich hinter ihnen.
„Vielleicht hatte er wirklich mal Geld“, sagte der Inspektor.
„Oder er träumte davon“, erwiderte der Gouverneur.
„Wenn er reich wäre, säße er wohl kaum hier“, meinte der Inspektor.
Der Inspektor ließ sich die Gefangenenliste zeigen. Dort stand: „Edmond Dantès – gefährlicher Bonapartist, nahm an Elba-Rückkehr teil. Geheim halten.“
Der Inspektor schrieb nur: „Nichts zu machen.“
Doch für Dantès begann eine neue Zeitrechnung. Am 30. Juli 1816 schrieb er das Datum an die Wand und markierte von da an jeden Tag.
Vierzehn Tage, zwei Monate, sechs Monate vergingen. Nichts geschah. Nach zehn Monaten ohne Antwort zweifelte er an sich selbst.
Ein Jahr später wurde der Gouverneur ersetzt. Der neue wollte keine Namen wissen, nur Nummern. Dantès verlor auch seine Identität. Er war jetzt nur noch: Nummer 34.
Nummer 34 und Nummer 27
Dantès durchlief alle Stadien des Unglücks. Zuerst trug ihn sein Stolz, genährt durch die Hoffnung und sein reines Gewissen. Dann begann er, an seiner Unschuld zu zweifeln. Von Stolz blieb bald nichts übrig – er flehte nicht mehr zu Gott, sondern zu den Menschen. Er bat darum, verlegt zu werden, selbst in einen schlimmeren Kerker. Hauptsache, es geschah etwas.
Selbst den stummen Wärter sprach er an, nur um seine eigene Stimme zu hören. Doch bald genügte auch das nicht mehr. Er bat sogar um Gesellschaft – selbst den „verrückten Abbé“. Auch das wurde abgelehnt.
Als alle menschliche Hoffnung vergeblich blieb, wandte er sich Gott zu. Doch seine Gebete waren nicht demütig, sondern leidenschaftlich. Er betete laut, verzückte sich an jedem Wort, bezog sein ganzes Leben auf göttliche Lehren. Und immer schlich sich ein Wunsch ein: Freiheit.
Doch nichts geschah. Und Dantès geriet in Wut. Seine religiöse Glut schlug um in Raserei. Er fluchte, tobte, warf sich gegen die Mauern, wurde wahnsinnig vor Hass. Die Schuld lag für ihn bei den Menschen, nicht bei Gott.
So kam er auf einen letzten Ausweg: den Tod. Der Gedanke an Selbstmord fasste Wurzeln. Doch hängen wollte er sich nicht – zu entehrend. Also wählte er das Hungern. Er begann sofort. Jetzt war sein einziger Plan: sterben. Und niemand sollte es merken. Wenn die Wärter das Essen brachten, würde er es heimlich zum Fenster hinauswerfen.
Dantès hielt an seinem Schwur fest: Zweimal täglich warf er das Essen aus dem vergitterten Fenster. Anfangs tat er es entschlossen, dann zögernd, zuletzt mit Bedauern. Der Hunger machte selbst das verdorbene Fleisch, den stinkenden Fisch und das schimmelige Brot begehrenswert. Manchmal hielt er das Tablett lange in der Hand und starrte auf die Speisen, bevor er sich überwand, sie wegzuwerfen. Doch er blieb standhaft – er wollte lieber sterben, als sein Wort zu brechen.
Bald war er so schwach, dass er das Essen nicht mehr aus dem Fenster werfen konnte. Er sah nichts mehr, sein Gehör ließ nach. Der Kerkermeister glaubte an eine Krankheit, Dantès aber hoffte auf den Tod. Er sah tanzende Lichter, fühlte sich fast wohl. Es war, als stünde er kurz vor dem Sterben.
Doch dann hörte er ein Kratzen an der Wand. Anfangs glaubte er an Ratten, doch das Geräusch war zu kräftig. Etwas oder jemand arbeitete an der Wand. Dantès’ Herz schlug schneller – vielleicht war das ein Zeichen Gottes, ein letztes Wunder vor dem Tod?
Er lauschte mit neuer Hoffnung. Das Geräusch dauerte stundenlang, verstummte und begann später erneut. Da betrat der Wärter den Kerker. Aus Angst, dieser könne etwas bemerken und eingreifen, redete Dantès ihn absichtlich wirr und laut an – über das Essen, die Kälte, seine Beschwerden. Der Wärter glaubte an Fieber, ließ die mitgebrachte Fleischbrühe stehen und ging.
Sofort horchte Dantès weiter. Das Kratzen war nun deutlich zu hören. "Es ist ein anderer Gefangener", dachte er, "jemand wie ich, der sich befreien will." Dann zweifelte er wieder. Vielleicht waren es nur Bauarbeiten?
Er wusste: Wenn er Klarheit wollte, musste er wachsam bleiben. Er blickte auf die dampfende Brühe, schleppte sich zum Tisch, setzte die Tasse an die Lippen – und spürte ein unbeschreibliches Wohlgefühl.
Dantès hatte wieder Kraft und Klarheit gewonnen. Er beschloss, vorsichtig herauszufinden, ob das Geräusch an der Wand von einem Arbeiter oder einem Mitgefangenen stammte. Er schlug dreimal gegen die Mauer. Sofort verstummte das Kratzen. Stundenlang blieb es still – ein deutliches Zeichen, dass es kein Arbeiter war, sondern ein Gefangener. Dantès war voller Freude. Sein Lebenswille kehrte zurück.
Am nächsten Tag lauschte er vergeblich. Das Geräusch blieb aus. Er aß gierig, lief in seinem Kerker auf und ab, schüttelte die Gitter, um wieder Kraft in seinen Körper zu bringen. Drei Tage lang wartete er, zählte jede Minute. Endlich, eines Abends, spürte er eine Erschütterung in der Wand. Diesmal war es eindeutig – jemand arbeitete auf der anderen Seite mit einem stumpferen Werkzeug.
Dantès wollte helfen. Er rückte sein Bett beiseite und suchte nach einem Werkzeug, um den Mörtel zu lösen. Doch in seiner Zelle fand sich nichts Nützliches. Schließlich zerbrach er seinen Wasserkrug und versteckte einige spitze Scherben im Strohsack. Damit begann er noch in derselben Nacht zu kratzen, doch es ging kaum voran – der Sandstein war härter als gedacht.
Am nächsten Morgen erklärte er dem Wärter, der Krug sei ihm aus der Hand gefallen. Der Wärter holte wortlos einen neuen. Sobald er gegangen war, begann Dantès erneut zu kratzen. Im Licht sah er nun, dass er die Nacht über an der falschen Stelle gekratzt hatte – er hatte den Stein selbst bearbeitet statt des brüchigen Kalks rundherum.
Erneut machte er sich an die Arbeit. Der Kalk war vom feuchten Klima mürbe geworden, ließ sich lösen. Bald hatte Dantès eine Handvoll entfernt. Er wusste, dass man in zwei Jahren, ohne auf Felsen zu stoßen, auf diese Weise einen Tunnel von zwanzig Fuß graben könnte. Doch für ihn zählte nicht die Dauer – allein der Gedanke an einen Weg nach draußen gab ihm neue Hoffnung und neue Kraft.
Dantès ärgerte sich, dass er so viele Jahre in Hoffnung und Verzweiflung verloren hatte. In drei Tagen entfernte er vorsichtig den Mörtel und legte einen behauenen Stein frei. Doch seine Fingernägel reichten nicht aus und die Scherben zerbrachen beim Versuch, den Stein zu lockern. Verzweifelt fragte er sich: Sollte ich schon jetzt aufgeben?
Die Suppe erhielt Dantès täglich in einer Kasserolle mit eisernem Stiel – ein wertvolles Werkzeug. Er stellte absichtlich seinen Teller in den Weg. Als der Wärter eintrat, zertrat er ihn. Dantès sagte: „Lassen Sie die Kasserolle hier. Sie können sie morgen beim Frühstück wieder mitnehmen.“ Der Wärter ließ sie stehen.
Dantès wartete eine Stunde, dann benutzte er den Stiel als Hebel. Nach einer Stunde löste sich der Stein, eine Vertiefung von über einem Fuß blieb zurück. Er versteckte den Kalk und bedeckte ihn mit Erde. Die ganze Nacht grub er weiter. Am Morgen setzte er den Stein zurück, stellte das Bett davor und legte sich hin.
Der Wärter brachte nur ein Stück Brot. Dantès fragte: „Wie, Sie bringen mir keinen neuen Teller?“ Der Wärter antwortete: „Nein, bei Ihnen wird alles zerbrochen. Sie behalten die Kasserolle. Dann zerbrechen Sie wenigstens kein Geschirr mehr.“
Dantès schlug die Augen zum Himmel und faltete die Hände. Dieses Stück Eisen bedeutete ihm mehr als alle früheren Gaben seines Lebens. Doch er merkte: Seit er arbeitete, war das Geräusch auf der anderen Seite verstummt. „Ganz gleich“, dachte er, „kommt mein Nachbar nicht zu mir, gehe ich zu ihm.“
Er arbeitete unermüdlich weiter. Am Abend hatte er schon zehn Hände voll Mörtel und Steine entfernt.
Dantès stellte die Kasserolle an ihren Platz. Der Wärter füllte sie mit Suppe und ging. Dantès horchte – aber alles blieb still. Offenbar traute ihm sein Nachbar nicht mehr. Doch Dantès arbeitete weiter. Nach wenigen Stunden stieß er auf ein Hindernis. Das Eisen rutschte ab – ein dicker Balken versperrte den Weg.
Verzweifelt rief er: „Oh! mein Gott, mein Gott! Habe Mitleid mit mir und lasse mich nicht in Verzweiflung sterben!“
Da erklang plötzlich eine Stimme: „Wer spricht zugleich von Gott und von Verzweiflung?“ Dantès wich erschrocken zurück. „Ich höre einen Menschen sprechen“, flüsterte er. Dann rief er: „Im Namen des Himmels, sprechen Sie weiter! Wer sind Sie?“
„Wer sind Sie selbst?“
„Ein unglücklicher Gefangener.“
„Ihr Name?“
„Edmond Dantès.“
„Wie lange sind Sie hier?“
„Seit dem 28. Februar 1815.“
„Ihr Verbrechen?“
„Ich bin unschuldig. Man beschuldigt mich, für die Rückkehr des Kaisers konspiriert zu haben.“
„Der Kaiser ist also nicht mehr auf dem Thron?“
„Er wurde 1814 verbannt. Und Sie – wie lange sitzen Sie schon?“
„Seit 1811.“
„Graben Sie nicht mehr! Wo ist Ihre Öffnung?“
„Bodennah, hinter meinem Bett.“
„Dann habe ich mich geirrt … Ich hielt diese Wand für die der Zitadelle. Ich wollte ans Meer gelangen.“
„Stopfen Sie Ihr Loch. Warten Sie auf Nachricht.“
„Wer sind Sie?“
„Ich bin Nummer 27.“
„Ich bin ein guter Christ!“, rief Dantès. „Aber bitte, lassen Sie mich Ihre Stimme hören, sonst zerschmettere ich mir den Schädel an der Wand!“





























