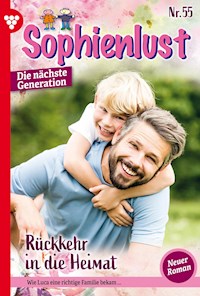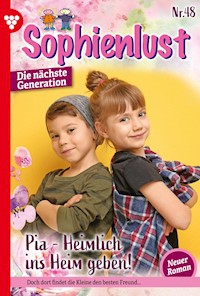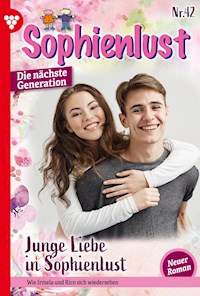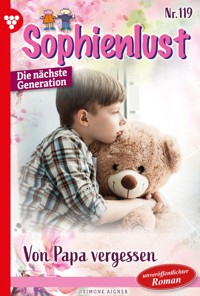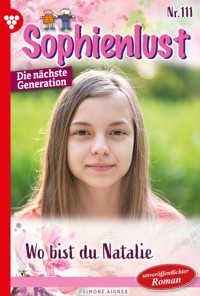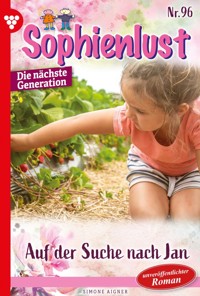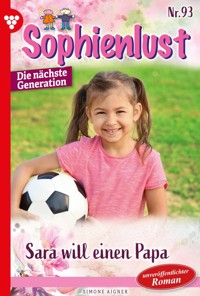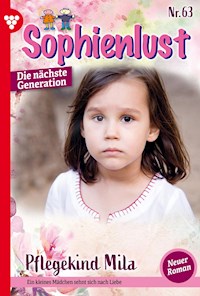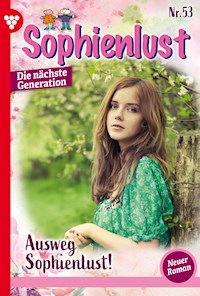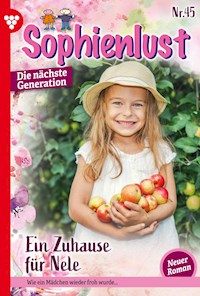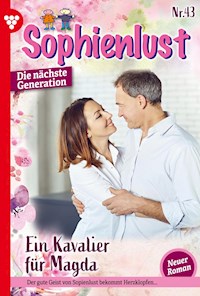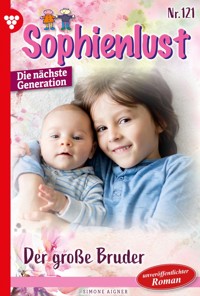
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust - Die nächste Generation
- Sprache: Deutsch
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie wird die von allen bewunderte Denise Schoenecker als Leiterin des Kinderheims noch weiter in den Mittelpunkt gerückt. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. Günter Altmann trug vorsichtig das Tablett mit Tee und Gebäck ins Wohnzimmer, wo seine Tochter Stella auf dem Sofa saß. Seine Schritte waren ungelenk. Die Hüfte machte ihm immer mehr zu schaffen. Behutsam stellte er das Tablett ab. »Danke, Papa.« Stella half ihm, die beiden Teetassen, die Teekanne und die Schale mit den Keksen auf den Tisch zu stellen. »Gerne. Ich freue mich doch, dass ihr mich besucht«, sagte Altmann. Achtsam setzte er sich seiner Tochter gegenüber in seinen Lieblingssessel. Neben Stella lag, seitlich abgestützt von ein paar Kissen, die kleine Amelia, die gerade sechs Monate alt war, und schlief. Linus, ihr großer Bruder, hatte sich bäuchlings auf dem Teppich ausgestreckt. Er war mit einem Ausmalbuch und den neuen Buntstiften beschäftigt, mit denen Günter Altmann seinen Enkel überrascht hatte. Neben dem Jungen stand ein Tetrapack mit Kirschsaft, in dem ein Strohhalm steckte. »Linus, magst du einen Keks?«, fragte der alte Herr jetzt seinen Enkel. »Später«, versicherte der Junge, ohne aufzusehen und malte eifrig weiter die Bauernhof-Szene aus. Altmann musste lächeln. Der Kuh hatte Linus orangefarbenes Fell verpasst, das Huhn war lila geworden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust - Die nächste Generation – 121 –Der große Bruder
Unveröffentlichter Roman
Simone Aigner
Günter Altmann trug vorsichtig das Tablett mit Tee und Gebäck ins Wohnzimmer, wo seine Tochter Stella auf dem Sofa saß. Seine Schritte waren ungelenk. Die Hüfte machte ihm immer mehr zu schaffen.
Behutsam stellte er das Tablett ab.
»Danke, Papa.« Stella half ihm, die beiden Teetassen, die Teekanne und die Schale mit den Keksen auf den Tisch zu stellen.
»Gerne. Ich freue mich doch, dass ihr mich besucht«, sagte Altmann.
Achtsam setzte er sich seiner Tochter gegenüber in seinen Lieblingssessel. Neben Stella lag, seitlich abgestützt von ein paar Kissen, die kleine Amelia, die gerade sechs Monate alt war, und schlief.
Linus, ihr großer Bruder, hatte sich bäuchlings auf dem Teppich ausgestreckt. Er war mit einem Ausmalbuch und den neuen Buntstiften beschäftigt, mit denen Günter Altmann seinen Enkel überrascht hatte. Neben dem Jungen stand ein Tetrapack mit Kirschsaft, in dem ein Strohhalm steckte.
»Linus, magst du einen Keks?«, fragte der alte Herr jetzt seinen Enkel.
»Später«, versicherte der Junge, ohne aufzusehen und malte eifrig weiter die Bauernhof-Szene aus. Altmann musste lächeln. Der Kuh hatte Linus orangefarbenes Fell verpasst, das Huhn war lila geworden. Eben setzte der Kleine an, mit einem blauen Stift das Schwein auszumalen.
»Er hat Fantasie«, sagte Altmann und wandte sich, noch immer schmunzelnd, seiner Tochter zu. Stella lächelte zurück. Dass ihr das nicht leicht fiel, sah er ihr an. Sein Lächeln fiel in sich zusammen.
»Es geht dir nicht gut«, stellte er fest. Augenblicklich füllten sich Stellas Augen mit Tränen. Hastig legte sie den Finger an die Lippen, zum Zeichen, dass er zu dem Thema nichts weiter sagen sollte, und sah zu ihrem Sohn.
Altmann nickte bedächtig. Es war klar, dass er in Gegenwart des Kindes nicht über den verständlichen Kummer seiner Tochter sprechen konnte. Und doch musste er ihr ins Gewissen reden. Seit sein Schwiegersohn Niklas kurz nach der Geburt von Amelia bei einem Unfall verstorben war, ging es Stella schlechter und schlechter, statt sich allmählich zu fangen.
Ein Wunder war das nicht. Stella und Niklas waren sehr glücklich gewesen und dieses Glück war von einem Moment zum anderen zersprengt worden. Schuld war ein Jugendlicher, der den Führerschein noch nicht lange hatte. Er hatte bei Neuschnee seine Fahrfähigkeiten falsch eingeschätzt und Niklas, der als Fußgänger unterwegs gewesen war, überfahren.
Altmann war der Ansicht, Stella brauchte einen Arzt. Längst fürchtete er, sie könnte auf dem Weg in eine Depression sein, dauerhaft niedergeschlagen wie sie war. Zudem schlief sie schlecht, aß wenig und grübelte ununterbrochen.
Sozialkontakte hatte sie mittlerweile auch kaum noch, soweit er das beurteilen konnte. Wenn er sie darauf ansprach, sagte sie stets, dass ihr Besuche oder Unternehmungen jedweder Art, derzeit zu viel waren.
Zu gerne hätte er sie bei der Betreuung der Kinder unterstützt, doch seine Möglichkeiten waren eingeschränkt. Linus war ein lebhafter Junge. Er brauchte jemanden, der mit ihm auf den Spielplatz ging oder im Garten Fußball spielte. Jemanden, der ihm das Radfahren beibrachte oder im Herbst Drachen steigen ließ. All das ließ seine kaputte Hüfte nicht zu. Er hatte beständig Schmerzen, auch nachts, trotz aller Medikamente. Auch Physiotherapie hatte nur bedingt geholfen.
Den Kleinen im Haus beschäftigen oder alleine in den Garten zu schicken, war keine Lösung. Und da war ja auch noch Amelia. Oft genug musste das Baby herumgetragen werden, wenn es weinte. Mit seiner Hüfte wäre das schon unter fahrlässig gefallen. Am Ende wurde der Schmerz unerwartet so schlimm, dass er mit dem Kind auf dem Arm stürzte. Das mochte er sich gar nicht vorstellen.
Stella putzte sich die Nase.
»Wann hast du denn jetzt deinen OP-Termin?«, fragte sie, als hätte sie seine Gedanken gelesen.
»Erst in vier Wochen«, gab Altmann zu.
»Hast du das nicht schon vor einem Monat gesagt?« Stella steckte ihr Taschentuch wieder ein.
»Vor zwei Wochen. Die sind in der Klinik im Moment total überlastet. Es sind wohl ein paar Ärzte ausgefallen«, erklärte er.
»Das tut mir leid, Papa. Ich sehe doch, dass du starke Schmerzen hast«, sagte Stella.
»Ach, so schlimm ist es gar nicht«, schwindelte Altmann. »Mir tut es nur leid, dass ich dir gerade jetzt so wenig helfen kann.« Und nach der Operation würde es auch dauern, bis er wieder voll einsatzfähig war. Etwa zehn Tage musste er im Krankenhaus bleiben, sechs Wochen lang durfte er nicht Autofahren und eine Rehabilitationsmaßnahme schloss sich dem Eingriff auch noch an. Alles in allem würde er etwa drei oder auch vier Monate mit sich selbst beschäftigt sein. Mindestens.
»Ich komm schon klar«, versicherte Stella. Sie nippte an ihrem Tee und Altmann sah, dass ihre Hand zitterte. Seine Tochter sah mager und bleich aus, hatte eingefallene Wangen und ihre Augen hatten jeden Glanz verloren. Ihr verzweifelter Zustand machte ihn ganz fertig.
Sowie die Kinder heute Abend im Bett lagen und schliefen, würde er mit ihr telefonieren und all das sagen, was er im Moment nicht aussprechen durfte, weil Klein-Linus zuhörte. Er würde Stella eine Nachricht schicken, und bitten, dass sie ihn anrief. Nicht, dass er mit dem Läuten des Telefons die Kinder weckte.
Zwei Stunden später verabschiedete er seine Tochter und seine Enkel. Amelia quengelte, sie hatte wohl Hunger.
»Kommt gut nach Hause«, sagte Altmann, strich Linus über den Rücken, der sein neues Malbuch und die Buntstifte gegen den Bauch gedrückt hielt, spielte kurz mit den Fingerchen des Babys, das Stella im Arm trug und umarmte seine Tochter.
»Lass uns später noch einmal telefonieren«, bat er.
»In Ordnung. Bis später, Papa«, verabschiedete Stella sich.
Altmann sah ihr und ihren Kindern nach, wie sie durch den Vorgarten zum Auto gingen. Weit hatten sie es nicht, bis nach Hause. In wenigen Minuten würden sie dort sein. Sein Herz war schwer. Das Leid seiner Tochter war auch sein Leid. Er hoffte so sehr, dass er sie überzeugen konnte, Hilfe anzunehmen.
Er schloss die Haustür und ging ins Wohnzimmer, um den Tisch wieder abzuräumen.
*
Stella schloss leise die Tür von Amelias Zimmer. Endlich schlief die Kleine. Lange genug hatte es wieder einmal gedauert. Sie lugte noch einmal in Linus‘ Zimmer. Ihr Sohn lag, die Beine an den Bauch gezogen, in seinem Bett. Die kleine Nachttischlampe tauchte den Raum in warmes Licht.
Linus‘ Augen waren geschlossen, sein Mund stand ein Stückchen offen. Das Kinderbuch, das er angesehen hatte, war ihm aus der Hand gefallen und lag neben seinem Kissen.
Leise ging Stella zu ihrem Jungen. Sie legte das Buch auf den Nachtschrank, löschte die Nachttischlampe, und verließ den Raum.
Ihr Mobiltelefon, das sie im Wohnzimmer an das Ladekabel gehängt hatte, meldete den Eingang einer Nachricht. Stella steckte das Handy vom Kabel ab und rief die Nachricht auf. Sie war von ihrem Vater.
»Schlafen die Kinder? Rufst du mich bitte an?«, schrieb er.
Stella klickte auf ›Teilnehmer anrufen‹, schloss die Wohnzimmertür und setzte sich auf das Sofa.
»Stella. Das ging ja schnell«, meldete sich ihr Vater, kaum dass der Ruf durchgegangen war.
»Ja. Du hast den richtigen Moment erwischt. Beide schlafen«, sagte sie, zog die Beine an und lehnte sich rücklings gegen das Polster. »Was drückt dich denn? Kann ich etwas für dich tun?«, fragte sie.
»Gar nicht, Stella. Im Gegenteil. Ich möchte dich bitten, dass du etwas für dich tust«, sagte er. In Stella ging etwas auf Abwehr. Sie ahnte, worauf ihr Vater anspielte.
»Wenn du wieder darauf hinaus willst, dass ich mir Hilfe holen soll … darüber haben wir schon gesprochen«, bemühte sie sich, im Keim zu ersticken, was sie nur als anstrengend empfand. »Niklas‘ Eltern leben in Spanien und Samantha, die früher ab und an auf Linus aufgepasst hat, hat inzwischen Abitur und studiert in Stuttgart. Abgesehen davon, dass sie inzwischen bestimmt nicht mehr für ein Taschengeld käme, so wie damals. Ich habe einfach niemanden, der die Kinder stundenweise nimmt, damit ich …« Sie brach ab. Damit sie was? Mal an sich denken konnte? Das wollte sie gar nicht. Was hätte sie denn mit der Zeit für sich anfangen wollen? Ihr fehlte für alles und jedes die Kraft. Nicht einmal mit ihrer ehemaligen Kollegin Petra traf sie sich noch, mit der sie seit ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin befreundet war.
»…damit ich entlastet bin«, schloss sie ihren Satz. Abgesehen davon zogen andere Mütter auch zwei Kinder alleine groß. Viele gingen zusätzlich sogar arbeiten. Doch das konnte sie im Moment noch nicht. Amelia war noch zu klein.
»Das wollte ich gar nicht sagen«, sprach ihr Vater sanft.
»Was denn dann?« Schon wieder spürte sie die Tränen. »Eine bezahlte Kraft kann ich mir nicht leisten.«
»Du brauchst Hilfe, mein Mädchen. Ich habe wirklich Angst um dich. Du musst zum Arzt.«
»Zum Arzt?« Stella hangelte nach dem Päckchen Taschentücher, das auf dem Tisch lag und nestelte eines heraus. »Was soll ich denn da?«
»Du bist krank, Stella. Krank vor Kummer. Du isst nicht, du schläfst nicht und du grübelst ständig. Das hast du mir selber gesagt«, wies er sie auf Tatsachen hin.
»Und? Wie soll mir ein Arzt da helfen?«, stieß sie hervor und beherrschte mühsam das aufsteigende Schluchzen.
»Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Vielleicht kann er dir ein leichtes Beruhigungsmittel aufschreiben, damit du wieder schlafen kannst. Und etwas zur Appetitanregung. Vielleicht auch … eine Fachkraft, mit der du reden kannst. Ich meine, wegen der Sache mit Niklas.«
»Papa, nein.« Sie fing an zu schluchzen. »Dass ich ihn vermisse, ist doch völlig klar.« Ein Zittern überlief sie.
»Stella, ich mache mir ernsthaft Gedanken um dich. Du gleitest in eine Depression. Wo soll denn das hinführen? Deine Kinder brauchen dich.«
Stella presste ihr Taschentuch vor den Mund. Es schnürte ihr Brust und Kehle zusammen. Sie wusste, ein bisschen recht hatte ihr Vater.
»Ich hab ja nicht mal einen Arzt«, würgte sie hervor, in dem hilflosen Versuch, das Ansinnen ihres Vaters abzuwehren. Noch während sie sprach, musste sie an ihren Schulfreund Vincent Gerdes denken. Er war Arzt geworden und hatte eine internistische Praxis in Maibach.
»Da findet sich doch jemand«, sprach ihr der Vater gut zu. »Ich kann mich ja mal umhören.«
»Bloß nicht.« Er würde bestimmt bei Lisbeth Schneider nachfragen. Sie hatte bis zu ihrer Pensionierung als Sachbearbeiterin bei der Krankenkasse gearbeitet und meinte, über sämtliche Ärzte im Umkreis von hundert Kilometern und mehr, gut Bescheid zu wissen. Er traf Lisbeth regelmäßig beim Seniorenstammtisch im Gasthof Selbacher in Wernau. Dazu kam, dass Lisbeth recht geschwätzig war und von Diskretion nichts hielt. Sie würde jedem, den sie kannte, erzählen, dass sie seit Niklas‘ Tod völlig instabil war.
»Warum denn nicht? Ich mache das gerne. Du hast doch genug mit den Kindern zu tun. Und wenn du einen Arzt-Termin hast, komm ich zu dir und passe auf die beiden auf«, versprach ihr Vater. »Das schaffe ich auch mit meiner Hüfte.«
»Lieb von dir. Aber umhören musst du dich nicht. Ich rufe Vincent an.« Kaum hatte sie es ausgesprochen, bereute sie es auch schon. Es fühlte sich an, als hätte sie sich selbst in eine Falle begeben.
»Vincent? Ich dachte, der ist jetzt in Regensburg«, sagte ihr Vater.
»Nein. Er ist schon eine Weile wieder in Maibach. Er hat irgendeine Praxis übernommen. Es stand damals in der Zeitung«, informierte sie ihn.
»Sehr gut, sehr gut. Da bin ich froh. Gleich morgen, ja?«, redete ihr der Vater zu.
»Ja, vielleicht.« Sie meinte, keine Luft mehr zu bekommen.
»Danke, Stella. Es ist mir eine große Beruhigung zu wissen, dass du dich um dich kümmerst«, ergänzte ihr Vater. Stella ballte eine Faust. Es regte sie fürchterlich auf, wenn ihr Vater ihr moralisch zusetzte.
Aus Amelias Zimmer klang klägliches Weinen.
»Ich muss Schluss machen, Papa. Amelia ist aufgewacht«, sagte sie rasch.
»Gut. Und sag mir bitte Bescheid, wann du zu Vincent gehen kannst.«
»Ja, mach ich. Tschüs.« Sie legte auf. Empörung wallte in ihr rauf und runter. Amelia weinte lauter. Sie hatte keine Zeit für ihren Ärger, sie musste sich jetzt um die Kleine kümmern.
*
Eine halbe Stunde später saß Stella wieder auf ihrem Sofa. Sie griff nach ihrem Handy. Irgendwo in den Tiefen ihres Speichers mochte sie noch Vincents private Telefonnummer haben. Wahrscheinlich war sie gar nicht mehr aktuell.
Stella fand die Nummer schneller, als gedacht. Auf dem winzigen Profilbild lächelte ihr der ehemalige Schulfreund entgegen. Er sah gut aus und viel erwachsener als damals, als sie sich zuletzt gesehen hatten. Sie wusste gar nicht mehr, wie lange das her war. Wann sie zuletzt mit Vincent geschrieben hatte, konnte sie auch nicht mehr feststellen. Der Provider hatte die alten Nachrichten gelöscht. Aber sie sah, dass Vincent vor wenigen Minuten online gewesen war.
Stella zögerte. Sie konnte ihm eine Nachricht schreiben. Vielleicht hatte er jetzt noch kurz Zeit, um zu telefonieren. Dann hatte sie es hinter sich. Und wenn er wirklich meinte, sie müsste zu ihm in die Praxis kommen, konnte sie ja auch morgen einen Termin bei seiner Sprechstundenhilfe vereinbaren.
Sie sah auf die Uhr. Es war kurz nach halb neun. Für eine Textnachricht unter alten Freunden war das noch eine gute Zeit.
›Hey, Vincent‹, schrieb sie. ›Ich hoffe, dir geht es gut. Ich brauche deinen Rat. Hast du zufällig Zeit, kurz zu telefonieren? Liebe Grüße, Stella.‹
Ohne noch einmal darüber nachzudenken, schickte sie den Text ab. Vincent ging Sekunden später online. Keine Minute darauf läutete ihr Handy. Ein Schreck durchfuhr sie. Es klingelte viel zu laut. Hastig nahm sie den Anruf an. Hoffentlich waren die Kinder nicht aufgewacht.
»Hey, Vincent«, sagte sie und bemühte sich, positiv zu klingen.
»Stella. Das ist ja eine Überraschung.« Vincent sprach freundlich und herzlich. Der Klang seiner Stimme tat gut. Für einen kurzen Moment erinnerte sie sich an die Leichtigkeit der Jahre, in denen sie befreundet gewesen waren. An Schwimmbad-Besuche im Sommer, Eislaufen und Schlittenfahren im Winter, Besuche von Konzerten und Partys. Die Abi-Feier. Auf der hatte sie sich in Sven verliebt, der nach drei Tagen kein Interesse mehr an ihr gezeigt hatte. Vincent hatte sie getröstet.
»Ich freue mich, von dir zu hören«, sagte er. »Und ich bin überrascht, dass du meine Nummer noch hast.«
»Ja, sicher.« Sie lachte leise und brach sofort wieder ab. Sie lachte kaum mehr, seit Niklas‘ Unfall.
»Um deine Frage zu beantworten: Mir geht es gut. Und dir?«, sprach er weiter.
»Nicht so gut.« Wieder brach sie ab. Ihr Herz fing an, hart gegen die Rippen zu pochen. Sie konnte nicht über ihren Kummer reden. Es ging einfach nicht.
»Das tut mir leid. Was ist denn los? Du hast geschrieben, du brauchst meinen Rat?«, fragte er.
»Ja. Ich … Also, mein Vater drängt mich, zum Arzt zu gehen. Ich habe aber gar keinen, außer meinen Frauenarzt.« Hitze schoss ihr in die Wangen. Was redete sie denn da?
»Er macht sich Sorgen um dich. Das hat er ja schon früher getan«, sagte Vincent. Sie stutzte. Das war richtig. Sie hatte ganz vergessen, dass Vincent das ab und an mitbekommen hatte. Damals zum Beispiel, als sie beim Eislaufen gestürzt war und sich danach tagelang mit Nackenschmerzen geplagt hatte. Ihr Vater hatte keine Ruhe gegeben, bis sie zum Arzt gegangen war. Er hatte eine Prellung diagnostiziert und ihr eine Salbe aufgeschrieben, und Physiotherapie verordnet.
»Ja, das stimmt«, gab sie zu.
»Und was genau sorgt ihn jetzt?«
Stella fixierte einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand. Dort hing die Pendeluhr, die Niklas‘ so gut gefallen hatte. Ihre Augen fingen an zu brennen.
»Ich bin … also, es ist so …« Wieder brach sie ab.
»Was?« Vincent sprach ganz sanft.
»Ich bin Witwe. Seit fünf Monaten. Und ich habe zwei Kinder.« Sie flüsterte die Worte ins Telefon. Tränen liefen ihr übers Gesicht. »Und irgendwie … kann ich nicht mehr.«
»Stella. Das tut mir furchtbar leid.« Er klang betroffen und voller Anteilnahme.
»Es war ein Unfall. Vincent, ich habe keine Kraft mehr.« Sie weinte verzweifelt.
»Was genau meinst du?«, fragte er behutsam.
»Ich kann nicht mehr essen und nicht mehr schlafen und ich weiß keinen Tag, wie ich früh aufstehen soll. Dabei brauchen mich die Kinder doch. Und mir fällt alles so schwer.« Schluchzen schüttelte sie. »Ich weiß nicht, wie ich Linus beschäftigen soll. Er kommt total zu kurz. Ich weiß nicht, wie ich mich um Amelia kümmern soll. Wickeln, trösten, Flasche zubereiten und ihr geben. Ich bin kaum dazu in der Lage. Früh weiß ich nicht, wie ich es schaffen soll aufzustehen.«
»Wie lange geht das schon?«, fragte Vincent ruhig.
»Seit damals. Also, seit es passiert ist.« Sie rang nach Luft.
»Stella, du solltest zu mir in die Praxis kommen. Am besten gleich morgen«, sagte Vincent ernst. »Das, was du beschreibst, klingt nach einer Depression. Du brauchst wirklich Hilfe, vielleicht auch eine Auszeit in einer psychosomatischen Klinik, in der du zur Ruhe kommen und Energie sammeln kannst.«
»Nein, Vincent.« Erschrocken setzte sie sich gerade. »Das geht nicht. Meine Kinder sind klein. Amelia ist ein halbes Jahr und Linus noch keine fünf Jahre alt. Ich habe niemanden, der sich um sie kümmern kann.«
Sie zerrte ein Taschentuch aus dem Päckchen, das noch immer auf dem Tisch lag.
»Was ist mit deinem Vater? Oder deinen Schwiegereltern?«, fragte er.
»Mein Vater hat große Probleme mit der Hüfte und muss demnächst operiert werden. Meine Schwiegereltern leben in Spanien. Ich habe wirklich niemanden. Was soll denn aus meinen Kindern werden?«
»Komm bitte morgen zu mir in die Praxis, wann immer du Zeit findest. Ich sage meinen Damen Bescheid, du brauchst keinen Termin. Wir reden dann weiter.«
»Wenn du mich irgendwohin einweisen willst, komme ich nicht.« Panische Furcht stieg in ihr auf. Warum hatte sie sich nur auf den Anruf eingelassen?