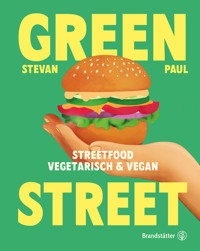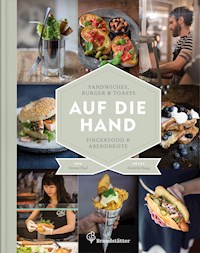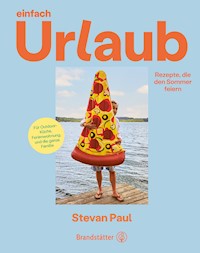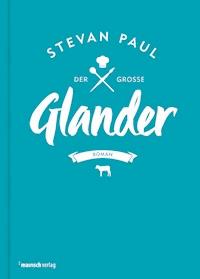
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Künstler Gustav Glander wird im New York der 1990er-Jahre zum Star der Eat-Art-Bewegung. Seine kulinarisch geprägten Arbeiten und Aktionen sind spektakuläre Inszenierungen und treffen den Nerv der Zeit, Kritiker und Sammler stürzen sich auf die Werke des schweigsamen Deutschen. Doch der Erfolg bereitet ihm Unbehagen. Nach einem Flug in die Heimat verschwindet Glander. Spurlos. Zwölf Jahre später: Ein Restaurant in Hamburg. Es herrscht Hochbetrieb in Küche und Service. Im Speiseraum sitzt auch der bekannte Kunstkritiker Gerd Möninghaus. Dem kommt einer der anderen Gäste seltsam bekannt vor. Zu spät fällt Möninghaus ein: War das etwa Glander? Als kurze Zeit später bislang unbekannte Skizzen des verschollenen Künstlers in der Redaktion auftauchen, beginnt der engagierte Journalist zu recherchieren. Seine Suche führt ihn von Hamburg nach New York, nach St. Moritz, an den Bodensee und ins Allgäu – und er macht dabei eine überraschende Entdeckung. Stevan Paul geht in seinem ersten Roman »Der große Glander« der Frage nach, was Essen zur Kunst macht. Er erzählt von der Liebe, vom Heimkommen und von der Freiheit, sich immer wieder selbst neu erfinden zu können. Herausgekommen ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Sorgfalt und das Authentische, eine Liebeserklärung ans Kochen – und ein großer Spaß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
GUSTAV
1
2
SILKE
3
4
5
PHILIP
6
TAD
7
8
KATRIN
9
JOSEF
10
11
JEAN-MARIE
12
MAGDA
13
14
ADAM
15
BRUNO
16
GUSTAV
DANKE
STEVAN PAUL
MEHR VON STEVAN PAUL
Impressum
GUSTAV
Gustav Glander kommt an einem sonnigen Märzentag in der geräumigen Wohnstube des Glanderhofs zur Welt, auf einem Höhenzug über dem Tal, fernab von Dorf und Kreisstadt. Seine Niederkunft ist gut vorbereitet, denn die einzige Hebamme in der Gegend ist seine Mutter selbst, und mit dem Einsetzen der Geburtswehen hat Magda Glander ihrem Mann erst in ruhigem Tonfall, dann immer bestimmter zu verstehen gegeben, was zu tun ist. Josef Glander hat alle Anweisungen befolgt und noch mehr heißes Wasser und zunächst die falschen, dann aber die anderen, die richtigen, die guten, dicken Tücher aus der unteren Kommodenschublade gebracht. Er hat seiner Frau den Schweiß von der Stirn gewischt, mitgeatmet und seinen Blick fest im Gesicht seiner Frau gehalten, und erst als Magda schreit: »Ich schwöre, ich bringe dich später um, Josef Glander!«, wagt er es, hinabzuschauen, wo er zuerst das Köpfchen sieht und dann pfeilschnell den ganzen Bub, in Schleim und Blut, auf den guten Tüchern liegend. Ein Zittern läuft durch den kleinen Körper, dann öffnen sich die blauen Lippen des Neugeborenen zu einer erstaunlich kräftigen Schreierei. Dem Vater wird ganz heiß. Tränen verschleiern ihm die Sicht auf den Sohn, und die Welt steht für ihn still. Aber nur kurz.
»Wir sind hier noch nicht fertig, Josef Glander!«
Später, als der kleine Gustav gewaschen und gewickelt in Magdas Armen liegt, öffnet Josef Glander auf Geheiß seiner Frau die Fenster, sieht hinaus, über den See, hinüber zu den Bergen, die noch Schnee tragen und durch die klare Luft greifbar nahe scheinen, so als wollten sie ihrerseits das Kind sehen. Hinter den Bergen zieht der Frühling aus Italien herauf, der erste Frühling im Leben ihres Sohnes. Gute Luft strömt von draußen in den Raum und auch das energische Zwitschern der ersten Singvögel. Magda wiegt das Kind, sieht hinaus in das vertraute Panorama, das heute majestätischer scheint und prachtvoller als sonst, und sie glaubt in diesem Moment, dass es ein gutes Leben werden wird, das da eben begonnen hat.
1
»Oh, Frau Möninghaus, guten A-ha-bend! Frau Möninghaus, unseren Haus-Apéro, den müüüssen Sie probieren«, Gerd Möninghaus äffte den Kellner nach, der eben mit der Bestellung verschwunden war. Silke Möninghaus studierte derweil teilnahmslos die Stuhlbeine am Nachbartisch. »Frau Möööninghaus, auch einen Apéro für Ihren Gatten?«, flötete Gerd Möninghaus, der sich noch nicht so richtig an die seltene Rolle als Begleiter seiner Frau gewöhnt hatte.
»Gerd. Ich hatte mich auf diesen Abend gefreut.«
Möninghaus rückte sich gerade und fand die eigene Stimme wieder: »Ist doch wahr, dieses alberne Getue ist unerträglich«, er blickte mürrisch hinauf zu den funkelnden Kronleuchtern, studierte die Gobelinstickereien auf den schweren Wandbehängen: »Gott, da kriegt man ja schon vom Hinsehen eine Hausstauballergie, das ist ja alles uralt hier.«
»Ja, Gerd. Mit alten Sachen kennst du dich ja aus. Aber der Küchenchef, der ist neu und darum sitzen wir hier, weil meine Leserinnen das interessiert, und der Verlag bezahlt auch dein Essen, also verwöhne die Welt mit deinem schönsten Lächeln, sie ist gut zu dir.«
Der Kellner erschien und servierte den Aperitif: »So, da haben wir unseren Mandarinen-Espuma, Frau Möninghaus, mit Wodka und Wakame-Algen, getoppt mit Osietra-Kaviar Malossol und Mandarinenfruchtfleisch. Sehr zum Wohlsein.«
Silke Möninghaus ergriff ihr Cocktailglas, prostete ihrem Mann mit einem breiten Grinsen zu, beugte sich dann nach vorn und flüsterte: »Und überhaupt, da kannst du mal nachfühlen, wie mir das immer geht, wenn ich ständig den großen Kunstexperten Gerd Möninghaus zu seinen furzlangweiligen, achsowichtigen Vernissagen begleiten muss. Da gibt es dann warmen Sekt, immer diese nervig laute Disko-Bums-Mucke und pro Gast ein halbes Räucherlachs-Canapé mit versalzenem Discounterlachs auf fitzelig dünnen Papierservietten serviert, deren erste Lage sich immer schon mit der Mayonnaise vermählt hat. Papierservietten muss ich essen, wenn ich dich begleite, Gerd, Papierservietten!« Silke Möninghaus nickte abschließend, sie lächelte jetzt nicht mehr, hob das Glas zum Mund, und Kaviarperlen und Algenhäutchen verschwanden zwischen ihren signalrot geschminkten Lippen. »Wir könnten uns ja heute Abend auch mal unterhalten, über deine Tochter zum Beispiel.«
»Und was macht die so?«, fragte Möninghaus müde.
Zu seiner Überraschung kramte seine Frau jetzt die aktuelle Ausgabe des Frauenmagazins hervor, dessen Chefredakteurin sie war, blätterte energisch im Heft und wurde im Reiseteil der Zeitschrift fündig. Sie reichte ihm das aufgeschlagene Heft, ihr roter Fingernagel markierte ein kleines Bild am Ende eines Beitrags über Das junge Ibiza – die schönsten Wohlfühlresorts. Gerd Möninghaus studierte das Foto lange, las die Bildunterschrift mehrmals: Relaxte Chillout-Sounds serviert DJane Mika zum Sundowner an der Strandbar. Auf dem Foto war eine junge Frau hinter einem Tresen mit zwei Plattenspielern zu sehen, sie trug einen übergroßen Kopfhörer und blickte ernst auf das Mischpult zwischen den Plattentellern, unter ihrem rechten Arm klemmte eine Schallplattenhülle. Er ging mit dem Gesicht ganz nah heran an das Bild, kniff die Augen zusammen, entzifferte die Schrift auf dem Albumcover: Facing the sun, stand da.
Er blickte hoch und sah fragend seine Frau an: »Aber Michaela heißt doch Michaela.« Gerd Möninghaus leerte das Cocktailglas mit einem Zug, schauderte, strich sich beiläufig über die Lippen. »Und warum sind denn bitte ihre Haare blau?« Aber sie war es, eindeutig. Seine Tochter. Michaela Möninghaus. Eigentlich Hotelfachfrau in Ausbildung, im Luxusresort Aguas de Ibiza. Jetzt aber wohl DJane an der Strandbar, Möninghaus beugte sich abermals hinab zu Foto und Artikel, einer der schönsten Sunsetbars Ibizas. Mit blauen Haaren. »Konntest du das nicht verhindern?«
»Ich dachte, wenn ich nichts sage, merkt’s vielleicht keiner in der Redaktion, schlafende Hunde soll man ja … und so war’s dann auch, Glück gehabt.« Silke Möninghaus lachte kurz und künstlich, griff zum leeren Cocktailglas, blickte sich dann suchend nach dem Kellner um.
»Was haben wir nur falsch gemacht?«, fragte Gerd Möninghaus die geleerten Gläser vor sich.
Dann bemerkte er erstmals den Mann, der ihnen schräg gegenüber an einem Zweiertisch saß und, offensichtlich alleine, bereits beim Hauptgang angekommen war. Der Mann war von riesenhafter Gestalt, im Stehen sicher über zwei Meter groß, schätzte Möninghaus, klein und zerbrechlich wirkte im Vergleich der gedeckte Tisch, an dem der Riese saß, das Weinglas in seiner Hand wirkte wie Puppenhaus-Zubehör. Konzentriert schnupperte der Riese am Wein, ließ ihn fachmännisch und elegant im bauchigen Glas kreisen, senkte nochmals die imposante Nase hinein, nahm einen Schluck, kaute mit geschlossenen Augen, sog Luft durch die Lippen, schluckte und nickte dann anerkennend. Der Mann trug eine sandfarbene Cordhose und ein marineblaues Hemd unter einem dunklen Sakko. Eine legere Eleganz, die in auffälligem Missverhältnis zum dichten, nachlässig gepflegten Bart des Riesen stand, auch seiner Frisur hatte der Mann nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet, vielleicht ließ sich das dicke, dichte schwarzgraue Haar einfach nicht besser bändigen. Wie ein Wilder, der sich fein angezogen hatte, für einen Ausflug unter die Menschen, dachte Möninghaus, der plötzlich von einem Gefühl der Vertrautheit zu diesem Mann ergriffen wurde. Merkwürdig bekannt schien ihm das Gesicht des Riesen, die wachen blauen Augen unter dichten Augenbrauen, die markante Nase, Möninghaus versuchte sich zu erinnern, ob und wo er diesem Mann schon einmal begegnet war.
»Und, was macht die Arbeit? So als König ohne Königreich?« Seine Frau unterbrach die ergebnislose Gedankenrecherche. Sie sprachen nie über ihre Arbeit, der Fakt, dass sie beide im selben Verlagshaus angestellt waren, hatte den Radius möglicher Gesprächsthemen zwischen den Eheleuten schon früh derartig eingeengt, dass sie beschlossen hatten, nur noch in Notfällen ihre Gedanken zu Verlagspolitik, Kollegen und Mitarbeitern auszutauschen. Ein solcher Notfall war in den vergangenen Wochen eingetreten.
»Der hat wirklich alle entlassen, alle. Wir waren zwölf Redakteure. Nur Wolfgang und ich sind noch übrig. Nächste Woche ist Umzug, Wolfgang und ich teilen uns dann ein winziges Zimmer, in diesem Nebengebäude in der Köhlerstraße, da, wo die Kundenzeitschriften gemacht werden. Für jede Scheißbesprechung mit dem feinen Herrn Chefredakteur darf ich dann zehn Minuten ins Verlagsgebäude rüberwackeln.« Möninghaus machte eine Pause. »Mir tut’s so leid um die Kollegen. Die finden doch nichts mehr, die gehen doch alle stramm auf die Sechzig zu!«
»Was hat denn Braunauer dazu gesagt?«
»Das ist die Zukunft, hat er gesagt. So geht Zeitschriftenmachen heute, hat er gesagt. Kleine Redaktion, zwei Leute, Chefredakteur, Grafiker, den Rest kaufen wir über Freie ein. Das hat er gesagt. Und dann einfach alle rausgeschmissen. Muss die erst mal ein Vermögen an Abfindungen gekostet haben. Die Kollegen haben wohl alle ordentlich Geld bekommen. Aber zur Frühpension reicht’s halt auch nicht. Die werden das Geld noch brauchen. Die waren ja alle ihr ganzes Berufsleben lang Redakteure eines Kunstmagazins. Die überleben doch keine fünf Minuten auf dem freien Markt. Braunauer hat zwar allen ganz generös angeboten, weiter frei für uns zu schreiben, was die jetzt aber natürlich erst mal nicht machen, die sind beleidigt und das zu Recht.« Möninghaus starrte auf eine einzelne, schwarz glänzende Kaviarperle, die sich zwischen dem Tischtuch und seiner Serviette versteckt hatte. »Ich habe keine Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das nächste Heft fertig kriegen soll. Wie bitte? Ja, danke, Weißwein, prima, nehm ich.«
Die Weingläser wurden gefüllt, junge Mädchen servierten die Vorspeise, auf das Kommando des Kellners im Hintergrund wurden die silbernen Cloches gelüftet, und sofort waberte dichter weißer Nebel über den Tisch, der intensiv nach Fichtennadeln roch und sich hartnäckig über den Tellern hielt. Nur langsam schälte sich ein Bastkörbchen aus dem Nebel, darin ein Fichtenzweig, auf dem zwei butterschwitzende Garnelen lagen.
»Großartig!«, rief Silke Möninghaus und zückte ihr Handy.
»Das sind unsere norwegischen Garnelen in Meersalzbutter aus dem Fichtenrauch«, erklärte der Kellner und wünschte: »Guten Genuss!«
Gerd Möninghaus versteckte sein aufkommendes Gelächter hinter vorgehaltener Hand, auch, weil sich seine Frau schon konzentriert Notizen machte. Guten Genuss. Er kicherte leise. Kommt man nicht drauf. Er war froh, seiner Frau nicht mehr erzählen zu müssen, was Braunauer ihm am Ende des Gesprächs, schon an der Tür, noch mit auf den Weg gegeben hatte, unangenehm nah war er dabei an ihn herangetreten, hatte die Stimme gesenkt, als verrate er ein Geheimnis: »Wissen Sie, Herr Möninghaus, mit der Kunst ist das im Verlagsgeschäft genau wie im richtigen Leben, Kunst muss man sich leisten können. Und den Fakt, dass Sie und der Herr Lechner hier überhaupt noch an einem Kunstmagazin arbeiten dürfen, haben Sie anderen, wesentlich erfolgreicheren Formaten unseres Hauses zu verdanken. Außerdem glaubt der Vorstand noch, und die Betonung liegt auf noch, Herr Möninghaus, an die Notwendigkeit eines Kunstmagazins im Verlags-Portfolio. Ja, wenn’s nach mir ginge … Überzeugen Sie mich, Herr Möninghaus. Rechtfertigen Sie das in Sie gesetzte Vertrauen. Große Geschichten, Herr Möninghaus. Emotionen. Rock ’n’ Roll! Schaffen Sie das, Herr Möninghaus?« Ohne eine Antwort abzuwarten, hatte der Chefredakteur ihn aus dem Zimmer geschoben.
»Das hier ist übrigens auch Kunst«, sagte Silke Möninghaus und holte ihren Mann mit einem beherzten Schlag mit dem Messer an seinen Tellerrand zurück ins Restaurant Belvédère.
»An der Jakobsmuschel ist noch die Verpackung dran«, konstatierte Möninghaus, als der nächste Gang serviert worden war und der Service sich wieder zurückgezogen hatte.
Seine Frau seufzte ins Weißweinglas: »Das ist Lardo. Eine italienische Spezialität, der weiße Rückenspeck vom Landschwein, wird mit Salz und Gewürzen eingerieben und zwischen Carrara-Marmorplatten gereift. Auf diesem Teller ummantelt er, hauchzart geschnitten, eine perfekt gebratene Jakobsmuschel, ein dünnes Kleidchen, das durch die Hitze durchscheinend, fast durchsichtig geworden ist und jetzt leicht schmelzend der Pilgermuschel seine Würze schenkt. Dazu passt der Dillblütenschaum mit den gerösteten Fenchelsamen hervorragend. Und diese frische, ganz zarte Schärfe des gegrillten Frühlingslauchs, der bringt da noch eine rauchige Note ins Gericht. Schatz, herzlichen Glückwunsch, du sitzt gerade vor einem perfekten Teller.«
Möninghaus lachte kurz, ein bisschen auch über sich, löffelte vorsichtig den ersten Happen, aß konzentriert, zerdrückte das zarte Muschelfleisch am Gaumen, schmeckte die Süße der Sauce, das Salzige vom Speck, der im Mund endgültig schmolz, wie überhaupt alles sich in Wohlgefallen auflöste – und er verstand. Es ist eigentlich wie mit der Kunst, dachte er. Manches muss man einfach auch erst mal erklärt bekommen, um es überhaupt schätzen zu können. Wie immer war sein Teller schneller geleert als der seiner Frau, die immer wieder innehielt, das Besteck tonlos auf den Teller sinken ließ, in Zeitlupe kaute, sich dann mit einem kurzen Bleistift eine weitere Notiz ins kleine Moleskine-Büchlein schrieb, das sie unter der Serviette versteckte. Als er sich erhob, blickte sie überrascht auf. »Ich muss mal schnell, äh, bin gleich wieder da.«
»Könntest du damit vielleicht warten, bis ich auch ...«, sagte Silke, doch Möninghaus hatte keine Zeit zu verlieren, der Riese war nämlich aufgestanden und durchschritt das Restaurant in Richtung der Waschräume. Möninghaus folgte ihm, den Protest seiner Frau hörte er schon nicht mehr, das hier war seine Chance, sich den Mann mal genauer anzusehen.
Möninghaus öffnete die Tür und kniff die Augen zusammen. Diese Toilette musste ein beleidigter Innenarchitekt entworfen haben, gleich nachdem er erfahren hatte, dass seine Dienste im denkmalgeschützten Restaurant selbst nicht benötigt würden. Die blendend weißen, fugenlosen Wände waren mit einer Art blau-rosa schimmerndem Perlmutt überzogen, statt eines Waschbeckens mit Wasserhähnen plätscherte ein breiter Strom quer durch ein langes Becken aus schwarzem Stein, das mit Naturkieseln gefüllt war. In der gegenüberliegenden Wand bildeten eiförmige Vertiefungen die Pissoirs und Möninghaus stellte sich genau neben den Riesen, der es schon hörbar laufen ließ. Man musste schon ordentlich zielen, die Mulden hatten allerhöchstens die Größe eines Straußeneis, Möninghaus hatte aber ein ganz anderes Problem, er musste gar nicht pinkeln, der Riese neben ihm ließ immer noch einen nicht enden wollenden, satten Strahl hören. Möninghaus lächelte gequält hinunter zu seinem Schwanz, der gänzlich funktionslos zwischen Daumen und Zeigefinger klemmte. Als der Riese den Reißverschluss nach oben zog und hinüber zum Wasserbecken ging, ließ Möninghaus noch etwas Zeit verstreichen, als habe sich da jetzt doch noch was getan bei ihm, verpackte dann seinerseits alles wieder und stellte sich neben den Riesen an den künstlichen Fluss. Im breiten Spiegel konnte er dem Mann jetzt seitlich direkt ins Gesicht sehen. Das Gefühl von vorhin, dieses Gefühl, in ein vertrautes Gesicht zu blicken, tippte ihm erneut auf die Schulter, er kannte den Riesen. »Guten Abend«, sprach er zum Spiegelbild des Mannes, er versuchte dabei, möglichst deutlich freudige Überraschung in die Worte zu legen, mit einem Anflug von Wir kennen uns doch!.
Der Riese nickte knapp, zeigte an den Rand des Beckens und sagte: »Die gelben Kiesel da, das sind die Seifen.«
Möninghaus starrte die gelben Kieselsteinimitat-Seifen an, die ihn in diesem Umfeld eher an WC-Frisch-Klosteine erinnerten, dann wandte er sich direkt dem Riesen zu, jetzt galt es. »Wir kennen uns doch!«, sprach er mit fester Stimme, genau in dem Moment, als der andere den Knopf für das Handtrocknungssystem gefunden hatte. Das dröhnende Rauschen des Gebläses schluckte seine Worte, und noch ehe der Luftstrom wieder abriss, hatte der Riese die Toilette verlassen.
Zum Hauptgang war er wieder zurück und ertrug den tadelnden Blick seiner Gemahlin. Auf dem Teller lag ein Tafelspitzstück von einem Rind, das angeblich in Japan mit Bier genährt und mit täglichen Massagen verwöhnt worden war, so erklärte es ihm zumindest seine Frau, und er möge insbesondere das süßsaure Kompott von Pflaume und Preiselbeere wahrnehmen. Dieser Teller sei Ausdruck der Philosophie des Küchenchefs, nämlich die Kombination aus einer regionalen Küche, die der Idee der nordischen Küche tief verbunden sei, mit ausgewählten Zutaten, Rezepten und Techniken aus aller Herren Länder, sozusagen die logische Fortsetzung der Fusion-Küche der Neunziger. Zudem eine echte Wohltat und Bereicherung, dass jetzt ein so brillanter Koch wie Matthiesen, nach all den Jahren der strengen und eingrenzenden New Nordic Cuisine, seinen Blick wieder auf die kulinarische Vielfalt der Welt richten würde. Ohne Standort und Heimat zu verleugnen, wohlgemerkt. Möninghaus nickte mechanisch alle Punkte ab und beobachtete den Riesen, der eben einen Espresso verschluckt hatte und jetzt Anstalten machte, seine Rechnung zu begleichen, der Oberkellner hatte das lederne Rechnungsmäppchen schon in der Hand.
»Hörst du mir überhaupt zu?«
Plötzlich stand der Koch im Restaurant, ohne die anderen Gäste eines Blickes zu würdigen, ging er direkt zum Tisch des Riesen. Der war aufgestanden, die Männer lachten und nach einem kurzen Gespräch gaben sie einander die Hand. Bevor der Koch wieder in der Küche verschwand, legte er behutsam, fast zärtlich, seine rechte Hand erst auf die Schulter des Riesen, berührte dann mit derselben Hand noch den Oberarm seines Gegenübers, nickte und wandte sich lächelnd zum Gehen. Kurz sah der Riese dem Koch noch hinterher, dann erschien schon der Oberkellner. Er begleitete seinen Gast zur Garderobe und hielt ihm mit einem letzten Gruß die hohe Flügeltür auf.
»Und dann bin ich zum Mond geflogen«, sagte Silke Möninghaus.
»Ach wirklich«, sagte Möninghaus und erhob sich, »das ist spannend, Silke, kleinen Moment, ja?« Ohne ein weiteres Wort ging er in Richtung der Getränkebar, hinter der eine automatische Schiebetür in die Küche führte. Der Oberkellner schnitt ihm kurz vor der Bar den Weg ab.
»Moment, Monsieur! Zur Toilette geht es links die Treppen runter.«
»In die Küche, ich möchte in die Küche, Herr …?«
»Adam, Adam mein Name. War denn mit dem Menü etwas nicht in Ordnung, Monsieur?«
Möninghaus ging in sich. Dazu konnte er so gar nichts sagen, irgendwie.
»Nein, nein, ich möchte nur den Küchenchef sprechen. Also loben. Ja. So.«
Oberkellner Adam musterte seinen Gast. Das war der Mann von Frau Möninghaus, der Chefredakteurin der Woman’s World, sie war als fachlich versierte Restaurantkritikerin bekannt, wieso schickte sie jetzt ihren Mann vor? Armer Kerl. Adam setzte sein verbindlichstes Lächeln auf: »Herr Möninghaus, jetzt gehen die Desserts raus und Herr Matthiesen muss noch mal richtig ran, machen wir’s doch so, Sie genießen Ihr Dessert, und den Herrn Matthiesen, den schick ich Ihnen zum Kaffee.«
»Sie kennen meinen Namen?«
»Selbstverständlich, Herr Möninghaus.«
Möninghaus schwebte zurück zum Tisch. Überraschend, wo man überall auf treue Leser seines Kunstmagazins traf! Als er wieder Platz nahm, konnte nicht mal die Gereiztheit seiner Gattin am Hochgefühl etwas ändern.
»Sach mal, was ist denn heute los mit dir, ADHS, oder was? Da bist du allerdings jetzt doch einen Ticken zu alt, um da noch mit anzufangen!«
»Tschuldigung«, er griff die Hand seiner Frau und beugte sich zu ihr über den Tisch: »Stell dir vor, dieser Kellner, der Oberkellner, der hier der Chef ist, der liest unsere KunstStücke!«
Nach dem Dessert sah sich Silke Möninghaus ziemlich rasch nach dem Service um: »Wir müssen los, mein Schatz, ich habe heute noch eine Überraschung für dich.«
»Jetzt noch?« Möninghaus sah auf die Armbanduhr, es war schon nach elf.
»Ja, jetzt noch, ich kümmer mich mal um …, ach du liebe Güte, da kommt Matthiesen, kommt der zu uns? Was will der denn, ein Schwätzchen halten?«
»Frau Möninghaus!«
»Herr Matthiesen. Toll war’s, ein Genuss, vielen Dank!«
Der Chefkoch deutete ein bescheiden-devotes Sichwinden an und nickte lächelnd. »Aber sagen Sie, Herr Matthiesen, ich bin erstaunt, Sie hier zu sehen, Sie gehen doch sonst sehr ungern ins Restaurant?«
»Ja, das stimmt, Frau Möninghaus, ich sach immer, ich habe meinen Gästen schon das Beste gegeben, was ich habe, meine Kochkunst und mein ausgezeichnetes Serviceteam, was soll ich denn da am Ende noch rumgurken. Aber heute ist eine Ausnahme, Herr Adam erzählte mir, Ihr Mann wolle mich sprechen?« Jetzt sahen beide Gerd Möninghaus an, seine Frau entgeistert, Herr Matthiesen erwartungsvoll.
»Ja! Genau!«, sagte Möninghaus. »Und da wären wir auch gleich beim Thema: Herr Matthiesen, Sie waren ja vorhin schon mal draußen, da an dem Tisch da, da saß ein groß gewachsener Herr und den haben Sie verabschiedet.«
Matthiesen runzelte die Stirn: »Äh, nein, eigentlich … nein.«
»Hab ich doch gesehen, Herr Matthiesen. Vertraulich am Arm gefasst haben Sie den Mann sogar!«
Der Koch schüttelte den Kopf.
»Kommst du mal auf den Punkt bitte, Gerd, vielleicht hast du ja einen von Herrn Matthiesens Köchen gesehen?«
»Das kann sein«, sagte Matthiesen und Möninghaus glaubte, Erleichterung in der Stimme des Kochs zu hören.
»Ach, jedenfalls wollte ich wissen, wer der Herr war, ich glaube, ich kenne den nämlich.«
»Ich kenn den nicht.« Matthiesen sah hinüber zu dem Tisch, an dem der Riese gesessen hatte. »Aber vielleicht kann uns ja der Herr Adam da weiterhelfen, Herr Adam, kommst du mal? Und bring mal das Reservierungsbuch mit!«
»Was darf ich notieren, wann dürfen wir uns wieder auf Sie freuen?« Adam war an den Tisch getreten und öffnete das Reservierungsbuch.
»Der Herr Möninghaus möchte wissen, wer der Herr war, der alleine an Tisch sechzehn saß.«
Herr Adam klappte das Buch mit einem Knall zu: »Ach so, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir aus Gründen der Diskretion niemals Auskunft über unsere Gäste geben.« Adam ließ die Worte wirken, nach einer Kunstpause beugte er sich verschwörerisch hinunter zu den Eheleuten Möninghaus und flüsterte: »Und in diesem Fall würde nicht mal Folter etwas nützen. Der Herr hatte nämlich nicht reserviert.«
Matthiesen und Adam verabschiedeten sich an der Tür von den Silke und Gerd Möninghaus, winkten dem abfahrenden Taxi hinterher. Adam blies langsam die Luft aus seinen aufgeblähten Backen: »Meine Güte, immer wieder überraschend, was die Leute so reitet.«
Matthiesen nickte lachend. Gemeinsam gingen sie wieder hinein, um jetzt zügig den Feierabend vorzubereiten. In der Küche roch es schon nach Reinigungsmittel, die Köche scherzten, schlugen sich gegenseitig mit den nassen, schweren Putzlappen gegen die Beine. In der Abwäsche schepperten Töpfe und Bleche, zwischen wachsenden Tellerstapeln arbeiteten schweigend die Spüler, routiniert, schwitzend, im heißen Dampf der weit geöffneten Maschinen. Matthiesen schloss die Tür des Küchenbüros hinter sich, warf sich in den Bürostuhl und rollte zum Schreibtisch, genoss kurz die Stille. Seine Jungs hinter dem großen Fenster, wie ein Stummfilm in verschwitztem Weiß.
Der Küchenchef zog das Handy aus der Hosentasche, tippte die Kontaktliste an, fand schnell den Namen, den er suchte, und stellte die Verbindung her: »Ja, hey, ich bin’s. Ja, so schnell spricht man sich wieder. Nein, nein, du hast nichts vergessen. Aber, weißt du was, da hat sich grade ein ganz besonderer Gast nach dir erkundigt. Ich dachte, das solltest du wissen.«
Im Taxi war die Stimmung zunächst frostig, Silke Möninghaus nannte dem Taxifahrer leise eine Adresse, echauffierte sich dann umso lauter über »diesen wirklich unmöglichen Auftritt« ihres Mannes. Sie wollte wissen, was ihn »geritten« hätte, und zählte auf, wo sie sich jetzt überall nicht mehr sehen lassen könne.
Möninghaus entschuldigte sich wortreich und erklärte die Sache mit dem Gast, der ihm so seltsam bekannt vorgekommen war. »Das kennst du doch auch«, sagte Gerd Möninghaus.
Silke Möninghaus schüttelte den Kopf.
»Ich muss dann einfach wissen, wer das ist, ich brauche dann Klarheit, um nicht wahnsinnig zu werden.«
Das Taxi hielt nach kurzer Fahrt schon wieder an. »Wo sind wir?«, fragte Gerd Möninghaus und sah mit angewinkeltem Kopf aus dem Fenster des Wagens: »Huch. Das Royal Grand?«
Die Gesichtszüge seiner Frau wurden augenblicklich weicher, sie lächelte. »Komm mal her, du Verrückter«, sagte sie und küsste ihn kurz, für einen Augenblick spürte er ihre Zungenspitze zwischen seinen Lippen. Dann setzte sie sich aufrecht und strich sich die Locken hinters Ohr. Möninghaus sah die feinen grauen Haare, die sich eingeschlichen hatten ins Blond und spürte plötzlich eine Verliebtheit in sich, die er verloren geglaubt hatte.
»Also«, sagte Silke. »Wir sind heute auf den Tag genau 22 Jahre verheiratet!« Möninghaus zog erstaunt die Augenbrauen nach oben. »Und da habe ich mir gedacht, Schnapszahl, Schnapsidee!« Sie griff seinen Kopf im Nacken, zog ihn zu sich heran und flüsterte ihm mit extratiefer Stimme ins Ohr: »Und darum schenke ich dir eine Nacht mit mir, im Royal Grand.«
Möninghaus spürte, wie ihm das Blut in den Schwanz schoss: »Das ist eine sehr gute Idee«, flüsterte jetzt auch er mit brüchiger Stimme.
»Macht dann 12,80 bitte, ja!«, bellte der Taxifahrer ungeduldig.
Sie hatte wirklich an alles gedacht. Das Nachtzeug, die Kulturtaschen, ihre Kosmetik und frische Kleidung für den nächsten Tag hatte sie am Morgen per Kurier ins Hotel und auf das Zimmer bringen lassen, dort stand auch eine Flasche Champagner auf Eis. Silke Möninghaus kicherte, als sie im Fahrstuhl ihrem Mann zwischen die Beine griff und sich an ihn schmiegte.
»Ich bin ein Idiot!«, murmelte Möninghaus zwischen dem dritten und vierten Stockwerk. »Der Mann im Restaurant, das war …« Weich stoppte der Lift im sechsten Stock. Lautlos öffneten sich die Türen und ein glockenklarer Gong erklang. »Natürlich. Das war der große Glander!«
2
Josef Glander reckte das Kinn zur Badezimmerdecke, schabte sich Schaum und graue Stoppeln aus dem Gesicht: »Ist Arturo eigentlich schon da, oder hat er sich verfahren, der alte Haschbruder?«
Den bösen Blick, den ihm seine Frau über den Schminkspiegel zuwarf, lachte Josef Glander einfach weg. Im Badezimmer duftete es blumig frisch, nach Aufbruch, Erwartung und kommenden Feierlichkeiten, nach den schönen Stunden, die sich immer ankündigten, wenn Magda Glander das teure Parfüm auftrug. Sie trug es nur zu besonderen Anlässen, zum Kirchgang, einer Abendeinladung, manchmal auch zur Elternsprechstunde in der Schule, wenn Gustav etwas ausgefressen hatte. Letzteres, fand Magda Glander, schadete zwar der Gesamtwirkung des Parfüms, war aber nötig, es schien Gustavs Klassenlehrer zu besänftigen, der sich gerne hitzig in Wallung redete und atemlos Vorfall an Vorfall reihte. Magda Glander trat dann ein Stück näher an den jungen Mann heran, sah ihm in die Augen, nickte und sagte: »Ich verstehe das.« Sie konnte sehen, wie die Nasenflügel des Pädagogen bebten, wenn er heimlich ihren Duft einsog, augenblicklich entspannte er sich und kam in kurzen Sätzen zum Ende seiner Ausführungen.
»Dein Klassenlehrer, der Herr Rögger, der kommt heute auch«, sagte Magda Glander, als sie den Jungen im Badezimmerspiegel entdeckte. Gustav stand in der Tür, verdrehte die Augen. »Komm, der ist sehr nett. Und der glaubt an dich, Gustav, gut siehst du aus!« Gustav Glander trug glänzend schwarze Lackschuhe, die er zuvor nur ein einziges Mal im Schuhgeschäft hatte tragen dürfen. Über die Knopfleiste des weißen Hemdes lief die geborgte Krawatte des Vaters, die dieser zuletzt bei der Beerdigung der Großmutter getragen hatte, schwarz wie der Anzug, den sie extra für heute gekauft hatten.
»Das glaub ich ja jetzt nicht, kommst du mal bitte her!« Die Mutter faltete das Einstecktuch neu, zog kraftvoll an den Ärmeln der Anzugjacke und seufzte: »Der Bub wächst also auch auf dem kurzen Weg vom Schneider zurück nach Hause.« Sie strich Gustav durchs Haar, zupfte nochmals am Tuch, zog erneut die Anzugärmel erfolglos in die Länge. Durch das geöffnete Zimmerfenster war das Röcheln eines Motors zu hören, dann ein asthmatisches Hupen.
»Onkel Arturo ist da!«, rief Gustav, befreite sich aus der Umarmung seiner Mutter und rannte los.
»Hoffentlich schenkt dein Bruder dem Bub nicht Haschisch zur Konfirmation«, murmelte Josef Glander, während er versuchte, die gesprenkelten Blutungen am Hals mit Klopapierfetzen zu stoppen.
Magda Glander griff sich das rechte Ohr ihres Mannes, drehte es schwungvoll so weit es ging nach hinten, und in den Schmerzensschrei ihres Mannes hinein erklärte sie: »Du wirst sehr nett sein zu meinem sehr lieben Bruder Arturo!« Dann ließ sie das Ohr los und ging hinunter, um ihren Bruder zu begrüßen.
Nach und nach trafen die Verwandten am Hof ein, die weit Gereisten waren schon in der Nacht angekommen und hatten in den umliegenden Pensionen Platz gefunden. Immer mehr Autos parkten entlang der schmalen Straße zum Glanderhof und dem alten Sägewerk hinter dem Haus. Gustav gab den Einweiser, begrüßte die aussteigenden Gäste, wischte sich die Küsse der Tanten mit dem Handrücken aus dem Gesicht. Magda Glander ging mit einem Tablett herum, reichte dick gebutterte Hefezopfscheiben mit Himbeermarmelade vom letzten Sommer, ihr Mann servierte Sekt oder Orangensaft, immer ein Glas in jeder Hand, sein rechtes Ohr leuchtete. Die Nachbarsmädchen sammelten leere Gläser und Teller ein, sie trugen schöne, weiße Kleider, unter ihnen auch Katrin, ihr sah Gustav lange hinterher. Ihr rotblondes Haar glänzte, kurz trafen sich ihre Blicke, und sie schenkte ihm ein Lächeln aus tausend Sommersprossen. Es dauerte ewig, bis alle Gäste zu trinken hatten und auf Gustavs Wohl anstießen: »Viva!«
In Kolonne ging es hinunter ins Dorf und zur Kirche, einige Wagen hupten wie bei einer Hochzeit. Ein blauer Himmel zog sich über das saftige Frühlingsgrün der Hügel, der Fluss neben der Kirche war vom Schmelzwasser angeschwollen und glitzerte blendend im Sonnenlicht, beim Aussteigen setzten die Tanten ihre Sonnenbrillen auf. Blumengestecke wurden knisternd von zartem Papier befreit, die überflüssigen Mäntel auf den Rücksitzen der Autos verstaut, Gesangsbücher aus Handschuhfächern gezerrt. Gustav bekam eine Kerze in die Hand gedrückt, auf der in Wachsbuchstaben sein Name und das Datum seiner Konfirmation standen. Den Tropfschutz am Ende der Kerze hatte sein Vater kurzerhand aus einem Bierdeckel gebaut, rund um den Kerzenstumpf war zu lesen: Unser Bier, ein guter Schluck Heimat! Gustav fand die Kerze insgesamt schrecklich und verbarg sie hinter seinem Rücken, als er über den Kies lief, um seine Mitkonfirmanden und den Pfarrer zu begrüßen. Im Augenwinkel sah er, wie seine Mutter am Ende der Kirchtreppe dem Klassenlehrer die Hand gab. Sie redeten kurz miteinander, dann sahen sie zu ihm herüber. Weinte seine Mutter? Jetzt winkten beide, seine Mutter hatte tatsächlich Tränen in den Augen und lächelte. Gustav sah schnell weg und beschleunigte seine Schritte.
Die Kirchenbänke waren alle besetzt, später eintreffenden Gästen blieben nur noch Stehplätze unter der Orgelempore. Als der Organist seinen donnernden Empfangschoral zu spielen begann, rieselte Holzstaub aus den Bodenbrettern der Empore.
Der Pfarrer erklärte eingangs, er freue sich, »dass Sie zumindest dann mal den Weg in die Kirche finden, wenn Gott sich Ihrer Kinder annimmt«. Dann begann ein für die Konfirmanden nicht enden wollender Ablauf von Gebeten und Gesängen. Während der Predigt verfolgte Gustav einzelne, größere Staubflocken, die im schräg einfallenden Sonnenlicht schwebten, eine Flotte imperialer Sternenzerstörer formierte sich, um im Kampf gegen die Rebellen das Schicksal dieser Kirche zu besiegeln. Endlich rief der Pfarrer die Konfirmanden nach vorne, die Kerzen wurden umständlich angezündet, das Glaubensbekenntnis gesprochen. Dann traten sie einzeln vor den Pfarrer und erhielten aus dessen Hand Gottes Segen und den biblischen Konfirmationsspruch, den sie sich ausgesucht hatten und der sie nun auf allen Lebenswegen begleiten würde, so hatte der Pfarrer es im Konfirmationsunterricht erklärt. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben war Gustav Glanders Konfirmationsspruch, und er ahnte, dass darin Bedingungen versteckt waren.
Viel später erst öffneten sich die schweren hohen Holztüren. Aus der Kühle der dunklen Kirche ging es augenblinzelnd hinaus in den warmen Frühlingstag, alle küssten sich und alle küssten vor allem Gustav, dessen Handrücken und Einstecktuch sich langsam vom Lippenstift der Tanten färbten. Seine Mutter weinte jetzt eigentlich die ganze Zeit, kaum dass sie ihn einmal ansah. Dann wurden Fotos gemacht, in Reihe warteten die Familien vor der Kirchentreppe auf ein Foto mit dem Pfarrer, während die neuen Gemeindemitglieder mit ihren Konfirmationskerzen Lichtschwerter-Gefechte austrugen.
»Alle in die Autos und mir nach!«, rief irgendwann Josef Glander, er hatte sich in der geöffneten Wagentür auf den Trittrahmen des Mercedes gestellt und winkte mit der ausgestreckten Hand in Richtung See.
»Ich fahr mit Onkel Arturo!«, rief Gustav aus dem aufgeklappten Wagenfenster des Citroën 2CV seiner Mutter zu, die sich suchend umblickte.
Er hatte sich vorsichtshalber schon früh in die Ente des Onkels gesetzt, der sich jetzt lachend auf den Fahrersitz warf, die braunen Locken hinters Ohr klemmte und dann mit gespieltem Ernst verkündete: »Das wird eine Höllenfahrt, für richtige Männer.« Arturo drehte den Zündschlüssel, riss an der Revolverschaltung, die Ente heulte auf und war in zwei Sätzen vom Kirchhof verschwunden. Hinter der nächsten Kurve öffnete der Onkel das schwarze Verdeck: »Wollen wir mal den Tag hereinlassen«, der Fahrtwind verwirbelte ihre Haare. In jeder Kurve wurden sie im Wagen herumgeschleudert, und es war Gustavs Aufgabe, mit einer Hand die Gitarre des Onkels festzuhalten, die in einem löchrigen Pappkoffer verstaut war und zwischen seinen Beinen klemmte. Der Tag leuchtete. Auf der Bundesstraße, sie konnten den See schon sehen, schlug sich Onkel Arturo mit der flachen Hand auf die Stirn, trat auf die Bremsen, verlangsamte die Fahrt: »Wir haben was vergessen!« Mit einer Hand öffnete er die Brusttasche seiner dunkelgrün gefärbten Jeansjacke und fischte eine Musikkassette heraus, die er in den Schlitz des Kassettenspielers schob, den Lautstärkeknopf am Autoradio drehte er ganz nach rechts. Drei kurze Trommelschläge, dann noch mal zwei, dann setzte ein federnder Bass ein, majestätisch erhoben sich die Bläser, Arturo war aufgesprungen und schaute jetzt oben zum Verdeck heraus, lenkte die Ente mit links, streckte den rechten Arm mit geballter Faust in den blauen Himmel und schrie in den Fahrtwind: »Buffalo Soldier! Dreadlock Rasta! There was a buffalo soldier, in the heart of America!«
Gustav musste sehr lachen, Onkel Arturo tauchte zurück in den Wagen: »Bob Marley, kennste?« Gustav lachte immer noch und schüttelte den Kopf. Als sie vor dem Restaurant bremsten und dabei tiefe Spuren in den hellen Kies gruben – die Festgesellschaft stand schon wartend an den Türen -, sangen sie beide im Chor: »O jojojo jojojojo jojojojojojojo jo!« Arturo würgte die Ente ab, drückte den Eject-Knopf, fing die herausfliegende Kassette auf und reichte sie Gustav: »Hier, für dich mein Freund.«
»Oh danke! Ich kann nur leider zu Hause keine Kassetten abspielen.«
»Das kann sich ja noch ändern«, erklärte Onkel Arturo, stieg aus und ging zum Kofferraum. »Komm mal mit«, sagte er und drehte sich zur Festgesellschaft auf dem Rasen vor dem Restaurant um. »Geht schon mal rein, Leute, wir haben hier noch zu tun.«
Schnell waren alle verschwunden, nur Magda Glander kam herüber zu den beiden: »Na, Geheimnisse?«
Arturo zwinkerte erst seiner Schwester zu, dann Gustav, öffnete dabei sehr langsam die Kofferraumklappe und sprach: »Gustav, zu deinem Eintritt in die christliche Gemeinde und in das Leben als Erwachsener schenke ich dir: eine Wolldecke!« Gustav lachte und zog an der Wolldecke, die um einen Karton gewickelt war. Schneider stand auf dem Karton über der Zeichnung einer Kompaktanlage. »Stereo-Lautsprecher, Plattenspieler mit einstellbarer Geschwindigkeit für LPs und Singles, Radio und Doppelkassettendeck zum Kopieren«, erklärte Onkel Arturo.
»Viel zu viel, kleiner Bruder«, zischte Magda Glander, deren Augen sich schon wieder mit Tränen füllten.
»Ich hatte eine gute Saison auf den Weihnachtsmärkten in Bozen und Meran«, flüsterte Arturo ihr ins Ohr, eine Luftgitarre spielend. Der Konfirmand überlegte, vor Glück mal zu schreien, und tat das dann auch.
Von Vater und Mutter gab es eine Uhr, sogar genau die, die er sich gewünscht hatte, mit Digitalanzeige.
»Ich habe gehört, die Kinder verlernen dann, die Uhr richtig zu lesen«, wusste Tante Merli, die Schwester seines Vaters, aber der Vater schüttelte nur unwirsch den Kopf, drückte seinen Sohn ungewohnt lange, dann sahen alle schweigend auf die Uhr.
»Wenn ich Sie dann zu Tisch bitten dürfte«, sagte das junge Mädchen, das auch schon den Sekt verteilt hatte, sie trug einen schwarzen Rock und eine enge weiße Bluse, Gustav konnte die Form ihres Busens erahnen. »So, und du, junger Mann, kommst mal mit mir, du sitzt nämlich heute am Kopf der Tafel.« Sie lachte, und Gustav schluckte trocken. Sie hatte das blonde Haar streng nach hinten gekämmt, es wurde mit einer großen schwarzen Spange zusammengehalten, das konnte Gustav sehen, als er hinter ihr her zum Tisch ging. Er überlegte, ob er Katrin schöner fand oder die Bedienung. Von seinem Platz aus konnte er die ganze Tafel überblicken, und aus den Kopfreihen zu beiden Seiten tauchten immer wieder Gesichter auf, die ihm zuzwinkerten, lächelten oder ein Glas in seine Richtung hoben. Mit einer Hand fuhr er vorsichtig über die kühle Tischdecke und konnte dabei die Stickereien unter seinen Fingerspitzen spüren. Das polierte Silberbesteck funkelte und die glänzenden Unterteller reflektierten die Flammen der Kerzen. Die Suppe wurde serviert, eine duftende dunkle Consommé, unter den Fettaugen drängten sich Grießklößchen, Markklößchen und gewürfeltes Rindfleisch, die Gemüsestreifen waren beeindruckend fein geschnitten. Der Vater war aufgestanden, schlug den Suppenlöffel ans leere Wasserglas und dankte der Festgesellschaft für ihre Anwesenheit, erwähnte weite Anfahrtswege und die großzügigen Gaben, wünschte dann einen guten Appetit, bevor alles kalt werde. Gustav tauchte den Löffel in die Suppe, probierte vorsichtig.
Er mochte die Brühe der Mutter, die oft als Suppe auf den Tisch kam, mit Suppennudeln als Vorspeise zu einem süßen Auflauf mit Obst, an seltenen Tagen schwammen bleiche Maultaschen mit Hackfleisch-Spinatfüllung darin, ein Festessen. Zur Herstellung diese Bouillon gab Mutter Maria hilf ins kochende Wasser, ein gelbes Brühpulver mit getrockneten Kräutern, der Vater dunkelte die klare Suppe bei Tisch mit Maggiwürze ein, bis Mutter »Josef!« sagte. Aber diese Brühe hier war anders. Salziger, würziger, klarer und dunkler, sie schmeckte intensiv und fleischig, es war, als hätte jemand Mutters Brühe übertrieben. Die Grießklößchen zerfielen, wenn man sie am Gaumen zerdrückte, mischten sich im Mund mit der Brühe zu einer Köstlichkeit, die Markklößchen waren von cremiger Konsistenz. Gustav löffelte schneller, während der Vater sich mit Arturo darüber stritt, ob Schildkröten in der Suppe seien. Arturo war sich sicher, sprach von Tierquälerei und rührte seine Suppe nicht an. Wie aus dem Nichts näherten sich die Kellner dem Tisch, kaum dass die Löffel gesunken waren, hoben mit ruhigen, beinahe synchronen Bewegungen und ernsthaften Mienen die Teller von den Tischen, schenkten Wein nach. Onkel Arturo sprach lange mit der hübschen Bedienung, die Gustav zu seinem Platz geführt hatte, nickte dabei unentwegt und zeigte seine weißen Zähne. Die Mutter hatte sich zu Herrn Rögger gesetzt, auch sie redeten miteinander, eigentlich sprach nur Herr Rögger, und immer wieder sahen beide zu Gustav hinüber, seine Mutter lächelte jetzt, wenn sich ihre Blicke trafen. Schon öffnete sich die Küchentür wieder, auf schweren Glastellern wurden Landschaften aus bunten Salaten serviert, darauf je zwei gebratene Fischfilets, die mit cremiger Sauce beträufelt waren.
»Unser Duett von Bodensee-Felchen und Egli an salade mesclun mit Kerbel-Hollandaise«, erklärte der älteste der Kellner, alle am Tisch klatschten. Der Salat war bitter und scharf, Gustav pickte die süßen Tomatenwürfel heraus, verteilte sie auf den buttrig-nussigen Fischfilets, auf denen die wolkenweich-luftige Sauce langsam schmolz, es war das Beste, was er je gegessen hatte.
Es war lauter am Tisch geworden, fordernd wurden Weingläser in die Luft gehalten, hellgelber Müller-Thurgau floss aus schweren grünen Flaschen und befeuerte die Gespräche und Witze der Tischgesellschaft. Gustav war müde geworden und blinzelte in die Nachmittagssonne. Die Terrasse vor dem Panoramafenster war in goldenes Licht getaucht, die zugeklappten Sonnenschirme warfen lange Schatten. Große Platten mit Schweinerollbraten, Rinderfiletsteaks und Putenschnitzeln wurden hereingetragen.
»Vorsicht, heiß!«, rief einer der Kellner, der eine Auflaufform mit Kartoffelgratin auf eine der zuvor verteilten Wärmeplatten stellte, cremig blubberte die fette Sahne zwischen den goldbraunen Kartoffelscheiben. Auch dampfende Butterspätzle kamen auf den Tisch und ertranken nur kurze Zeit später in dunkler Morchelsauce. Die Kellner trugen jetzt weiße Stoffhandschuhe und servierten die Gemüse, grüne Bohnen und Möhren, mit Vorlegebesteck von nadelfein zerkratzten Goldplatten, die hübsche Bedienung brachte Gustav noch eine Cola.
Ob er mal die Küche sehen wolle, fragte ihn das Mädchen plötzlich, und Gustav errötete. Die Mutter, die die Frage mitbekommen hatte, nickte ihm über die Tafel hinweg aufmunternd zu und Gustav nickte daraufhin seinem Colaglas zu.
»Also dann«, sagte das Mädchen aufmunternd, und Gustav folgte ihr, den Blick auf den Fußboden gerichtet, nur kurz sah er ihre schwarzen Schuhe mit dem hohen Absatz. Das Lärmen und Lachen der Festgesellschaft wurde leiser, und als das Mädchen die Schwingtüren zur Küche öffnete, war das Restaurant hinter ihnen verschwunden, gleißendes Neonlicht erhellte den weitläufigen, fensterlosen Raum. In der Hitze schwitzten über Töpfe gebeugt die Köche, blaugelbe Flammen züngelten an rußschwarzen Pfannen, entzündeten sich am heißen Fett, dazwischen kurze, laute Rufe, knappe Befehle. Schwere Stahltüren öffneten sich im weißen Kachelwerk, kurz waren die Stahlregale der Kühlhäuser zu sehen, in denen sich volle Gemüsekisten stapelten, in Eiswannen lagen glänzende Fischleiber, die Mäuler weit geöffnet, als schnappten sie nach Luft. Jemand trug ein großes Stück Fleisch an Gustav vorbei, Blut lief über die Hände des Mannes, der das Stück auf einen massiven Holzklotz warf, breite Knochen ragten aus dem dunkelroten Fleisch heraus. Mit einem Beil schlug der Koch mächtige Steaks aus dem Stück, zwinkerte Gustav zu, der sich umdrehte: Das Mädchen war verschwunden. Gustav lief einfach weiter, in jene Richtung, in der er den Ausgang und die Türe zum Restaurant vermutete, in dem seine Familie saß. In einem riesigen Aquarium kämpften Krebse miteinander, kreuzten die Scheren, die sich öffneten und schlossen.
»Hechtklößchen mit Krebsschwänzen können in drei Minuten.«
»Oui, Chef!«, brüllte der Mann, den Gustav nicht hatte kommen hören. Der Koch fuhr mit einer großen löchrigen Kelle ins Becken, balancierte bald darauf fünf Krebse durch die Küche, Gustav folgte ihm interessiert. Der Mann warf die graugrünen Krebse in einen Topf mit kochendem Wasser. Die Tiere verschwanden augenblicklich zwischen Zwiebelringen, Lorbeerblättern und grob geschnittenem Gemüse, tauchten Sekunden später wieder an der Oberfläche auf, die Panzer jetzt leuchtend rot. Kurz tauchte der Koch die Tiere aus dem Sud in ein Bad aus Eiswürfeln und Wasser, drehte, riss und trennte dann die Schwänze vom Körper der Krebse, brach die schützenden Panzer zwischen Daumen und Zeigefinger, zog das Fleisch aus der harten Hülle. Die Schwänze sahen aus wie dicke rote Raupen. In einer Pfanne schmolz Butter, der Koch schnitt die Raupen am Rücken ein, zog mit einer Pinzette etwas langes schwarzes aus dem Krebsschwanz. »Ist der Darm«, sagte er und warf die Krebsschwänze in die knisternde Butter, schwenkte die Pfanne kurz, würzte mit Salz, griff in ein Kästchen und bestreute alles mit gehackter Petersilie. Danach griff er nach einem kleinen Blech, auf dem Küchenpapier lag, verteilte den Inhalt der Pfanne darauf und schob das Ganze unter eine Lampe. Aus einem zweiten Topf fischte er dampfende weiße Klöße, die er ebenfalls auf das Blech gab. »Hechtklößchen kann!«, schrie der Koch jetzt.