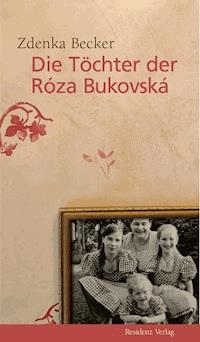Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jede Woche besucht die Tochter ihren alten Vater, der zu Hause im Rollstuhl sitzt und in Erinnerungen an die Vergangenheit lebt - an seine Ehe mit einer schönen Kommunistin, an seine berufliche Laufbahn, die ihn vom einfachen Polizisten bis zum Polizeipräsidenten im Westen der Slowakei führte. Für seine Karriere entscheidend war ein spektakulärer Fall: Es gelang ihm, eine brutale Mörderin zu überführen, die ihren Mann enthauptet hatte. Jetzt, Jahrzehnte danach, wünscht sich der Vater, dass die Tochter ein Buch über seinen größten Fall schreiben soll … Obwohl sich diese anfangs zu wehren versucht, nimmt die Geschichte, die auch ihre eigene ist, sie mehr und mehr gefangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deuticke E-Book
Zdenka Becker
Der größte Fall
meines Vaters
Roman
Deuticke
Die Arbeit an diesem Roman wurde durch Stipendien des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur unterstützt.
Gefördert durch das Land Niederösterreich
ISBN 978-3-552-06220-7
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2013
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it’s been clear
George Harrison, Beatles
Eins
Jeden Samstagvormittag knöpfe ich das Hemd meines Vaters auf, lockere die Gürtelschnalle und ziehe ihm seine Hose aus. Ab diesem Zeitpunkt läuft alles nach einer viele Male erprobten Choreographie ab: Ich greife unter seine Achseln, verschränke meine Hände hinter seinem Rücken und ziehe ihn mit Schwung in die Höhe. Er steht, wackelt ein bisschen, rudert mit den Armen in der Luft, versucht sich irgendwo anzuhalten, erwischt meine Schultern, in die er seine knorrigen Finger krallt. Dann verlagert er sein Gewicht auf ein Bein, schiebt einen Fuß vor den anderen und geht an meiner Hand vorsichtig ins Badezimmer. Das Geräusch seiner Hausschuhe, die über den Boden schleifen, begleitet uns.
Samstag ist Badetag.
Unter der Last seiner fast neunzig Jahre gebückt, hält er sich an den Griffen in der Dusche fest, lässt das warme Wasser auf seinen Nacken prasseln, genießt die Wärme, die ihm mit den Jahren abhandengekommen ist. War er früher noch verfroren, kühlt er jetzt regelrecht aus, wie er immer wieder betont. »Die Pumpe muss sich mehr anstrengen«, sagt er oft und meint damit sein Herz, das von Jahr zu Jahr schwächer wird.
Ich schrubbe seinen Körper mit einem Waschlappen ab und benutze Hirschseife, die einzige Sorte, die er akzeptiert. Langsam komme ich hinter alle Hautfalten, greife zwischen seine Beine, spüre sein Geschlecht, verdrehe meinen Kopf und schließe zur Sicherheit auch die Augen, um den Aufprall ungewollter Intimität zwischen Tochter und Vater abzuschwächen. Blind taste ich um Gebiete, die nicht für mich bestimmt sind, und erspüre eine Verhärtung im linken Hoden, der größer und praller als der rechte ist. Unfähig, ihn mit meiner Entdeckung zu konfrontieren, entscheide ich, den Knoten ein bis zwei Wochen zu beobachten und erst dann einen Arzttermin zu vereinbaren.
Stumm spüle ich den weißen Schaum mit einem sanften Wasserstrahl ab. Der Vater steht nackt wie Gott ihn nicht schuf da und zittert, bedankt sich für das angewärmte Tuch auf seinen Schultern mit einem ergebenen Blick und macht einen Schritt auf mich zu. So stehen wir im Bad: der hilflose Vater, nur gefaltete Haut und Knochen, und ich, seine Tochter, der er als einzigem Menschen erlaubt, ihn zu baden, obwohl eine Pflegerin, Frau Gabi, sechs Tage in der Woche für ihn sorgt.
Die Samstage gehören nur uns beiden.
Ich ziehe ihm einen frischen grau-grün gestreiften Pyjama an, alle seine Pyjamas sind grau-grün gestreift, lege ihn zum Aufwärmen ins Bett und koche für uns beide ein Mittagessen – einen Eintopf aus Gemüse und Nudeln. Seine Portion zerdrücke ich mit einer Gabel und füttere ihn, weil er nach dem Duschen immer sehr geschwächt ist. Das Lätzchen unter seinem Kinn färbt sich rot, grün und gelb. Er schmatzt und verdreht dabei genussvoll die Augen. Nach dem Mahl schließt er sie und schläft tief und fest.
Seit fast zwei Jahren sitzt Vater im Rollstuhl. Er kann nicht mehr gehen, abgesehen von wenigen unbeholfenen und zittrigen Schritten in der Wohnung. Die Schwäche in den Beinen kam schleichend. Zuerst schmerzten die Hüften, dann die Knie, später erschlafften seine Muskeln so stark, dass sie ihn nicht mehr tragen konnten. Am Anfang verkroch er sich und blieb zu Hause, verweigerte alle Ausfahrten. Die Untersuchungen bei verschiedenen Ärzten, die er nicht ablehnen wollte und konnte und zu denen er von der Rettung abgeholt wurde, bedeuteten eine Qual für ihn. Liegend oder sitzend transportiert, auf einer Trage in die Ordination geschoben – er, der früher mit bloßem Blick sein Gegenüber zum Strammstehen und Salutieren gebracht, der seiner Umgebung Respekt eingeflößt hatte.
Seine ersten Opfer waren Zivildiener. Junge Männer, die, statt mit der Waffe in der Hand dem Vaterland zu dienen, Kranke von zu Hause ins Krankenhaus und vom Krankenhaus nach Hause trugen, die in Alten- und Pflegeheimen den alt, gebrechlich und der Pflege bedürftig gewordenen Teil der Bevölkerung beim Essen unterstützten, ihm den Hintern auswischten, bei der Körperpflege halfen und ihn nachmittags spazieren fuhren. »Warum bist du kein Soldat geworden?«, schrie er den ersten, der in seine Wohnung kam, streng an. »Hast du Angst vor Ordnung und Disziplin?«
»Ich mag keine Waffen. Und das Schießen schon gar nicht.«
»Das ist keine Antwort.«
»Soll ich Sie fallen lassen?«
»Untersteh dich!«
»Ich will helfen.«
»Indem du frech bist? Wer ist dein Vorgesetzter?«
Für den Nachmittagsspaziergang ziehe ich Vater seine Ausgehuniform an. Ohne die Uniform verlässt er das Haus nicht mehr. Er ist nicht wie andere Pensionisten, die in ausgebeulten Jogginganzügen ihre Tage verbringen. Mein Papa ist jemand. Mein Papa war jemand. Er war Polizeipräsident, jemand, der es gewohnt war, dass ihm die Menschen Respekt entgegenbringen.
Mein Vater Teodor Mudroch trug zeit seines Lebens, zuerst als Leutnant, Oberleutnant und Kapitän, am Ende seiner Laufbahn als Major, Oberst und Landespolizeipräsident, eine unsichtbare Uniform. Aber seit er im Rollstuhl sitzt, braucht er die richtige, die ihm die fehlende Würde verleiht. Ich ziehe sie ihm nach dem samstäglichen Mittagsschlaf an: die graue Hose mit den roten Streifen an der Seitennaht, das hellblaue Hemd, die dunkelblaue Krawatte mit roten und silbergrauen Streifen, die schwarze Jacke mit Medaillen auf dem Revers. Ja, auch die Medaillen müssen sein. Je eine für seine Heldentaten während des Zweiten Weltkriegs für die Verteidigung des Vaterlandes, für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft und für den Titel Held der sozialistischen Arbeit. Zum Schluss setze ich ihm seine flache Kappe mit dem Stern über dem Schild auf, die aus ihm definitiv einen Polizisten macht, einen, der, obwohl sitzend, von seiner wahren Größe nichts eingebüßt hat.
Manche Menschen, die wir während des Spaziergangs treffen, lächeln, manche lachen, drehen sich nach uns um und rufen: »Ist schon Karneval?« Es wird sicher auch solche geben, die sich hinter unserem Rücken auf die Stirn tippen – die sieht der Vater zum Glück aber nicht, und mich interessieren sie schon lange nicht mehr.
»Guten Tag, Herr Präsident«, grüßt die mollige Frau vom Magistrat freundlich und reicht meinem sitzenden Vater die Hand, wobei sie sich zu ihm bückt. In ihrem Kreuz knarrt es gefährlich, sie spürt einen kleinen Stich zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel, aber sie lächelt trotzdem. Im Ausschnitt ihres blaugeblümten Kleides faltet sich überschüssige Haut zu abstrakten Gebilden, die direkt vor seiner Nase baumeln.
Ich weiß als einzige, welche Gedanken meinem Vater bei einem solchen Anblick in den Sinn kommen, sage aber nichts, schaue ihn nicht einmal an, um ihn nicht zu ermuntern, seinen üblichen Satz »Ich fühle mich sexuell belästigt« auszurufen und damit die gute Frau zu beleidigen. Seit mein Vater alt ist, wirklich alt, kümmert er sich nicht mehr um gesellschaftliche Umgangsformen und sagt jedem, der es hören will, und vielen, die es nicht hören wollen, was er sich gerade denkt. Wäre die Frau jünger, knackiger und ihr Busen straffer, hätte er sicher gefragt: »Zu dir oder zu mir?«, und die Frau wäre errötet, hätte sich ein bisschen geziert und gesagt »Aber Herr Präsident« und würde am nächsten Samstag vor unserer Tür mit einem selbstgebackenen Kuchen stehen, mir vorschlagen, mich endlich auszuruhen, weil sie sich für ein paar Stunden um meinen Vater kümmern würde.
»Habe die Ehre«, ruft sein ehemaliger Kripo-Assistent Laco Jahoda schon von weitem und hebt dabei umständlich seinen Hut. Erst vor kurzem ließ er seine beiden, von verknöcherten Spornen geplagten Schultern operieren, weil er die Arme nicht mehr heben konnte. Doch trotz der Operation bewegen sich seine Arme oberhalb der Brust äußerst ungeschickt und lassen keinen Zweifel daran, dass auch frisch ausgefräste Gelenke keine jungen Gelenke sind.
Wir treffen Jahoda jeden Samstag auf unserem Spaziergang, sodass in mir der Verdacht erwacht, er halte sich absichtlich jedes Mal in dem Park auf, den Vater und ich regelmäßig durchqueren. Von Papa weiß ich, dass Jahodas Frau gestorben ist, die Kinder im Ausland leben und er an schrecklicher Einsamkeit leidet. »Wie geht es Ihnen?«, fragt er freundlich, und mein Vater antwortet mit einem nach oben gerichteten Daumen, woran ich ablesen kann, dass er heute besonders gut drauf ist. Jahoda ist etwa achtzig Jahre alt und kann noch gehen. Mit einem Stock. Aber wie lange noch? Angesichts meines Vaters auf Rädern wird ihm die eigene Zukunft bewusst.
»Was macht die Gesundheit, Chef?«, fragt Jahoda mehr aus Gewohnheit als aus echtem Interesse und stellt sich uns in den Weg.
»Wie immer, wie immer, Laco. Und deine?«
Mein Vater spricht jeden, der jünger ist als er, und sei es nur um ein paar Jahre, mit Du an, bietet aber das gegenseitige Duzen niemals an. So entstehen oft skurrile Situationen, weil sein Gegenüber zwar jünger ist, aber manchmal betagter wirkt als er selbst. Zwei alte Männer: der eine der Präsident, der andere »ein junger Spund«.
Kaum haben wir uns von Jahoda verabschiedet, der uns traurig nachschaut, baut sich eine neue Barriere auf. »Guten Tag, Herr Nachbar! Sie sehen heute besonders gut aus, wie in den alten Zeiten«, schleimt die Schreckschraube (Zitat Papa) vom ersten Stock, der wir unseren Schrebergarten überlassen haben. »Und die Uniform! Die heutigen sind nicht mehr so schön wie die alten. So viel Silber auf den Aufschlägen macht sie edel.« Mein Vater hebt die rechte Hand an die Schläfe, ruft begeistert »Práci česť«1, was die Frau mächtig irritiert, weil der sozialistische Gruß nach dem Fall des Eisernen Vorhangs provokant klingt, und lässt sich von mir so schnell wie möglich zum Eissalon schieben, um die unmögliche Person hinter uns zu lassen. Es ist die Erdbeer-Zitrone-Vanille-Zeit, die wir gern in einem Glasbecher stochernd auf der Terrasse genießen.
Die Serviererin, die uns im »Roma«, einer von einem echten Italiener betriebenen Gelateria, bedient, sieht aus, als ob sie die ganze Zeit wegen irgendetwas böse wäre. Es ist möglich, dass sie wegen uns schlechter Laune ist, dabei kennt sie Vater und mich seit Jahren und meinte sogar einmal, aber nur einmal, dass sie uns jeden Samstag erwarte und dass sie sich den ganzen Winter auf uns freue.
Hinter der Glasvitrine stehen Behälter mit vielen bunten Eissorten, zu denen mein Vater die ganze Zeit schielt; erst dann bemerke ich die junge Wasserstoffblondine, die im schalbreiten Minirock davorsteht und eines ihrer nackten Beine an dem anderen reibt. Beim Anblick nackter Beine, das war schon immer so, wird mein Vater ganz jung. Er starrt sie mit einer Mischung aus Verzückung, Unruhe und Konzentration an.
»Die Italienerinnen sind die schönsten Frauen auf der Welt«, sagt er.
»Und wie viele davon kennst du?«
Er verdreht genussvoll die Augen und erzählt, dass er während des Kriegs, eigentlich kurz davor, in Italien gewesen sei und – das war natürlich noch lange, bevor er die Mama kennenlernte – eine heiße Affäre an der Adria erlebt habe. »Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, würde ich gern nach Italien fahren. Einfach so.«
Ich schaue seinen Rollstuhl an, greife nach seiner Hand und tätschle sie leicht. Noch bevor ich etwas sagen kann, erscheint die Verkäuferin aus der nahen Konditorei auf der Terrasse und schreit schon von weitem: »Gut, dass ich Sie hier treffe, Herr Präsident, wir haben gerade frische Cremeschnitten bekommen. Ich habe Ihnen ein paar zur Seite gelegt.« Sie setzt dabei ein Gesicht auf, als hätte sie gerade ein Staatsgeheimnis verraten, und nimmt unaufgefordert an unserem Tisch Platz.
*
Wenn die Nachbarn nur wüssten, wie mein Vater ihre falsche Fürsorge hasst. Wie er ihre Freundlichkeiten und Hilfsangebote jeder Art so gut es geht meidet, mit welchem Widerwillen er ihre schleimigen Aussagen über sein gutes Aussehen in der Polizeiuniform zur Kenntnis nimmt. Aber vor allem widern ihn die Gespräche an, die um ihre Enkelkinder kreisen, denen sie huldigen und die sich in ihren Worten aus minderbegabten, pickeligen und aufmüpfigen Jugendlichen in wahre Genies verwandeln.
»Meiner hat die Mathematikolympiade gewonnen. In der Logik kann ihm keiner das Wasser reichen.«
»Unsere Kleinste ist die Klassenbeste. Und sie spielt Blockflöte so schön, dass einem das Herz aufgeht. Bei der Schul-Muttertagsfeier war sie der Star.«
»Der Große von den dreien schaffte es auf ein amerikanisches College. Er hat das Zeug dazu, die Welt aus den Angeln zu heben.«
Aber das Schlimmste für meinen Papa ist, dass diese Greise ihre eigene Existenz und selbst ihre Daseinsberechtigung tatsächlich über eben diese »missratenen Fratzen« definieren, die auf amerikanischen Colleges mit dem schwer verdienten Geld ihrer Eltern studieren und sich deshalb für etwas Besonderes halten, während die Alten sich selbst als Humus sehen, dem diese fragwürdige Genialität entsprossen ist. Die Selbstverleugnung der Alten bringt ihn jedes Mal wieder in Rage. Er sitze zwar im Rollstuhl, sagt er, aber solange er noch klar denken und Gutes von Schlechtem unterscheiden könne, sei er nicht blöd.
Die Zwillinge meines Bruders, Michi und Dani, seine einzigen Enkelkinder, denn ich versagte in dieser Hinsicht, hält er keineswegs für genial. In dem Jungen, der sich laut Papa einredet, ein begnadeter Künstler zu sein, sieht er einen Pseudobohemien, der seine Untalentiertheit mit dem Pinsel zu vertreiben versucht und dabei seinen Eltern das Geld aus der Tasche zieht; das Mädchen, das mit seinen Reizen, und nur mit seinen Reizen, sich als Schauspielerin an heruntergekommenen Bühnen lächerlich macht, hält er für eine – eigentlich spricht kein Großvater das hässliche Wort aus, und er hat es auch nie ausgesprochen, sondern nur angedeutet – dumme Gans, die von ihrer mediengeilen Mutter schlecht beraten worden sei.
*
Das mit der Würde ist so eine Sache. Man hat sie oder man hat sie nicht. Mein Vater wollte sie immer haben. Vielleicht ist er gerade deswegen Polizist geworden. Aber er war einer, der es sich einrichten konnte, wie ein Beamter jeden Tag um halb fünf nach Hause zu kommen, obwohl er in seinen jungen Jahren als ermittelnder Oberleutnant tätig war. Außerhalb der Bürozeiten arbeitete er selten, es sei denn, es passierte etwas so Ungewöhnliches wie der einzige Mordfall in seiner fünfunddreißigjährigen beruflichen Laufbahn.
Eine junge Frau betritt den Eissalon, mein Vater verdreht den Kopf nach ihr. Sie ist etwa dreißig Jahre alt, hat braune, lockige, schulterlange Haare und auffällig schöne, kornblumenblaue Augen. Sie bestellt eine Familienpackung Eis, die Verkäuferin geht nach hinten, um das Bestellte zu holen. Mein Vater fixiert die junge Frau und murmelt dabei: »Das gibt es doch nicht.«
»Papa, wer ist das?«
»Sie erinnert mich an jemanden.«
»An wen?«
Die Verkäuferin kommt, übergibt der Kundin, die das Geld auf den Tresen legt, eine Plastiktüte mit Eis. Erst als die junge Frau sich von der Terrasse, auf der wir sitzen, entfernt, beginnt er zu erzählen: »Ich würde schwören, die habe ich schon irgendwo gesehen.«
»Beruflich oder privat?«
»Die Augen … die kenne ich.« Dann winkt er plötzlich ab und arrangiert sich, wie es scheint, mit seiner fortschreitenden Vergesslichkeit. Jetzt gilt seine ganze Aufmerksamkeit wieder nur dem Eis vor ihm.
»Was hast du die ganze Woche gemacht?«, fragt er mich und schiebt umständlich den Eislöffel in seinen Mund. Eine rosagelbliche Masse rinnt an seinem Kinn hinunter. Ich greife nach einer Serviette und wische ihm das Gesicht ab. Wenn man mir vor Jahren gesagt hätte, dass ich meinen Vater eines Tages wie ein kleines Kind behandeln würde, hätte ich ihn ausgelacht. Heute ist es für mich die normalste Sache der Welt, ihn im Rollstuhl zu fahren, ihn zu füttern und zu baden. So wie meine Eltern mich in der Kindheit mit dem Kinderwagen spazieren fuhren, mich fütterten und badeten, so fahre ich ihn spazieren, füttere und bade ihn.
»Warst du verreist?«
»Nein. Ich habe geschrieben«, lüge ich, »die ganze Zeit nur geschrieben.« Schon längst verkneife ich mir, ihm Details aus meinem Alltag zu erzählen, weil er einerseits vieles nicht versteht und deshalb unzählige Fragen stellt oder andererseits sich so hemmungslos in meine Angelegenheiten einmischt, dass wir jedes Mal in heftigen Streit geraten. Wenn ich ihm erzählen würde, dass mich gerade ein Stalker mit seinen E-Mails belästigt, würde er mich zwingen, ihn zu mir zu nehmen, natürlich bewaffnet, damit er den lästigen Mann, der seine Tochter nicht in Ruhe lässt, erschießen könne. Es würde nichts nützen, ihm zu erklären, dass ich den Mann (wer weiß, vielleicht ist es eine Frau) gar nicht kenne, weder sein Gesicht noch seinen Namen, dass er ein unsichtbares Phantom in der elektronischen Unterwelt ist und sich, wenn ich ihm keine Aufmerksamkeit schenke, bald ein anderes Opfer suchen wird.
»Lara, woran arbeitest du gerade?«, will er wissen.
Ich erzähle ihm mit wenigen Sätzen den Inhalt meines geplanten Buchs, verschweige jedoch, dass ich es zwar gerne schreiben würde, aber im Moment nicht kann. Wann immer ich mich an den Computer setze, breitet sich in meinem Gehirn schwere Düsternis aus, die mein Denken behindert. Außerdem plagen mich jedes Mal Kopfweh und eine Leere, die ich bisher nicht gekannt habe. Mein Arzt nennt es Spannungsschmerz, macht meine sitzende Tätigkeit für die Beschwerden verantwortlich, rät mir zu mehr Sport oder am besten zu verreisen und zu entspannen. Ich betrachte meinen Vater, der ohne mich den Halt verlieren würde, und spüre, dass mein Urlaub warten wird müssen.
Er kratzt in der Eisschale nach den letzten Resten der süßen Versuchung, die ich ihm trotz des ausdrücklichen ärztlichen Verbotes einmal in der Woche zu essen erlaube. Dann greift er nach den Eishippen, schiebt sie in den Mund, zermalmt sie geräuschvoll mit seinen Dritten und erst als er die letzten Brösel schluckt, regt er beiläufig an: »Schreib einmal etwas Vernünftiges. Schreib über mein Leben als Polizist.« Er blickt dabei in die Richtung, in der die junge Frau mit der Familienpackung Eis verschwunden ist.
»Was?«
»Schreib einmal etwas über einen echten Kriminalfall. Ich werde dir dabei helfen.«
Wie er auf die Idee mit dem Kriminalfall gekommen ist, weiß ich nicht. Er hat in seinem ganzen Leben keine Bücher gelesen, jedenfalls keine Romane, schon gar nicht Kriminalromane. Seine einzige Lektüre waren Zeitungen, in denen er seine politische Überzeugung bestätigt sah, und die kriminalistischen Zeitschriften, die immer noch in seinem Wohnzimmerschrank stehen, in Schubern nach Jahrgängen sortiert.
Diese kriminalistischen Zeitschriften waren ein richtiger Schatz, denn dank ihnen war ich ein beliebtes Mädchen in der Klasse. Am Nachmittag, wenn niemand bei uns zu Hause war und wir Schlüsselkinder nach einer spannenden Beschäftigung suchten, weil das Ärgern der Nachbarin von der dritten Stiege uns nicht mehr freute, saßen wir auf der Couch, blätterten die Magazine durch und suchten nach Bildern mit verletzten und toten Menschen. Je blutiger, umso besser.
Da waren Unfallopfer mit zertrümmerten Gliedmaßen, missbrauchte Frauen und Kinder, bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Körper und halb verweste Wasserleichen. Diese Schwarzweißbilder, auf denen echtes Blut zu sehen war, erschreckten und zogen uns gleichzeitig magisch an. Vor allem Mädchen, nachdem sie das erste Foto erblickt hatten, klappten blitzschnell die Zeitschrift zu und fingerten dann vorsichtig nach der Stelle, wo das Bild war, das ihnen so viel Schrecken eingejagt hatte, um den Kopf in den so entstandenen Spalt zu stecken. Aus dieser Perspektive war natürlich nichts zu sehen, deshalb vergrößerten sie langsam den Abstand zwischen den Seiten so lange, bis die Aufnahmen wieder richtig zu sehen waren. Dann saßen oder knieten wir alle rund um den Couchtisch mit aufgerissenen Augen und Händen vor dem Mund und gaben uns einer kollektiven Furcht hin. Jeder von meinen Gästen musste mir versprechen, von unserem Geheimnis niemandem etwas zu erzählen, was die Zusammengehörigkeit zwischen uns Eingeweihten noch mehr vergrößerte. Dass mein Vater von unserem Hobby nichts wissen durfte, brauche ich nicht zu erwähnen. Und er dachte sich auch nichts dabei, die Zeitschriften im offenen Wandschrank stehen zu lassen. Vor ihm zeigte ich nie Interesse an ihnen, weil ich wusste, dass er sie sofort wegsperren würde.
Jeden Monat wartete ich mit großer Ungeduld auf die neueste Ausgabe, die Vater nach Hause brachte und die er an den folgenden Abenden mit großer Akribie las. Ich las die Artikel nicht. Auch nicht heimlich. Und auch keiner meiner Freunde vertiefte sich in einen dieser mit kleiner Schrift auf Glanzpapier gedruckten Berichte. Die Bilder allein reichten uns.
*
»Komm, Papa, wir gehen heim.« Ich hole mich in unsere Samstagsrealität zurück, während ich seine untere Gesichtshälfte mit einer Serviette abtupfe. Ein leichter Wind, der sich erhoben hat, wirbelt sanft die restlichen Papierservietten vom Tisch und lässt sie zwischen den Stühlen tanzen. »Hoffentlich fängt es nicht gleich zu regnen an«, sage ich und schaue besorgt zum Himmel.
»Du hast meine Frage nicht beantwortet«, murmelt er unter dem weißen Zellstoff und ringt nach Luft.
»Was für eine Frage?«
»Du sollst einmal einen Krimi schreiben.«
»Das war doch keine Frage, sondern ein Befehl.«
»Ist das ein Unterschied?«
»Hängt dein Wunsch mit der jungen Frau, die wir gerade gesehen haben, zusammen?«
»Vielleicht«, sagt er nachdenklich. »Im Leben hängt alles mit allem zusammen.«
Ich gehe und schiebe ihn im Rollstuhl vor mir. Die mit Blüten dicht behängten Ahornbäume begleiten uns auf dem Rückweg. Wir begegnen fremden Menschen, die angesichts von Vaters Festtagsbekleidung lachen oder lächeln und nicht wissen, dass die Uniform keine Verkleidung, sondern das reale Leben ist. Die Sterne auf den Aufschlägen und die fast täglich polierten Medaillen sind für ihn die zweite Haut, die er über seiner alten und kranken trägt.
*
Vater hat mich verwirrt. In mir schwirren Gedanken. Sie wirbeln in meinem Kopf wie die vom Wind von den Tischen des Eissalons entführten Papierservietten.
Auf einmal sehe ich mich als Kind auf seinem Schoß sitzen und betteln: »Papa, Papa, erzähle mir etwas von der Jagd auf die Verbrecher.« Und Vater erzählt harmlose Geschichten aus seinem Polizistenalltag, und ich höre ihm zu, und in meinem Kopf läuft ein spannender Film. Da werden die Diebe gefangen, vor Gericht gestellt, verurteilt, geknebelt und in ein dunkles Gefängnis gesteckt. Ihre Opfer bekommen eine großzügige Entschädigung und eine Auszeichnung für die Verdienste um den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Mein Sinn für Gerechtigkeit überschlägt sich.
Als Kind spielte ich nie Räuber und Gendarm, darauf war mein älterer Bruder Fedor spezialisiert, der, egal, auf welcher Seite er stand, immer als Sieger hervorging. Seinen Siegeszug zog er auch später durch und wurde nach einer anstrengenden Pubertät und turbulenten Sturm-und-Drang-Jahren, die uns allen, aber vor allem den Eltern zusetzten, mit Ach und Krach Anwalt. Selbstverständlich ein erfolgreicher. Heute lebt er mit seiner zweiten Frau Renata, ihren beiden Töchtern, seinem Papagei aus erster Ehe, den gemeinsamen Zwillingen Michi und Dani, drei Katzen, fünf Wellensittichen und einem Hund namens Othello in hunderten Kilometer Entfernung.
»Das müssen wir gleich der Mama erzählen«, sagt Vater, der sich nach mir umdreht und dabei die Bremse seines Rollstuhls anzieht. »Sie wird sehr stolz auf dich sein«, schreit er in das plötzliche Gequietsche der Räder unter ihm. Auch im Rollstuhl spielen wir die Polizei.
»Was erzählen?«
»Dass du über meinen Kriminalfall schreiben wirst.«
»Aber Papa …«, kontere ich. »Was ich schreibe und wann, das entscheide immer noch ich.« Er schaut mich beinah flehend an, was mich verwirrt. Noch vor ein paar Jahren hätte er mich für eine solche Antwort gerügt. »Für heute ist Schluss«, sage ich entschlossen, damit er nicht nochmals anfängt. »Ich bringe dich nach Hause, und dann muss ich gleich fahren.«
»Fahren wir heute nicht zum Friedhof?«, fragt er, enttäuscht wie ein kleines Kind, obwohl er weiß, dass ich heute nur bis sechs Uhr bleiben kann. Mein Vater würde am liebsten jeden Samstag, wenn ich ihn besuche, zum Friedhof fahren und die Mama und seinen Vater, meinen Opa, die vor Jahren gestorben sind, besuchen, denn Frau Gabi, die ihn von Sonntag bis Freitag betreut, besitzt kein Auto und kann mit ihm keine Ausflüge machen.
»Wir fahren nächste Woche«, verspreche ich ihm. Er greift nach meiner rechten Hand und drückt sie fest. »Ehrenwort?«, fragt er, mich dabei mit seinen undurchsichtigen Expolizistenaugen prüfend.
»Ehrenwort.«
»Und wir fangen auch mit dem Recherchieren an.«
Schon lange habe ich ihn nicht so enthusiastisch erlebt.
*
Das habe ich nun davon, dass ich mich um meinen altersschwachen Vater kümmere, ihn jeden Samstag bade, mit ihm spazieren gehe und ihn zum Eisessen ausführe. Aus heiterem Himmel setzt er mir einen Floh ins Ohr, der nicht aufhört, zu hüpfen und zu flüstern und meine Gedanken auf eine Klippe zuzutreiben und eine Entscheidung zu fordern.
Man darf die Geduld nie verlieren, höre ich meinen Vater sagen, der meine Sprunghaftigkeit zu zügeln versucht. Aber es ist nicht nur die Sprunghaftigkeit, die mich manchmal scheitern lässt, nicht die alle paar Monate stattfindende Übersiedlung meines Arbeitszimmers, deretwegen Armin, mein Mann, alle Zustände bekommt, sondern der nie abreißende Gedankenfluss, der mich oft an einem unbedarften und Zweifeln enthobenen Leben hindert. Unlängst schrieb mir ein Schriftstellerfreund aus einem fernen Land, dass ihm nach vielen Jahren bewusst geworden sei, wie viel Sonnenschein ihm wegen des Schreibens entgangen ist, und dass er, trotz aller Freiheit, keine Wahl gehabt hatte.
Mein Vater weiß nicht, was er sich selbst damit antut, wenn er mich auffordert, über ein Verbrechen zu schreiben, in das er als Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes involviert war. So würde er zusammen mit der Mörderin in den Mittelpunkt der Geschichte rücken und ich als Autorin müsste sowohl die Täterin als auch den ermittelnden Oberleutnant gehörig unter die Lupe nehmen. Um ihnen Charakter einzuhauchen, würde ich nicht nur schwarz und weiß malen, die Mörderin als blutrünstiges Weib und den Ermittler als den gefeierten Helden darstellen können.
Romanfiguren sollen Ecken und Kanten haben, gute und schlechte Eigenschaften, es muss ihnen erlaubt sein, Fehler, die sie menschlicher erscheinen lassen, zu machen, aber auch schwach, ängstlich oder weinerlich zu sein. Aber würde es mein Vater verstehen, wenn ich ihn so beschreibe, wie ich ihn sehe? Es könnte ihm peinlich sein, und ich würde, obwohl ich ihm den Wunsch nach einem Kriminalfall erfülle, als Verräterin dastehen. Ich muss daran denken, dass ich einmal irgendwo gelesen hatte, dass gute Literatur keine Rücksicht auf irgendetwas oder irgendjemanden nehmen dürfe, weil sie sonst wertlos wäre.
Da fällt mir Renata, die Frau meines Bruders, ein. Nachdem sie mein letztes Buch gelesen hatte, mobilisierte sie die halbe Verwandtschaft gegen mich und erzählte allen, wer in Wirklichkeit in dem Roman welche Figur sei, welche Familiengeheimnisse ich ausgeplaudert hätte und dass alles sowieso nicht wahr und ich eine gemeine Lügnerin wäre. Ich verstehe nur nicht, wieso sie sich so aufregte, wenn alles in dem Buch gelogen war. Gelogen ist ausgedacht, und etwas Ausgedachtes kann doch keinen beleidigen. Schon allein die Tatsache, dass sich jemand über eine mehr oder weniger ausgedachte Geschichte mit ein paar Wahrheitssplittern so aufregen kann, motiviert mich, über meinen Vater, wenn nicht gleich, so doch irgendwann später, zu schreiben.
Ich fühle mich wie ein Stein, der auf einen Anstoß wartet, um ins Rollen gebracht zu werden.
*
In der Nacht kann ich nicht schlafen. Ich stehe auf, gehe in die Küche und setze Teewasser auf. Immer, wenn ich nicht schlafen kann, trinke ich Tee aus frischen Minzeblättern, die ich im Hof mit anderen Küchenkräutern in Töpfen züchte. In der Dunkelheit zupfe ich etliche Blätter ab. Der Wind hat aufgefrischt, die Nussbaumblätter rascheln lauter als sonst, am Zaun bellt der Nachbarhund, der wie so oft unter den Sträuchern einen Igel erschnüffelt hat. Noch bevor ich zurück ins Haus gehe, spüre ich die ersten Wassertropfen auf meinem Gesicht.
Der Pfefferminztee duftet nach Sommer. Ich sitze über die dampfende Teetasse geneigt und denke darüber nach, was mir den Schlaf raubt. Armin kommt in die Küche, setzt sich zu mir und erzählt, dass er auch nicht schlafen könne. Der Grund seiner Schlaflosigkeit ist eine längst fällige Haussanierung, zu der er keine Lust hat. »Ich werde es doch nicht tun«, sagt er nach einer Weile. »Nicht in diesem Jahr.« Ich nicke und denke an die undichten Fenster in meinem Arbeitszimmer und die knarrende Heizung, schweige aber, weil ich keine Kraft habe, über die Restaurierung zu sprechen. Ich werde im Herbst neue Gummidichtungen an allen Fensterflügeln anbringen, denke ich, und bin froh über den Aufschub. Gemeinsam legen wir uns nieder, schalten das Licht aus und starren in die Finsternis. Obwohl wir nicht miteinander sprechen, merke ich an seinem Atem, dass er genauso wenig schläft wie ich.
*
Ich hasse Baustellen in unserem Haus. Ich hasse das Klopfen und Hämmern im Nebenzimmer oder auf dem Dach, das mich daran hindert, meine Gedanken zu Ende zu bringen. Da ist es mir viel lieber, wenn Armin, der seit einem Jahr im Ruhestand ist, in einem Fitnessstudio der Bewegung huldigt oder einen Berg besteigt. Er gehört zu den jugendlichen Alten, zu der neuen Generation der Nichtmehrberufstätigen, die beim Frühstück alle wichtigen Zeitungen lesen, Aktienkurse studieren, danach eine Runde joggen, zweimal im Jahr einen Marathon laufen, sich nachmittags im Japanischkurs auf die nächste Reise vorbereiten, beim Kickboxen entspannen, am Abend die angesagte Theaterpremiere besuchen oder bis tief in die Nacht politische Sendungen verfolgen.
Die neuen Alten, die alles sein wollen, nur nicht alt, und von denen einige zu unseren Freunden zählen, betreiben Sport, ernähren sich nur von Salat und Vitaminsäften, radeln danach einige Runden, damit sich der Salat nicht an ihren Hüften festsetzt, suchen im Internet nach einem neuen Partner für ihre sexuell-libidinösen Bedürfnisse, gründen Firmen, lesen nur Informatives und Lustiges, zwecks Pflege der positiven Energie, halten ausschließlich Komödien und Kabarett für Kunst und betreiben ganz nebenbei eine Antirauchkampagne gegen ihre Stammwirte, weil die sich nicht an die Gesetze halten.
Alt sein ist anstrengend, um nicht zu sagen stressig. Da lobe ich mir die paar ruhigen Stunden in der Woche bei meinem Vater.
*
Sobald ich zu meinem Vater fahre und die Stadt meiner Kindheit durchwandere, stolpere ich über Erinnerungen. Anders als die Gegenwart, die knallig, laut und schrill ist, kommt mir die Vergangenheit ruhig, beschaulich und bunt vor. Einfach nur bunt. Ich sehe mich als ein kleines Mädchen in einer Sandkiste spielen, höre die Spatzen und die Meisen zwitschern und erinnere mich daran, einen Mann in den Wolken gesehen zu haben, der mir zuwinkt. Lange dachte ich, dass das Gott persönlich oder zumindest ein Engel wäre, bis mir meine Freundin Elvíra erklärte, dass da oben keiner wohne und das sage sogar der Genosse Gagarin, und der müsse es doch wissen, er war schließlich der erste Mensch im Himmel. Später in der Schule gab ich mich dem Träumen hin, das ich nur dann unterbrach, wenn wir Völkerball spielten oder eine Leichtathletikolympiade organisierten.
Ich war gut im Sport, vor allem der Hochsprung entwickelte sich dank meiner langen, schlanken Beine zu meiner Paradedisziplin, aber auch im Lauf über lange Distanzen gewann ich meistens. Das Gewinnen machte mir Spaß; heute denke ich, dass ich damals danach süchtig war, der Mama zu imponieren. Ich wollte so sein wie sie: schön, erfolgreich und unerschrocken.
Es ist halb fünf Uhr nachmittags, mein Vater steigt aus dem Autobus. Ich laufe zu ihm, werfe mich ihm um den Hals, nehme ihm die braune Ledertasche mit zwei Gürtelschnallen ab und begleite ihn nach Hause. Weil ich schon ein großes Mädchen bin, wärme ich ihm sein Abendessen, das die Mutter vorbereitet hat. Sie selbst wird später kommen, heute hat sie eine Sitzung, sie hat sehr oft Redaktionssitzungen, in denen es um wichtige Frauenangelegenheiten geht.
Meine Mama, Anna Mudrochová, ist Redakteurin einer Frauenzeitschrift, die den sozialistischen Frauen den Weg weist. Ohne diese Zeitschrift wüssten die Frauen nicht, dass sie ihre Kinder mit Liebe erziehen sollen, sie hätten keine Ahnung davon, wie man Pullover strickt, Pflanzen umtopft, Marmelade einkocht, einen Koffer für den Urlaub packt und ganz nebenbei die Schönste auf dem Betriebsball ist.
Meine Mama ist sehr schön, manche behaupten, ich sehe ihr ähnlich. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich keine hohen Stöckelschuhe trage. Ich wage es nur manchmal, wenn sie nicht da ist und ich ihre Kleider anprobiere. Wenn ich dann eines nach dem anderen vom Kleiderbügel nehme und auf dem Bett ausbreite, riechen sie nach ihr und geben mir, nur für einen Augenblick, das Gefühl, sie wäre da.
Mamas Vorliebe für die russische Literatur beeinflusste die Wahl unserer Vornamen. Meinem älteren Bruder gab sie den Namen Fedor nach dem russischen Dichter Fjodor Dostojewski, mich nannte sie Lara wie die große Liebe des Doktor Schiwago. Sie selbst hieß Anna und verglich sich oft mit der Figur der Anna Karenina, die mich beim Lesen zu Tränen rührte.
Mama ist selten zu Hause, weil sie sich beruflich verwirklichen will. Und damit sie sich wirklich verwirklichen kann, muss sie (sie sagt, sie muss, aber ich darf es nicht so sagen) nebenbei eine politische Karriere anstreben, die auch Zeit kostet. Wenn es ihr gelänge, Vorsitzende der sozialistischen Frauen zu werden, könnte sie vielleicht bald den Posten der Chefredakteurin übernehmen. Ich möchte aber nicht, dass sie Chefredakteurin wird, denn dann wird sie nämlich nie zu Hause sein.
Auch mein Bruder, der sich stets mit seinen Kumpels irgendwo herumtreibt (Zitat Mama) und auf die Schule ebenso wie auf die Karriere pfeift, weshalb er eines Tages unter der Brücke landen wird (Zitat Papa), kommt nur zum Schlafen in die Wohnung. Als Familie bleiben nur der Papa und ich übrig. Er unterschreibt meine Schulnoten, und ich wärme sein Abendessen auf. Danach schauen wir fern.
Der Schlaf entführt mich in das Land der Träume. In der Früh bin ich stolz auf meine Seele, die so viel erlebt und gesehen hat. Manchmal beneide ich sie, weil sie viel mehr Freiheit genießt als ich. Aber nur Seele sein, das möchte ich auch nicht. Seit der Uropa tot ist, weiß ich, dass die Seelen selten wieder auf die Welt kommen.
*
Mein Vater war Polizist. Sein Ressort war die Kriminalität bei der Bahn. Meistens ging es dabei um Diebstähle, die damals an der Tagesordnung waren, aber die Diebe konnten selten ausgeforscht werden. Wie denn auch? Zu dem Zeitpunkt, zu dem das Opfer bemerkte, dass die Brieftasche oder die teure Uhr fehlte, war der Dieb schon längst über alle Berge. Der Bestohlene kam aufs Revier, machte eine Anzeige, einer der Beamten – wenn überhaupt jemand anwesend war – schrieb ein Protokoll. Mein Vater schrieb nie Protokolle, das machte Cilka für ihn, seine Sekretärin, weil er selbst an der Schreibmaschine nicht einmal die »Adlermethode« mit einem Finger beherrschte.
Über Cilka, die eigentlich Cecilia hieß, sprach er oft. Er nannte sie aber nur im Büro so, zu Hause sprach er immer nur vom Frettchen, weil ihn ihr Gesicht an einen Nager erinnerte. Frettchen macht ständig Tippfehler, Frettchen kommt zu spät, Frettchen ist ständig beim Arzt oder beim Einkaufen, nicht einmal einen ordentlichen Kaffee kann Frettchen kochen. Wenn sich Vater ärgerte, war dem Frettchen der ganze Abend gewidmet.
Manchmal war er, wie er es selbst nannte, im Terrain. Er hielt sich dann in Verschiebebahnhöfen auf, kletterte auf die Güterwaggons, kroch unter ihre Räder, suchte zwischen den Puffern nach Spuren, inspizierte die aufgebrochenen Plomben, die ihm die Bahnbediensteten zeigten. Bei solchen Terminen waren auch Sachverständige dabei und natürlich die Vertreter der Firmen, die die Ware an ihre Kunden verschickt hatten. Und weil im sozialistischen System die beschädigte Ware keinem gehörte, regte sich auch niemand von der Versicherung auf. Der Schaden wurde entweder sofort beglichen oder die betroffene Firma konnte ihn anstandslos abschreiben.
Nur die Polizei konnte keinen Erfolg verzeichnen.
Es war nicht einfach, in so einem Fall zu ermitteln. War der Waggon zum Beispiel in Košice noch ordnungsgemäß verschlossen, entdeckten die Eisenbahner in Bratislava, dass die Plomben aufgebrochen worden waren und die Güter zum Teil fehlten. Die ganze Ware war nie weg. Die Diebe waren arme Leute und besaßen keine Fahrzeuge, die den Inhalt eines Eisenbahnwaggons fassen hätten können. Es fehlten also nur ein paar Fernseher, Radios, Autoreifen, Ersatzteile, Koks, Kohle, Holz oder kleinere Möbelstücke, Stoffe und Bekleidung. Die Liste könnte endlos fortgesetzt werden.
»Ein aufgebrochener Waggon ist wertlos«, sagte mein Vater. »