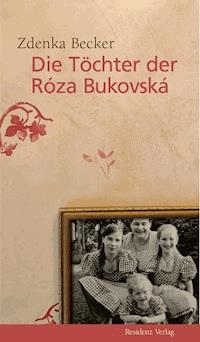Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Macht der Erinnerung Hilde und Karl könnten einen beschaulichen Lebensabend verbringen, wäre da nicht Karls zunehmende Demenz und die bevorstehende Übersiedelung ins Altersheim. Am Dachboden findet Hilde eines Tages eine Kiste mit alten Briefen – und während das Gedächtnis ihres Mannes immer mehr nachlässt, wird die Vergangenheit für Hilde umso lebendiger. Die Briefe führen sie zurück in jene Zeit, als Karl und sie verlobt waren, getrennt durch familiäre Verpflichtungen, Karls Arbeit in Berlin – und das NS-Regime, das bald seinen Schatten über ihr junges Glück wirft. Als auch noch ein Hobbyhistoriker beginnt, Fragen nach dem Verschwinden von Hildes Nichte zu stellen, droht ihr das Geflecht aus Lügen, das sie um ihr Leben aufgebaut hat, zusehends zu entgleiten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ES ISTSCHONFASTHALBZWÖLF
ZDENKABECKER
ROMAN
Notiz
Obwohl dieser Roman auf realem Briefwechsel basiert, ist die Handlung frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Alexander Moritz
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2022 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagmotiv: © mauritius images/Pixtal
Abbildung Seite 235: Archiv Zdenka Becker
Lektorat: Senta Wagner
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 10,9/13,1 pt Alegreya und der 9,5/13,1 pt Brevia
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-220-4
eISBN 978-3-903217-95-9
Inhalt
FISCHBACH, 17. AUGUST 2008
FISCHBACH, 17. AUGUST 2008, NACHT
FISCHBACH, 18. AUGUST 2008, MORGEN
FISCHBACH, 18. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 18. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 18. AUGUST 2008, NACHT
FISCHBACH, 19. AUGUST 2008, VORMITTAG
FISCHBACH, 19. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 20. AUGUST 2008
ST. PÖLTEN, 21. AUGUST 2008, MORGEN
FISCHBACH, 22. AUGUST 2008, VORMITTAG
FISCHBACH, 23. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 23. AUGUST 2008, ABEND
FISCHBACH, 23. AUGUST 2008, ABEND
FISCHBACH, 24. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 24. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 25. AUGUST 2008, VORMITTAG
FISCHBACH, 25. AUGUST 2008, MITTAG
FISCHBACH, 25. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 25. AUGUST 2008, ABEND
FISCHBACH, 26. AUGUST 2008, MITTAG
FISCHBACH, 26. AUGUST 2008, ABEND
BERLIN, 21. JUNI 1941
FISCHBACH, 27. AUGUST 2008
BERLIN, 19. APRIL 1942
FISCHBACH, 28. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 28. AUGUST 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 3. JÄNNER 1943
BERLIN, 18. FEBRUAR 1943
FISCHBACH, 23. FEBRUAR 1943
FISCHBACH, 29. AUGUST 2008
FISCHBACH, 29. AUGUST 2008, ABEND
FISCHBACH, 6. SEPTEMBER 1943
FISCHBACH, 30. AUGUST 2008
FISCHBACH, 31. AUGUST 2008
FISCHBACH, 1. SEPTEMBER 2008, MORGEN
Berlin, 23. JÄNNER 1944
FISCHBACH, 3. SEPTEMBER 2008
FISCHBACH, 4. SEPTEMBER 2008, VORMITTAG
FISCHBACH, 4. SEPTEMBER 2008, NACHMITTAG
MOSBACH, 16. SEPTEMBER 1944
FISCHBACH, 4. SEPTEMBER 2008, NACHMITTAG
MOSBACH, 22. OKTOBER 1944
FISCHBACH, 6. SEPTEMBER 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 24. DEZEMBER 1944
MOSBACH, BARACKE 17A, 16. JÄNNER 1945
MOSBACH, BARACKE 17A, 18. FEBRUAR 1945
FISCHBACH, 7. SEPTEMBER 2008, NACHMITTAG
FISCHBACH, 7. SEPTEMBER 2008, SPÄTER NACHMITTAG
ST. PÖLTEN, 11. OKTOBER 2008, NACHMITTAG
DANK
FISCHBACH, 17. AUGUST 2008
Die Haustür geht auf. Im Türrahmen erscheinen eine alte Frau und ein alter Mann. Beide wirken unbeholfen und blicken sich unsicher um. Die Frau greift nach dem Arm des Mannes, wobei sie sich am Handlauf, der neben der Tür montiert ist, mit der freien Hand abstützt.
»Komm, Karl«, sagt sie ruhig, »draußen ist es jetzt nicht mehr so heiß.«
Der alte Mann schiebt einen Fuß nach vorne, lässt ihn ein paar Zentimeter sinken, mühevoll erreicht er die erste Stufe. Die Frau macht es ihm nach und steigt gleich, ein wenig eckig, beinah forsch, die zweite Stufe hinunter. »Bald hast du es geschafft«, murmelt sie mehr für sich als für ihren Gatten, der zwar hölzern, aber doch ohne Panne die beiden Stufen in den Hof schafft und nun neben der Zuckerfichte vor dem Eingang steht.
»Gehen wir nach Hause?«, fragt er.
»Karl, wir sind zu Hause.«
»Seit wann?«
Die alte Frau winkt ab und führt Karl zum Gartentisch unter dem Nussbaum. Auf dem gedeckten Tisch stehen eine Thermoskanne mit zwei Kaffeetassen, daneben ein flacher Plastikbehälter, unter dessen Abdeckung einige Mehlspeisstücke durchschimmern.
»Schau, Vroni hat uns einen Kuchen gebacken.«
»Ich möchte nach Hause gehen«, murrt der Alte und bleibt neben seinem Stuhl stehen. Mit einer Hand hält er sich an ihm fest, mit der anderen fährt er durch sein schütteres, weißes Haar, gleitet über das Gesicht, berührt seine spröden Lippen. »Bitte, bringen Sie mich nach Hause.«
»Karl, noch einmal – wir sind zu Hause. Ich bin seit fast 70 Jahren deine Frau, ich heiße Hilde und wir haben zwei Kinder, vier Enkelkinder mit fünf Urenkeln, die alle woanders wohnen und uns manchmal besuchen. Wir sind eine Familie.« Ihre feste Stimme wird langsam brüchiger. »Soll ich dir etwas von unseren Kindern erzählen?«
»Na gut, dann bleibe ich, aber nur auf eine Tasse.« Karl setzt sich umständlich nieder, legt seine von Altersflecken übersäten Hände auf den Tisch und schaut die Frau vor ihm an, die ihm irgendwie bekannt vorkommt, die er aber nicht einordnen kann. »Und jetzt?«, fragt er. »Was machen wir jetzt?«
»Wir trinken ein, zwei Tässchen Kaffee, essen Kuchen und genießen die Sonne.«
»Und wenn jemand kommt und uns von hier verjagt?«
»Niemand wird uns von hier verjagen«, sagt Hilde, während sie ein Stück Zwetschkenkuchen auf einen der Teller platziert. »Hmmm, der duftet aber köstlich. Probier mal!«
»Ich will nach Hause.«
»Karl, wir sind zu Hause. Das hier ist unser Haus.«
»Seit wann?«
»Eigentlich seit immer.«
»Seit immer? Das gibt es nicht.«
Hilde greift nach der Hand ihres Mannes und drückt sie. »Karl, ich lebe hier schon immer«, betont sie, »weil ich in diesem Haus geboren worden bin, und du bist auch hier zu Hause, seit wir verheiratet sind.«
»Wir sind verheiratet? Seit wann?«
»Das habe ich gerade gesagt, seit fast 70 Jahren.« Die alte Frau wird nachdenklich. »Warte«, sagt sie nach einer Weile, »im Februar waren es genau 67 Jahre.«
»Wie denn? Zuerst 70 und dann 67 Jahre? Liebe Dame, Sie haben es nicht so genau mit der Wahrheit.«
Hilde sagt nichts mehr. Sie schiebt sich ein Stück Kuchen in den Mund und kaut langsam. »Der schmeckt hervorragend. Jetzt probier doch mal.«
Karl nimmt ebenfalls eines und stopft es ganz in den Mund. »Wenn Sie meinen«, brummt er, wobei Biskuitbrösel und Zwetschgenmus auf sein Hemd fallen. Weder Karl noch seine Frau kümmern sich darum. Was ist schon ein schmutziges Hemd gegen ein paar Minuten Ruhe? Trotz ihres hohen Alters weiß Hilde, dass sie sich nicht mehr auf einer Geraden vorwärtsbewegt, wie sie es immer angestrebt hatte, sondern sich im Kreis dreht. Der Dämon der Vergesslichkeit hat nicht nur über ihren Karl Macht gewonnen, er greift unbarmherzig auch nach ihr. Sie spürt, wie die Tage in diffuses Licht schwinden, ihre Konturen verlieren, blasser werden.
Es ist ein warmer Sommer, Mitte August. Die Bäume im Garten tragen viel mehr Obst als in den vergangenen Jahren. Das Rot der Äpfel leuchtet durch das Laub, die überreifen Birnen fallen ins Gras. Die Ameisen und Wespen feiern ein Fest.
Doch plötzlich wird die nachmittägliche Idylle durch ein lautes Geräusch gestört. Ein Rasenmäher frisst sich im hinteren Teil des Gartens durch das Gras, ein junger Mann in kurzen Jeans und einem blauen T-Shirt schiebt das Gerät vor sich her.
»Wer ist das?«, schreit Karl auf und wird unruhig. »Ist das ein Einbrecher?«
»Nein, Karl, beruhige dich. Das ist Markus. Der kommt öfter zu uns.«
»Ist er mein … unser … nein, unser Sohn ist er nicht.«
»Markus ist ein Zivildiener. Er hilft uns den Garten in Ordnung zu halten. Und er macht für uns Besorgungen. Ein sehr netter Bursche.«
»Ich dachte schon …«
Hilde ist müde. Ihr eigenes Alter macht ihr genug zu schaffen, aber seit es mit Karl angefangen hat, erträgt sie den Alltag immer schwerer. Schon vor Jahren begann er vergesslicher zu werden, wer wird es nicht, wenn er den Achtziger hinter sich gelassen hat. Es fängt mit dem Brillensuchen an, die Hausschlüssel sind auf einmal weg, die Fernbedienung war vor einer Minute noch da, von Menschen, die ständig kommen und gehen und die man nicht erkennt, gar nicht zu sprechen.
»Das ist für Ihr Alter normal«, sagte die Hausärztin und verschrieb beiden ein Ginkgo-Präparat, das den ermüdeten Gehirnzellen auf die Sprünge helfen sollte. Je eine Tablette in der Früh, zu Mittag und am Abend, Tag für Tag, und dann vergisst man, die Tabletten zu nehmen, man findet sie nicht mehr, verdammt, wo sind die blöden Pillen, sie lagen doch gerade noch auf dem Tisch.
»Frau Doktor, wie soll ich weiter mit meinem Mann zusammenleben, wenn er nicht mehr weiß, wer ich bin?«
»Er hat doch sicher auch etwas hellere Momente. Sprechen Sie mit ihm über Ihr Leben.«
»Wir haben viel durchgemacht. Zuerst der Krieg, dann die schwere Arbeit, und als die Kinder in die Stadt gingen, um zu studieren …« Hilde legte ihr Gesicht in die gefalteten Hände und stöhnte. »Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer unser Leben war.«
»Ja, sicher. Das Leben besteht aus schönen und weniger schönen Tagen. Das sogenannte Glück besteht, wie Sie wissen, nur aus kurzen Augenblicken. Der Rest ist Alltag. Holen Sie das Schöne zu sich, blättern Sie in den Familienalben, sprechen Sie mit Ihren Kindern, Nachbarn, Freunden, schaffen Sie sich ein Tier an. Eine Katze wäre am einfachsten.«
»Als Trudi und Karli noch klein waren, hatten wir zwei Katzen und einen Hund.«
»Sehen Sie, es kann sein, dass Ihr Gatte durch Tiere, die im Hof herumrennen, seine innere Orientierung wiedergewinnt. Zumindest teilweise.«
»Zu uns kommen manchmal Nachbarskatzen. Und Sie meinen …?«
»Ja, geben Sie den Besuchskatzen warme Milch, dann werden sie öfter kommen.«
Obwohl Karl sehr früh die Konturen seines Lebens verloren hatte, wusste er genau, dass da etwas war, da, in seinem Kopf, in seiner Seele, konnte aber die Geschichten nicht mehr abrufen. Irgendwo schien sich ein Vakuum gebildet zu haben, ein Leerraum, als ob ein volles Lager ausgeräumt worden war. Gähnende Leere. Wie konnte das nur passieren? Wohin ist sein Leben verschwunden?
Sie verließen die Ordination Hand in Hand und stützten einander beim Gehen. Auf der Straße wartete schon Vroni auf sie mit laufendem Motor, half ihnen einzusteigen und brachte sie nach Hause.
»Karl, am Wochenende kommen die Kinder«, sagt Hilde und legt sich ein zweites Stück Kuchen auf den Teller. »Sie wollen mit uns etwas Wichtiges besprechen. Du kannst dir schon denken, was.«
»Was?«
»Sie meinen, dass wir es in einem Seniorenheim leichter hätten als hier. Bequemer und vor allem sicherer.«
»Und wer bringt mich heute nach Hause?«
Wenn Trudi und Karli es ernst meinen und sie in ein Heim geben, was wird dann aus ihnen?, denkt Hilde. Das Haus wird verkauft und jemand wird in den Sachen herumwühlen, die ihr Leben ausmachten. Was wird aus den Geheimnissen, von denen nur sie wissen? Hilde stockt. In dem Moment durchfährt sie etwas wie ein Dolch. Sie weiß, die Sache duldet keinen Aufschub. Nervös fuchtelt sie mit den Händen, greift Karl an den Schultern und rüttelt ihn. »Karl, wir müssen etwas unternehmen.«
Das Rasenmähergeräusch hat endlich aufgehört. Jetzt rumort Markus in der Scheune, ordnet die Gartengeräte, rollt den Wasserschlauch ein. »Ich bin fertig!«, ruft er in Richtung Tisch, an dem die beiden Alten wie erstarrt sitzen.
»Brauchen Sie noch etwas, Frau Dorn?«
»Ja, bitte … würden Sie noch …«
Markus kommt näher, klopft seine schmutzigen Hände an der Hosennaht ab, zieht aus der Tasche ein Taschentuch und säubert sich provisorisch.
»Wollen Sie ein Stück Kuchen mit uns essen?«
»Nein, danke … ich wollte gerade …«
»Lernen können Sie auch am Wochenende.« Hilde versucht zu scherzen, was ihr in dem Moment nicht sonderlich gut gelingt.
»Meine Freundin wartet auf mich.«
»Na, dann lassen Sie sie nicht warten.«
»Aber Sie wollten doch etwas.«
»Ja, Sie bitten, eine Kiste vom Dachboden zu holen, aber das hat Zeit. Vielleicht morgen.«
»Wenn Sie wollen, hole ich sie sofort. Das geht schnell. Um welche geht es?«
»Die große dunkelbraune mit dem Holzdeckel. Sie steht direkt rechts neben dem Aufgang unter den Dachbalken. Ich hoffe zumindest, dass sie immer noch dort steht. Ich war schon lange nicht mehr oben.«
»Das haben wir gleich«, ruft Markus fröhlich und seine Schritte donnern schon über die fragile Holztreppe, die zum Dachboden führt. Der junge Mann legt eilig ein paar zusammengerollte Teppiche auf die Seite, verschiebt die Verpackungskartons eines Fernsehers und einer Waschmaschine, wirbelt Staub auf, entdeckt die gesuchte Kiste und müht sich mit ihr auf den Hof.
»Wo soll ich sie hinstellen?«, fragt er.
»Lassen Sie sie unter dem Dachvorsprung stehen. Ich werde sie gleich abstauben.«
»Darf ich?«
»Nein, nein, Sie haben mir schon genug geholfen. Laufen Sie zu Ihrer Freundin. Liebe soll man nicht warten lassen.«
Und weg ist er, der junge, ungestüme Mann, fast noch ein Kind. 23 Jahre ist er alt, Student, im letzten Semester hat er sein Bachelorstudium in Wirtschaft und Management abgeschlossen. Und bevor es mit dem Masterstudium weitergeht, leistet er seinen Zivildienst ab. Alle wundern sich über die Unterbrechung, nur Hilde nicht, sie weiß, warum er das Jahr braucht. Markus sitzt manchmal mit ihr zusammen und weiht sie in seine Pläne ein. Er erzählt ihr Dinge, die er sich nicht traut, seinen Eltern gegenüber zu äußern. Karl würde ihn, wenn er könnte, am liebsten wegschicken, aber Hilde liebt den Jungen, weil er sie an ihren Lieblingsenkel Max erinnert.
Am Abend kommt Vroni wie jeden Tag noch einmal und unterstützt Karl beim Waschen und Umziehen. Bevor sie ihn ins Bett legt, hilft sie ihm beim Essen, danach schlichtet sie das benutzte Geschirr in den Geschirrspüler, wischt den Tisch ab, kehrt die Brösel vom Boden und geht. Hilde sitzt noch eine Weile im Hof, schaut der heraufziehenden Dunkelheit zu, beobachtet den Mond, wie er sich langsam von links nach rechts bewegt. Eine schmale Sichel, ähnlich der, die sie in ihren jungen Jahren auf dem Acker und im Garten verwendet hat.
Wie oft hat sie ihn schon angehimmelt. Wie oft hat sie mit Karl draußen gesessen und ihm Wünsche geschickt, an seine magische Kraft geglaubt. Aber der Mond schwieg. Manchmal erspürte er ihre innersten Träume und machte sie wahr, andere Male enttäuschte er sie und schickte ihr nur kaltes Licht. Wie viele Jahre ist das her? Es ist schon fast nicht mehr wahr.
Hilde schaut nach Karl, der im Ehebett friedlich schläft und leise schnarcht. Sie stellt ein Glas Wasser auf das Nachtkästchen, richtet seine Bettdecke und schaltet das Licht aus. Sie weiß, ihr Mann wird bis Mitternacht fest schlafen, dann aufwachen, hektisch versuchen aufzustehen und verlangen, nach Hause gebracht zu werden. Er wird toben, schreien und betteln, so wie jede Nacht, aber früher oder später gewinnt die Müdigkeit, und er wird sich von Hilde ins Bett zurücklegen lassen.
Bevor sie das Schlafzimmer verlässt, fällt ihr Blick auf zwei Fotos, die neben der Tür an der Wand hängen. Trudi mit ihren dünnen Mäusezöpfchen und einer großen Zahnlücke. Ihre Milchzähne sind ausgerechnet zwei Tage vor dem Termin beim Fotografen ausgefallen. Karli, er war gerade neun Monate alt, steht in einem gestrickten Anzug auf einem Stuhl, eine unsichtbare Hand hält ihn, damit er nicht herunterfällt. Wie sehr er ihr damals wegen seiner abstehenden Ohren leidtat. Später, als er schon den Kindergarten besuchte und die Ohren immer noch nicht anlagen, klebte sie sie ihm über Nacht mit einem Pflaster am Kopf fest, was aber nichts nutzte. Hilde wendet sich von den Fotos ab und geht. Es ist halb neun. Sie hat noch mindestens drei Stunden Ruhe, die sie heute nützen möchte.
Draußen steht die Kiste. Auf der dicken Staubschicht kann man noch die Handabdrücke von Markus erkennen, Spuren seines Körpers, gegen den er die schwere Last beim Tragen über die steile Treppe gedrückt hat. Hilde kehrt den Staub mit einem kleinen Besen herunter, streicht über den Deckel und versucht ihn anzuheben, aber er lässt sich nicht öffnen. Und wenn er angenagelt ist?, schießt es ihr durch den Kopf. Sie schiebt ihre Finger in den Spalt zwischen der Kiste und dem Deckel und zieht an ihm. Sie spürt eine leichte Bewegung. Na also, denkt sie. Kurz entschlossen eilt sie in die Werkzeugkammer und holt Hammer und Meißel aus der Werkzeugkiste. Geschehe, was geschehe, sie muss die Kiste heute aufbringen.
Sie führt den Meißel in den Spalt und klopft dagegen. Hoffentlich wird Karl von dem Krach nicht wach, denkt sie und hört trotz der berechtigten Sorge nicht mit dem Hämmern auf. Der Meißel dringt immer tiefer ein, sie spürt Holzspäne an ihrer Hand, und da macht es einen Ruck und der Deckel springt auf. Mühevoll schiebt sie ihn zur Seite und erkennt von der schwachen Hoflaterne beleuchtet einen Stapel Zeitungen in der Kiste.
»Das darf nicht wahr sein«, entkommt es ihr. »Hat Karl die Briefe etwa vernichtet?«
Hilde greift nach dem Zeitungspapier, durchwühlt es panisch, es knistert spröde unter ihren Fingern, und stößt auf ein Bündel Briefe. Erleichtert nimmt sie es heraus und drückt es an ihre Brust.
Ludwigsfelde, 2. Februar 1938
Liebste Hilde!
Ich bin gut angekommen und arbeite seit gestern in der Fabrik. Schade, dass Du die Halle, in der ich beschäftigt bin, nicht sehen kannst. Groß, sauber und mit den besten Werkzeugen ausgestattet, die man sich nur vorstellen kann. Manche davon habe ich noch nie gesehen. Hier zu arbeiten macht wirklich Spaß. Der Meister hat mein Zeugnis begutachtet, dann zeigte er mir meine Werkbank und sah mir eine Weile zu. Ich glaube, ich habe ihn mit meiner Präzision überzeugt, weil er die ganze Zeit genickt und sogar ein bisschen gelächelt hat. Als er ging, klopfte er mir auf die Schulter.
In der Wohnbaracke habe ich ein Bett in einer Stube mit sechs Betten bekommen, einen Stuhl für meine Sachen und einen verschließbaren Spind. Mehr brauche ich im Moment nicht.
Heute war ich beim Bürgermeister wegen meiner Karteikarte. Da habe ich auf der Amtstafel zwei Trauungen angeschlagen gesehen. Das eine Paar wird am 14., das andere am 21. März getraut. Mir war dabei richtig warm ums Herz. Bei uns wird es auch bald so weit sein.
Wir haben noch zu Hause ausgemacht, dass wir, wenn es geht, im April heiraten werden. Ich glaube, es wäre am besten gleich nach Ostern. Das wäre am Sonntag, den 16. April. Wäre Dir das recht? Andererseits, wenn wir später heiraten würden, könnte ich Ende Mai, Anfang Juni schon meinen Urlaub bekommen, und wir könnten eine kleine Hochzeitsreise machen. Oder ist es Dir zu spät?
Schreibe mir, wie Du darüber denkst. Und vergiss nicht, den Trauschein Deiner Eltern beizulegen. Ich werde dann aufs Gemeindeamt gehen, mich über alles erkundigen und uns gleich anmelden. Und noch etwas: Wir werden in Ludwigsfelde heiraten, nicht in Berlin. Es sei denn, Du möchtest auch kirchlich kopuliert sein, damit es besser hält. Das ginge natürlich auch in Berlin.
Wegen der Wohnung habe ich mich auch schon umgehört. Es wird am besten sein, wir nehmen uns für den Anfang ein möbliertes Mansardenzimmer, dann werden wir weitersehen. Es steht uns alles offen – einen Baugrund zu kaufen oder uns in einem Neubau eine Mietwohnung zu nehmen. Hier wird heuer viel gebaut. Aber wenn sich in Berlin eine günstige Wohnmöglichkeit findet, werden wir sie natürlich wahrnehmen, und ich werde mit der Bahn in die Arbeit nach Ludwigsfelde fahren. Das ist nicht weit. Etwa eine halbe Stunde.
Wichtig ist nur, dass Du kommst und wir heiraten und gemeinsam unseren Hausstand gründen. Du kannst Dir sicher sein, wir werden eine schöne Wohnung finden, Möbel kaufen, dafür gibt es günstige Ehestandsdarlehen, und ein schönes Leben zusammen beginnen. Unsere Liebe wird uns über alle Hindernisse hinweghelfen.
Inzwischen ist es schon sehr spät und ich gehe schlafen. Gute Nacht, meine Liebe. Träum was Schönes.
Viele Bussis, Dein Karl
FISCHBACH, 17. AUGUST 2008, NACHT
Es ist kurz vor Mitternacht. Hilde sitzt immer noch im Hof und strengt ihre Augen an. Sie spürt die Nachtkälte, fröstelt ein wenig. In den Händen hält sie Karls ersten Brief, der sie in eine ganz andere Wirklichkeit entführt. Ihr ist, als ob gerade ein Theatervorhang aufginge und sie auf einer Bühne stünde. Sie erkennt die Kulissen, riecht den alten Staub, bis in den letzten Nerv spürt sie den Sog der teuflischen Idee, ein Großdeutsches Reich zu erschaffen. Sie macht Hitler, der dabei die Regie führte, für die größte Tragödie ihres Lebens verantwortlich. Es ist aber nicht nur die Vergangenheit, die sie gerade vereinnahmt, sondern es sind vor allem die Geschehnisse in jenen schicksalhaften Jahren, von denen Karl nichts weiß und die sie seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht aus dem Kopf bekommt.
Was war da alles? Krieg, Heirat, Trennung, unzählige Versprechen? Vielleicht die Hoffnung auf ein besseres Leben? Schuld? Eine große Schuld, die ihr bis heute auf den Schultern lastet, ein Geheimnis, das sie mit ihrer Nichte Lina teilt, und die Gewissheit, ein Leben lang einem Toten manchmal näher zu sein als den Lebenden?
Ist es das, wovon die Frau Doktor sprach? »Blättern Sie in den Familienalben, sprechen Sie mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, erinnern Sie sich.«
Die dicke Brille rutscht ihr bis zur Nasenspitze und droht ganz herunterzufallen. Hilde hält sie mit der rechten Hand auf, setzt sie ab und legt die Bügel zusammen. Genug für heute, denkt sie, morgen ist auch noch ein Tag. Doch dann fragt sie sich – ist es überhaupt zulässig, den Geist aus der Flasche zu lassen und mit der Illusion zu spielen, dass alles noch gut werden wird?
Sie steht auf, schwankt dabei leicht, der Schwindel macht ihr gerade jetzt zu schaffen. Trotzdem gelingt es ihr, den Kistendeckel zu schließen, die Briefe, die sie doch gerade erst wiederentdeckt hat, sollen nicht feucht werden. Langsam, die Pantoffeln über den rauen Beton schleifend, bewegt sie sich in Richtung Haus. »Mama, Mama«, hört sie schon im Vorzimmer ihren Mann rufen und weiß, dass die Nacht vorläufig zu Ende ist. Aber das ist ihr in dem Moment herzlich egal.
Fischbach, 27. Februar 1938
Lieber Karl,
vielen Dank für Deinen lieben Brief. Wie schön ist es zu wissen, dass es Dir gut geht.
Die Heiratsurkunde meiner Eltern und auch die anderen Dokumente habe ich auf der Gemeinde besorgt. Nur weiß ich immer noch nicht, ob ich schon im Frühjahr zu Dir kommen kann. Elfi möchte nicht, dass ich gehe. Sie droht, dass sie sich und Lina etwas antut, wenn ich sie allein im Haus lasse. Sie schafft die Arbeit im Stall und auf den Feldern nicht, die Kleine ist noch zu jung, um ihr zu helfen, und die Pacht von der Bäckerei wird sie auch nicht aus der Misere herausreißen. Der Fischer zahlt wenig, und das auch nicht regelmäßig. Das ist ein Jammer. Der Papa hätte ihn schon längst hinausgeworfen.
Weißt Du, Karl, wenn ich es mir so richtig überlege, es ist schon ganz schön egoistisch von mir, meine Schwester im Stich zu lassen, wo ich ihr bei der Geburt der Kleinen versprochen habe, immer auf sie beide aufzupassen. Sicher, ich war damals selbst noch ein Kind, aber versprochen ist versprochen. Und ich liebe die Kleine, als ob sie meine eigene Tochter wäre, das kannst Du mir glauben.
Deshalb mein Vorschlag: Ich werde heuer die Feldarbeit noch mit Elfi zusammen verrichten. Wenn wir Glück haben, bekommen wir noch ein, zwei Knechte dazu. Nach der Ernte werden wir nach einem geeigneten Pächter suchen, und ich komme gleich zu Dir. Heiraten können wir auch im Herbst.
Bitte, sei mir nicht böse. Ich möchte nicht nur eine gute Ehefrau, sondern auch eine gute Schwester und Tante sein.
Mit den allerliebsten Grüßen und vielen Bussis
Deine Hilde
FISCHBACH, 18. AUGUST 2008, MORGEN
Was für eine kurze Nacht. Beinah schlaflos. Hilde und Karl liegen noch in ihren Betten. Wenn Karl aufwacht, wird sie sich an ihn schmiegen, denkt die alte Frau, und ihm das Gefühl geben, dass sie zu ihm gehört. Das wird ihnen beiden guttun. Und er wird fragen, »Wer sind Sie? Und was wollen Sie von mir?«, Hilde aber bald erkennen und ihr etwas von seinem wehen Knie und seinen Kreuzschmerzen erzählen. Währenddessen rumort Vroni in der Küche und bereitet den beiden ein Frühstück: Malzkaffee, Haferflockenbrei, ein Butterbrot mit selbst gemachter Marmelade. Mundgerecht geschnitten, wie sie es gernhaben.
Vroni kommt auch aus dem Dorf. Sie wohnt nur ein paar Häuser weiter. Ihr Mann ist vor ein paar Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, die einzige Tochter hat nach Innsbruck geheiratet, hat dort Familie und Kinder und kommt die Mutter nur alle paar Monate besuchen. Und Vroni kann nicht mit gefalteten Händen im Schoß dasitzen, sondern will helfen. Die Dorns kennt sie schon seit Jahrzehnten; mit ihrer Tochter Trudi ging sie in die Schule. Danach arbeitete sie im städtischen Seniorenheim als Altenpflegerin. Jetzt kümmert sie sich nur noch um Hilde und Karl.
»Was ist das für eine Kiste im Hof?«, fragt Vroni. »Soll ich sie wegräumen?«
»Nein, bitte nicht, lass sie dort, wo sie ist. Markus wird sich am Nachmittag darum kümmern«, erwidert Hilde, die gewaschen und vollständig angezogen die Küche betritt. Zum Glück kann sie sich noch selbst pflegen, wenn auch sehr mühsam. Aber wie lange noch?
Karl hingegen lässt das Morgenritual über sich ergehen: Waschen, Anziehen, Morgenübungen, Frühstücken. Er wehrt sich nicht mehr gegen Vronis Berührungen und das feuchte Tuch im Gesicht, wenn sie ihn nach dem Essen reinigt. Bewusst oder unbewusst versteht er, dass die einzige Alternative ein Pflegeheim, vielleicht sogar eine Pflegestation wäre, und das möchte er mit allen Mitteln verhindern. Als er noch gesund und fit war, sprach er oft davon, dass er auf gar keinen Fall in einer Aufbewahrungsstätte alter Knochen und weicher Gehirne landen möchte. Lieber bringe er sich um. Das sagt man gern, solange man noch Kraft hat, dachte Hilde damals, aber jetzt glaubt sie es, weil Karl bei aller Schwäche und Hilflosigkeit immer noch ein willensstarker Mensch ist.
1938 war er ein gut aussehender Mann Anfang 20, der Träume und Ziele hatte und Hilde von ganzem Herzen liebte. Aber die Zeiten waren schlecht. Trotz einer abgeschlossenen Lehre als Mechaniker fand er in seiner Umgebung keine Anstellung. Er schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, unterstützte seinen Vater in der Schlosserwerkstatt, reparierte Fahrräder, Motorräder, Nähmaschinen, half den Bauern in der Landwirtschaft, aber ein fester Posten war nicht in Sicht. Und dann hörte er von den Flugmotorenwerken von Daimler-Benz in Ludwigsfelde bei Berlin, die Mechaniker wie ihn suchten und gute Verdienstmöglichkeiten sowie eine Existenzgründung für junge Menschen boten. Ende Jänner 1938 fuhr er mit der Bahn dorthin. Im gleichen Jahr begann sich vieles im Land zu verändern.
Fischbach, 13. März 1938
Lieber Karl,
ich muss Dir gleich schreiben, weil so einen Menschenauflauf unsere Stadt noch nie gesehen hat. Ich war mit der Steffi auf dem Weg zum Markt, um Honig zu besorgen. Wir haben unsere Fahrräder durch die Stadt geschoben, da hielt uns schon ein Polizist auf. Er sagte, dass wir nicht ins Zentrum fahren dürfen, weil der Führer angekommen ist und vor dem Pittner-Hotel so viele Menschen stehen, dass man gar nicht durchkommen kann. Karl, stell Dir das nur vor, der Führer war höchstpersönlich da, und Frau Machatsch sagte, dass er nur wegen der Karfiolsuppe nach St. Pölten gekommen ist, die ihm Frau Pittner schon bei seinem letzten Besuch gekocht und serviert hat.
Natürlich habe ich mich darüber sehr gewundert. Was? Eine Karfiolsuppe? Warum nicht eine kräftige Rindssuppe oder zumindest Hühnersuppe, aber nein, die Karfiolsuppe musste es sein, weil, das wirst Du, lieber Karl, nicht erraten, unser Führer ein Vegetarier sein soll. Steffi sagte, dass er am liebsten Eiernockerl mit grünem Salat isst. Warum nicht, dachte ich, mir schmecken sie auch, aber immer nur die Eiernockerl und die Karfiolsuppe, das wäre mir auf die Dauer nicht genug, vor allem dann, wenn ich mir auch etwas Besseres leisten könnte. Der Führer könnte, wenn er wollte, täglich ein knuspriges Schnitzel oder einen saftigen Schweinsbraten auf dem Teller haben, aber ein Vegetarier ist eben ein Vegetarier und so einen zu verstehen, fällt mir richtig schwer.
Wir haben zu Hause zwei Schweine geschlachtet, Alois hat uns dabei geholfen. Das ganze Fleisch haben wir verkauft und aus den Innereien Würste und Blunzen gemacht. Aber auch davon haben wir das meiste verkaufen müssen, damit ein bisschen Geld ins Haus kommt und wir die Rechnungen bezahlen können.
So, lieber Karl, jetzt habe ich Dir die Ohren vollgequatscht und gehe schlafen.
Eine große Umarmung und viele Bussis!
Deine Hilde
Ludwigsfelde, 17. März 1938
Liebste Hilde!
Sei bitte vorsichtig mit dem, was Du schreibst und sagst. Man kann ja nie wissen, ob Dich einer belauscht oder auf dem Postamt unerlaubt die Briefe aufmacht und liest. Halte Dich zurück mit der Kritik.
Hast Du schon die Ariernachweise besorgt? Du weißt, heutzutage ist es wichtig, eine einwandfreie Herkunft vorzuweisen.
Gruß und Kuss
Dein Karl
Fischbach, 25. März 1938
Lieber Karl, mein Liebster,
ich weiß, ich soll vorsichtig sein, und ja, ich bin es auch im gewissen Sinne, aber das, was sich jetzt in unserem Land abspielt, ist so unvergleichbar mit allem bis dahin Gewesenen.
Österreich ist seit zwei Wochen an das große Deutschland angeschlossen, uns gibt es sozusagen nicht mehr, und ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, ob es gut oder schlecht ist. Wer weiß das so genau? Auf jeden Fall haben sich die Wiener sehr gefreut, im Radio sagten sie, dass Tausende am Heldenplatz standen und dem Führer zugejubelt haben.
Karl, ich bin nur eine einfache Frau, verstehe nicht viel von der großen Politik, aber wenn so viele Leute, und sicher sind dabei studierte, gescheite Menschen, der neuen Führung zujubeln und ihr vertrauen, wird schon etwas dran sein.
Aber noch etwas ganz anderes: Seit gestern sind die Schwalben da. Und gleich nach ihrem Ankommen verjagten sie die Spatzen, die in ihrem Nest überwintert hatten. Du kannst es Dir nicht vorstellen, was für ein lautes Gezwitscher draußen bei der Aktion war. Jetzt ist alles ruhig. Die Schwalben reparieren das Nest, die Spatzen sind in das Vogelhäuschen gezogen, das auf dem Nussbaum hängt. Das kleine Vogelhaus hat Peppi vor Jahren zusammengezimmert. Er wollte unbedingt so ein Futterhäuschen haben, weil auch sein Freund, der Adi, so eines hatte. Verrückt, dass ich mich so lange an solche Kleinigkeiten erinnern kann.
Ich hoffe, es geht Dir gut. Schreib mal mehr, ob Dir die Arbeit immer noch so gut gefällt und was Du in der Freizeit unternimmst.
Viele Bussis!
Deine Hilde
FISCHBACH, 18. AUGUST 2008, NACHMITTAG
Karl ruht in einem Gartensessel. Hilde schaut ihm dabei eine Weile zu. Was ist aus dem jungen, attraktiven Mann geworden, den sie so sehr liebte, denkt sie. Wohin sind sein Charme, Humor und jugendliches Draufgängertum verschwunden? Schon allein optisch ist er kaum wiederzuerkennen, mit der Demenz hat sich auch der letzte Rest seiner Persönlichkeit davongeschlichen. Geblieben ist eine gebrechliche Körperhülle, die ganz allein durch die permanenten Schmerzen ein Leben vorgaukelt. Mit Medikamenten wird der letzte Rest an Energie künstlich gedämmt, damit sich der lebende Tote ruhig verhält.
Hilde mag nicht mehr daran denken, wie es mit Karls Krankheit begonnen hat. Die alltäglichen Hoppalas passieren doch jedem. Hier und da geht ein Glas zu Bruch, die Brille, der Ausweis, der Schal oder die Handschuhe sind nicht mehr auffindbar. Aber wenn das Zittern und die unbemerkt gebliebene nasse Hose im Schritt sowie die zeitweise völlige Orientierungslosigkeit dazukommen, ist es doch etwas anderes.
Zuerst fällt es ihr auf, dann den Kindern, irgendwann sehen es alle, nur der Betroffene nicht. »Warum lacht ihr?«, fragt er, »seid ihr blöd, oder was?« Alle sind blöd, alle sind arrogant, keiner hat Verständnis. Sie verstecken absichtlich seine Sachen, wollen ihn ärgern, warum kommen ständig fremde Menschen ins Haus, was hat das alles mit ihm zu tun? »Lasst mich in Ruhe, ich will niemanden sehen und mit niemandem sprechen, wo sind wir überhaupt, ich möchte endlich nach Hause gehen!«, schreit er.
Zum Internisten geht er nicht freiwillig. Hilde und Vroni führen ihn wie einen Gefangenen in die Ordination, drücken ihn in den Stuhl, hieven ihn auf die Liege, sprechen für ihn und ziehen ihm die Kleider vom Leib. Es folgt eine Reihe an Untersuchungen, das Blut fließt in schmale Röhrchen, der Harn in den Becher, der ganze Körper, in ein unförmiges Nachthemd gehüllt, wird in eine Röhre geschoben. Es klopft laut darin, tausende Spechte pochen gegen das Metall, durchdringen Karls Kopf. Wer kann bei dem Krach nur ruhig und gelassen bleiben? Er drückt auf den Panikknopf, den er mit den Händen umklammert und auf die Brust presst, er wird umgehend aus der Röhre geholt. Man reicht ihm einen Plastikbecher mit Wasser, es schmeckt seifig, die Chemie beruhigt. Einatmen, ausatmen, die Schwester tätschelt Karls Hand, setzt ihm Kopfhörer auf und schiebt ihn wieder in die enge Höhle. Diesmal ist er tapfer, er hält still, auch wenn sein Herz davonzurennen versucht. Die endlosen Minuten vergehen irgendwann.
In der Apotheke bekommen sie einen vollen Papierbeutel mit Medikamenten, weiße, cremefarbene und bläuliche. Vroni befüllt später einen Plastikdosierer – Morgen-Mittag-Abend-Nacht. Alle paar Monate eine Kontrolle in der Klinik, die Krankheit schreitet fort und lässt sich trotz der Medikamente und diverser Therapien nicht mehr aufhalten.
»Nützen Sie die Zeit, solange es noch geht. Erfreuen Sie sich an Kleinigkeiten, feiern Sie jeden Tag, als ob er der letzte wäre. Sie werden sehen, wie viel Schönes noch auf Sie wartet.« Sie fahren mit dem Taxi nach Hause, Vroni vorne, die beiden Alten auf der Rückbank halten einander an den Händen. In ihren Augen Angst wie in der Geisterbahn.
Hilde hadert nicht mehr mit ihrem Schicksal. Wozu auch? Sie hat sich ihm ergeben, was ihr die Kraft gibt weiterzumachen. Und die Kraft wird sie noch brauchen. Als sie zu den alten Briefen in der Holzkiste zurückkehren und weiterlesen will, kommt Markus und fragt: »Was haben Sie heute für mich?«
»Nichts. Nichts Besonderes. Wollen wir nicht lieber ein bisschen plaudern?«
Markus kennt sehr gut die Launen seiner Schützlinge und ist auch mit Hildes Einsamkeit bestens vertraut. Die Arme, denkt er oft, mit dem infantilen Karl kann sie nicht richtig reden und die Kinder sind weit weg. Nach einem langen Leben ist es ungerecht, so alleingelassen zu werden. Aber dann fallen ihm seine Eltern ein und er ist sich nicht mehr sicher, ob er vielleicht auch eines Tages das Weite suchen wird, nur um ihrem Einfluss zu entkommen. Sie sind keine schlechten Eltern, in gewissem Sinne und auf ihre Art sogar cool, aber sie haben kein Verständnis für die Entscheidungen ihres Sohnes.
Auf ihren Wunsch hin hat er ein Wirtschaftsmanagement-Studium begonnen und mit dem Bachelor vorerst abgeschlossen. Auch wenn sein Vater ein Banker ist und mit einem einträglichen Posten in der Wirtschaft winkt, kann sich Markus sein Leben in Anzug und Krawatte in einem Büro nicht vorstellen. Er bekommt die Meetings des Vaters mit, den Stress und den Ärger mit den Mitarbeitern, die hysterischen Ausbrüche der Mutter, weil ihr Mann mehr Zeit mit seiner Sekretärin verbringt als mit ihr, unzählige Flugreisen in Städte, von denen er nur die Flughäfen kennt.
Der Vater sei tolerant, sagt er, er zwinge ihn nicht zum Studium. »Aber was möchtest du sonst machen?«, hatte er herausfordernd gefragt. »Was interessiert dich?« Das ist es ja. Markus weiß noch nicht ganz genau, was er später machen möchte. Die Natur interessiert ihn, Geschichte, Philosophie, Musik oder die Arbeit mit Menschen. »Und ist das ein Beruf?«, hatte der Vater gefragt.
»Noch nicht … aber … ich möchte mich ausprobieren.«
»Und das auf unsere Kosten?«
»Ich brauche euer Geld nicht. Ich verdiene es mir selbst.«
»Und wie? Als Straßenmusikant?«
»Warum nicht?«
Der Zivildienst ist eine Zwischenstation. Die Zeit des Wartens auf eine Entscheidung. Oder Weichenstellung. Markus ahnt, dass sein Vater auf seine Rückkehr an die Fachhochschule oder die Universität hofft, und er möchte ihm diese Hoffnung auch nicht nehmen, auch wenn es für ihn definitiv ausgeschlossen ist, ein Wirtschaftsmanager zu werden.
An den Wochenenden führt er Touristen durch das ehemalige Konzentrationslager in Mauthausen.
Dass er einen Vermittlerkurs in der KZ-Gedenkstätte absolviert hat – das Wort Führer darf man in Mauthausen nicht benützen –, davon hat er seinen Eltern nichts gesagt. Wozu auch? Das hätten sie sowieso nicht verstanden. Auch wenn sein Großvater, der Vater seiner Mutter, von der Gestapo nach Mauthausen verschleppt worden war, wo er ums Leben kam.
Markus wusste, sein Opa war bei der Familie in Ungnade gefallen. Man sprach nicht gern über ihn, in der Erinnerung schien er ausgelöscht zu sein. Nicht nur, dass er verheimlicht hatte, Jude zu sein, er schwängerte sogar seine damalige Freundin und lief dann feige davon. Irgendwann gegen Ende des Krieges erfuhren sie von seinem Tod und keiner weinte ihm eine Träne nach. Keiner, außer Markus, der seinen Großvater gern kennengelernt hätte.
Der Kurs und die Führungen in Mauthausen waren seine Rebellion gegen die Eltern. Der Drang, etwas Eigenständiges und Vernünftiges zu tun und sich dabei ein Taschengeld zu verdienen, war gleichzeitig die Gelegenheit, sich abseits der Vorstellungen des Vaters zu positionieren und dabei mehr über seinen geheimnisvollen Großvater zu erfahren.
Fischbach, 31. Mai 1938
Lieber Karl,
Deine Karten mit Freude erhalten. Du fragst, wie es mir geht? Mir geht es schlecht. Der Traisen-Acker ist ganz gelb, man sieht gar keine Zeile vor lauter Unkraut. Zum Jäten sind wir nicht gekommen, drum ist er halt so. Jeden Tag bin ich todmüde, was mich richtig verdrießt. Die Jungpflanzen haben wir auch nicht gesetzt. Wir brauchen dringend Regen, bitte schick uns welchen.
Beim Holzhacken hat uns Hans geholfen. Zumindest das. Das ist alles viel zu viel für Elfi und mich. Aber ich habe keine andere Lösung.
Heute war ich in der Apotheke wegen einer Salbe und bin dann zum Alois hinausgefahren. Er hat gerade eine Grußkarte von Lydia bekommen. Ihr Mann Fritz ist in Zell am See auf Saison, sie ist bei ihm. Am Nachmittag war ich daheim, die Steffi war bei mir.
Ich möchte noch so viel schreiben, aber ich kann nicht. Mir ist so unwohl, ich muss mich niederlegen. Es ist zehn Uhr abends. Leb wohl und auf Wiedersehen.
Bussi, Deine Hilde
Ludwigsfelde, 20. Juni 1938
Liebste Hilde!
Es tut mir sehr leid, dass es Dir so schlecht geht. Und auch ich habe leider nichts Gutes zu berichten. Ich bin nämlich im Krankenstand. Gestern habe ich mich überhoben. Das war nämlich so: Ich wurde am Montag von einem Arbeiter an einer neuen Maschine angelernt, nach einer Stunde konnte ich selbstständig arbeiten. Am Dienstag war ich schon viel schneller. Dabei musste ich auch schwer heben und dem Mann, der die Ware her- und wegführt, auch noch helfen. Es war kurz vor dem Feierabend, ich sollte noch die Maschine reinigen, der andere rief mich, ihm zu helfen, und dabei hatte ich noch so eine dumme Stellung oder war überarbeitet, ganz gleich. Ich bekam einen starken Stich ins Kreuz, das war allerhand, aber ich habe weitergearbeitet, und erst als ich fertig war, ging ich wieder heim.
Ich dachte, es wird über die Nacht besser, aber ich hatte mich geirrt. In der Früh ging ich zur Betriebskrankenstation, die Schwester hat mich mit einer Salbe eingerieben. Es wurde für kurze Zeit besser, danach gleich wieder schlechter. Am Nachmittag wollte ich zu einem Privatarzt gehen, er hatte aber heute keine Ordination. Aber wenn ich zu ihm morgen hingehe, wird er mir sicher nur etwas zum Einreiben verschreiben und ich muss es auch noch bezahlen. Und wirklich helfen wird es wahrscheinlich auch nicht. Auch der Krankenzettel vom Büro kostete 25 Pfennige.
Für drei Tage im Krankenstand bekommt man kein Gehalt. Wenn ich länger krank sein sollte, werde ich vielleicht entlassen. Aber ich werde mir selbst helfen. Meine gute Konstitution wird mir dabei behilflich sein. Wenn ich schon bei der schlechten Kost, die wir hier bekommen, nicht eingehe, wird mich auch die Arbeit nicht umbringen. Und gehen werde ich, wann ich will und nicht, wenn sie mich wegschicken.
Auch die Wiener, die hier sind, stecken ständig ihre Köpfe zusammen. Alle paar Monate möchte einer von ihnen von hier abhauen. Ähnlich ist es mit Sudetendeutschen, Steirern, Kärntnern, Berlinern. Es ist kein leichtes Leben hier.
Das Essen in der Fabrik ist ziemlich einfach und billig. Ständig Gemüse und Pellkartoffeln, die stark machen sollen. Ich esse hier immer zu Mittag um 30 Pfennige. Die meisten Deutschen essen das nicht einmal fertig. Ich auch nicht immer. Ein Nachschlag kostet zehn Pfennige. Man kann auch um 40 oder 50 Pfennige essen, da ist Fleisch überall dabei. Das Nachtmahl kaufen wir uns im Geschäft. Braunschweiger ist eine ekelhafte, fette Wurst, schmeckt überhaupt nicht und kostet 40 Pfennige. Die Wurstsorten sind überhaupt nicht so gut wie die unseren. Am besten schmeckt noch der Speck, der 32 Pfennige kostet. Der kommt selten in die Geschäfte und ist auch gleich ausverkauft.
Wir werden auch Fettkarten bekommen für Butter, Schmalz usw. Butter kostet 3,60 pro Kilo. Hier wird noch in Pfund gewogen, aber das kann man schnell umrechnen. Eine Flasche Bier kostet 66 Pfennige, Zucker und Mehl gleich viel wie bei uns. Also mit dem Essen ist es nicht weit her und schon gar nicht nach unserem Geschmack.
Die Wohnungen sind ebenfalls sehr teuer. Meine Kollegen zahlen vier und fünf Mark in der Woche. Nicht immer möbliert, dafür aber mit Kaffee und Brötchen zum Frühstück. Ich zahle in der Baracke 40 Pfennige pro Tag. Ich überlege, dass ich mir auch ein Privatzimmer nehme. Da hat man mehr Ruhe als in der Baracke. Von der Siedlung, wo die meisten Mansardenzimmer vergeben werden, ist es eine halbe bis Dreiviertelstunde zur Arbeit.
Bald möchte ich mir ein Fahrrad kaufen, es kostet circa 60 Mark. Damit komme ich schneller in die Arbeit und kann am Wochenende Ausflüge machen. Morgen werde ich nach Berlin fahren und mir einen Plan und neue Arbeitshandschuhe kaufen. Danach schaue ich mir die Stadt an.
Wenn Alois auch hierherkommen möchte, soll er kommen. Hier ist genug Arbeit.
Viele Bussis!
Dein Karl
Fischbach, 14. Juli 1938
Lieber Karl!
Danke Dir für Deinen Brief und die schönen Postkarten, die ich die ganze Zeit anschaue und bewundere. Gib Acht auf Dich, dass Dir nichts zustößt. Ich kann es kaum abwarten, dass Du zu mir kommst und mich irgendwann mitnimmst. Ich freue mich so sehr auf unsere Hochzeit. Ich bin schon sehr ungeduldig und nervös, Du kannst es Dir gar nicht vorstellen, wie.
Ich habe mich für Dich fotografieren lassen, damit Du nicht vergisst, wie ich aussehe. Heute war ich die Bilder mit Steffi abholen. Und was für eine Enttäuschung. Ich schaue darauf nicht gut aus, habe ein riesiges, rundes Gesicht. In Wirklichkeit bin ich viel zarter und schmächtiger. Aber ich schicke Dir die Fotos trotzdem.
Vor ein paar Tagen bin ich der N.S.-Frauenschaft beigetreten. Wir lernen dort, was man vom deutschen Frauenwerk wissen soll. Zum Beispiel, dass jeder vernünftig denkende Mensch einsehen muss, dass die Frauen nur zum Wohle des deutschen Volkes und zum Wohle jedes einzelnen Mannes geschult werden. Die Frauen brauchen einen Verein, in dem sie von ihrer Frauenarbeit nicht abgelenkt werden sollen, im Gegenteil. Wir wollen den Frauen helfen, dass sie noch tüchtigere Hausfrauen und viel bessere Mütter werden. Unser Verein soll keine Konkurrenz zu den Männervereinen werden. Unser Ziel ist es, die Frauen zu guten Kameradinnen ihrer Männer zu erziehen, und das geht nur dann, wenn auch sie weltanschaulich und politisch geschult werden. Wir Frauen wollen nicht politisieren, das überlassen wir den Männern, doch wir müssen als Erzieherinnen der Kinder und heranwachsenden Männer der deutschen Zukunft fähig sein, schon den Kleinen etwas Gemeinschaftssinn und Volksgemeinschaft beizubringen.
Liebster Karl, ich, deutsche Frau, will Dir immer eine treue Gefährtin sein, auch wenn wir heute noch so weit voneinander entfernt leben.
Mit herzinnigem Kuss von Deiner
Hilde
FISCHBACH, 18. AUGUST 2008, NACHMITTAG
Hilde sitzt vor der Kiste mit den Briefen und hält ihre Hände vors Gesicht. Das gibt es nicht, denkt sie. War sie das oder war das jemand anderer? Kalter Schweiß läuft ihr über den Rücken, aber sie kann nicht aufhören, sich über sich selbst und die Zeit, in der sie jung gewesen war, zu wundern. Warum hatte sie nicht auf ihr Inneres gehört? Warum wollte sie unbedingt daran glauben, was der Führer sagte, auch wenn es mit ihrem Glauben überhaupt nicht vereinbar war?
Die Briefe, die stummen Zeugen der Vergangenheit und ihrer eigenen Schwäche, lassen ihr keine Ruhe. Da muss sie durch, entscheidet sie, auch wenn sie daran zugrunde geht.
Mit 20 Jahren war sie unglücklich über ihr Aussehen, das nicht den Anforderungen der Partei entsprach. Ihr rundes, fast slawisches Gesicht, dünnes, mausgrau-blondes Haar, die dunklen Augen und die kleine, gedrungene Figur hielt sie für einen Rassenmakel, den sie ideologisch auszugleichen versuchte. Was hätte sie damals nur für dicke, goldblonde Zöpfe wie die ihrer besten Freundin Steffi gegeben! Und für blaue Augen. Und für eine schlanke Figur. Steffi, Abbild der deutschen Frau, Musterbeispiel an genetischer Perfektion, war für sie nicht nur das schönste Mädchen der Schule und des Dorfes, sondern der ganzen Welt.
Ein länglicher, germanischer Schädel war das Ideal, nicht der böhmische »Plutzer«, der von Weitem schrie: »Ich bin rassisch nicht so wertvoll, wie man es von mir erwartet.« Und dabei konnte sie auf einen starken schlesisch-deutschen Zweig in ihrem Stammbaum verweisen, der alle Zweifel an ihrer makellosen, arischen Herkunft beseitigen müsste.
Hilde, eine vom Alter gekrümmte Frau mit schütterem, weißem Haar und matten Augen blickt zurück auf ihr Leben und kommt nicht aus dem Staunen heraus. »Oh, Karl«, sagt sie mehr zu sich als zu ihrem im Rollstuhl schlummernden Mann, »was haben sie nur aus uns gemacht? Oder sind wir selbst schuld daran?« Hildes Lippen bewegen sich ohne einen Laut, und doch dröhnt tief in ihr eine innere Stimme.
»Frau Dorn, ein Mann ist am Tor und möchte Sie sprechen.« Markus, der gerade mit dem Einkauf zurückkommt, reißt sie aus ihren Gedanken. Er trägt zwei volle Körbe mit Lebensmitteln, die er auf den Stufen ins Haus abstellt.
»Wer ist es?«
»Ich weiß nicht. Er hat nicht gesagt, wie er heißt. Nur, dass er Sie sprechen möchte.«
»Er soll hereinkommen.«