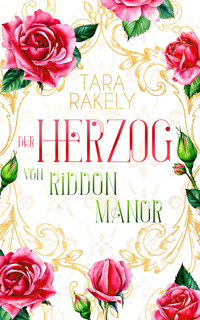
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der ruinierte Ruf des Duke of Ailesbury ist zusammen mit seinem entstellten Gesicht ein sicherer Garant dafür, keine Ehefrau zu finden. Seine letzte Hoffnung erscheint in Form eines Baronets, der ihm aus Geldgier seine Tochter verspricht. Dieses Unterfangen führt ihn jedoch nur in einen weiteren Salon Englands, in dem er von dem verstörten Schluchzen einer Heiratskandidatin gedemütigt wird. Erneut scheint seine Lage aussichtslos, bis das Mündel des Baronets ihm anbietet, an die Stelle ihrer Cousine zu treten und ihn zu heiraten. In Amelia Bennett begegnet John die erste Frau, die nicht vor ihm zurückweicht, sobald er die Maske abnimmt. Doch reicht ihr Mut, um ihm einen Erben zu schenken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Herzog von
Riddon Manor
Tara Rakely
Impressum
Urheberrecht und Copyright © by Tara Rakely
Erstausgabe Mai 2024
Covergestaltung: Julia Zeiner-Haring
Korrektorat: Petra Schütze
Inhalt
Impressum
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Leseprobe "Das Portrait des Veteranen"
Danksagung/Über die Autorin
Weil das Herz immer besser fühlt,
als das Auge jemals sehen könnte.
Prolog
Nachdem das Mädchen bei seinem Anblick in hysterische Tränen ausgebrochen und aus dem Salon gestürmt war, setzte John die Maske zurück an jenen Platz, an dem sie sein halbes Gesicht verdeckte. Aufstöhnend sank er in einen Stuhl vor dem kalten Kamin. Bitterkeit legte sich wie immer zuverlässig über die Scham. Er hatte die Nase voll hiervon. Von den Demütigungen und Schmähungen. Am liebsten würde er ganz England brennen sehen. Er wollte die Welt zu Kleinholz schlagen und einen Scheiterhaufen daraus machen. Seine Knöchel knackten.
Er war gekommen, um Lucille Bennett zur Frau zu nehmen. So war es abgemacht gewesen zwischen seinem Berater und dem Baronet. Es hatte genug Geld den Besitzer gewechselt und der nicht gerade unbedeutende Titel einer Herzogin stand für die Frau in Aussicht. Dennoch hatte Miss Lucille bereits bei seinem Eintreten zitternd in der Ecke gestanden, sorgsam jeden seiner Blicke gemieden und die Flucht ergriffen, als er schließlich die Maske abgenommen hatte.
»Wir können wohl gleich den Rückweg antreten«, knurrte er und stützte den Ellbogen auf die Lehne, um die Faust an den Mund zu drücken. Der Geschmack von Blut lag ihm auf der Zunge. Er würgte es durch seine enge Kehle hinab.
Walsh, der mit hinter dem Rücken verschränkten Händen vor dem Fenster stand und sich größtenteils über Spitzbart und Blasiertheit definierte, schüttelte den Kopf. »Vielleicht bekommt Bennett sie zur Raison.«
»Vergeudete Zeit«, erwiderte John. »Die Mutter hat das letzte Wort.«
Da die Dame des Hauses beim Anblick seines Gesichts nach Luft geschnappt und ihrem Gatten beim Hinauslaufen zugeraunt hatte, dass das nicht sein Ernst sein konnte, bestand keine große Hoffnung darauf, dass besagtes Wort zu Johns Gunsten ausfallen würde.
Nicht, dass er das jetzt noch wollen würde. Er brauchte keine Frau, der vor ihm graute. Er brauchte kein weiteres Wesen in seinem Leben, das ihn sich wie ein Monstrum fühlen ließ. Die Gesellschaft war ihm genug Erinnerung daran.
»Ich will sie nicht haben.« Es war bloß ein Flüstern und dennoch füllte es den Raum mit seinem Schmerz. Er konnte nur hoffen, dass Walsh diese unmännliche Anwandlung nicht ebenfalls spürte.
Sein Verwalter schüttelte abermals den Kopf. »Wie Ihr seht, ist die Auswahl leider begrenzt. Ihr könnt es Euch nicht leisten, Miss Lucille abzulehnen, sollte sie jemand umstimmen können.« Draußen zwitscherten Vögel und hier drinnen seufzte Walsh tief, bevor er einen vertraulicheren Ton anschlug. »Wir haben es doch schon mit einer Saison in London versucht, John. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Ihr eine Wiederholung dieser Erfahrung wünscht.«
John machte ein kehliges Geräusch, das gewiss ausreichte, um seine Ablehnung einer solchen Vorstellung kundzutun. Diese verfluchte Ballsaison hatte ihm die schlimmsten Wochen seines Lebens beschert. Lieber würde er seinem Bruder in den Freitod folgen, als sie noch einmal zu durchleben. Ganz abgesehen davon, dass dieser Höllenritt ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte.
Die Standuhr in der Ecke tickte erbarmungslos vor sich hin. Irgendwo im Flur tuschelten ein paar Bedienstete. Der Pfarrer und der Friedensrichter unterhielten sich im Nebenzimmer und zwei Gläser stießen verstohlen gegeneinander. Wozu sich nicht den teuren Brandy des Baronets schmecken lassen, wenn man den Weg hierher schon ganz umsonst angetreten hatte?
Ununterbrochen hörte man von oben Schluchzen, das gewiss an so manchem Herzen rührte, doch das seine erschreckend kaltließ. Dieses Mädchen dort oben kreischte und weinte, weil es ihn so gottverdammt abstoßend fand. Wie brachte man unter solchen Umständen Mitleid zustande? Er wusste es nicht, denn er war schließlich kein Heiliger. Er war nur ein Mann, der sich wünschte, die Erde möge sich unter ihm auftun und ihn ein für alle Mal von seinem Kummer befreien.
Ein sachtes Klopfen an die offene Tür ließ ihn unbeteiligt den Blick heben.
Eine junge Frau stand für einen Moment unschlüssig unter dem Türsturz, ehe sie den Raum betrat und vor ihm knickste. »Euer Gnaden.«
Euer Gnaden, wiederholte er in Gedanken. Drei Jahre und er konnte die Anrede immer noch nicht mit sich in Verbindung bringen. Als zweitgeborener Sohn war er nicht für diese Rolle bestimmt gewesen; er war nicht dazu erzogen oder auch nur irgendwie darauf vorbereitet worden, ein Duke zu sein.
»Wer seid Ihr und was wollt Ihr?«, fragte er kurz angebunden und ging wieder dazu über, in den kalten Kamin zu starren.
»Amelia Bennett, Euer Gnaden. Ich will Euch einen Vorschlag unterbreiten.«
Während Walsh sich nun verbeugte und die Dame angemessen begrüßte, blieb John gleichgültig und nonchalant sitzen. Er war in diesem Haus nicht besonders freundlich aufgenommen worden und hatte keine Lust auf Heucheleien, nur weil die Konventionen danach verlangten.
»Bennett also. Eine Schwester von Miss Lucille?«, hakte er nach, obwohl es ihn nicht weniger interessieren könnte.
»Ihre Cousine, Euer Gnaden.«
»Und was könnte Miss Lucilles Base von mir wollen?«
»Euch heiraten.«
Die Uhr schien mit dem Ticken aufzuhören und das Getuschel fand ein Ende.
Walsh gab einen herablassenden Laut von sich wie ein angedeutetes Lachen.
John hob nun nicht bloß den Blick, sondern auch den Kopf. Seine Hand sank in seinen Schoß und er nahm sich einen Moment, um die Frau zu mustern, die so kühn davon sprach, ihn ehelichen zu wollen. Blaue Augen unter dunklen, markanten Brauen, reizvoll geschwungene Lippen, ein schmales Gesicht passend zur zierlichen Gestalt und blondes Haar, das am Hinterkopf zu einem Knoten gefasst war. Eine Frau, die er als Schönheit bezeichnen musste. Das genaue Gegenteil von ihm. »Ihr wisst, wer ich bin?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Der Duke of Ailesbury, Euer Gnaden«, antwortete sie, die zarten Hände artig gefaltet wie ein Schulmädchen. Dabei wirkte sie mindestens vier oder fünf Jahre älter als ihre achtzehnjährige Cousine.
»Und wie nennen mich die Leute?«, hakte er weiter nach.
Die nächste Erwiderung kam erst nach einem Zögern. »Den dunklen Herzog.«
Also kannte sie die Geschichten, die sich um sein Familienwappen rankten.
Eine idiotische Erkenntnis, denn wer kannte sie nicht?
»Und den wollt Ihr heiraten?«, fragte er spöttisch, während er sich erhob und langsam auf sie zuging. Sie wich nicht zurück, sondern sah ruhig zu ihm hoch, wozu sie den Kopf in den Nacken legen musste, weil sie ihm nur bis zum Kinn reichte. Der süße Duft von Vanille stieg ihm in die Nase und für einen Moment fiel sein Blick auf ihren Hals. »Aus welchem Grund könntet Ihr das wollen, Miss Bennett? Um Eure Cousine heldenhaft vor dem Monster zu schützen?«
Ihr Blinzeln wirkte ertappt. »Und wenn es so wäre?«
»Dann würde ich sagen, Ihr verdient einen Blick auf die Abscheulichkeit, auf die Ihr Euch so tapfer einlassen würdet.« Er zog sich die Maske vom Gesicht und brachte sein Haar damit ein weiteres Mal in Unordnung.
Gleich würde sie die Flucht ergreifen – so wie die wenigen Frauen vor ihr, die sein Gesicht gesehen hatten. Gleich würde sie nach Luft schnappen, sich die Hand vor den Mund schlagen und Reißaus nehmen. Gleich würde sie …
Seine Erwartungen lagen plötzlich zerschlagen zu seinen Füßen. Wie Scherben zwischen seinen und ihren Schuhspitzen, weil sie nichts von alledem tat.
Ihr nächster Atemzug fiel zittrig aus und ihre Haltung wurde steif, doch sie schreckte nicht einmal zurück. Nur ihre Wimpern senkten sich eine Winzigkeit, als wollten sie ihre Augen vor dem Grauen schützen, das er bedeutete.
»Seht hin«, befahl John von dumpfem Zorn geleitet. »Seht Euch das Ungeheuer an, dem Ihr soeben Eure Hand angeboten habt.«
Amelia gehorchte nach einem Pulsschlag und besah sich ganz genau, was von seiner linken Gesichtshälfte noch übrig war. Er wäre gerne gestorben in diesem Moment. Die Scham gab sich alle Mühe, ihm den Wunsch zu erfüllen, doch versagte wie so oft. Mehr als pochenden Schmerz in seinen Eingeweiden brachte das vermaledeite Ding nicht zustande.
»Welches Wort würdet Ihr dafür verwenden, hm?«, fragte er und bedrängte sie noch etwas mehr, wobei sie keine Spur vor ihm zurückwich. Sein hastig gehender Atem versetzte eine Strähne ihres seidig anmutenden Haares in Bewegung. »Abstoßend? Widerwärtig? Ekelhaft? Oder seid Ihr kreativer als der Rest?«
»Euer Gnaden, lasst es gut sein«, warf Walsh müde ein.
Statt einer Antwort überraschte Amelia ihn mit ein paar heiser gesprochenen Worten: »Ich habe ebenfalls einen Makel, Euer Gnaden.«
Verwirrt trat er einen Schritt zurück und musterte sie eingehend. Einen Makel wollte sie haben? Es war jedenfalls keiner, den man sehen konnte. »So?«
Ihre Zungenspitze schnellte hervor und entfachte eine schmerzhaft brennende Begierde in seinem Unterleib, die unpassender nicht sein könnte.
»Ich bin nicht mehr unberührt, Euer Gnaden.«
Walsh murmelte ein paar geringschätzige Worte in seiner Muttersprache, dann schien das heisere Geständnis über ihren Köpfen zu schweben. Lange genug, um zu bemerken, dass sich Miss Lucille oben in ihrem Schlafgemach offenbar gefasst oder endlich das Bewusstsein verloren hatte.
Ohne seinen Blick von jenem blauen zu lösen, der ihn in seine Tiefen lockte wie ein Ozean einen Taucher, traf er eine Entscheidung. Erneut beugte er sich zu ihr vor und knurrte: »Ich will in meinem Heim kein Gekreisch und kein Gezeter. Ich will keine Szenen wie die Eurer Base. Ich will kein Erzittern und Erbeben vor mir. Keine Erniedrigungen, die mir in Form von Furcht ausgeteilt werden. Ich brauche einen Erben von einer Ehefrau, die mir treu ist und meinem Namen keine weiteren Skandale anhängt. Könnt Ihr mir das versprechen?«
»Euer Gnaden!« Walshs Worte sausten wie eine Schelte auf ihn hinab.
Amelias Blick war weit geworden, doch eindeutig vor Verwunderung anstatt aus Angst. »Ihr habt mein Wort darauf«, sagte sie leise, aber bestimmt.
John schluckte hart. Hatte sie das gerade wirklich gesagt? Ein Herzschlag verstrich. Und noch einer. Soeben wollte er ihr im Gegenzug versprechen, dass er niemals in böser Absicht Hand an sie legen würde, da stand plötzlich der Hausherr in der Tür. Dessen nervöser, sonderbar hart gewordener Blick huschte zwischen John und seiner Nichte hin und her. Falten der Verwirrung erschienen auf seiner Stirn unter einem grauen Haaransatz.
»Was geht hier vor?«, fragte der Alte mit einem Unterton voller Skepsis.
»Ihr könnt Eure scheue Tochter behalten, Bennett«, verkündete John mit kalter Stimme, während er sein Gesicht erneut verbarg, weil es nicht in diese Welt, sondern in die Hölle gehörte. »Und mein Geld. Ich nehme dafür Euer Mündel.«
Kapitel 1
Drei Tagesreisen in getrennten Kutschen und getrennten Zimmern später versperrte ihr das angeblich verfluchte Riddon Manor die Sicht auf den dämmrigen Abendhimmel. Türmchen reihte sich an Türmchen, wilder Wein an Efeu, Fenster an Erker. Es war ohne Zweifel das beeindruckendste Herrenhaus, das Amelia je gesehen hatte. Der Park machte einen gepflegten Eindruck und der Wintergarten schien aus allen Nähten zu platzen. Die Gerüchte über die endlosen Reichtümer des dunklen Herzogs schienen also den Tatsachen zu entsprechen. Taten es auch die anderen?
Sie stieg aus der Kutsche. Ihre Schuhsohlen brachten den Kies zum Knirschen und sie füllte sich die Lungen mit nach Blüten und Pferden duftender Luft. Von den Stallungen her drang ein leises Wiehern wie ein Willkommensgruß.
Die Dienerschaft – sehr wenige Leute für ein so imposantes Anwesen, kaum Frauen und davon keine unter fünfzig – stand auf den Stufen zur Eingangstür und senkte soeben das Haupt für ihren Herrn, der aus der Kutsche gesprungen war und die Treppe hinaufeilte, ohne Amelia auch nur eines Blickes gewürdigt zu haben.
Sie eilte ihm hinterher und konnte zum Schürzen ihrer Röcke nur eine Hand benutzen, weil sie in der anderen den Korb mit Lucys Katzen hielt. Die Hausangestellten musterten sie aus großen Augen und schienen in höchstem Maße irritiert von dem Lächeln, das sie ihnen zuwarf.
In der Eingangshalle hatte sie keine Zeit, die Einrichtung zu bewundern, da ihr Gemahl bereits die nächste Treppe nach oben nahm.
»Euer Gnaden!«, rief sie ihm nach und er blieb stehen, was sie ihm gleichtat.
Mit der Rechten am Handlauf drehte er sich zu ihr um und bedachte sie mit einem vernichtenden Blick. Er schien geradezu hellauf begeistert, sie im Haus zu haben. »Was? Wünscht Ihr eine Führung? Soll ich Euch zeigen, wo mein Vater meine Mutter erdrosselt hat? Oder wollt Ihr wissen, in welchem Raum mein Bruder den Plan gefasst hat, seine Frau zu ertränken? Ersteres ist mir natürlich bekannt. Ich war schließlich dabei. Es war die Bibliothek. Von Letzterem kann ich es nicht sicher behaupten, aber ich vermute seinen Salon.«
Amelia ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Ich muss etwas mit Euch besprechen«, antwortete sie mit fester Stimme und hielt seinem Blick stand, während in ihrem Rücken die Dienerschaft die Ohren spitzte.
Der Herzog musterte sie abschätzig, bevor er unwirsch nickte. »Dann kommt.«
Bemüht darum, mit ihm und seinen langen Beinen Schritt zu halten, hastete sie durch ein paar Gänge und betrat schließlich das Arbeitszimmer des Dukes.
Er wartete, bis sie in der Mitte des Raumes stand, dann warf er die Tür hinter ihr so fest in die Angeln, dass man den Knall bestimmt noch in der Eingangshalle hörte. Eine der Katzen protestierte mit einem Miauen.
»Also, was wollt Ihr?«, fragte Riddon ungeduldig und stellte sich hinter seinen Schreibtisch, der mit Papierkram beladen war.
In der Luft hing nur der Duft seines maskulinen Rasierwassers, aber keinerlei Hauch von Zigarrenrauch, wie sie ihn aus anderen Herrenzimmern kannte.
»Ich möchte über mein Taschengeld sprechen.«
Erst huschte Überraschung über jene Hälfte seines Gesichts, das nicht von der Maske verdeckt war. Darauf folgte eine Regung, die sie nicht benennen konnte. Er schnaubte. Nickte. »Natürlich. Wie konnte ich annehmen, Ihr hättet Eure Base aus reiner Nächstenliebe gerettet?«
Amelia ging nicht darauf ein. »Wie viel gedenkt Ihr, mir zuzugestehen?«
Seine Augenbraue hob sich. »Wie viel gedenkt Ihr, zu verlangen?«
Sie nannte ihm einen Betrag, der ihr für eine Herzogin angemessen erschien.
Riddon dachte kurz darüber nach, nannte dann einen höheren und fügte leiser hinzu: »Ich bin weder geizig noch arm.«
Eine der Katzen gab erneut ein Miauen von sich. Vielleicht spürte sie, wie sich Amelias Herzschlag beschleunigte und ihre Handflächen feucht wurden. Was sie als Nächstes tun musste, war riskant, aber notwendig, damit nicht alles umsonst gewesen war. Sie gestattete ihrer Stimme kein Zittern, ihrer Haltung kein Wanken, als sie sagte: »Ich brauche es für sechs Monate im Voraus. Jetzt.«
Die Schultern ihres Gemahls strafften sich, was ihn noch größer, noch maskuliner und vor allem noch bedrohlicher wirken ließ. Seine Miene verschloss sich lückenlos und nahm eine Härte an, die ihr einen Schauer über den Rücken jagte. »Für Euren Liebhaber?«, fragte er in einem Knurren.
»Nein, Euer Gnaden.«
Die Wahrheit stieß auf taube Ohren. »War Euer Vormund nicht einverstanden mit Eurer Wahl und Ihr plant nun, Euch mit meinem Geld nach Schottland abzusetzen? Eine hübsche kleine außergesetzliche Vermählung in Gretna Green für die Frau, die den dunklen Herzog an der Nase herumgeführt hat?« Das Knurren wurde tiefer und Riddons Tonfall stetig drängender, als redete er sich gerade in Rage, weil er endlich einen lange geschmiedeten Plan durchschaute.
»Nein, Euer Gnaden«, sagte sie und hoffte, dass die Erwähnung Gretna Greens ihre Wangen nicht zu einem verräterischen Erröten brachte.
Der verbissene Zug um seinen Mund wurde fast grausam. »Ihr habt mir Euer Wort gegeben.« Er betonte jede Silbe und bedrängte Amelia mit seinem dunklen Blick, als wollte er sie damit pfählen. »Ein Erbe. Und vor allem. Kein. Skandal.«
»Und ich halte mein Wort.« Es war nur halb gelogen. Der Skandal, den dieses Geld auslösen würde, würde nicht ihn betreffen. Nicht zur Gänze und gewiss nicht auf jene Weise, die er befürchtete.
Riddon wischte sich grob über den Mund, bevor er die Hand wieder zur Faust ballte. »Wenn ich Euch jetzt gebe, was Ihr verlangt«, begann er mit rauer Stimme, »werdet Ihr dann vor mir fliehen?«
»Nein, Euer Gnaden.«
Eine Ewigkeit schien zu verstreichen, während ihre Blicke ineinander verhakt blieben, bis der Herzog merkwürdig vibrierend Luft ausstieß und sich abwandte, um eine Schublade seines Schreibtisches zu öffnen. Gleich darauf ertönte das Klimpern von Münzen und Amelia tat es dem Herzog gleich – sie atmete in einem Schwall aus und wandte sich von dem Mann ab. Dass er überhaupt zugestimmt hatte, sie zu heiraten, obwohl sie ein Niemand war, hatte sie bereits maßlos überrascht und ihr klargemacht, wie verzweifelt er sein musste. Doch dass er jetzt trotz seines Misstrauens bereit war, ihr eine so hohe Summe auszuhändigen, brachte gar ihr Weltbild ein wenig ins Wanken.
Ihr Blick fiel auf das Gemälde Seiner Gnaden, das über dem Kamin hing.
Seine Züge waren noch nicht gar so streng und ernst gewesen. Nicht so verbittert und verhärmt; sein Gesicht noch nicht entstellt und von einer Maske halb verborgen. Seine Augen strahlten ebenso schwarzbraun wie das Haar, das ihm in die Stirn fiel. Um seine vollen Lippen spielte ein angedeutetes Lächeln und ihr wurde bewusst, dass der Herzog durchaus ein Mann war, der ihr gefallen hätte. Sehr sogar. Früher. Damals.
Nicht vor seinem, sondern vor ihrem Schicksalsschlag.
Als sie den Blick von dem Gemälde nahm, bemerkte sie, dass ihr Ehemann sie beobachtet hatte. Für einen Moment war seine Miene weich, doch das korrigierte er sofort. »Ich bewundere Euren Schneid, Miss Bennett.«
Er sagte Miss Bennett, obwohl sie nun eigentlich Mrs. John Bertram Riddon war. Doch dieser Gedanke schien ihm nicht zu behagen. Amelia wartete schweigend.
Riddon kam um den Tisch herum und hielt ihr einen Umschlag entgegen. »Ganz England wartet nur darauf, dass ich dem Beispiel meines Vaters und Bruders folge und ebenfalls eine Ehefrau ermorde, und Ihr setzt kaum einen Fuß in mein Haus und bittet mich schon um Geld.«
»Ganz England wird verstehen, dass ich mein Taschengeld ausgeben möchte, solange ich noch dazu in der Lage bin«, gab sie bemüht trocken zurück und griff nach dem Umschlag, der sich schwerer anfühlte, als er sein konnte.
»War das dann alles?«, fragte Riddon kühl.
»Ja, Euer Gnaden.«
In seinem Kiefer arbeitete ein Muskel. »Dann gute Nacht.«
Sie deutete einen Knicks an und wandte ihm den Rücken zu. Als sie schon den kühlen Türknauf in der Hand fühlte, hielten seine Worte sie zurück: »Jetzt könnt Ihr es mir sagen. Ist das Geld für Euren Liebhaber bestimmt?«
Er klang nicht wütend und auch nicht lauernd. Nur müde.
Über die Schulter hinweg warf sie ihm einen Blick zu. »Nein, Euer Gnaden.«
*
»Mrs. Riddon scheint sich gut eingelebt zu haben, Euer Gnaden.«
John knurrte, während er seine Unterschrift auf ein weiteres Dokument setzte. Seinem Berater, der vor dem Schreibtisch stand, warf er einen warnenden Blick zu. Er mochte es nicht, wenn er Amelia so nannte. Dem Namen Riddon hafteten nur Schmutz und Schande an. Wie könnte diese grauenvolle Brandmarkung zu jener zarten Schönheit passen, die seit drei Wochen durch das verfluchte Riddon Manor wandelte und überall ihren süßlichen Duft nach Vanille hinterließ?
Er mochte es schlichtweg nicht. Ebenso wenig wie den provokanten Unterton des anderen. »Wird das eine neuerliche Belehrung darüber, dass sie nicht hätte heiraten dürfen, oder darüber, dass ich ihr das Geld nicht hätte geben dürfen?«, fragte er scharf. »Verzeiht, aber bei all den Standpauken der letzten Zeit ist mir entfallen, wann welche an der Reihe ist.«
Walsh zögerte einen Moment, dann trieb die Geringschätzung die Worte aber doch aus seinem Mund. »Sie hat fast die volle Summe an eine Pfarrei in der Nähe ihres Oheims geschickt. Ich muss wohl nicht laut aussprechen, was ich denke.«
Musste er nicht, denn sie dachten vermutlich dasselbe. Nämlich, dass irgendein mittel- wie makelloser Dandy das Geld dort abgeholt hatte. Irgendein attraktiver, wortgewandter Charmeur, dessen Anblick Amelias Augen zum Leuchten brachte, anstatt Schatten hineinzuzwingen. Jene Schatten, die besonders dunkel geworden waren, als sie vor drei Wochen das Gemälde angesehen hatte.
John würgte an dem Bewusstsein, dass er offenbar auch ohne die Narben nicht nach ihrem Geschmack gewesen wäre, obwohl es sinnlos war, darüber nachzudenken. Er könnte die Hässlichkeiten ohnehin nicht zum Verschwinden bringen.
Nach einem Lippenlecken war er endlich fähig, eine Antwort zu geben. »Wie meine Ehefrau ihr Geld ausgibt, geht Euch nicht das Geringste an, Walsh.«
Wie schrecklich falsch es sich anfühlte, sie als seine Ehefrau zu bezeichnen, war fast schon irrsinnig.
Der Ire verzog das Gesicht. »Das wäre gewiss zutreffend, wenn sie schlichtweg weitere Töpferscheiben oder mehr Ton gekauft hätte, obwohl sie davon ohnehin schon Unmengen herbest-«
John schlug die Faust auf den Tisch. »Sie darf verdammt noch mal alles kaufen, woran sie Freude hat!«, schmetterte er durch den Raum. »Darüber werden wir nicht diskutieren und das hat niemand zu hinterfragen! Es ist mein Geld! Und wenn ich es sie bis zum letzten Sovereign ausgeben lasse, ist es immer noch allein meine Sache, Herrgott noch mal!« Schwer atmend senkte er das Haupt, um dem pikierten Starren seines Gegenübers zu entkommen.
Reichte es denn nicht, dass sie hier sein musste? Seine Frau sein musste?
Wollte Walsh ihr auch sonst jegliche Freude vergällen und verbieten?
Das war eine niederträchtige Anwandlung, die seinen Verwalter da ereilte.
Darüber hinaus war das kleine Atelier, das sie sich – nach Einholen seiner Erlaubnis über Umwege – im Wintergarten eingerichtet hatte, seine einzige Hoffnung darauf, dass sie zu bleiben gedachte. Das einzige Anzeichen dafür, dass sie nicht einfach nur hier ausharrte und auf den Mann ihres Herzens wartete, der kommen und sie bei Nacht und Nebel fortholen würde.
Seine Wangen wurden von Hitze heimgesucht und er brauchte einen Moment, um den Grund dafür in der Frage zu begreifen, die er sich insgeheim stellte. Ob den Dienern bereits aufgefallen war, wie oft er in den letzten Tagen ohne Anlass am Wintergarten vorbeiging, nur um einen Blick auf Amelia zu erhaschen? Jede Stunde erfand er eine fadenscheinige Ausrede für sich selbst, um dort vorbei zu müssen und für die paar Sekunden, die seine entschleunigten Schritte brauchten, zu beobachten, wie Amelia sich über ihre Töpferscheibe beugte; wie das Sonnenlicht goldene Reflexe in ihr Haar zauberte; wie ihre Hände zärtlich über feuchten Ton strichen und dabei genau zu wissen schienen, was sie taten.
Walshs Räuspern, das für gewöhnlich gewichtige Themen ankündigte, riss ihn aus seinen Gedanken und er fühlte sich ertappt. »Euer Gnaden, es wäre langsam angebracht, Eure Gemahlin in ihrem Schlafzimmer aufzusuchen.«
Trocken schluckend gab John vor, ein paar Zeilen zu lesen, obwohl sein Verstand die Buchstaben in schwarzer Tinte zu keinem einzigen Wort zusammensetzen konnte. Wenn Walsh bloß wüsste, wie oft er jede Nacht vor der Verbindungstür stand, die Amelias und sein Gemach voneinander trennte. Wie lange er bei Mondschein mit sich haderte und wie fest er sich dabei die Fingernägel in den Handballen presste. Wie hart sein Herz schlug und wie tief die Sehnsucht in ihm brannte, weil ihn ihr Duft überall in den Gängen in den Wahnsinn trieb.
»Ich gebe ihr noch etwas Zeit«, würgte er irgendwann hervor.
»Zeit wofür?«
»Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen.« Eilig faltete er das Blatt Papier zusammen und goss rotes Siegelwachs auf die Naht. Umso schneller er das erledigte, desto früher wurde er seinen lästigen Berater los.
»Euer Gnaden, bei allem Respekt, die Herzogin ist dreiundzwanzig Jahre alt und keine Jungfrau mehr. Sie weiß, worauf sie sich eingelassen hat. An diesen Gedanken, wie Ihr es nennt, hat sie bereits ein anderer gewöhnt.«
»Bei allem Respekt?«, hakte John ungläubig nach und kämpfte gleichermaßen gegen Übelkeit und den Drang, jemandem wehzutun. »Das nennt Ihr Respekt?«
»Ich sage ja nur, dass das Bangen erst ausgestanden ist, wenn diese Frau Euch einen Erben geschenkt hat.«
»Ich frage mich, was Euch mehr Angst einjagt. Die Vorstellung, ich könnte den Verstand verlieren, bevor ich einen Nachfolger gezeugt habe, oder die stets über meinem Kopf schwebende Bedrohung, Amelia könnte mir vorher davonlaufen.«
Walsh zog die Brauen zusammen. »Ihr könntet beide Ängste lindern, indem Ihr Euren Pflichten nachkommt, John. Ich war nicht mit Eurer Wahl einverstanden, aber Ihr habt sie nun mal getroffen und nun sollten wir das Beste aus der Situation machen. Das Beste ist nach wie vor ein Erbe. Wenn Ihr fürchtet, sie könnte sich zieren, stellt ihr doch in Aussicht, dass sie in Euer Londoner Stadthaus ziehen darf, sobald sie guter Hoffnung ist.«
Johns Ärger verschwand augenblicklich und wurde von etwas ersetzt, für das er keinen Namen fand. Er fühlte bloß das schwere Gewicht auf seinem Herzen. »Hat sie denn Wünsche diesbezüglich geäußert?«, fragte er verunsichert.
»Das muss sie nicht. Ich weiß aus Erfahrung, dass alle Damen nach London wollen. Außerdem würdet Ihr ihr damit mehrere Freiheiten in Aussicht stellen, von denen sie gewiss nicht abgeneigt wäre.«
Die Freiheit, seine Gegenwart nicht länger erdulden zu müssen, zum Beispiel. Nicht zu vergessen die Freiheit, sich einen Liebhaber zu nehmen oder die Beziehung zu ihrem vorherigen wiederaufzunehmen, während für ihn hier auf Riddon Manor wieder alles beim Alten sein würde. Nur dass er dann eine maßlos schöne Frau und ein gewiss ebenso liebreizendes Kind hätte, die beide nichts für ihn übrig hatten und die er vielleicht zwei Mal im Jahr zu Gesicht bekäme. Allein der Gedanke brachte ihm so viel Schmerz ein, dass er nicht wusste, wohin damit. Er warf das versiegelte Schriftstück, an das er sich die ganze Zeit über unbewusst geklammert hatte, in Richtung Tischkante. Ein Wunder, dass er es nicht längst in der Faust zerdrückt hatte.
»Ihr seid für heute entlassen, Mr. Walsh«, brachte er hervor – heiser und dennoch in jenem Tonfall, der keine Widerrede duldete.
Es folgten ein langer Blick und ein Seufzen samt Griff nach dem Brief, dann war sein Berater verschwunden. John atmete auf und lehnte sich zurück, um sein Haar zu raufen und für einen Moment die Augen zu schließen. Besser gesagt das eine, das er noch hatte. Er strich sich übers Gesicht, berührte erhitzte Haut und warmes Leder, dann fuhr er sich über die Lippen.
Ein dumpfes Geräusch ließ ihn hochfahren und in grüne Katzenaugen blicken.
Das schwarz-weiß gefleckte Tier war unbemerkt hereingekommen und auf den Tisch gesprungen, wo es nun unschlüssig stand und ihn neugierig musterte. Der Anblick erinnerte ihn unweigerlich daran, wie Miss Lucille sich von Amelia verabschiedet hatte. Noch lauter schluchzend als zuvor hatte sie sich an ihre Cousine geklammert und unaufhörlich den Kopf geschüttelt, während der Baronet mit kalten Augen zugesehen und seine Frau nach ihrer Tochter gegriffen hatte wie ein Geier nach dem Aas. Die Diener hatten die wichtigsten Habseligkeiten von Bennetts Mündel zusammengesucht – den Rest würde man schicken, hieß es. Das war inzwischen auch passiert. Nach einem letzten Kuss auf die Wange ihrer Cousine, die sie offenbar für verloren glaubte, hatte Miss Lucille scheinbar wahllos zwei der Hauskatzen in einen Korb gestopft und ihn Amelia in die Hände gedrückt.
Vorsichtig streckte John die Hand aus. Eine kleine, feine Nase schnupperte an seinen Fingern und rieb sich dann schnurrend an ihm. Behutsam liebkoste er das Wesen, das sich nicht an seinem Familienfluch oder der Maske störte. Genauso wenig wie seine Pferde es taten. Auf ihre ganz eigene Art waren Tiere gnädiger, als ein Mensch es jemals sein könnte.
Amelia hatte während der merkwürdigen Abschiedsszene vor dem Haus ihres Onkels keine einzige Träne vergossen. Vermutlich hatte sie sich das für die Einsamkeit der Kutsche aufgespart. Eine Vorstellung, die ihm die Brust eng machte und ihn vor Schuldgefühl kaum atmen ließ.
Kapitel 2
Die letzten Wochen hatten ausgereicht, um ihr zu beweisen, dass sie sich geirrt hatte. Der Herzog war kein Mann, der ihr gefallen hätte.
Er war einer, der ihr gefiel.
Einer, der unweigerlich ihre Blicke auf sich zog. Jedes Mal, wenn er am Wintergarten vorbeiging, beobachtete sie ihn unauffällig in der Spiegelung des Fensterglases. Jedes Mal, wenn sie in den Gängen auf ein Gemälde stieß, das ihn zeigte, blieb sie davor stehen. Jedes Mal, wenn er nach draußen in den Stall ging, sah sie ihm hinterher, und wartete fast ungeduldig auf seine Rückkehr, um genau dann zu einem Spaziergang aufzubrechen, nur damit sie einen Blick darauf erhaschen konnte, wie er den Hals seines Pferdes tätschelte und ihm lobende Worte zuflüsterte. Am liebsten führte er den Rappen aus, der den Namen Fly trug, wie sie von Bessie wusste. Der junge Hengst schien sein liebstes Pferd zu sein, doch er ging mit allen gleich sorgsam um. An ihren Flanken klebte niemals Blut, wie sie es an den Tieren ihres Onkels so oft gesehen hatte; sie waren niemals völlig erschöpft und schreckten nicht vor seiner Berührung zurück. Im Gegenteil. Sie kamen auf ihn zu, wenn er sie draußen auf den Koppeln rief; rieben ihre Stirnen an ihm und wirkten in seiner Gegenwart stets vollkommen entspannt.
Nicht dass das etwas bedeuten musste. Ein Mann konnte tagsüber seinen Jagdhund verhätscheln und nachts seine Ehefrau misshandeln. Das eine schloss das andere nicht aus. Dennoch sprach es für das Wesen des Herzogs, dass er sich den Tieren gegenüber nicht grausam zeigte. Ganz entgegen den Gerüchten, die sich um ihn rankten. Aber Gerüchten konnte man selten trauen.
Draußen zwitscherten die Vögel und taten ihr Wohlgefallen über den sonnigen Tag kund. Amelias Hände glitten über kühlen, nassen Ton und formten ihn nach ihren Vorstellungen, ganz ohne, dass sie bewusst darüber nachdenken müsste.
Neben ihr summte Bessie irgendein altes Volkslied. Ein Stickrahmen ruhte vergessen in ihrem Schoß und brauchte heute wohl nicht mehr auf Aufmerksamkeit zu hoffen. Die Haushälterin war eine hagere Frau mit weißem Haar, die die sechzig bereits überschritten, aber nichts an Rüstigkeit eingebüßt hatte.
Blind griff Amelia nach einem ihrer Kratzwerkzeuge, doch es lag nicht auf dem Tischchen zu ihrer Linken, wo es eigentlich liegen sollte. Auch dann noch nicht, als sie hinsah, um es auch mit den Augen statt nur mit den Fingerspitzen zu suchen. Sie musste es gestern versehentlich mit nach oben genommen haben. Ein Seufzen entrang sich ihr, ehe sie die Hände in einen Eimer klaren Wassers tauchte und so notdürftig abtrocknete, dass sie dabei weder sauber noch trocken wurden. »Ich bin gleich wieder da«, murmelte sie im Aufstehen.
Bessie blinzelte ihr entgegen, als wäre sie aus tiefen Träumen erwacht. »Soll ich etwas für Euch holen, Euer Gnaden?«
»In der Zeit, die ich bräuchte, um zu beschreiben, wie der Gegenstand aussieht, habe ich ihn mir drei Mal selbst geholt«, erwiderte Amelia lächelnd und bahnte sich einen Weg durch sattgrüne Pflanzen aus dem Wintergarten hinaus.
In der Eingangshalle war die Luft gleich um ein Vielfaches trockener. Einer der Gründe, weshalb das Gewächshaus der perfekte Ort zum Töpfern war.
Sie eilte die Stufen nach oben und den Gang entlang, der zu ihren Gemächern führte. Aus einem der Zimmer zu ihrer Rechten hörte sie Mr. Beetle ein Lied trällern. Die nicht getroffenen Töne – und davon gab es viele – glich er mit Begeisterung aus. Amelia zog die Lippen nach innen, um nicht zu kichern, während sie an den offenen Türen vorbeiging. Ihre Erheiterung verflog augenblicklich, als sie den Blick wieder nach vorne richtete, weil sie partout keinen auf den alten Butler erhaschen konnte. Stattdessen fiel er nun direkt auf ihren Ehemann, der ihr durch den Flur entgegenkam. Nur wenige Schritte trennten sie voneinander. Ihr Herz schlug schneller. Sein Gang war wie immer entschlossen und elegant; seine Haltung selbstbewusst und stolz, was seine Stattlichkeit betonte. Jene Stattlichkeit, die ihrem naiven Wesen, ihrem einstigen Selbst, angenehme Aufregung einbrachte, doch dem Teil von ihr, der in jener Nacht unsanft auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen war, nur dumpfe Furcht aufzwang.
Ihre Blicke ließen sich dennoch nicht an die Kandare nehmen, sondern wanderten verstohlen über seinen Körper. Er trug ein weißes Hemd mit nachlässig gebundenem Plastron, dazu dunkle Hosen und die kastanienbraune Weste, die sie schon öfter an ihm gesehen hatte. Darüber den ockerfarbenen Gehrock, der das Schwarzbraun seines Haares so vorteilhaft betonte. Es schmiegten sich keine Reitstiefel an seine Beine, also brach er offenbar nicht zu einem Ausritt auf.
Schließlich hasteten sie aneinander vorbei – sie seine förmliche Anrede murmelnd, er schweigend. So nah, dass sie seine Wärme zu spüren glaubte und ihr der Duft seines Rasierwassers zu Kopf stieg.
Für ein paar Schritte kämpfte sie gegen den Drang, sich nach ihm umzudrehen, um ihm letzten Endes doch nachzugeben. Ertappt riss sie den Kopf gleich wieder nach vorne, weil der Herzog ebenfalls einen Blick über die Schulter geworfen hatte, der geradewegs auf den ihren getroffen war.
In ihren Gemächern angekommen holte sie erst einmal tief Luft und stand für ein paar Momente nur im Raum, bevor sie ihr Werkzeug von dem Schrankbrett nahm, auf das sie es gestern gedankenverloren gelegt haben musste. Um nicht zu riskieren, dem Duke erneut über den Weg zu laufen, rannte sie beinahe zurück in den Wintergarten. Erleichtert schloss sie die Tür hinter sich und nahm wieder an ihrer Töpferscheibe Platz. Ihr Herz raste immer noch.
Bessie wirkte, als wäre sie tatsächlich eingeschlafen. Das Sonnenlicht tanzte auf ihrem schmalen Gesicht.
Amelia nahm ihre Arbeit wieder auf, wobei sie insgeheim die verglaste Front zur Eingangshalle im Blick behielt. Nur aus dem Augenwinkel. Wenn er nicht ausritt, machte er sich für gewöhnlich alsbald wieder auf den Weg nach oben.
Auch diesmal dauerte es keine fünf Minuten, bis er die Halle erneut durchschritt und wieder die Treppe nach oben nahm – den Kopf kaum merklich dem Gewächshaus zugewandt und etwas Kleines in den Händen haltend. Sobald er aus ihrem Sichtfeld verschwunden war, wandte sie sich dem Ausblick in den Garten zu. Hier drinnen würde es für eine Weile nichts mehr zu sehen geben.
Die Fingerspitzen an geschmeidigem Ton entlangziehend, stellte sie sich zum wiederholten Mal die Frage, weshalb der Herzog noch nicht in ihr Schlafzimmer gekommen war, obgleich es ihn doch so dringend nach einem Erben verlangte.
Plötzlich ging mit einem Ruck die Tür auf, Bessie schrak hoch und der Koch warf einen entnervten Blick herein. »Ist das zu glauben? Kommt er hier herunter für ein Schälchen Milch. Für alles kommt er neuerdings selbst herunter, als gäb’s keinen einzigen Lakaien mehr in diesem Haus, und dauernd braucht er plötzlich was. Vorhin war’s ein winziges Stück Apfelkuchen, das nicht der Rede wert war, davor ein halbes Glas Wasser. Aber was will er denn jetzt mit einem Schälchen Milch? Ein Schälchen, ist’s zu fassen?!«
»Vergiss dich nicht vor Ihrer Gnaden, Morty, hm?«, ermahnte Bessie mit einem Tonfall, der sich nicht zwischen streng und amüsiert entscheiden konnte.
Der alte Herr wandte sich Amelia zu, als hätte er sie noch gar nicht bemerkt, und begann sofort zu katzbuckeln. »Verzeihung, Euer Gnaden, vielmals vielmals um Verzeihung, Euer Gnaden. Hab’ Seine Gnaden früher so selten zu Gesicht bekommen, dass ich jetzt, so scheint’s, den Kopf verliere.«
Amelia kam nicht dazu, ihm eine beschwichtigende Antwort zu geben, weil er unter seinem fortwährenden Gemurmel den Rückzug antrat.
Bessie seufzte und griff nun doch erneut nach ihrem Stickrahmen. »Manchmal beschleicht mich das Gefühl, ich sei nur von Hofnarren umgeben.«
Obwohl sie mit jenem Gefühl durchaus ebenfalls schon Bekanntschaft gemacht hatte, schwieg Amelia mit einem Lächeln auf den Lippen.
Was könnte er wahrhaftig mit einem Schälchen Milch anfangen? Seinen Apfelkuchen hineinstippen? Ihre Mutter hatte das gerne getan – Mehlspeisen in Milch getränkt. Zumindest hatte das ihr Vater erzählt. Zu einer jener seltenen Gelegenheit, zu der er von ihr gesprochen hatte.
»Wie ist der Herzog eigentlich zu seinen Narben gekommen?«, fragte sie vorsichtig und warf der Haushälterin einen Blick zu.
»Ich kenne selbst nur die Gerüchte, Euer Gnaden.« Bedauernd schüttelte Bessie den Kopf, ohne von der Stickerei aufzusehen. »Dass er versucht hat, seine Mutter zu beschützen, woraufhin sein Vater ihn mit einem Schürhaken übel zugerichtet hat. Dann hat der Wundbrand sein Übriges getan. Hässliche Sache, so ein Wundbrand.« Sie legte die Stirn in Falten. »Man sagt, es habe nicht gut ausgesehen für Seine Gnaden. Der Mann kann froh sein, dass er noch am Leben ist.«
Ein schweres Knäuel wickelte sich um Amelias Herz und ließ es kaum schlagen. »Sein Vater hat sich in einer Gefängniszelle erhängt, nicht wahr?«
»Soweit ich weiß, ist das korrekt, ja.«
»Und sein Bruder hat sich erschossen?«
Nun blickte Bessie doch zu ihr auf. Nachsichtig. »Warum sprecht Ihr nicht mit dem Herzog darüber? Er ist derjenige, der die Geschichte nicht nur aus Gerüchten kennt.«
»Ich glaube nicht, dass er sich über derartige Fragen besonders freuen würde.«
»Gewiss nicht. Wer würde das schon? Aber bestimmt sieht er ein, dass Ihr ein Recht darauf habt, die Wahrheit zu kennen.«
Amelia bezweifelte es. »Von der damaligen Dienerschaft ist niemand mehr hier?«
»Viele sind geflohen, als der alte Herzog seine Frau ermordet hat. Den Rest hat Seine Gnaden entlassen, als sein Bruder es vor drei Jahren dem Vater gleichgetan hat. Die Stallbelegschaft ist zu Teilen noch die Gleiche, aber die bekommt naturgemäß nicht viel davon mit, was im Haus vor sich geht«, erzählte Bessie. »Nur dieser spitzmausgesichtige Ire sucht die armen Hallen von Riddon Manor schon seit jeher heim, soweit ich weiß.«
»Ihr meint den Berater des Herzogs? Mr. Walsh?«
Bessie nickte. »Hat schon den alten Herzog beraten, da war sein Haar angeblich noch rot. Obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es jemals so etwas wie Farbe an diesem Kerl gegeben haben soll.«
»Er ist kein Mensch, für den man sich leicht erwärmen kann«, meinte Amelia.
»Kalt wie ein Grab. So fühl’ ich mich, wenn ich den anschauen muss.«
Der Vergleich erschien ihr durchaus passend. Mr. Walsh war der letzte Mensch auf Erden, dem sie ihre heiklen Fragen stellen wollte. Sie konnte ihn nicht leiden und spürte, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte.
Doch der Herzog schien sie ebenso wenig zu mögen. Zumindest zeigte er nicht das geringste Interesse daran, sie kennenzulernen. Möglicherweise gefiel sie ihm nicht. Immerhin war er gekommen, um Lucy zu heiraten, und sie beide waren so verschieden, wie es zwei Frauen nur sein konnten.
Überhaupt wirkte er wenig angetan vom Konzept der Ehe. Vielleicht hatte also bloß Mr. Walsh beschlossen, dass der Duke of Ailesbury im Alter von zweiunddreißig Jahren nun endlich eine Frau brauchte.
*
Donnerschläge rissen sie aus dem Schlaf und ließen sie mit rasendem Herzen im Bett hochfahren. Da sie meist bei offenen Vorhängen schlief, zeigte ein Blick aus den Fenstern jedoch eine sternenklare, still stehende Nacht.
Als sich der vermeintliche Donner wiederholte, begriff sie, was es in Wirklichkeit war – Fäuste, die an eine Tür hämmerten. Nicht an ihre, sondern an die ihres Gemahls. Gleich darauf hallte die Stimme eines jungen Mannes durch den Gang: »Euer Gnaden, kommt schnell! Euer Gnaden!«
Während Amelia aus dem Bett stieg und sich eilig einen Morgenmantel über das weiße Nachtkleid warf, wurde draußen eine Tür aufgerissen und der Herzogherrschte sein Gegenüber im Flüsterton an: »Seid Ihr von allen guten Geistern verlassen, Scowell?! Die Herzogin schläft nebenan!«
Scowell, der Jüngste unter den Stallburschen, stieß zwischen schweren Atemzügen hervor: »Ihr müsst sofort kommen! Das Fohlen! Jades Fohlen!«
Die braune Stute mit dem weißen Stirnfleck, die immer so lieb um eine Nascherei bettelt, schoss es Amelia durch den Kopf.
»Was redest du? Es ist zu früh.« In Riddons Stimme lag plötzlich ein unruhiger, sorgenvoller Unterton, der sich sofort auf sie übertrug.
»Pickett sagt, es kommt! Und dass es Jade nicht gut geht!«
Unter fortwährendem Fluchen eilte der Herzog zurück in sein Gemach, bevor die hastigen Schritte zweier Männer von den Wänden widerhallten.
Amelia stürzte hinaus und erhaschte einen flüchtigen Blick auf ihren Ehemann, der sich den ockerfarbenen Gehrock überwarf, ehe er die Treppe hinunterstürmte. Sie lief ebenfalls nach unten und stieg in der Halle so ungeschickt in ihre Stiefel, als hätte sie noch nie welche getragen.
Die Nachtluft schlug ihr eisige Kälte und ihr eigenes, offenes Haar ins Gesicht, als sie Richtung Stallungen rannte. Kies knirschte unter ihren Sohlen und ihre Hände ballten sich vor ihrer Brust um den Stoff des Morgenmantels.
Aufgeregte Stimmen drangen aus der Stallgasse. Scowell stand vor einer der Boxen und trat von einem Bein aufs andere.
Amelia überwand die Distanz und sah über die brusthohe Holzwand den Herzog hinter einer auf dem Boden liegenden Stute im Heu knien. Seine Hand strich prüfend über einen geschwollenen Bauch, der sich hastig hob und senkte. Jade litt offenbar Schmerzen und kickte ab und an mit den Beinen, als wollte sie aufstehen. Stallmeister Pickett kramte währenddessen Gegenstände zusammen und wirkte fahrig, was so gar nicht zu seinem schwerfälligen Äußeren passte.
»Kann ich helfen?«, fragte Amelia besorgt.
Ihr Ehemann riss den Kopf hoch und zeigte sich nahezu erschrocken über ihre Anwesenheit. Er trug keine Maske und kein Plastron, aber seinen Anzug samt Weste. Offenbar war er noch nicht im Bett gewesen. Seine Miene, die eben noch die Weichheit der Empathie gezeigt hatte, verschloss sich vor ihr und er wandte sich ruckartig ab. »Das ist keine Arbeit für eine Frau.«
»Beim Kinderkriegen zu helfen, ist keine Arbeit für eine Frau?«, hakte Pickett spöttisch nach. »Na, Ihr werdet Augen machen, wenn sie erst den neunten Duke of Ailesbury aus ihren zarten, schmalen Lenden …«
Der Herzog schoss einen vernichtenden Blick in Picketts Richtung. »Und wenn es schiefgeht? Soll sie das mitansehen?!«
»Ich habe meinem Vater die Hand gehalten, während er seinen letzten Atemzug getan hat«, warf Amelia ein. »Ich muss nicht geschont werden.«
»Da hört Ihr’s, Euer Gnaden«, brummte Pickett, ehe Riddon erneut widersprechen konnte, und an Amelia gewandt meinte er: »Rein mit Euch. Euch hab’ ich lieber hier drinnen als Scowell, dieses tattrige Ding.«
Amelia betrat die Box und hörte ihren Gemahl murmeln: »Für gewöhnlich gehorcht eine Frau ihrem Mann und nicht dem Stallmeister.« Seine Worte klangen zu sanft, um als Tadel durchzugehen, deshalb schenkte sie ihnen keine weitere Beachtung.
Scowell schien nach einem Konter zu suchen, um seine Ehre zu verteidigen, aber Jades Stöhnen ließ ihn das Gesicht verziehen. Er war den Tränen nah.
»Genau das meine ich«, murmelte der Stallmeister nachsichtig. »Außerdem hat Jade Euch gern. Ich seh’ doch, wie sie Euch immer die Koppel entlang auf Eurem Spaziergang begleitet und Eure Streicheleinheiten genießt. Vielleicht wirkt Eure Anwesenheit beruhigend auf sie. Für gewöhnlich ist’s den Stuten lieber, wenn man sie dabei in Ruhe lässt, aber uns’re Jade is’ anders. Versucht es, Mädchen.«
Riddon hob den Kopf. »Habt Ihr die Herzogin gerade Mädchen genannt?«
»Na, ’n Junge is’ sie ja keiner, oder?«, antwortete Pickett ungerührt.
Der Herzog würde es nicht wissen, wenn es so wäre, dachte Amelia. Er kam ja nicht in ihr Schlafgemach.
Vorsichtig näherte sie sich der auf der Seite liegenden Stute und ließ sie an ihrer Hand schnuppern. Jades Nüstern blähten sich angestrengt und ein mitleiderregender Laut entrang sich ihr. Amelia setzte sich ins Heu und überließ ihr die Entscheidung darüber, wie viel Nähe sie brauchte. Die Stute traf eine, indem sie ihr den Kopf in den Schoß zu legen versuchte, was erst gelang, als Amelia näher rückte und sich unter das Pferd schob. In ihrem Rücken hörte sie Scowell schniefen. Der Kampf gegen die Tränen war hörbar verloren.
Der Bursche war noch jung, schoss ihr durch den Kopf. Kaum sechzehn. Drei Jahre jünger als der Verehrer ihrer Cousine, von dessen liebevoller Rücksichtnahme Lucy stets schwärmte. Ab welchem Alter begannen Männer, ihr Zartgefühl zu verlieren?
In ihrem dunklen Herzog schien zumindest noch ein Hauch davon zu schlummern, wie sie sich beim Anblick seiner großen und dennoch feinen Hände eingestand, die unglaublich sanft über braunes Pferdefell strichen.
»Soll ich den Rossarzt holen?«, fragte Scowell, doch der Stallmeister schüttelte den Kopf.
»Wir können nur warten«, murmelte er und setzte sich auf einen Schemel, der mitten in der Box stand. »Ich hasse es, zu warten.«
Ruhig über die verschwitzte Stirn der Stute streichend, leckte Amelia sich die trockenen Lippen und schmeckte Strohstaub. Ein Beben wanderte durch ihren Körper, als hätte dieser erst jetzt bemerkt, wie kalt die Nacht war. Verwirrend, dass der Herzog ausgerechnet in diesem Moment aus seinem Gehrock schlüpfte. Noch verwirrter war sie allerdings, als ihr Ehemann ihr das Kleidungsstück über Jade hinweg entgegenstreckte, ohne ihr dabei ins Gesicht zu sehen.
Erst nach zwei Herzschlägen begriff sie, dass er seine Jacke für sie ausgezogen hatte. Zögerlich griff sie danach und hüllte sich zum ersten Mal in ihrem Leben in den Gehrock eines Mannes. Er war ihr viel zu groß, der Stoff noch warm von seinem vorherigen Träger, nach Rasierwasser duftend und ihr eine Geborgenheit vermittelnd, die sein Besitzer selbst so gar nicht ausstrahlte. Aber tat er das mit dieser Geste nicht irgendwie doch?
Nachdenklich glitt ihr Blick über seine breiten Schultern und die muskulösen Arme in weißen Hemdsärmeln, bis Jade sich wieder aufbäumte und sich hörbar Flüssigkeit über das Stroh ergoss.
Pickett sprang auf und sah dem Herzog über die Schulter. »Es kommt.«
»Es wäre mir nicht aufgefallen«, murmelte Riddon spöttisch.
Der Stallmeister bekreuzigte sich. »Gütiger Herr im Himmel, steh’ uns bei. Das muss ihr erstes und letztes Fohlen bleiben.«
»Es war ja auch nicht geplant.«
»Zumindest nicht von uns, Euer Gnaden«, mischte sich Scowell ein. »Jade und Fly haben’s ganz gut geplant, wie’s scheint.«
Amelia warf ihm einen Blick zu, wofür sie den Kopf in den Nacken legen und unnatürlich verrenken musste. »Was ist denn passiert?«
»Abgehauen sind die zusammen«, antwortete Scowell derart vorwurfsvoll, als hätten die Pferde damit gegen die Etikette verstoßen. »Wir haben sie über Stunden hinweg gesucht und uns schon mit unserem Tod abgefunden.«
»Mit Eurem Tod?«, hakte Amelia verständnislos nach.
Der Bursche wurde leiser. »Na, die gehören doch zu den Lieblingen vom Herzog, Fly und Jade. Deshalb haben wir uns nicht getraut, es ihm zu sagen. Aber als es dunkel geworden ist, mussten wir mit der Sprache rausrücken. Sobald er mitgesucht hat, haben sich die Ausreißer dann auch finden lassen. Waren unten in dem kleinen Tal am Bach. Ganz friedlich haben sie da neben’ander gegrast. Hatten wohl ordentlich Hunger, nach dem, was sie davor getrieben haben.«
»Scowell, Ihr sprecht mit Ihrer Gnaden«, ermahnte der Herzog grimmig, während Amelia sich ein Kichern verbiss.
Scowell nickte, schien aber nicht zu verstehen. »Weiß ich doch.« Seine Stirn legte sich in Falten, die fast sofort einem Lächeln wichen. »Jedenfalls waren wir alle so mächtig erleichtert, dass wir Kuchen essen mussten und überhaupt keine Köpfe gerollt sind. Sind wahrscheinlich noch nie unter Seiner Gnaden.«
»Vielleicht lagere ich sie bloß gut außer Sicht«, murmelte Riddon und entlockte Amelia damit nun doch ein Glucksen, was seinen Blick flüchtig auf sie lenkte.
Einen Herzschlag später beanspruchte Jade seine ganze Konzentration, als eine Wehe durch sie hindurchwanderte. Pickett behielt scharf im Auge, was sich tat.
»Es liegt richtig«, sagte der Herzog leise und klang erleichtert. Damit legte sich eine sonderbar ruhige Atmosphäre über den Stall und die Zeit schien langsamer zu verstreichen.
Amelia liebkoste die Stute, doch ihr Augenmerk lag meist auf ihrem Ehemann, der dem Fohlen auf die Welt half. Im Einklang mit Jades Wehen zog er sachte an dem kleinen Wesen mit den überlangen Beinen. Seine Hände befreiten es von der weißen Hülle, in der es so lange Zeit verbracht hatte, damit es nun den ersten Atemzug tun konnte. »Eine Stute«, verkündete Riddon und tastete das Kleine ab, das ihn misstrauisch beäugte. Das Fohlen war um ein Vielfaches dunkler als die Mutter, doch der weiße Fleck auf der Stirn schien beinahe von derselben Form und Größe. Ein Erbstück. Ein Muttermal, wenn man so wollte.
»Scowell«, sagte der Herzog. »Holt einen Eimer warmes Wasser von drinnen.«
Der Bursche stürmte davon. Jade richtete sich ein wenig auf und Pickett sagte zu Amelia: »Gebt Ihr etwas Heu zu fressen, damit sie merkt, dass sie sich noch Zeit lassen darf. Sie soll nicht sofort aufstehen.«
Während Amelia sich erhob, um den Korb mit Heu zu holen, der vor der Box stand, legte der Herzog das Fohlen zu seiner Mutter und lobte Jade mit verstohlen leise gesprochenen Worten. »Hast du gut gemacht.«
»Sobald sie in die Höhe kommt, nehm’ ich ihr ein bisschen Milch ab«, verkündete Pickett. »Das Kleine sieht mir recht mickrig aus. Wird ’ne Zeit brauchen, bis es steht.«
Amelia legte ein paar Handvoll Heu vor Jades Maul und die Stute begann zu fressen, nachdem sie ihrem Fohlen noch einmal entgegengeschnaubt hatte. Vermutlich half das Kauen gegen den Schmerz.
Der Herzog wusch sich in einem Eimer die Hände und griff nach einem Tuch, um das Kleine trockenzureiben.
Scowell kehrte mit dem gewärmten Wasser zurück und der Stallmeister wies mit dem Kinn Richtung Jade, woraufhin der Bursche ihr zu trinken gab. Ein kleines, dankbares Wiehern ertönte, bevor Jade sich an dem Wasser gütlich tat.
Das Fohlen hatte derweil schwer damit zu tun, seine langen Beine zu sortieren und zwischendurch den Mann zu beäugen, der es abrubbelte und ihm dann die Hand vor die kleinen Nüstern hielt. Wieder flüsterte der Herzog etwas. Diesmal verstand sie kein Wort, doch der Tonfall war noch immer jener liebevolle, den er auch für Jade benutzt hatte. Ein Tonfall, der sie nicht kaltließ, wie sie sich eingestand. Stattdessen rührte es an ihrem Herzen, wenn die dunkle Stimme des Herzogs von dieser Zärtlichkeit belegt war, die man ihm gar nicht zutraute. Warum eigentlich nicht? Wegen seiner maskulinen Erscheinung? Wegen der ablehnenden, stolzen Haltung? Wegen der schlecht verheilten Narben, die sich dunkel vom Rest seines Gesichts abhoben und ihn ein Auge gekostet hatten?
Vielleicht wegen all dieser Dinge zusammen.
Nach ein paar Minuten erhob sich Jade stöhnend aus dem Heu und tat ein paar Schritte. Pickett half ihr aus, machte hier und da einen Handgriff und schob mit dem Fuß das blutig gewordene Stroh beiseite, damit sie es nicht überall in der Box verteilte. Dann füllte er ein Fläschchen mit Stutenmilch, verschloss es und reichte es dem Herzog. Dieser warf Amelia einen Blick zu. »Möchtet Ihr?«
Amelia antwortete mit einem zögerlichen Nicken und nahm ihrem Ehemann das Fläschchen ab. Behutsam und verunsichert ob der weiteren Vorgehensweise näherte sie sich dem Fohlen und wollte daneben auf die Knie sinken, da legte der Herzog ihr eine Hand an den Unterarm, um sie daran zu hindern.
»Ihr müsst es stützen«, murmelte er und bedeutete ihr, sich breitbeinig über das Kleine zu stellen, damit es sich anlehnen konnte. Als das Fohlen verwirrt unter ihrem weißen Nachtrock hervorlugte, griff der Herzog nach ihren Händen und richtete sie aus, wie sie gehörten – eine unter dem zarten Maul des Fohlens, jene mit der Flasche über den Kopf des Tieres erhoben. Seine Haut war überraschend weich und warm, seine Berührung unerwartet sanft. Beiderlei beschleunigte ihren Pulsschlag auf angenehmste Weise. Sie flüsterte ein Dankeschön und senkte den Kopf, um ihre heiß werdenden Wangen zu verbergen.
Nach jener Nacht damals hatte sie geglaubt, man hätte ihr die Fähigkeit zu derartigen Empfindungen ausgetrieben. Scheinbar war das ein Irrtum gewesen.
Oder war es Selbstschutz? Eine fingierte Reaktion ihres Körpers, weil klar war, dass der Herzog ihrem Schlafgemach nicht ewig fernbleiben würde?
Der Stallmeister vertrieb ihre Gedanken mit einem Auflachen. »Die Kleine hat einen Zug wie mein Vater ihn hatte, sobald meine Mutter den Nussschnaps aufgetischt hat. Gott hab’ die beiden selig.«
Amelia widmete sich dem genüsslich schmatzenden Fohlen in ihrer Obhut. Es war schrecklich zierlich und noch so unvertraut mit dem eigenen Körper, besonders mit den Spinnenbeinen. Die Ohren standen in verschiedene Richtungen und der dunkle Blick wirkte verschlafen.
»Die wird eine richtige Schönheit«, sagte Scowell mit Vaterstolz in der Stimme.
»Das ist sie schon jetzt«, flüsterte Amelia lächelnd und hob den Kopf, um den Stallburschen anzusehen, doch ihr Blick traf stattdessen auf den des Herzogs. Er erwiderte ihr Lächeln nicht, sondern wandte sich von ihr ab.
Der letzte Schluck war getrunken und Amelia gab das Fohlen frei, das sich sofort zurück ins Heu sinken ließ.
»Ein paar Minuten geben wir ihr noch«, meinte Pickett. »Wenn die kleine Miss nicht von selbst aufsteht, müssen wir ihr helfen. So ein junger Körper muss in Gang kommen, damit das Blut ordentlich fließen kann.«
Scowell streckte die Hand nach dem leeren Fläschchen aus. »Das könnt Ihr mir geben, Euer Gnaden, ich wasch’s aus.«
Amelia reichte es ihm über die niedrige Abtrennung der Box hinaus und hörte gleich darauf das Plätschern von Wasser, welches das Rascheln des Strohs übertönte, den das Fohlen mit seinen winzigen Ausschlägen verursachte.
Jade machte ein paar Schritte auf den Herzog zu und drückte ihm den Kopf an den Oberkörper, um sich an ihm zu scheuern, wobei sie ihn gegen die Holzwand stieß und ihm ein Keuchen entlockte, das den Hauch eines Lachens in sich zu bergen schien. Tatsächlich umspielte ein winziges Schmunzeln seine Lippen, von dem Amelia geradezu fasziniert war. »Ja, das hast du gut gemacht. Hab’ ich doch schon gesagt«, murmelte er der Stute zu und tätschelte ihr den Hals, bevor er sich räusperte und seiner Stimme die übliche Strenge verlieh: »Und warum habt Ihr mir jetzt einen solchen Schrecken eingejagt, Pickett?«
Der Stallmeister wies mit dem Kinn auf Jade: »Die da hat getan, als wär’s zum Sterben. Glaubt mir, wenn ich sage, dass ich mich am meisten gefürchtet hab’. Sobald Ihr mit der Herzogin gekommen seid, war’s dann gut. Da war sie zufrieden. Vorher hat sie Drama gemacht. Ihr kennt doch uns’re Jade.«
Der Herzog gab ein Seufzen von sich und wandte sich Scowell zu. »Seid so gut und holt uns eine Kanne Kaffee.«
*
Zwei Stunden und eine zweite gemeinschaftlich geleerte Kanne später hatte das Fohlen seine ersten Schritte gemacht, bei seiner sehr liebevollen Mutter getrunken und ihnen allen die Herzen gestohlen.
Drei Schritte hinter dem Herzog stieg Amelia die Treppe hoch und hielt sich die Hand vor den Mund, um ein Gähnen dahinter zu verbergen.
Als sie die nebeneinanderliegenden Türen zu ihren Schlafzimmern erreichten, hielt Riddon vor der seinen inne. »Danke für Eure Hilfe«, sagte er und benutzte wieder jene seltsam gesenkte Stimme, die sich mit ihrer Sanftheit so dringlich in ihr Herz zu schleichen suchte.
Von Verlegenheit heimgesucht wickelte sie das wärmende Obergewand fester um ihren Körper. »Ich hatte nicht den Eindruck, besonders von Nutzen gewesen zu sein«, gab sie flüsternd zurück. »Dennoch gern geschehen.«
Der Herzog erwiderte nichts darauf. Ein letztes Mal huschte sein Blick über ihr Gesicht, bevor er nach einem kaum hörbaren Gutenachtwunsch in sein Gemach verschwand.
Amelia blieb allein im Gang zurück und vergrub die Hände tiefer in weichem Stoff. Erst einige Herzschläge später begriff sie, dass es noch immer der Gehrock Seiner Gnaden war, der sie einhüllte.
Kapitel 3
Unter blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein tobte Jade mit ihrem Fohlen über die eigens für sie eingezäunte Wiese. Das Kleine war drei Tage alt, entzückend ohne Ende und wild wie ein Wirbelsturm. Laut Stallmeister Pickett hatte der Tierarzt behauptet, selten ein so übermütiges Frühchen erlebt zu haben und dass es sich ganz prächtig zu entwickeln versprach.
Immer wieder unternahmen Mutter und Tochter Abstecher zu Amelia, die am Rande der Koppel auf der untersten Zaunlatte stand, das herzerwärmende Treiben beobachtete und abwechselnd Streicheleinheiten und Brombeeren austeilte.
Gerade schob sie sich selbst eine in den Mund. Die säuerliche Süße explodierte auf ihrer Zunge, schmeckte nach Wald und dem späten Sommer. Vielleicht auch nach dem nahenden Herbst, der schon die ersten Blätter einfärbte.
Hinter sich vernahm sie Schritte durch das Gras. Gewiss Bessie, die sie für eine Tasse Tee nach drinnen holen wollte oder ihr eine nach draußen brachte.
Ohne sich nach ihr umzudrehen, knüpfte Amelia dort an, wo sie heute Morgen beim Frühstück aufgehört hatten. »Ich habe noch einen. Was ist der Unterschied zwischen einem kalten Fisch und dem Herzog?«
»Ich weiß es nicht, aber die Antwort interessiert mich brennend.«
Bereits beim ersten Wort war Amelia erstarrt, denn es kam eindeutig nicht aus dem Mund der Haushälterin. Unendlich verärgert auf sich selbst schnitt sie eine Grimasse, bevor sie sich dem Herzog zuwandte, der einen Schritt schräg hinter ihr stand, die Hände hinter dem Rücken verschränkt hielt und eine ernst-ablehnende Miene zur Schau stellte. Er trug den ockerfarbenen Gehrock, den sie in der Nacht der Fohlengeburt getragen hatte. Vermutlich hatte Mr. Beetle ihn inzwischen gereinigt.
Ihr Herz raste fürchterlich aufgebracht. »Verzeiht, Euer Gnaden. Ich dachte, Ihr wärt jemand anderes.«
»So viel hatte ich mir bereits zusammengereimt«, antwortete er kalt. »Wenn Ihr mich jetzt erleuchten würdet.«
Ihre Wangen glühten. »Das würde ich lieber nicht, Euer Gnaden.«
Was sollte er denken, wenn sie den Rest ihres Scherzes vorbrachte? Die Pointe bestand nämlich im Grunde aus einer Beschwerde darüber, dass sie öfter einen kalten Fisch zu Gesicht bekam als ihren eigenen Ehemann. Er würde es vermutlich als Kritik an seinem Fernbleiben ihres Schlafzimmers auffassen und nicht als das, was es in Wahrheit war. Nämlich Amelias stille, gewiss schrecklich dumme und naive Sehnsucht, ein wenig Zeit mit ihm zu verbringen und den Mann hinter der Maske kennenzulernen. Den Mann, der mit seinen Pferden so liebevoll sein konnte, wie er in diesem Moment erneut unter Beweis stellte, als Jade vor ihm ankam und Zärtlichkeiten einforderte.
Ihr war sehr wohl bewusst, dass ihre unerwartet kommenden Gefühle eine idiotische, wenn nicht gar gefährliche Anwandlung darstellten. Neugier war der Katze Tod. Und die Anziehungskraft eines schönen Mannes oft das Verderben einer Frau.
»Pickett hat die Papiere für das Fohlen bereitliegen«, sagte Riddon tonlos und tätschelte Jade über den Zaun hinweg den Hals. »Er braucht noch einen Namen, den er eintragen kann. Ich dachte mir, Ihr möchtet das vielleicht übernehmen.«
Während er dem Fohlen die Hand an die Nüstern hielt, hielt Amelia den Atem an. »Ich darf der Kleinen einen Namen geben?«, fragte sie flüsternd.
Der Herzog senkte in einem vornehm-knappen Nicken das Haupt. »Sagt einfach Pickett Bescheid, wofür Ihr Euch entschieden habt.«
»Papiere, sagt Ihr?«, hakte sie nach. »Habt Ihr denn vor, sie zu verkaufen?«
»Ich habe eigentlich vor, sie Euch zu schenken. Falls Ihr sie haben wollt.«
Ihr Blick wurde weit. »Das … das wäre … Natürlich würde ich sie haben wollen.«
»Ihr wirkt überrascht. Dabei wisst Ihr bereits, dass ich nicht geizig bin. Immerhin habe ich Eurem früheren Liebhaber ein gutes Auskommen beschert.«
Schwer schluckend nahm sie den Blick von ihm. Es war gefährliches Terrain, auf welches er dieses Gespräch zu lenken gedachte.
Als ihm klar wurde, dass er keine Antwort zu erwarten hatte, fuhr er fort: »Er hat inzwischen genug Zeit und Möglichkeiten verstreichen lassen. Darf ich also davon ausgehen, dass er nicht kommen wird?«
Die Vorstellung war absurd und verstörend. Ihre Nasenspitze wurde kalt, als hätte jemand versucht, sie mit dem Gesicht voran in Eiswasser zu stoßen. »Was?«
»Meine Frage war recht eindeutig, Euer Gnaden.« Die Anrede war nicht mehr als ein Knurren. »Ich will wissen, ob Ihr eine Flucht vor mir plant.«
Irritiert davon, dass sich dieses Thema in seinem Kopf auch nach einem Monat offenbar noch nicht erledigt hatte, schüttelte sie den ihren. »Ich habe Euch mehrere Versprechen gegeben, Euer Gnaden. Einige vor Eurem Berater, einige weitere vor einem Priester. Und keines davon gedenke ich zu brechen.«
»Es würde Euch niemand einen Vorwurf machen. Ihr würdet mich zwar ruinieren, aber mir fällt keine Person ein, die es Euch übel nehmen würde.«
»Ihr würdet es mir übel nehmen.«
»Warum sollte Euch das kümmern? Ihr wärt längst fort.«
»Ich empfinde Euer anhaltendes Misstrauen als höchst kränkend, Mr. Riddon.«
Seine Augenbraue schnellte in die Höhe. »Ihr sprecht mir meinen Titel ab?«
»Und Ihr sprecht mir die Vertrauenswürdigkeit ab und begegnet jeder meiner Beteuerungen mit neuerlichem Argwohn und spitzen Bemerkungen.«
Er wandte sich von ihr ab und wischte sich über den Mund. Als sein Blick zu ihr zurückkehrte, jagte ihr die Kälte darin einen Schauer über den Rücken. Seine Stimme war ebenso eisig, als er sagte: »Beteuerungen nutzen mir nichts. Aber Ihr könnt mir heute Nacht zeigen, wie ernst sie gemeint sind.«
Er kehrte ihr den Rücken und ging eilig zurück zum Herrenhaus.
Sie sah ihm nach, wobei ihr das Herz im Hals klopfte. Doch nicht wie sonst auf angenehme Art.
*
Unten im Salon schlug die Standuhr gewiss elf Uhr, obwohl sie hier oben niemand hören konnte. Im Dunkel der Nacht lief John in seinem Gemach auf und ab, während er sich wünschte, dass … Gott, er wünschte so vieles. Zum Beispiel dass er seiner Ehefrau heute Nachmittag nicht auf diese primitive Weise gedroht hätte. Auf die quälende Erinnerung daran schenkte er sich noch einen Whiskey ein und leerte ihn in einem Zug, bevor er seine Wanderung fortsetzte. Er hoffte,





























