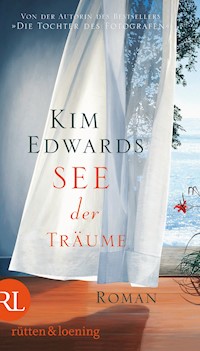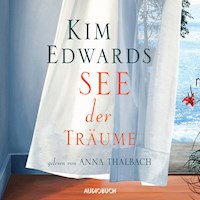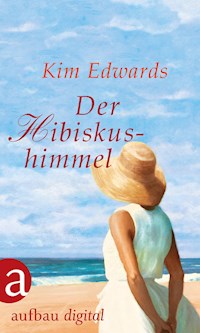
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kim Edwards Buch liest sich wie das Werk eines klugen, unerschrockenen Reisenden, der bei der Rückkehr nach Hause wertvolle Andenken aus anderen Ländern bei sich trägt. So lernen wir in 14 preisgekrönten Erzählungen einen Feuerschlucker kennen, der in Liebe entflammt, einen Kriegsheimkehrer und seine asiatische Braut und eine geheimnisvolle Frau, deren Leben mit dem von Marie Curie verwoben ist. Ein jeder von ihnen stößt an die Grenzen von Zeit, Ort und Lebenslage, auf der Suche nach dem größte Mysterium der Menschheit - dem unfassbaren Wunder der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Kim Edwards Buch liest sich wie das Werk eines klugen, unerschrockenen Reisenden, der bei der Rückkehr nach Hause wertvolle Andenken aus anderen Ländern bei sich trägt. So lernen wir in 14 preisgekrönten Erzählungen einen Feuerschlucker kennen, der in Liebe entflammt, einen Kriegsheimkehrer und seine asiatische Braut und eine geheimnisvolle Frau, deren Leben mit dem von Marie Curie verwoben ist. Ein jeder von ihnen stößt an die Grenzen von Zeit, Ort und Lebenslage, auf der Suche nach dem größte Mysterium der Menschheit – dem unfassbaren Wunder der Liebe.
Über Kim Edwards
Kim Edwards’ Roman »Die Tochter des Fotografen« war ein internationaler Bestseller und in den USA eines der erfolgreichsten Bücher der letzten Jahre. Für ihren Erstling »Der Hibiskushimmel« wurde die Autorin vielfach ausgezeichnet. Sie lebt in Lexington und unterrichtet Kreatives Schreiben an der University of Kentucky.
Gesine Schröder übersetzt seit 2007 aus dem Englischen und hat u.a. Jennifer duBois und Curtis Sittenfield ins Deutsche übertragen. Nach Aufenthalten in den USA, Australien, Indien, England und Kanada lebt sie in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kim Edwards
Der Hibiskushimmel
Erzählungen
Aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder und Milan Clauss
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Das Rad des Lebens
Spring, Mountain, Sea
Ein Licht in der Dunkelheit
Balance
Im freien Fall
Die Einladung
Die Laterne des Aristoteles
Die Geheimnisse eines Feuerkönigs
Durst
Himmlischer Saft
Gold
Im Garten
Ratten
Die Geschichte meines Lebens
Zusatzmaterial
1. Die Autorin und das Buch
2. Vom Reisen und Schreiben. Kim Edwards im Gespräch.
3. Diskussionsthemen
Impressum
Das Rad des Lebens
Mein Vater lebte in der Überzeugung, dass die Geschichte sich wiederholt. Nicht im großen Maßstab der Nationen und der Kriege, sondern in den Lebensläufen von Familien. Er war ein religiöser Mensch und glaubte, dass der Lauf der Welt festgefügten Mustern folgte, die sich dem Frommen im andächtigen Gebet enthüllten. Was ist Schicksal, und was liegt in der Macht des Einzelnen? Mein Vater hätte auf diese Frage immer geantwortet, alles sei Schicksal. Das entsprach unserer Religion, und somit war es die einzige Antwort, die er geben konnte. Und er übertrug sie auf uns, seine Kinder.
Er war ein kleiner, aber kräftiger Mann mit einer Glatze, die ihn weise und alterslos erscheinen ließ. In jenen Jahren, die der Unabhängigkeit unseres Landes vorausgingen, war er sehr einflussreich und strahlte eine fast schon majestätische Würde aus. Heute weiß ich, dass das Erbe, das er jedem Einzelnen von uns auferlegte, nur plötzlichen Erinnerungen an halbvergessene Träume entsprungen war. Aber damals schien es mir, schien es uns allen, als seien es göttliche Eingebungen, die er ohne Vorwarnung über uns ausgoss wie Regenschauer aus heiterem Himmel.
»Jamaluddin«, sagte er dann, indem er seinen Blick finster und entschlossen auf meinen Bruder heftete, »gleicht in jedem seiner Züge seinem Großonkel Sayed.« Und er beschwor das Bild unseres Großonkels herauf, der lange vor unserer Geburt die Armee im Kampf gegen die kommunistischen Rebellen geführt hatte und noch im hohen Alter aufrecht und mit ungetrübtem Blick durchs Leben schritt. Von dem Tag an nannten wir unseren Bruder Sayed, zuerst nur scherzhaft, bald aber in vollem Ernst, bis sein wirklicher Name nur noch ein Eintrag in den Familienurkunden war. Ein anderer meiner Brüder glich einem Heiler, und ein weiterer kam nach einem Händler aus längst vergangenen Zeiten. Als meine Schwestern geboren wurden, befand mein Vater, sie seien getreue Abbilder meiner Zwillingstanten, der schönsten Frauen in seinem Heimatdorf. Noch Jahre später leuchteten ihre Wangen, wenn er davon sprach, und sie hielten sich besonders aufrecht, warfen ihr Haar nach hinten und lächelten das bezaubernde Lächeln schöner Frauen.
Von seinen dreizehn Kindern war ich das siebte, das erste Mädchen, und musste am längsten auf mein Vermächtnis warten. Mein Vater war ein bedeutender Mann, einer der Großen unseres Landes, und wir hatten früh gelernt, ihn nicht bei seiner Arbeit zu stören. Dennoch rückte ich mich hin und wieder in sein Blickfeld, in der Hoffnung, seiner Inspiration auf die Sprünge zu helfen. Ich sang unter seinem Fenster wie Shala, die große Dichterin der Familie, die mit ihren Liedern ganzen Dörfern Trost gebracht hatte. Oder ich überreichte ihm Tabletts voller Gebäck und dachte dabei an meine Großmutter, deren Haus immer von dem süßen Duft von Kokos und Gewürzen erfüllt gewesen war. Mein Vater nahm diese Opfergaben gleichgültig entgegen. Wenn ich ihm im Vorraum über den Weg lief, ließ er seine Fingerknöchel über meine Schulterblätter gleiten, aber obwohl ich an der Reihe war, würdigte er mich keines weiteren Blickes. Ich blieb Eshlaini, ich hatte keinen anderen Namen.
Eines Tages fand mich meine Mutter weinend in der Küche.
»Eshlaini«, sagte sie, lief leichtfüßig zu mir herüber und schloss mich in die Arme. Sie war mit ihrem elften Kind schwanger, und ich vergrub meinen Kopf in den Rundungen ihres Körpers, um ihr mein Leid zu klagen: Zwei meiner jüngeren Brüder hatten ihre Namen schon erhalten, nur ich nicht. Meine Mutter streichelte mein Haar und hörte mich an, und als ich zu Ende erzählt hatte, nahm sie meinen Kopf in ihre Hände und sah mir eine Weile nachdenklich in die Augen, bevor sie zu sprechen anfing.
»Eshlaini«, begann sie, »höre mir gut zu. Eshlaini, das ist der Name, den ich für dich ausgewählt habe, und ich hoffe, dass du ihn dein Leben lang tragen wirst. Am Abendhimmel gibt es einen wunderschönen, hellen Stern. In der Nacht, in der du geboren wurdest, habe ich diesen Stern lange angesehen. Als ich einschlief, träumte ich von ihm und erwachte aus diesem Traum mit deinem Namen, Eshlaini, auf den Lippen. Mit Gottes Hilfe habe ich viele Kinder geboren und ihnen allen Namen gegeben, aber schon bald wird dein Name der Einzige sein, der bleibt. Trockne jetzt deine Tränen. Erfreue dich an deinem schönen Namen, Eshlaini.«
Von diesem Tag an hörte ich auf, mir einen anderen Namen zu wünschen, und bald bekam ich noch einen Bruder. Meine Mutter legte mir das Neugeborene in den Arm. Ich erinnere mich noch an seine rötliche Haut, den schwarzen Haarschopf und daran, wie warm sich das kleine bewegliche Bündel anfühlte. Damals pflegte man noch die Traditionen, und meine Mutter wurde jeden Morgen in einem von einem Kohlenfeuer erwärmten Bett massiert. Die Hebamme ließ heiße Steine über ihren Bauch rollen. Ich saß in einer Ecke, wiegte behutsam das Kind in meinen Armen und hörte zu, wie sie miteinander sprachen.
»Wie fühlt sich das an?«, fragte die Hebamme und bewegte einen Stein hin und her. Ich hörte, wie meine Mutter scharf die Luft einsog, und sah ihre weißen Zähne hervorblitzen, als sie sich vor Schmerz auf die Lippen biss.
»Es tut weh«, sagte meine Mutter. »Es war eine leichte Geburt, aber der Schmerz ist schlimmer als je zuvor.«
Die Hebamme runzelte die Stirn und betastete prüfend ihren Bauch.
»Du solltest es genug sein lassen«, sagte sie. »Wenn du noch mehr Kindern das Leben schenkst, wirst du es mit deinem eigenen Leben bezahlen, Shalizah. Elf Kinder! Du solltest zufrieden sein.« Sie schwieg einen Moment, bevor sie fortfuhr. »Das solltest du wirklich, und er sollte es auch.«
»Eshlaini«, sagte meine Mutter und stützte sich mit ihren Ellbogen auf, »bring das Baby zu mir her.«
Ich tat wie befohlen und wiegte meinen Bruder neben dem Bett auf meinen Armen, während die Hebamme meiner Mutter in Kräutern und Ölen getränkte Stoffbinden um den Leib wickelte.
»Wie willst du ihn nennen?«, fragte sie und zog eine der Stoffbahnen so fest, dass meine Mutter vor Schmerz zusammenzuckte.
»Ich weiß es noch nicht.« Sie betrachtete das Gesicht meines kleinen Bruders. »Ich muss ihn erst ein wenig kennenlernen. Zul vielleicht. Das scheint ein guter Name für ihn zu sein.«
Die Hebamme reichte meiner Mutter ein Glas mit einer grünlichen Flüssigkeit, die so übel roch, dass ich die Nase kraus zog.
»Es ist nicht gut«, sagte sie, indem sie ihre Hände an ihrer Schürze abwischte, »einem Kind einen Namen zu geben und ihn wenige Jahre später wieder zu ändern. Was aus ihnen wird, liegt nicht in seiner Hand.«
Meine Mutter seufzte und trank die grüne Brühe, verzog das Gesicht und streckte eine Hand nach mir aus.
»Die ersten fünf Jahre gehören sie mir«, sagte sie. »In dieser Zeit interessiert er sich noch gar nicht für sie.« Sie lächelte und zog mich dicht zu sich heran. »Und dann habe ich immer noch Eshlaini. Eshlaini wird mir erhalten bleiben.«
»Es ist nicht richtig«, sagte die Hebamme noch einmal.
»Es ist nicht an uns, darüber zu urteilen«, antwortete meine Mutter.
Und das tat sie nicht, oder wenn sie es tat, redete mein Vater ihr ihre Ängste aus. Nicht umsonst galt er als der begnadetste Redner seiner Generation. Ich sehe es noch vor mir, wie er in seinem Arbeitszimmer inmitten einer Runde wichtiger Persönlichkeiten aufrecht und würdevoll auf einem harten Stuhl saß, während sich über ihren Köpfen der Deckenventilator langsam drehte. Egal, wie viele Männer dort versammelt waren, es war immer die Stimme meines Vaters, die sich gegen die anderen behauptete. Sie klang dunkel, melodiös und mächtig wie der Monsunregen. Es waren immer die Hände meines Vaters, die ich erhoben sah, wenn er mit kraftvollen Gesten seine Worte unterstrich, und es war immer mein Vater, der am meisten von den Entscheidungen sprach, die sie zu fällen hatten, und von dem Kurs, den sie einschlagen mussten, um das Land sicher durch die kommenden Ereignisse zu führen. In seinen täglichen Gebeten gab er sich als schicksalsergebener Mensch, aber er redete wie jemand, der erwartete, dass seine Worte den Lauf der Welt lenken konnten.
Auch meine Mutter schien daran zu glauben, denn trotz der Warnung der Hebamme wurde sie binnen eines Jahres wieder schwanger. Diesmal hatte sie von Anfang an Beschwerden und war bald ans Bett gefesselt. Ich saß oft bei ihr und ließ sie unter dem stetigen Summen und Klicken des Ventilators meine Haare flechten. Sie hatte starke Hände, und die Zöpfe, die sie mir flocht, zogen an meiner Kopfhaut. Noch heute, nach so vielen Jahren, flechte ich manchmal meine Haare, um diese Momente wieder heraufzubeschwören, wenn uns in der gedämpften tropischen Hitze hinter den geschlossenen Fensterläden feine Schweißperlen auf der Stirn standen und meine Mutter an dem abscheulichen medizinischen Tee nippte, der immer an ihrem Bett stand.
Die Wehen setzten ein, als an den Bäumen das Obst reifte, am Ende der heißen Trockenzeit und vor dem Beginn des Monsunregens. Wir hielten es für ein gutes Omen: Wir glaubten, sie würde von den Fiebern der heißen Jahreszeit ebenso verschont bleiben wie von der Kälte und Nässe des Monsuns, wenn sie zu dieser günstigen Zeit gebar; wir glaubten, sie würde am Leben bleiben.
Es war früher Morgen, als die Wehen einsetzten, und schon gegen Mittag desselben Tages hatte ich eine Schwester. Sie wurde in ein Zimmer neben dem meiner Mutter gebracht, in dem ich manchmal nachts schlief, und ich bekam die Aufgabe, mich um sie zu kümmern. Meine winzige Schwester – selbst in Decken eingehüllt war sie sehr zart. Ich berührte ihre klitzekleinen Finger und Ohren und bestaunte die durchscheinende Haut auf ihrer Stirn, unter der sich feine Äderchen abzeichneten. Durch die offene Tür konnte ich meine Mutter schlafen sehen. Ihr dunkles Haar umrahmte wie ein Schatten ihr bleiches Gesicht auf dem hellen Kissen. Die Hebamme war nach Hause gegangen, und ich blieb eine Weile auf der Schwelle stehen, um in der aufsteigenden Hitze des Tages ihren gleichmäßigen Atemzügen zu lauschen.
Zwei Stunden lang blieb alles friedlich. Ich betrachtete meine Schwester und hielt mein Schweigen wie ein langes Gebet. Als irgendwann am Nachmittag wieder Stöhnen aus dem Zimmer meiner Mutter zu mir herüberdrang, in das sich die beruhigenden Worte der Hebamme mischten, schrak ich hoch, aber es überraschte mich nicht. Voller Angst ließ ich meine Schwester zurück und rannte zu meiner Mutter hinüber. Die Laken waren blutbefleckt, und die Hebamme hob kaum den Kopf, als ich durch die Tür trat.
»Was ist denn?«, rief ich. »Was geschieht mit ihr?«
»Sie bekommt noch ein Kind«, sagte die Hebamme. »Deine erste Schwester hat noch einen Zwilling. Geh jetzt, kümmere dich um sie, und mach dir um deine Mutter keine Sorgen. Ich tue für sie, was ich kann, vertraue darauf – und vertraue auf Gott.«
Diesmal dauerten die Wehen länger. Das fühlte ich, obwohl ich keine Uhr hatte, um es zu messen. Ich versorgte meine Schwester, während die Hitze des Tages sich sammelte, anschwoll und wieder abebbte. Später sagte man mir, es habe zwölf Stunden gedauert, aber mir erschienen diese Stunden, in denen ich die erstickten Schreie und das Stöhnen meiner Mutter mit anhörte, wie Tage oder Jahre. Es war schon nach Mitternacht, als die Hebamme meine zweite Schwester in mein Zimmer brachte. Sie war noch kleiner und zerbrechlicher als die erste.
»Eshlaini!«, rief die Hebamme. Sie hatte mich über der schweren Geburt ganz vergessen. »Warst du die ganze Zeit über hier?« Ich nickte. Es gab ein Bett in dem Zimmer, aber ich saß stocksteif und wachsam auf dem einzigen Stuhl. Ich war erschöpft und verängstigt – in der Nachtluft ahnte ich die Gegenwart von Geistern und Stimmungen, die sich tagsüber im Verborgenen hielten.
»Kind«, sagte sie und legte mir ihre Hand auf die Schulter, »du musst schlafen.«
»Ich will meine Mutter sehen«, sagte ich.
»Sie schläft jetzt. Und das solltest du besser auch tun.«
»Sie ist tot«, sagte ich. »Ich weiß es.«
Die Hebamme sah mich überrascht und besorgt an. »Nein, sie ist nicht tot. Oh, Kind«, sagte sie, und trotz meiner neun Jahre, obwohl sie bis zur völligen Erschöpfung gearbeitet hatte, hob sie mich hoch und trug mich in das andere Zimmer hinüber. Meine Mutter atmete unregelmäßig und flach, und sie sah so blass aus wie die winzigen Kinder, die sie gerade geboren hatte. Aber als ich ihren Arm berührte, spürte ich ihre Wärme, und meine Anspannung löste sich.
»Na also«, sagte die Hebamme und streichelte mein Haar. Sie lehnte meinen Kopf an ihre Schulter und brachte mich zurück in das Zimmer nebenan, das von dem zarten Atmen meiner Schwestern erfüllt war. Sie legte mich auf das schmale Bett und breitete einen alten Sarong über mich.
»So ist es besser, Eshlaini. So ist es gut. Schlaf jetzt.«
Und ich schlief, aber ich schlief unruhig und träumte viel. Als ich erwachte, war es dunkel, aber das Haus war erfüllt von dem Geräusch eiliger Schritte und von eindringlich geflüsterten Worten. Die Tür zum Zimmer meiner Mutter stand einen Spaltbreit offen. Ich sah, wie mein Vater an ihrem Bett saß und ihre Hand hielt. Er betete. Ich war zu jung, um die Worte zu verstehen, aber ich hatte sie bei anderen Todesfällen gehört und wusste, wofür sie standen.
Was dann geschah, kann ich nicht mehr genau sagen. Die Worte regneten auf mich herab, und plötzlich traf mich die Erkenntnis, wie ich meine Mutter retten konnte. Ich stand auf. Ich weiß noch, dass der Boden sich unter meinen nackten Füßen kalt anfühlte und wie das Mondlicht auf das Gitterbett schien, in dem meine Schwestern schliefen. Noch im Schlaf bewegten sich ihre Münder, und ihre Hände und Füße ruderten herum wie in dem Wasser, aus dem sie gekommen waren. In der Stille, die aus dem Zimmer meiner Mutter herüberdrang, griff ich nach einem dicken Kissen und legte es auf die schlafenden Gesichter meiner Schwestern. Ich war neun Jahre alt und nahm beim Wort, was ich von der Hebamme gehört hatte. Wenn diese Zwillinge meine Mutter das Leben kosteten, so dachte ich, dann konnte sie noch gerettet werden, wenn sie starben.
Niemand kann im Nachhinein wissen, was passiert wäre. Vielleicht wäre ich in meinem Schmerz der verfehlten Logik meines Plans bis zum Ende gefolgt. Aber ich war kein schlechter Mensch und nicht wirklich verrückt, und es ist genauso gut möglich, dass ich davor zurückgeschreckt wäre. Vielleicht wäre ich nur einen Augenblick später an ihrem Kinderbett zusammengebrochen, hätte das Kissen wieder an mich genommen und in seine weichen Daunen geweint. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, und es spielt auch keine Rolle mehr. Denn mein Vater sah mich gerade in dem Moment, da ich meinen Entschluss gefasst hatte. Plötzlich stand er auf der Schwelle, und das entsetzlich kalte Licht in dem Zimmer hinter ihm zeichnete seinen dunklen Umriss in den Türrahmen. Er brüllte so laut auf, dass die Szene sich uns allen unauslöschlich ins Gedächtnis brannte. Sein Brüllen schreckte meine Brüder auf, und sie purzelten in das Zimmer wie kleine Vögel aus ihrem Nest. Sie wurden Zeuge, wie mein Vater mich schlug. Er schlug mich mit der ganzen Wucht eines erwachsenen Mannes, den die Unaufhaltsamkeit des Todes in ohnmächtige Wut versetzt hatte. Und sie hörten, wie er mir endlich den Namen gab, den ich mein Leben lang tragen sollte.
»Nimm sie mit«, sagte er und schob mich zu meinem ältesten Bruder hinüber, dem, der nach seinen Worten einem Soldaten ähnlich war. »Nimm sie und schließe sie in ihrem Zimmer ein. Sie ist wahnsinnig geworden wie damals ihre Großmutter. Rohila.« Er spuckte den Namen aus wie Schlangengift. »In dieser Besessenen kehrt Rohila zu uns zurück.«
Rohila. Wir alle kannten diesen Namen, aber wir sprachen ihn nur selten aus. Sie war die Mutter meines Vaters, und es hatte Zeiten gegeben, in denen sie für ihre Schönheit und ihre Nähkünste bekannt gewesen war. Damals kamen Bräute und reiche Frauen zu ihr, und sie ließ Abend für Abend ihre Nadel im Lampenlicht blitzen wie eine springende Elritze. Ihre eigenen Kleider waren so ausgesucht elegant, dass sie die Blicke aller Männer auf sich zog. Man erzählte sich, dass eine eifersüchtige Frau sie verflucht hatte, als sie schließlich heiratete. Niemand hätte es damals geahnt, denn Rohila und ihr Ehemann waren zu Anfang ein glückliches Paar. Erst später meinten sich die Leute daran zu erinnern, dass sie von Kopfschmerzen und wirren Träumen geplagt worden war. Bald nach der Heirat wurde sie schwanger, und es zeigte sich gleich, dass etwas nicht stimmte. Rohilas Bauch schwoll an, ohne dass sie selbst zugenommen hätte, und man erzählte sich später, dass sie unnatürlich nervös wirkte.
Jeder kennt das Fieber, das eine Mutter nach der Geburt ihres Kindes befallen kann, und die Vorsichtsmaßnahmen, die dagegen getroffen werden müssen. Es war nicht Rohilas Schuld, dass ihre Hebamme unkundig oder vergesslich war, vielleicht auch eifersüchtig oder behext. Sie konnte nichts dafür, dass die schützende Kräutertinktur nicht zubereitet und kein Opfer dargebracht wurde, so dass sie nach der Geburt ihres ersten und einzigen Kindes einem Anflug von Wahnsinn nicht widerstehen konnte. Man fand sie auf einer Brücke, als sie gerade im Begriff war, ihr Baby, meinen Vater, in den Fluss zu werfen. Daraufhin wurde sie von ihrem Mann verstoßen. Er heiratete eine andere Frau, jene Frau mit dem süß duftenden Gebäck, die ich später meine Großmutter nennen sollte. Rohila wurde nach Hause zurückgeschickt, wo sie von da an in großer Einsamkeit lebte. Sie pflegte ihre alten Eltern, und als sie starben, half sie ihren Brüdern und deren Frauen im Haushalt. Ich sah sie nur ein einziges Mal, eine gebeugte alte Frau, die Kindern aus dem Weg ging und die uns schlimme Träume bescherte. Mehr weiß ich nicht über sie, und dennoch glaube ich heute, dass ich ihr Schicksal begreife.
Denn durch das Vermächtnis, das mit ihrem Namen auf mich überging, wurde auch ihr Schicksal zu dem meinen. Ich war noch ein Kind, aber an dem Tag, als meine Schwestern geboren wurden und meine Mutter starb, wurde der weitere Verlauf meines Lebens festgeschrieben. Ich wurde Rohila, die niemals heiraten sollte, die zu Hause bleiben und sich um ihre Brüder kümmern würde, und um ihren Vater, wenn er alt wurde. Es wurde nie ausgesprochen, sondern stillschweigend vorausgesetzt. Hätte man meine Familie gefragt, ob ich so ein hartes Leben verdiente, hätten alle erstaunt aufgeblickt und geantwortet, es sei eben so vorherbestimmt. Für sie, die nach starken, gesunden und berühmten Vorbildern benannt waren, war es einfach, an die Vorsehung zu glauben. Wenn alles dem Schicksal überlassen war, dann lag es nicht in ihrer Macht, sich für mich einzusetzen. Und doch kam ich bald auf einen Gedanken, der ihnen nie in den Sinn gekommen wäre. Wenn ich tatsächlich, meinem Namen entsprechend, als alte Jungfer ein einsames Leben zu Hause zubringen würde, dann verbarg sich dahinter noch eine andere Wahrheit: Es war die Entscheidung meines Vaters, die dazu geführt hatte.
Was ist Schicksal, und was liegt in der Macht des Einzelnen? Mit siebzehn war ich eine schlanke und gesunde junge Frau mit langen Beinen und schmalen Fesseln. Ich begriff schnell, dass auch der Körper das Schicksal eines Menschen prägt. Niemand, der mich mit unbefangenen Augen sah, hätte geahnt, was meine Bestimmung innerhalb der Familie war. Auch die jungen Männer ahnten nichts davon, die mich auf meinem Weg zur Schule abpassten, um einen Blick auf meine goldbronzene Haut zu erhaschen. Sie liefen mir nach und versteckten Briefe zwischen den Seiten meiner Schulbücher, in denen sie von Liebe und der Zukunft sprachen, von einem Neubeginn. Ich hätte so klug sein sollen, zu wissen, dass diese Briefe nur Köder am Haken eines anderen vorherbestimmten Lebens waren. Ich hätte an meine Mutter denken sollen, die nur den Kopf abwandte, als die Hebamme sie mahnte, eine Wahl zu treffen, die sie nie hatte. Aber ich war jung und naiv und setzte all meine Hoffnung in diese Briefe in meinen Taschen. Ich lächelte den jungen Männern schüchtern zu, errötete vorteilhaft, und schon bald begannen sie das Haus meines Vaters aufzusuchen, um bei ihm um meine Hand anzuhalten.
An dem Abend, als der erste junge Mann sich vorstellte, stand ich im Obergeschoss am Fenster und sah zu, wie er an der Tür klingelte. Er hatte mir einen Brief zugesteckt, in dem er versprach, mich für sich zu gewinnen, und ich platzte fast vor Freude und Erwartung. Ich war mir sicher, dass mein Vater es sich anders überlegen würde. Schließlich wünschte sich niemand eine unverheiratete Tochter. Mein Verehrer hatte sich sehr sorgfältig gekleidet und seine Haare mit Wasser gekämmt, bis sie wie poliert aussahen. Nachdem er im Haus verschwunden war, wartete ich darauf, hinzugerufen zu werden.
Die Wartezeit kam mir endlos vor, und doch dauerte es kaum eine halbe Stunde, bis ich die Haustür zuschlagen hörte. Als ich zum Fenster lief, sah ich, wie der junge Mann eilig die Straße hinunter verschwand. Am nächsten Tag hielt ich verzweifelt nach ihm Ausschau, in der Hoffnung, zu erfahren, was passiert war. Aber auch wenn ich manchmal aus der Entfernung einen Blick auf ihn erhaschte, vermied er es fortan, mit mir zu sprechen.
Was mochte mein Vater ihm gesagt haben, und warum hatte er das getan? Ich glaubte, er habe den jungen Mann vielleicht für keine gute Partie gehalten. Schließlich war er ein berühmter und bedeutender Mann und konnte in Bezug auf seine Schwiegersöhne wählerisch sein. Daher überlegte ich diesmal lange, bis ich aus den Briefen, die ich erhielt, den eines jungen Offiziers auswählte, der in der Nähe stationiert war. War nicht auch mein ältester Bruder Offizier? Diesmal musste mein Vater einverstanden sein. Einige Zeit und viele Briefe und schüchterne Blicke später suchte auch dieser junge Mann das Haus meines Vaters auf. Ich wollte nichts dem Zufall überlassen und hockte mich unter das Fenster des Arbeitszimmers, um ihr Gespräch mit anzuhören.
»Aber eines macht mir Sorgen«, sagte mein Vater und klopfte seine Pfeife aus. Mein junger Offizier saß ihm hoffnungsvollen Blickes gegenüber. »Und zwar diese Besessenheit, mit der sie geschlagen ist. Ich mache mir Sorgen darum, was passieren könnte, wenn Sie beide Kinder bekämen. Wissen Sie, meine Tochter ist nicht ganz normal. Sicherlich haben Sie schon davon gehört – sie hätte beinahe ihre beiden Schwestern getötet, als sie klein waren. Und noch heute ertappe ich sie manchmal dabei, die Kinder im Park zu beobachten. Dann bekommt sie denselben unnatürlichen Gesichtsausdruck, den sie in jener Nacht auch hatte. Wir haben immer ein wachsames Auge auf sie, wissen Sie.«
»Ich hatte ja keine Ahnung …«, sagte der junge Mann. In seiner Stimme schwang Besorgnis mit. Ich wäre am liebsten durch das Fenster gesprungen, um ihm zu versichern, dass es nicht stimmte, was mein Vater über die Kinder im Park behauptete. Diese Kinder hatten mich nie interessiert, und auch die Nacht, in der meine Schwestern geboren worden waren, erschien mir längst wie ein Traum oder eine bloße Geschichte, die jemand anderem passiert sein mochte.
»Wenn ich es nicht ehrlich mit Ihnen meinte«, fuhr mein Vater fort, »würde ich Ihnen sofort die Hand meiner Tochter geben. Aber ich kann einen jungen Mann wie Sie nicht dazu verdammen, an ihrer Seite in ständiger Unsicherheit zu leben. Sie brauchen eine starke Frau, die Ihnen eine Stütze sein kann. Meine Tochter wird ihr Leben hier zubringen, und wenn ich sterbe, wird das Haus ihr gehören, so ist es vorherbestimmt. Ich habe lange gebetet, um in dieser Sache Einsicht zu erlangen, und ich bin sicher, dass es so ist.«
Es war ein warmer Abend, und dennoch begann ich zu zittern, als ich meinen Vater so reden hörte. Ich bebte so sehr, dass ich meine Hände unter meinen Armen festklemmen musste, damit sie nicht gegen die Hauswand klopften, denn ich begriff, was dieses Gespräch für mich bedeutete. Mein Vater vertrieb meine Verehrer mit voller Absicht, und er tat es nicht, um sie zu schützen, sondern um seiner selbst willen. Er wünschte sich einen friedvollen Lebensabend, und ich, Eshlaini, sollte diejenige sein, die ihn umsorgte. Das war keine göttliche Fügung, sondern der Wille meines Vaters. Der junge Mann erhob sich, um sich zu verabschieden, und reichte meinem Vater zum Dank die Hand. Dieser Anblick brachte mich schließlich dazu, etwas zu tun, was ich jahrelang für undenkbar gehalten hatte: Ich stand vor dem Fenster auf und widersprach meinem Vater.
»Es ist nicht wahr, was mein Vater Ihnen erzählt hat«, sagte ich.
Die beiden Männer drehten sich schockiert nach mir um. Ich sah zu dem jungen Offizier hinüber. Mir schlug vor Begeisterung über meinen mutigen Schritt das Herz bis zum Hals, und ich glaubte, er müsse dasselbe empfinden. Vielleicht erwartete ich sogar, dass er meine Hand ergreifen und mit mir fliehen würde, aber stattdessen wich er meinen Blicken aus. Als ich ihn so sah, verlangsamte sich mein Puls wieder, erst aus Ärger und dann vor Scham. Er starrte geradewegs die Wand an, und in seiner Wange zuckte ein Muskel. Schließlich war es wieder mein Vater, der als Erster das Wort ergriff. Er sprach ruhig und freundlich, wie man es mit Kindern und Verrückten tut.
»Rohila«, sagte er, »es ist nicht an dir, darüber zu urteilen. Geh jetzt auf dein Zimmer.« Der junge Mann wandte sich ab. Er vermied es, mich anzusehen oder mit mir zu sprechen.
»Rohila«, begann mein Vater noch einmal, aber diesmal unterbrach ich ihn.
»Ich habe alles gehört«, rief ich. Mir wurde bewusst, dass ich mit meinen wild abstehenden Haaren, meinem tränenverschmierten Gesicht und dem schrillen Klang meiner Stimme wie eine Besessene wirken musste. »Ich habe gehört, wie du mir das Haus versprochen hast. Wenn du mich nicht heiraten lässt, Vater, dann setze mich zumindest in dein Testament ein. Dieser Mann hier soll es bezeugen. Sorge dafür, dass es wirklich so kommt, wie du es beschlossen hast.«
»Nicht ich habe es entschieden«, sagte mein Vater. Doch er sah mich dabei so seltsam an, als hätte er mich gerade zum ersten Mal wirklich bemerkt. Dann zuckte er mit den Schultern. »Aber es ist nur eine Kleinigkeit. Dies Haus ist der am wenigsten wertvolle Teil meines Besitzes, und es wird nicht viel Zeit kosten, es in mein Testament einzutragen.«
In dieser Nacht saß ich noch lange wach und betrachtete das Schriftstück in meiner Hand. Mein Vater hatte darauf meinen wahren, offiziellen Namen gebraucht, um mir das Haus zu vermachen. Obwohl es nur ein kleines Haus von bescheidenem Wert war und obwohl ich wusste, dass nie wieder jemand um meine Hand anhalten würde, mischte sich ein seltsamer Stolz in meine Enttäuschung. Ich besaß jetzt dieses Stück Papier mit meinem Namen darauf, und ich wusste, dass ich einen Sieg errungen hatte, wie klein er auch sein mochte.
Was geschieht, wenn eine Wut, die so stark ist, dass sie von innen heraus die Augenlider verbrennt, zu lange keinen Ausdruck findet? Ich weiß es jetzt – sie verwandelt sich in einen galligen Knoten in den Eingeweiden, in einen schwarzen verschlossenen Samen. Ich spürte ihn jeden Tag, während ich meinen Vater versorgte und die Jahre meines eigenen Lebens eines nach dem anderen verstrichen. Abends saß ich oft vor dem Spiegel und besah meine neuen Runzeln oder zupfte die Haare aus, die an meinem Kinn zu sprießen begannen. Ich träumte davon, zu gehen, aber zu jener Zeit gab es für eine alleinstehende Frau keinen anderen Ort als ihr Elternhaus. Die ganze lange Kette der Ereignisse hielt mich unverrückbar dort fest. Manchmal fand meine Wut seltsame Wege, sich zu entladen. Ich zerbrach heimlich Dinge, deren Verlust er erst Monate später bemerkte – eine kleine Vase, die meiner Mutter gehört hatte, oder den Füllhalter eines berühmten Generals. Ich begrub seine Medaillen im Garten. Manchmal glaubte ich fast selbst daran, besessen zu sein, aber ich musste nur mit der Hand meinen Bauch betasten, um mich der Wahrheit zu vergewissern. Dort hatte sich die Wut eingenistet, ich konnte sie fühlen. Sie war hart wie ein verkrampfter Muskel und so groß wie eine Kastanie.
Eines Tages, nach vielen Jahren, erkannte ich, dass mein Vater sterben würde. Er war über achtzig und wirkte durchaus rüstig und gesund, aber an diesem Morgen bemerkte ich, wie seine Hand zitterte, als er seinen Reis zum Frühstück aß, und als er einen Brief unterschrieb, den ich für ihn getippt hatte, bebte seine Hand so sehr, dass ich seinen Namen nicht wiedererkannte. Er weigerte sich lange, zum Arzt zu gehen, aber als er es endlich doch nicht mehr vermeiden konnte, bestätigte man mir, was ich schon seit langem ahnte: dass er höchstens noch ein Jahr zu leben hatte.
An jenem Tag öffnete sich der Samen. Ich spürte, wie er nachgab und seine Säfte in meine Adern entließ. Mit jedem Tag, an dem mein Vater an Kraft verlor, bahnten sich neue Triebe ihren Weg in meine Arme und Beine. Ich spürte, wie ich von innen heraus zu neuem Leben erwachte. Wenn ich meinen Vater auf seinem Weg die Treppen hinauf stützte oder wenn er sich hinlegen musste, weil er sich schwach fühlte, spürte ich, wie Blätter in mir sprossen, wie Blütenknospen aufbrachen und sich in meinen Wangen und Fingerspitzen entfalteten. Als er bettlägerig wurde, war meine Verwandlung fast abgeschlossen; ein neues Selbst war im Begriff, geboren zu werden. Ich summte vor mich hin, wenn ich ihn pflegte, wenn ich seine erschlafften Beine wusch oder ihm die Decken aufschüttelte.
Und ich begann, mit ihm zu sprechen, nachdem ich all die Jahre schweigend meine Wut in mir verschlossen hatte. Der Krebs hatte seinen Kehlkopf zerfressen, so dass er mir nicht antworten konnte, wenn ich ihm schilderte, was ich mit dem Haus vorhatte. Nur seine Augen blieben immer auf mich gerichtet, während ich die Fenster öffnete, um zu lüften, den Ventilator abstaubte oder ein Glas Wasser eingoss und ihm an die Lippen setzte. Einmal sagte ich, ich würde das Haus niederbrennen, würde das Feuer anfachen, bis die blauen Flammen höher hinauswuchsen als die Baumkronen und nichts als Asche übrig blieb. Dann wiederum malte ich ihm aus, wie ich es an Menschen anderen Glaubens vermieten würde, die in der Küche Schweinefleisch brieten und ihre Hunde überall umherlaufen ließen. Oder es sollte ein Freudenhaus werden, raunte ich ihm zu, während ich seine Kissen zurechtrückte, in dem sich die Freier die Klinke in die Hand gaben und wonnevolle Seufzer aus jedem Zimmer drangen. Dann richtete ich mich plötzlich auf, als sei mir gerade etwas in den Sinn gekommen, und sagte, ich könnte natürlich auch selbst einen Liebhaber hierher mitbringen.
Mein Vater machte ein kehliges, gurgelndes Geräusch, und ich sah zu ihm hinunter. Er sprach ohne einen Laut, indem er mit übertriebenen Gesten die Worte auf seinen Lippen formte.
»Rohila«, sagte er. »Nicht. Es ist genug.«
»Rohila ist tot«, antwortete ich unwirsch und presste ihm ein feuchtes Tuch erst auf die eine, dann auf die andere Wange. »Sie ist schon vor Jahrzehnten gestorben, das solltest du doch wissen.«
Eine Weile tat er nichts, dann berührte er mich wieder am Ärmel. Ich sah ihn an. Er rang nach Worten, und ich spürte eine jähe Wärme auf meiner Haut.
»Was hast du gesagt?«, fragte ich, obwohl ich es natürlich verstanden hatte. »Könntest du das wiederholen?«
Seine Lippen zitterten, als sie meinen Namen formten.
»Es tut mir leid, Eshlaini«, sagte er.
Wurzeln schoben sich in meine Zehen vor und wuchsen dort fest. Es war nur mein Name, aber er berührte mich wie ein Lichtstrahl, in dem das Glück neue Blüten trieb.
Der Körper ist das einzige Schicksal, das weiß ich jetzt. Sein Werden und Vergehen ist das Einzige, was das Leben vorherbestimmt. Mein Vater lebte sein Leben als mächtiger Mann, aber es war ihm nicht gegeben, so zu sterben, wie er es sich gewünscht hätte: schnell und in Würde. Stattdessen zog sich sein Lebensende quälend in die Länge, und er wurde unaufhaltsam von innerer Fäulnis zerfressen. Es war kein gnädiger Tod, der da seinen Körper ereilte, bevor der Geist Ruhe fand. Kurz vor seinem Ende entdeckte ich Maden in dem losen Fleisch zwischen seinen letzten verbliebenen Zähnen. Ich las in seinen Augen, dass er immer noch begriff, was mit ihm geschah, als ich sie einzeln herauszog und sein Zahnfleisch desinfizierte. Einige Tage darauf glühte er vor Fieber. Seine dürren Finger fühlten sich in meinen Händen wie brennende Räucherstäbchen an. Er schien vor meinen Augen einzutrocknen; seine Haut zog sich über den Knochen straff und verhärtete sich. Obwohl ich ihn in parfümiertem Wasser badete und kühlende Tücher auf seine heiße Stirn drückte, konnte ich die Verwandlung nicht aufhalten, die sich an ihm vollzog. Er schrumpfte in sich zusammen, und seine Haut umspannte eine veränderte Gestalt. Es sollte noch einige Tage dauern, bis ich verstand. Als ich ihn dann mit seiner rauen, dunklen Haut zusammengekrümmt vor mir liegen sah, erkannte ich es. Er war der dunkle Samen, den ich ausgestoßen hatte.
Als er im Sterben lag, kam die Familie. Mit dem Flugzeug, im Auto oder mit dem Zug reisten sie aus entlegenen fremden Städten oder aus den umliegenden Dörfern an und versammelten sich alle am Sterbebett. Bei ihrer Ankunft drückten sie meine Hände und berührten als Zeichen tiefer Zuneigung ihr Herz und ihren Mund mit den Fingerspitzen. Aber keiner von ihnen sah mir in die Augen und bemerkte, wie ich mich verändert hatte.
Was sie viel mehr interessierte, war das Testament meines Vaters, und ganz besonders die Verfügung, die mir das Haus zuschrieb.
Natürlich wussten sie von dem Versprechen, das zwanzig Jahre zuvor mein Schicksal besiegelt hatte. Zwanzig Jahre zuvor, als noch Schwärme von Moskitos die dämmrigen Zimmer des Hauses bewohnt hatten und sich direkt dahinter der Dschungel erhob wie eine undurchdringliche Wand. Damals hatte sich niemand für diesen wertlosesten Besitz meines Vaters interessiert, und sein Versprechen hatte nicht viel bedeutet. Ich, Eshlaini, sollte mein Leben hingeben, und im Austausch bekam ich die Aussicht auf ein Haus.
Damals konnte sich niemand vorstellen, wie sehr die Stadt sich ausdehnen sollte. Jetzt hatte sie das Haus erreicht und machte das Grundstück zu dem wertvollsten Stück Land, das mein Vater besaß. Wenn man es jetzt verkaufte, würde es uns alle unvorstellbar reich machen. Vor dem Tod meines Vaters hörte ich, wie sie unter vier Augen oder in kleinen Gruppen darüber sprachen. Wenn ich die Bettpfanne leerte oder seine Druckgeschwüre versorgte, berieten sie sich flüsternd im Nebenzimmer oder am Fuß der Treppe. Sie konnten es mir nicht nehmen, aber sie wollten es haben, und was mich am meisten überraschte: Ich erkannte in ihren freundlich lächelnden Gesichtern, dass sie glaubten, ich würde es ihnen ohne Widerstand überlassen.
Nach seinem Tod versammelten wir uns, um sein Testament zu verlesen und darüber zu beraten. Schließlich wandte sich mein ältester Bruder an mich, der den Namen des Soldaten trug. Wie mein Vater war er kurz von Wuchs, und sein Haar lichtete sich.
»Rohila«, sagte er, »dies Haus gehört dir, so wurde es beschlossen, aber ich nehme nicht an, dass du es willst. Schließlich ist es zu groß für eine alleinstehende Frau. Ich möchte dir anbieten, bei meiner Familie zu wohnen. Du könntest mit uns zusammen ein angenehmes Leben führen, und im Austausch würdest du das Haus in den allgemeinen Nachlass übertragen.«
Er verstummte, und alle wandten sich zu mir um. Ich spürte ihre drängenden Blicke, aber es gab auch noch etwas anderes, das auf mir lastete. Der Glaube an das Schicksal lässt sich nicht einfach abschütteln. Ich wusste, wie viel einfacher es wäre, nachzugeben und dem Weg zu folgen, der für mich vorgezeichnet worden war.
»Du hast recht«, sagte ich, »ich will das Haus nicht.«
Ich unterbrach mich und beobachtete, wie die Erleichterung ihre Anspannung löste. Mein ältester Bruder lächelte. Sie wandten sich wieder einander zu und begannen, meine Anwesenheit zu ignorieren, wie sie es immer getan hatten. Aber bevor es so weit kam, nahm ich den Faden wieder auf.
»Ich will das Haus nicht. Dennoch werde ich es behalten.«
Worte sind mächtig. Das wusste ich von meinem Vater. Und doch überraschte es mich, zu sehen, was das Gesagte bei meinen Geschwistern anrichtete. Mein ältester Bruder trat auf mich zu und nahm meine Hände. Auch wenn es immer hieß, er ähnele unserem Großonkel, war es in Wirklichkeit mein Vater, dem er am meisten glich. Ich sah in sein gütiges, besorgtes Gesicht und erkannte in ihm das exakte Ebenbild meines Vaters an jenem Abend, als ich siebzehn Jahre alt war.
»Liebste Rohila«, sagte er, »du stehst unter Schock. Bestimmt willst du es dir noch einmal in Ruhe überlegen.«
»Jamaluddin«, antwortete ich. Ich entzog ihm meine Hände und bemerkte, wie überrascht er war, dass ich seinen angestaubten Geburtsnamen benutzte. »Mein Vater hat mir dieses Haus vermacht. Es war sein letzter Wille. Wie könnte ich mich ihm widersetzen?«
Jamaluddin schüttelte den Kopf. »Wir hatten gedacht, du könntest bei einem von uns wohnen«, sagte er. »Wir würden uns um dich kümmern, du müsstest dir um deine Zukunft keine Sorgen mehr machen, Rohila.«
»Mein Name ist Eshlaini«, erklärte ich.
Erst da bemerkten sie, wie ich mich verändert hatte. Meine Haut verströmte den Duft neuerblühten Lebens, und meine Haare umflossen meine Schultern wie die einer Seeanemone. Sie wichen vor mir zurück, als ich an ihnen vorüberging, und folgten mir mit den Blicken, als ich den Raum verließ. Später hörte ich, wie sie die Köpfe zusammensteckten und über die Möglichkeiten berieten, die ihnen noch blieben, die rechtlichen ebenso wie die weniger ehrenvollen. Aber das Testament hielt. Es war so vorherbestimmt, erklärte ich ihnen lächelnd. Und sie konnten nichts dagegen tun.
Seit ich das Haus verkauft habe, bin ich reich, aber ich lebe ein bescheidenes Leben. Ich habe eine Wohnung in der Stadt, einige Möbel und ein fabrikneues Auto. Und Kleider – ich habe alle meine alten Sarongs, alle Mädchenkleider und altjüngferlichen Gewänder weggeworfen, die sich über die Jahre angesammelt hatten. Statt ihrer habe ich mir die elegant geschnittenen Kostüme und modernen Kleider gekauft, die ich früher immer in Magazinen bewundert hatte. Im Gedenken an meine Mutter und meine Großmutter trage ich Halstücher in leuchtenden Farben und Schmuck – Edelsteine und seltene Metalle, die in der Dämmerung aufglänzen wie kleine Sterne oder wie eine Nähnadel, die das Lampenlicht einfängt.
Vielleicht waren es diese leuchtenden Farben und glitzernden Juwelen, die das kleine Mädchen so anzogen. Sie lebt in einem Waisenhaus nicht weit von meiner Wohnung. Ich sah sie oft im Vorübergehen, wie sie auf einem staubigen, leeren Platz mit einem Rattanball spielte oder mit anderen Mädchen Seilspringen übte. Sie ist ein ernstes Kind, freundlich, aber auch eigenständig. Einmal winkte sie mir zu, und von da an sah ich immer nach ihr, wenn ich dort vorbeikam, und war seltsam enttäuscht, wenn ein Tag ohne den Anblick ihrer lebendigen Augen und ihres hellen, schmalen Gesichts verstrich. Ich begann, mir Gedanken über sie zu machen; ich versuchte mir vorzustellen, was sie dorthin verschlagen haben mochte und was man ihr über die Möglichkeiten erzählte, die das Schicksal für sie bereithielt. Schließlich dachte ich darüber nach, wie ich ihr helfen könnte – mit einem Schulstipendium vielleicht, mit neuer Kleidung oder einem Fahrrad. Und dann kam ich eines Tages auf eine ganz andere Idee.
Warum sollte ich nicht auch eine Tochter haben? Warum nicht?
Das Haus meines Vaters gibt es nicht mehr. Ich habe bei dem Abriss zugesehen, als der Bagger große Stücke aus den Wänden biss und nach und nach die Zimmer zerlegte, die ich so oft geputzt hatte. Ich hatte in diesen Räumen so viel Unglück und Tod erlebt, und jetzt war ich erleichtert, als nichts von ihnen zurückblieb. Seitdem verfolge ich fasziniert den ausgeklügelten Prozess, die Choreographie aus Stahlträgern, Beton und von Arbeitern wimmelnden Bambusgerüsten, mit der an derselben Stelle ein Hochhaus entsteht. Die Arbeiter wissen, dass dort einmal das Haus meines Vaters stand, und nehmen mich manchmal mit in den Rohbau, um mir zu zeigen, wie sie vorankommen. Ich nicke beeindruckt und lausche dem Echo meiner Schritte in der hochaufgetürmten Leere.
Jetzt dämmert es, und die Abendluft ist durchtränkt vom Duft der Blumen. Ich sitze im Auto, sehe den Arbeitern in den hellen Lichtkegeln ihrer Scheinwerfer zu und denke an meine Tochter, die in einer Woche bei mir einziehen wird. Ich habe ihr Zimmer neu gestrichen und eingerichtet, aber nur mit dem Nötigsten. Sie wird es früh genug selbst mit den Dingen füllen, die ihr gefallen. Ich mag diese Vorstellung, wie sich mein Zuhause auf unberechenbare Weise verändern wird. Und aus denselben Gründen freue ich mich bei dem Gedanken, dass sich dies Hochhaus bald mit Hunderten Menschen füllen wird, die durch nichts mit meiner Vergangenheit oder meiner Zukunft verbunden sind.
Eines nach dem anderen verlöschen die Lichter, bis alle Arbeiter gegangen sind und das Gebäude ganz im Dunkeln liegt. Ich starte mein Auto und fädele mich in den Verkehr. Die Nacht ist sternenklar, und einen Moment lang frage ich mich, welchen dieser Sterne meine Mutter angesehen haben mag, als ich geboren wurde. Es ist nicht die Suche nach der Vorsehung, die mich dazu treibt, sondern nur der einfache Wunsch nach einem Licht, das uns durch die Zeiten verbindet. Hier bin ich und finde mit dem Steuer in der Hand meinen eigenen Weg zu einem Zuhause, in dem mich nur meine Zukunft erwartet. Ich bin dieses Licht. Ein anderes Schicksal habe ich nicht. Ich bin Eshlaini, und mit mir endet die Geschichte.
Spring, Mountain, Sea
Es war schon Winter, als Rob Eldred 1954 mit seiner Frau aus Übersee nach Hause zurückkehrte. Sie hatten die Stadt hinter sich gelassen und fuhren Richtung Norden durch den ersten heftigen Sturm dieser Jahreszeit. Der Schnee schien unsichtbar durch das Autodach zu fallen, denn etwas dämpfte ihre Worte und Gesten immer mehr, bis sie schließlich schweigend nebeneinander saßen. Rob fuhr langsam, aber ohne Pausen einzulegen, und kämpfte gegen ein nagendes Gefühl der Enttäuschung an, das allmählich von ihm Besitz ergriff. Von der Landschaft, nach der er sich während seiner Dienstzeit in der Marine so zurückgesehnt hatte, war nichts zu erkennen. Die Straße war stellenweise auf eine einzige schmale Fahrspur verengt, und wohin er auch sah, zogen sich weiße Felder bis zu der blassen, verschwommenen Linie des Horizonts. Nur vereinzelt ragten kahle Bäume aus dem Meer von Schnee, einsame Häuser oder windschiefe Gitterzäune. Sogar ihm kam dieser Anblick trostlos vor, obwohl er wusste, dass der Schnee eines Tages einem Frühling voller leuchtend grüner Wiesen und tiefblauer Seen weichen würde. Er sah verstohlen zu Jade Moon hinüber, die den Kragen ihres roten Wollmantels fest zugezogen hatte und ihre dunklen Augen ruhelos über die Landschaft schweifen ließ, als suchte sie nach einem Fluchtweg.
In jenem Jahr war der Winter in Upstate New York besonders unwirtlich, und Rob Eldred erinnerte sich später an ihn immer als den härtesten Winter seines Lebens. Obwohl Jade Moon in einem Dorf aufgewachsen war, wo der Schnee in dicken Flocken über die strohgedeckten Hütten wirbelte und manchmal monatelang die Straßen unpassierbar machte, wurde ihr in ihrem ersten Winter in der neuen Heimat nie richtig warm. Sie hatten ein kleines Haus, das sich an einen Hügel duckte und dadurch einigermaßen windgeschützt war, aber dennoch drehte Rob die Zentralheizung immer voll auf. Wenn er dann mit Sägemehl in den Haaren von der Arbeit heimkam, saß Jade Moon meist, in mehrere Pullover und eine Daunendecke gehüllt, zusammengekauert auf dem Sofa. Manchmal lag der Telefonhörer neben der Gabel und tutete leise vor sich hin. Dann hängte er ihn unauffällig wieder ein und sagte nichts dazu, denn er wusste, welche Angst ihr die körperlosen, verzerrten Stimmen einjagten, wenn sie in dieser ungewohnten Sprache auf sie einredeten, ohne dass eine Geste oder ein Lächeln ihr das Verständnis erleichterten.
Er war kein geduldiger Mensch, aber in diesem ersten Winter bemühte er sich sehr um sie. Er massierte ihr jeden Abend die Hände und kochte heiße Schokolade, und sie umklammerte mit beiden Händen die Tasse, um sich daran zu wärmen, und leerte sie begierig wie ein kleines Kind. Manchmal brachte er aus dem Ort parfümierte Badeöle mit und ließ so heißes Wasser ein, dass nach Rosen, Flieder oder Maiglöckchen duftende Dampfwolken sie einhüllten, wenn sie aus ihrem wollenen Hauskleid schlüpfte. Dann kniete er neben der Wanne und bewunderte ihren schlanken Körper, der sich durch das Kind, das sie erwartete, angenehm rundete.
»Wie eine heiße Quelle«, murmelte sie und stieg so behutsam in die Keramikwanne, als müsste sie sich vorsehen, nicht mit dem Fuß an einen ufernahen Stein zu stoßen. Einmal, noch bevor sie sich bekannt gemacht hatten, hatte er gesehen, wie sie sich in das heiße Wasser einer solchen Quelle gleiten ließ. Ihre Haut war so zart und hell gewesen wie der Schnee, der um sie herum hochwirbelte. Er hatte sich hinter einem Baum verborgen, um zu sehen, wie sie auf ihren langen Beinen durch den aufsteigenden Dampf schritt und ihr Haar wie ein Schwall schwarzen Wassers bis zu ihrer Hüfte herabfiel.
Hier, in dem fremden Land, schloss sie bei dieser altvertrauten Wohltat die Augen. Ihre Wimpern waren lang und dicht gewachsen und ruhten auf den hohen Wangenknochen eines feingeschnittenen, ovalen Gesichts. Er schob eine Hand unter ihr Haar, um ihren Rücken zu waschen, und ließ den Badeschaum über ihre Brustwarzen hinabgleiten, deren Höfe sich jetzt, in Erwartung ihres Kindes, dunkler gegen ihre helle Haut abhoben. Später, im Bett, hielt er sie in seinen Armen und erzählte ihr leise in ihrer eigenen Sprache, was er den Tag über erlebt hatte. Alle Menschen und Orte, von denen er berichtete, verglich er mit ihrem Dorf und seinen Bewohnern, die so unendlich weit entfernt schienen. Sie dürstete nach dieser Sprache, nach dem steten Tröpfeln der vertrauten Silben. Also redete er weiter und weiter leise auf sie ein, dachte sich kleine Geschichten aus oder sang Teile von Liedern, an die er sich noch erinnerte, bis ganz allmählich ihre Anspannung nachließ und sie schließlich in seinen Armen einschlief. Seine Stimme und die vertrauten Worte ihrer eigenen Sprache hatten die Kälte des Tages vertrieben.
In diesem Winter waren die Morgen besonders klar und kalt, manchmal auch grau überschattet von dem nächsten herannahenden Sturm. Wie das grelle Licht die warmen, dunklen Nächte vertrieb, war für Rob Eldred jedes Mal wieder ein Schock, und er schlich behutsam durch die kleinen Zimmer ihres Hauses, um Jade Moon nicht zu wecken. Dennoch erschien sie unweigerlich immer in dem Moment in der Küchentür, wenn er gerade dabei war, sich seine Stiefel überzuziehen. Wenn sie ihm dann dabei zusah, wie er seine Jacke zuknöpfte, wirkte ihr Gesicht völlig ausdruckslos, aber er wusste, dass sie sich hinter dieser Maske auf ihre Art gegen den langen, stillen Tag wappnete, der vor ihr lag. In all den Tagen und Wochen, die sie an der bergigen Küste ihres Heimatortes mit glücklichen Träumereien über die Zukunft zugebracht hatten, hatte er nie vorhergesehen, wie einsam sie sein würde und wie schwer es ihr fallen könnte, seine Sprache zu lernen. An diesen kalten Tagen ihres ersten gemeinsamen Winters vermied er es, zu ihr hinüberzugehen und sie zum Abschied zu küssen, weil er seine Stiefel schon angezogen hatte und sie sich an einen Brauch aus ihrer Heimat hielten, der es nicht erlaubte, das Haus in Schuhen zu betreten. Also lächelte er ihr stattdessen aus der Entfernung zu und ging in das grelle Licht des Morgens hinaus, seiner eigenen unerwarteten Einsamkeit entgegen.
Rob Eldred hatte sich gleich nach seinem Highschool-Abschluss bei der Navy verpflichtet. Er hatte Heldengeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg gehört und träumte von ruhmreichen und unblutigen Kämpfen mit großen Raketen, die wie Feuerwerkskörper über dem dunklen Wasser explodierten. Als seine Vorgesetzten entdeckten, dass er ein besonderes Talent für Sprachen besaß, und ihn statt an die Front in ein Schulungsprogramm schickten, war er enttäuscht. Den Marschbefehl erhielt er einige Zeit später doch noch, aber nicht, um zu kämpfen. Er verbrachte seine Zeit am Schreibtisch, an Bord eines Funkschiffes, wo er Nachrichten abfing und übersetzte. Der Krieg, wie er ihn kennenlernte, hatte etwas mit Sprache zu tun, mit den Nuancen der Übersetzung. Er wusste, dass diese Arbeit wichtig war, auch wenn es nicht immer danach aussah. Schließlich wurde ihm ein Posten auf dem Festland zugewiesen, in dem Dorf, wo er später Jade Moon kennenlernen sollte. Erst dann, erst als er auf seinem Weg die Küste entlang die verwüsteten Dörfer und die vielen Bettler mit ihren entsetzlichen Narben und Verstümmelungen sah, begriff er, was ihm erspart geblieben war.
Die anderen Zimmerleute kannten seine Vorgeschichte und konnten sie ihm nie ganz verzeihen. Dass er im Krieg so leicht davongekommen war, wurde in ihren Augen noch dadurch verschlimmert, dass er eine Asiatin geheiratet hatte. In der Kleinstadt, in der sie lebten, hatten die letzten beiden Kriege spürbare Wunden hinterlassen; ein halbes Dutzend junge Männer waren ihnen zum Opfer gefallen. Die meisten der Zimmerer, mit denen Rob arbeitete, waren ältere Männer, deren Gedächtnis weit zurückreichte. Stanley Dobbs und Earl Kelly hatten in Korea je einen Neffen verloren, und Euart Simpsons einziger Sohn war nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Gefangenenlager in den Philippinen umgekommen. Einmal brachte Euart die in der Luft liegenden Vorwürfe auf den Punkt, indem er Rob ein Foto seines Sohnes vor die Füße warf. Auf dem Bild war ein lächelnder Junge in einer Männeruniform zu sehen, dessen Gesicht genau dem seines Vaters glich, aus der Zeit, bevor die Trauer so tiefe Falten hineingegraben hatte.
»Mein Beileid«, sagte Rob und reichte ihm das Bild zurück. Euart setzte sich, und die Verachtung in seinem Blick ließ nach.
»Beileid«, sagte er, »verträgt sich nur nicht besonders damit, eine Japse mit nach Hause zu bringen.«
»Sie ist keine Japanerin«, sagte Rob. Er schwankte zwischen Wut und Mitgefühl.
»Was heißt das schon«, gab Euart zurück und spuckte in einen Haufen Holzspäne neben der Hobelmaschine. »Eine von uns ist sie jedenfalls nicht.«
Ihr Kind wurde Ende April geboren, als die Maiglöckchen hinter dem Haus gerade ihre Blüten öffneten. Wie es zu der Zeit üblich war, fuhr Rob Jade Moon auf gewundenen Landstraßen zum nächstgelegenen Krankenhaus und arbeitete sich durch einen Berg von Formularen, während seine Frau vor Schmerz nach Luft schnappte und sich auf die Lippen biss. Dann brachte man sie weg, und er sah sie erst zwölf Stunden später wieder, wie sie mit ordentlich zurückgebundenen Haaren und ihrer Tochter im Arm aufrecht in ihrem Bett saß. Sie war überglücklich – und wütend.
»Ich habe alles verschlafen!«, schimpfte sie. Rob war erleichtert, sie wieder bei Kräften zu sehen. Es war, als hätte ein schleichendes Gift sie den ganzen Winter über in eine Kältestarre versetzt, die sie jetzt endlich überwunden hatte. »Sie haben mich die ganze Zeit über betäubt, und als ich wieder aufwachte, war schon alles vorbei. Das Kind war schon da. Ich habe überhaupt keine Erinnerungen an die Geburt!« Er wusste, wie anders in ihrer Heimat Kinder zur Welt kamen, wo die Frauen sich vor der Geburt mit anderen Frauen zusammen zurückzogen, traditionelle Kräuter zu sich nahmen und der Natur ihren Lauf ließen. Jade Moon hörte auch in den nächsten Tagen nicht auf, sich leise, aber vehement zu beschweren, und Rob bemerkte die neugierigen Blicke der beiden jungen Mütter in den anderen Betten. Als Jade Moon ihren Kittel öffnete, um ihre neugeborene Tochter zu stillen, wich diese Neugier purer Bestürzung.
»Irgendetwas stimmt mit ihnen nicht«, vertraute Jade Moon ihm an und nickte zu den beiden hinüber. »Diese armen Frauen haben Kinder, aber keine Milch. Die Schwester bringt ihnen jeden Tag eine Flasche aufgewärmte Kuhmilch, stell dir das vor!«
Rob drehte sich ein Stück zur Seite, um einen Blick auf die Frau im Nebenbett zu erhaschen, eine blasse, hagere Person mit einem rötlichen Haarknoten im Nacken. Sie sah ihn über den dunklen Schopf ihres Kindes hinweg mitleidig an. Als sich ihre Blicke trafen, ergriff sie das Wort.
»Es geht mich ja wirklich nichts an«, sagte sie, »aber irgendjemand sollte Ihre Frau über … über das da aufklären.« Sie wies mit dem Kinn erst auf Jade Moons weiße, volle Brust und dann auf die Milchflasche in ihrer eigenen Hand. »Das hier ist ein modernes Krankenhaus. Zivilisiert. Wir versuchen es ihr die ganze Zeit zu erklären, wir haben es sogar mit Zeichensprache probiert, aber sie lächelt nur und wird rot.«
Rob wusste nicht, was er darauf sagen sollte. Ihm war klar, dass Jade Moon nur aus Mitleid mit den beiden Frauen in Verlegenheit geriet, die scheinbar nicht in der Lage waren zu stillen. Er sah sie an, die sanft den kleinen Kopf seiner Tochter streichelte, während sie ihr die Brust gab, und vergaß die rothaarige Frau. Voller Glück und Staunen setzte er sich zu ihr auf das Bett.
»Worüber habt ihr geredet?«, fragte Jade Moon.
»Über dich.« Rob nahm ihre Hand. »Und über unser wunderschönes Baby.«
Jade Moons Züge entspannten sich, als sie auf ihre Tochter hinuntersah. »Ja«, sagte sie, »ist sie nicht ein süßes kleines Ding?« Dann blickte sie lächelnd auf und erklärte, dass das Kind Spring heißen sollte.
Rob war überrascht. Er wusste, dass bei ihr zu Hause das Wort für Frühling ein häufiger Mädchenname war, aber er wusste auch, dass dieses Mädchen in Amerika aufwachsen würde, und versuchte sie umzustimmen. Lily, schlug er vor, als er an die Blütenpracht hinter ihrem Haus dachte. Oder vielleicht Rose?
»Nein«, sagte sie und hob das kleine Bündel hoch, um ihr ins Gesicht zu sehen. »Blumen sind zu vergänglich. Ich möchte meiner Tochter einen Namen geben, der ihr in ihrem späteren Leben hilft, der ihr Kraft gibt. Sie ist im Frühling geboren, und der Frühling ist eine Zeit der Erneuerung, die immer wiederkehrt.«
»Was hältst du dann von April?«, fragte er. Seine Tochter ruderte auf dem Arm ihrer Mutter mit ihren winzigen Fäustchen. Schon jetzt glich sie Jade Moon mit ihren Augen und ihrem Haar, und schon jetzt hatte Rob Angst um sie, wenn er daran dachte, wie sie an ihrer Andersartigkeit zu leiden haben würde. »Was hältst du von May? Oder meinetwegen June?«
»Nein«, wiederholte sie. Sie legte sich das Baby über die Schulter und massierte mit einer Hand seinen Rücken. »Spring.«
Schließlich gab er nach, aber die ganze Zeit über, die Jade Moon noch im Krankenhaus verbrachte, ließen ihn seine Bedenken nicht los. Bei der Arbeit stand er mit seinen Kollegen in einem gerade fertiggestellten Rohbau und verteilte Zigarren an Männer, die seit Monaten kaum mit ihm gesprochen hatten. Er dachte an die rothaarige Frau im Krankenhaus und an Jade Moons einsame Tage in ihrem Haus auf dem Hügel. Und als es Zeit wurde, den Namen seiner Tochter in die Geburtsurkunde einzutragen, brachte er es nicht über sich, Jade Moons Wunsch zu entsprechen. Er schrieb April Celeste in die Urkunde und setzte seine Unterschrift darunter. Auch Jade Moon unterschrieb in wackeligen lateinischen Buchstaben und lächelte ihn an. Sie konnte nicht gut genug lesen, um die Veränderung zu bemerken.
»April«, sagte die Schwester und kitzelte das Baby, »das ist aber ein hübscher Name.«
Rob nickte nur und beeilte sich, seine junge Familie außer Hörweite der gesprächigen Krankenschwester zu befördern. Er fühlte sich schrecklich schuldig. Dieser Augenblick sollte ihm immer im Gedächtnis bleiben: Auch wenn es nur eine Kleinigkeit war, so unscheinbar wie ein neuer Trieb am Stamm eines Baumes, war es doch sein erster Verrat.
Zu Robs eigener Überraschung hatte er es bei der Arbeit nach der Geburt seines ersten Kindes leichter. Viele der jüngeren Zimmerleute waren selbst frischgebackene Väter, und diese Gemeinsamkeit wurde zu einer schmalen Brücke über den alten Strom von Feindseligkeiten. Er gewöhnte es sich an, mit seinen Kollegen in der Stadtbäckerei zu Mittag zu essen – dickes, selbstgebackenes Brot mit Thunfischsalat oder Schinken –, und schon bald luden sie ihn ein, dem Bowlingverein beizutreten. Zum ersten Mal seit seiner Rückkehr aus dem Krieg hatte er das Gefühl, die zwei Hälften seines Lebens miteinander in Einklang bringen zu können. Er lernte Bowling und trat außerdem noch der örtlichen Freimaurerloge bei. Zwar blieb Jade Moon dadurch an zwei Abenden in der Woche allein, aber sie ging ganz in ihrer Mutterrolle auf und litt nicht so an seiner Abwesenheit wie vorher. Außerdem hatten die Frauen aus dem Kirchenverein begonnen, ihr Besuche abzustatten, zu denen sie Pasteten und Aufläufe mitbrachten, und hatten sich mit eigenen Augen davon überzeugt, dass es bei Familie Eldred genau die gleichen Sitzgarnituren und Couchtische, Stickdeckchen und Trockensträuße gab wie in ihrem eigenen Zuhause. Wenn sie sich verabschiedeten, wirkten sie zutiefst beruhigt und versicherten, sie würden bei Gelegenheit wiederkommen. Miss Ellie Jackson, eine resolute alte Jungfer mit schriller Stimme, kam tatsächlich wieder, einmal mit einem Blechkuchen und das zweite Mal mit einer Lesefibel, die sie aus den Beständen der Grundschule ausgeliehen hatte, um Jade Moon ein für alle Mal Englisch beizubringen. Rob schien es, dass die Bruchstücke seines Lebens sich endlich zu einem komplizierten, aber doch verständlichen Muster zusammenfügten. Auch wenn es ihm missfiel, Ellie Jackson immer öfter bei sich zu Hause anzutreffen, war er doch im Großen und Ganzen glücklich, dass sich nach dem harten und einsamen Winter endlich alles zum Besseren wendete.
Ellie Jackson hätte mit ihrem fast fanatischen Eifer und ihrer eisernen Entschlossenheit genauso gut eine Missionarin sein können. Sie war hochaufgeschossen und hager, hatte kleine, aber lebhafte blassblaue Augen und hielt ihr graumeliertes Haar adrett kurz geschnitten. Sie nahm in dem Haushalt der jungen Familie sogleich die Zügel in die Hand und widmete sich Jade Moons Erziehung mit demselben Tatendrang, den sie sonst für die Organisation des Kirchenbasars oder für ihren Frühjahrsputz aufbrachte. Jeden Nachmittag kam sie von zwei bis vier Uhr mit ihren Kochbüchern und Messbechern vorbei, und schon bald bestand Robs Abendessen nicht mehr aus Reis und kurzgebratenem Gemüse, sondern aus Käsemakkaroni, Frikadellen, Würstchen mit Bohnen, Kartoffelsalat oder sogar Lammbraten. Oft war Ellie noch da, wenn er nach Hause kam, gestikulierte in der Küche wild mit beiden Händen und versuchte Jade Moons schlechtes Englisch dadurch wettzumachen, dass sie Stufe um Stufe ihre Lautstärke höher schraubte, bis sie manchmal mit ihrer schrillen Stimme das Baby weckte. Rob zuckte bei solchen Szenen gequält zusammen, weil er wusste, wie sinnlos es war, herumzuschreien, und weil er sich selbst dieselbe schlechte Angewohnheit eingestehen musste. Jade Moon hatte nicht annähernd sein Talent für Sprachen, und er besaß nicht die Geduld eines guten Lehrers. Allzu oft hatte er sich selbst dabei ertappt, wie er Worte mit zunehmender Lautstärke und wachsender Frustration wieder und wieder aussprach, als könnte die bloße Wiederholung sie dazu zwingen, ihn zu verstehen.
Deshalb freute es ihn, dass im Laufe der Zeit immer mehr Englischlehrbücher auftauchten und dass eines Tages, als er nach Hause kam, alle möglichen Gegenstände weiße Zettelchen trugen, die Ellie in ihrer ordentlichen, kantigen Handschrift mit den passenden englischen Bezeichnungen beschriftet hatte. Die Fenster waren geöffnet, um die frühsommerliche Luft hereinzulassen, und die Zettel flatterten in der milden Brise. Schrank, stand auf einem von ihnen, Herd, Kühlschrank, Tisch, Tasse, Sofa, Radio, Regal