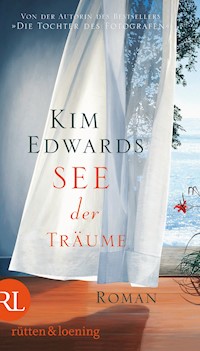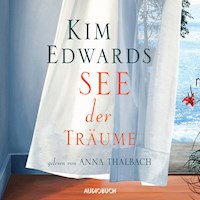9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lexington, Kentucky, 1964: In einer stürmischen Winternacht liegt die hochschwangere Frau des Arztes David Henry in den Wehen. Sie bringt einen kerngesunden Sohn auf die Welt. Doch die Wehen setzen erneut ein, und dem Jungen folgt eine Zwillingsschwester. Dieses Kind ist behindert. In Sekundenschnelle trifft David eine Entscheidung: Während seine Frau Norah in der Narkose liegt, bittet er die Krankenschwester Caroline, den Säugling stillschweigend in ein Heim zu bringen. Doch Caroline flieht mit dem Mädchen und zieht es allein groß ...
So beginnt eine tief bewegende Geschichte, die ein Vierteljahrhundert umspannt. Wie kann eine Frau weiterleben, wenn ihr das Kind genommen wird? Schmerzhaft und schön erzählt Kim Edwards die Schicksalsgeschichte einer Familie. Sie berichtet von Trennungen und Neuanfängen und der erlösenden Kraft der Liebe.
"Die Tochter des Fotografen" ist ein überwältigendes Epos über das Lebensglück und Lebensleid. Der Roman war in den USA ein Überrschungserfolg, wochenlang stand er auf Platz 1 der Bestsellerlisten.
"Ein Roman zum Bewundern, Betrauern und Begeistertsein." BamS.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Kim Edwards
Die Tochter des Fotografen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Silke Haupt und Eric Pütz
Impressum
Titel der Originalausgabe
The Memory Keeper’s Daughter
ISBN E-Pub 978-3-8412-0200-0
ISBN PDF 978-3-8412-2200-8
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2444-0
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, November 2010
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 bei Gustav Kiepenheuer, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © 2005 by Kim Edwards
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Henkel/Lemme unter Verwendung
eines Gemäldes von Alice Dalton Brown »Summer Breeze« (Detail), 1991
Courtesy Fischbach Gallery, New York/Bridgeman, Berlin
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
1964
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
1965
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
1970
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
1977
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
1982
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
1988
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
1989
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Bonusmaterial zu Kim Edwards’ Roman »Die Tochter des Fotografen«
Das Buch
Die Autorin
Das Interview Kim Edwards über die Entstehung ihres Bestsellers »Die Tochter des Fotografen«
Diskussionsthemen
1964
1. Kapitel
März 1964
ES SCHNEITE BEREITS SEIT MEHREREN STUNDEN, als ihre Wehen einsetzten. Nachdem zuerst nur einige wenige Flocken im trüben, grauen Himmel des späten Nachmittags zu sehen waren, jagte der Wind in den darauffolgenden Stunden den Schnee in Schwaden über ihre Veranda. Als der Sturm zunahm, standen sie Seite an Seite am Fenster und beobachteten, wie die scharfen Böen sich aufbauschten und umherwirbelten, bevor sie sich am Boden zerstreuten. Überall in der Nachbarschaft schienen Lichter auf, und die nackten Äste der Bäume bekamen einen weißen Überzug.
Nach dem Abendessen wagte er sich in den Sturm hinaus, um von dem Holzstoß, den er im letzten Herbst an die Garage gestapelt hatte, ein paar Scheite zu holen. Die Luft schlug ihm klar und kalt ins Gesicht, und der Schnee in der Einfahrt war längst knöcheltief. Er schüttelte die weichen weißen Kappen von den Scheiten und trug sie ins Haus. Das Anmachholz auf dem Eisenrost fing sofort Feuer, und für eine Weile setzte er sich mit gekreuzten Beinen an den Kamin, legte Scheite nach und sah dem blauen, hypnotisierenden Aufschlagen der Flammen zu. Draußen fiel der Schnee noch immer still durch die Dunkelheit, im Lichtkegel der Straßenlampen aber wirkte er wie eine weiße, unbewegliche Masse. Als er sich erhob und aus dem Fenster sah, hatte sich ihr Auto in einen weißen Hügel verwandelt. Seine Fußstapfen in der Einfahrt waren nicht mehr zu sehen.
Er strich sich die Asche von den Händen und setzte sich auf das Sofa neben seine Frau, die ihre Füße auf Kissen gebettet hatte. Ihre geschwollenen Knöchel waren übereinandergeschlagen, und ein Exemplar von »Dr. Spock’s Baby and Child Care« balancierte auf ihrem Bauch.
Versunken befeuchtete sie jedesmal ihren Zeigefinger, wenn sie eine Seite umblätterte. Ihre Hände waren schmal, die Finger kurz und kräftig, und beim konzentrierten Lesen biß sie sich leicht auf ihre Unterlippe. Wenn er sie ansah, war er vor Liebe und Verwunderung überwältigt. Daß sie seine Frau war und daß ihr Baby in drei Wochen auf die Welt kommen sollte, verblüffte ihn außerordentlich. Es würde ihr erstes Kind sein, erst seit einem Jahr waren sie verheiratet.
Sie sah lächelnd auf, als er die Decke fest um ihre Beine schlug. »Wie ist es wohl«, überlegte sie laut, »wenn wir noch im Mutterleib sind? Zu schade, daß wir uns nicht daran erinnern können.« Sie öffnete ihr Kleid und zog den Pullover hoch, den sie darunter trug. Ein Bauch, rund und hart wie eine Melone, kam zum Vorschein. Sie ließ ihre Hand über seine glatte Oberfläche gleiten. Der Schein des Feuers tanzte auf ihrer Haut und warf ein rötliches Gold auf ihre Haare. »Glaubst du, es ist wie im Inneren eines großen Lampions? Im Buch steht, daß das Licht durch meine Haut dringt, und das kann das Baby schon wahrnehmen.«
»Ich weiß es nicht«, sagte er.
Sie lachte. »Warum nicht? Du bist doch der Arzt.«
»Ich bin nur Orthopäde«, erinnerte er sie. »Ich könnte dir das Verknöcherungsmuster von fötalen Knochen erklären, aber das ist auch schon alles.« Er nahm ihren Fuß, der in einem hellblauen Socken steckte und geschwollen und gleichzeitig zart aussah, und begann ihn vorsichtig zu massieren. Er arbeitete sich über ihre ausgeprägte Ferse und die sanfte, konvexe Kurve ihres Astralagus zu den Mittelfußknochen und den Zehengliedern vor, die sich unter Haut und straffen Muskeln auffächerten. Ihr Atmen erfüllte den stillen Raum, ihr Fuß wärmte seine Hände, und er dachte an die vollendete und verborgene Symmetrie der Knochen. Die Schwangerschaft verlief mustergültig und ohne Komplikationen. Trotzdem konnte er seit einigen Monaten nicht mehr mit ihr schlafen. Statt dessen hatte er jetzt das Bedürfnis, sie zu beschützen. Am liebsten hätte er sie ständig Treppen hochgetragen, sie in Decken gewickelt oder ihr Schälchen mit Vanillepudding serviert. »Ich bin kein Invalide«, protestierte sie jedesmal lachend. »Ich bin kein junger Vogel, der aus dem Nest gefallen ist.« Trotzdem gefiel ihr seine Zuwendung. Manchmal wachte er auf und beobachtete sie beim Schlafen, das Flattern ihres Augenlids, das langsame Heben und Senken ihrer Brust, ihre ausgestreckte Hand, die so klein war, daß er sie mit seiner eigenen ganz umschließen konnte. Sie war elf Jahre jünger als er.
Zum erstenmal hatte er sie vor über einem Jahr gesehen, als sie die Rolltreppe eines Kaufhauses im Zentrum hochgefahren war, in dem er Krawatten kaufen wollte. Er war dreiunddreißig Jahre alt und gerade nach Lexington, Kentucky, gezogen. Mit ihrem blonden Haar, das in einem eleganten Nackenknoten gebunden war, und den Perlen, die an ihrem Hals und ihren Ohren schimmerten, war sie eine Erscheinung inmitten der Menschenmenge. Sie trug einen dunkelgrünen Wollmantel, und ihre Haut war ebenmäßig und blaß. Er betrat die Rolltreppe und kämpfte sich durch die Menge, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Sie fuhr in den vierten Stock, Wäsche und Strumpfwaren. Als er ihr durch Gänge folgte, deren Regale mit weich schimmernden Slips, Büstenhaltern und Höschen bestückt waren, hielt ihn eine Verkäuferin an und fragte ihn lächelnd, ob sie ihm helfen könne. »Einen Morgenmantel«, sagte er, die Gänge absuchend, bis er ihr blondes Haar und eine dunkelgrüne Schulter erblickte. Für einen Moment entblößte sich die anmutige Neigung ihres hellen Nackens. »Ich suche einen Morgenmantel für meine Schwester, die in New Orleans wohnt.« Natürlich hatte er weder eine Schwester, noch wußte er von sonst irgendeinem noch lebenden Verwandten.
Die Verkäuferin verschwand, um einen Moment später mit drei Morgenmänteln aus robustem Frottee wiederzukommen. Er wählte blind, sah kaum hin, als er den obersten ergriff. »Diesen gibt es in drei Größen. Im nächsten Monat haben wir eine größere Farbauswahl«, sagte die Verkäuferin, aber er war schon im Gang verschwunden. Einen korallenroten Morgenmantel über dem Arm, hinterließen seine Schuhe auf den Fliesen ein quietschendes Geräusch, als er sich ungeduldig zwischen den anderen Käufern auf die Stelle zuschob, wo sie stand. Sie durchwühlte die Stapel mit den teuren Strümpfen, die, mit Pappe verstärkt und in glattes Zellophan gehüllt, kleine Fenster frei ließen, durch die die reinen Farben schienen: Beige, Marine, ein Braun, so dunkel wie Schweineblut. Der Ärmel ihres Mantels streifte seinen, und er konnte ihr Parfüm riechen, das fein, aber doch durchdringend duftete, ähnlich den Fliederblüten, die damals vor den Fenstern seiner Studentenbude in Pittsburgh wuchsen. Die niedrigen Fenster seiner Souterrainwohnung waren immer schmutzig gewesen, von Ruß und Asche blind. Im Frühling aber blühte der Flieder, weiße und lavendelfarbene Sträuße drängten sich gegen das Glas. Wie Licht drang ihr Duft in sein Zimmer. Vor lauter Atemnot räusperte er sich und hielt den Frotteemantel hoch, aber die Verkäuferin hinter dem Tresen lachte, gerade einen Witz zum besten gebend, und bemerkte ihn nicht. Als er sich wieder räusperte, sah sie ihn verärgert an und nickte dann der Frau zu, die drei dünne Päckchen mit Strümpfen wie riesige Spielkarten in ihren Händen hielt.
»Es tut mir leid, aber Frau Asher war zuerst hier«, erklärte sie kalt und überheblich. Da blickte er plötzlich in die Augen der Frau, die er eben noch verfolgt hatte, und er war überrascht, daß sie vom gleichen dunklen Grün wie ihr Mantel waren. Sie musterte ihn, und ihre Augen wanderten über seinen soliden Tweedmantel, sein sauber rasiertes, vor Kälte gerötetes Gesicht und die gepflegten Nägel seiner Hände. Dann zeigte sie auf den Morgenmantel über seinem Arm und lächelte dabei amüsiert und ein bißchen geringschätzig.
»Für Ihre Frau?« fragte sie. Sie hatte einen vornehmen Kentucky-Akzent. Obwohl er erst sechs Monate in dieser Stadt des alten Geldes lebte, war ihm bekannt, daß hier solche Nuancen wichtig waren. »Es ist in Ordnung, Jean«, fuhr sie fort, wobei sie der Verkäuferin den Rücken zuwandte. »Nehmen Sie ihn zuerst an die Reihe. Dieser arme Mann muß sich hier drinnen, unter all der Spitzenunterwäsche, sehr verloren und unwohl fühlen.«
»Er ist für meine Schwester«, erklärte er, verzweifelt bemüht, den schlechten Eindruck, den er machte, zu korrigieren. Er hatte schon öfter Anstoß erregt, und es passierte ihm häufig, daß er jemanden kränkte, weil er zu direkt war. Der Mantel glitt zu Boden, und er bückte sich, um ihn aufzuheben. Als er sich wieder aufrichtete, stand sein Gesicht in Flammen. Ihre Handschuhe lagen auf dem Glas, ihre bloßen Hände ruhten leicht gefaltet daneben. Sein Unbehagen schien sie zu besänftigen, denn als er erneut in ihre Augen sah, blickten sie ihn wohlwollend an. Später erzählte sie ihm, daß es komisch ausgesehen habe, wie er als einziger Mann in der ganzen Wäscheabteilung mit dem riesigen häßlichen Morgenmantel kämpfte.
Er startete einen erneuten Versuch, sich zu erklären. »Es tut mir leid. Ich scheine etwas durcheinander zu sein, weil ich sehr in Eile bin. Sie müssen wissen, daß ich Arzt bin und man mich im Krankenhaus bereits erwartet.«
Ihr Lächeln veränderte sich, wurde ernst.
»Ich verstehe«, sagte sie und wandte sich wieder der Verkäuferin zu. »Bitte, Jean, nehmen Sie ihn dran.«
Bevor er ging, hatte er ihren Namen und ihre Telefonnummer. Sie waren in der perfekten Handschrift geschrieben, die ihr ihre Lehrerin, eine ehemalige Nonne, in der dritten Klasse eingetrichtert hatte. »Jeder Buchstabe hat eine Form«, hatte sie den Schülern erklärt, »eine völlig einzigartige Form, und es ist eure Pflicht, genau diese Form zu treffen.« Als dünne, blasse Achtjährige hatte die Frau im grünen Mantel, die später seine Ehefrau werden sollte, ihre kleinen Finger um den Füller gepreßt und sich allein in ihrem Zimmer stundenlang in Schreibschrift geübt, bis ihre Feder flüssig über das Papier glitt. Als sie ihm diese Geschichte später erzählte, sah er ihren im Schein der Schreibtischlampe gebeugten Kopf und ihre verkrampften Finger vor sich. Dann wunderte er sich über ihre Hartnäckigkeit, ihren starken Glauben an die Schönheit und ihre Bereitschaft, den strengen Weisungen einer ehemaligen Nonne zu folgen. An jenem Tag aber wußte er von alldem nichts. An jenem Tag trug er den Zettel in der Tasche seines Arztkittels von einem Krankenzimmer zum nächsten, immer an die Buchstaben denkend, die, einer perfekt in den anderen fließend, kunstvoll ihren Namen bildeten. Noch am gleichen Abend rief er sie an, führte sie am nächsten zum Abendessen aus, und drei Monate später waren sie verheiratet.
Jetzt, in diesen letzten Monaten ihrer Schwangerschaft, paßte ihr der weiche korallenrote Morgenmantel wie angegossen. Sie fand ihn versteckt unter anderen Kleidern und hielt ihn hoch, um ihn ihm zu zeigen. »Aber deine Schwester ist vor langer Zeit gestorben«, rief sie überrascht aus und war plötzlich verwirrt. Für einen Augenblick erstarrte er lächelnd, und die Lüge aus dem letzten Jahr schoß wie ein dunkler Vogel durch den Raum. Dann zuckte er verlegen mit den Schultern. »Ich mußte damals irgend etwas sagen. Ich mußte einen Weg finden, an deinen Namen zu kommen.« Sie durchquerte das Zimmer und umarmte ihn.
Es schneite noch immer. Während sie lasen oder sich unterhielten, nahm sie ab und zu seine Hand und führte sie zu ihrem Bauch, damit er die Bewegungen des Babys fühlen konnte. Von Zeit zu Zeit stand er auf, um das Feuer zu schüren, schaute aus dem Fenster und sah den Schnee Zentimeter um Zentimeter ansteigen.
Um elf Uhr erhob sie sich, um ins Bett zu gehen. Er blieb noch zwei Stunden unten, um die letzte Ausgabe des »Journal für Knochen- und Gelenkchirurgie« zu lesen. Als Arzt hatte er einen guten Ruf. Man hielt ihn für einen begabten Diagnostiker, und er galt auch als geschickter Chirurg. Er war der erste seines Jahrgangs gewesen, der den Abschluß machte. Dennoch war er sich seiner Fähigkeiten noch nicht ganz sicher, so daß er sich in jeder freien Minute weiterbildete. Erfolge betrachtete er als eine Art Beweise zu seinen Gunsten. Mit seinem Wissensdurst empfand er sich als Außenseiter, da es seiner Familie immer nur um das tägliche Überleben gegangen war. Seine Eltern sahen Bildung als unnötigen Luxus an, als etwas, das zu nichts führte. Wenn sie – arm, wie sie waren – überhaupt einen Arzt aufsuchten, fuhren sie in die Klinik von Morgantown, die achtzig Kilometer entfernt lag. Er konnte sich noch sehr lebhaft an diese seltenen Ausflüge erinnern, bei denen er auf der Ladefläche des geliehenen Pick-ups auf und ab hüpfte, während Staub hinter dem Wagen herwirbelte. Seine Schwester, die in der Fahrerkabine neben den Eltern saß, nannte das Schauspiel »die tanzende Straße«. Im Morgantown Hospital waren die Räume dämmrig, vom trüben Grün oder Türkis eines Tümpels, und die Ärzte, die kühl und abwesend wirkten, waren immer in Eile und kurz angebunden. Jetzt, viele Jahre später, gab es immer noch Momente, da er den Blick dieser Ärzte im Nacken spürte und sich selbst als Betrüger empfand, der jeden Augenblick entlarvt werden konnte. Er war sich darüber im klaren, daß die Wahl seines Fachgebietes auf dieses Gefühl zurückging. Überraschungen, die in der Allgemeinmedizin ständig auftreten konnten, mochte er genausowenig wie heikle Operationen an Organen. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit gebrochenen Gliedmaßen, formte Gipsverbände, studierte Röntgenaufnahmen und beobachtete Brüche, wie sie sich langsam und doch auf so wunderbare Weise wieder schlossen. Er liebte es, daß Knochen so solide waren, daß sie sogar der weißen Hitze der Einäscherung trotzten. Es fiel ihm leicht, seinen Glauben auf etwas zu gründen, was so fest und verläßlich war.
Er las bis weit nach Mitternacht, bis die Worte schwarz und zusammenhanglos auf den weißen Seiten glänzten, warf dann das Journal auf den Couchtisch und stand auf, um nach dem Feuer zu sehen. Er stopfte die verkohlten, noch glimmenden Scheite in die Glut, öffnete die Luftklappe ganz und schloß den Messingschirm vor dem Kamin. Als er das Licht löschte, glommen noch einzelne Glutherde in der Asche, die zart und weiß wie der Schnee war, der sich nun hoch auf der Verandabrüstung und den Rhododendren türmte.
Die Treppe knarrte leise unter seinem Gewicht. Er hielt am Kinderzimmer inne und betrachtete die schattenhaften Umrisse von Wiege, Wickeltisch und Stofftieren, die auf den Regalen saßen. Die Wände waren in einem hellen Meergrün gestrichen. An der gegenüberliegenden Seite hing ein Quilt mit Kinderreimen, den seine Frau mit winzigen Stichen genäht hatte, wobei sie bei der kleinsten Ungenauigkeit jedesmal eine ganze Stoffbahn herausgetrennt hatte. Ein kleines Stück unterhalb der Decke befand sich eine Zierleiste mit Bären. Auch die hatte sie, mit Hilfe einer Schablone, eigenhändig angefertigt.
Einem Impuls folgend, betrat er das Zimmer und schob die glatten Vorhänge beiseite, um den Schnee zu betrachten, der nun fast zwanzig Zentimeter hoch auf Laternenpfählen, Zäunen und Dächern lag. In Lexington war so ein Unwetter selten, und der stetige Schneefall und die Ruhe erfreuten ihn und stimmten ihn friedlich. In diesem Moment schienen sich die Mosaiksteine seines Lebens zusammenzufügen. Alle vergangene Traurigkeit und Enttäuschung und jedes ängstlich gehütete Geheimnis wurden von den weichen weißen Schichten verborgen. Morgen würde alles unberührt sein, die Welt würde gedämpft und verletzlich daliegen, so lange, bis die Kinder aus der Nachbarschaft herauskommen und sie mit ihren Fußstapfen, Rufen und ihrer Freude zerstören würden. Er konnte sich an solche Kindheitstage in den Bergen erinnern, seltene Momente der Flucht.
Er stand eine ganze Weile dort am Fenster, bis er hörte, wie sich Norah leise regte. Mit gesenktem Kopf saß sie auf der Bettkante, die Hände in die Matratze gekrallt. »Ich glaube, das sind die Wehen«, stöhnte sie und blickte auf. Ihr Haar war gelöst, eine Strähne klebte an ihrer Lippe. Er strich sie hinter ihr Ohr zurück. Sie schüttelte den Kopf, als er sich neben sie setzte. »Ich fühle mich irgendwie komisch. Diese Krämpfe kommen und gehen.«
Er half ihr, sich auf die Seite zu legen, und legte sich dazu, um ihr den Rücken zu massieren. »Es ist wahrscheinlich nur falscher Alarm«, beruhigte er sie. »Schließlich ist es drei Wochen zu früh, und bei der ersten Geburt kommen die Babys meistens zu spät.«
Was er da eben gesagt hatte, stimmte, das wußte er. Er war sich dessen sogar so sicher, daß er nach einer Weile einschlief. Doch plötzlich wachte er auf und sah sie vor sich. Sie hatte sich über das Bett gebeugt und rüttelte an seinen Schultern. In dem seltsamen Licht, das der Schnee ins Zimmer warf, wirkten ihr Morgenmantel und ihr Haar weiß.
»Ich habe die Abstände gemessen. Die Wehen liegen fünf Minuten auseinander und sind so stark, daß ich Angst habe.«
Nachdem sie ihm dies eröffnet hatte, spürte er, wie ihn eine Welle von Aufregung und Angst erfaßte. Während seiner Ausbildung hatte er jedoch gelernt, in Notfällen ruhig zu bleiben und seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. So nahm er sich, ohne jede Dringlichkeit, eine Uhr und begann langsam die Diele mit ihr auf und ab zu gehen. Immer wenn die Wehen einsetzten, drückte sie seine Hand so fest, als wollte sie seine Finger mit ihren verschmelzen. Die Wehen kamen tatsächlich erst alle fünf, dann alle vier Minuten. Er nahm den Koffer vom Schrank und war angesichts der Tragweite des lang erwarteten, gleichzeitig aber so überraschenden Ereignisses plötzlich wie betäubt. Obwohl sie selbst ständig in Bewegung waren, schien sich die Welt um sie herum zu verlangsamen und zum Stillstand zu kommen. Er nahm alles überdeutlich wahr, spürte seinen eigenen Atem über die Zunge streichen, bemerkte ihr Unbehagen, als ihre Füße in die einzigen Schuhe glitten, die sie noch tragen konnte, und sah, wie ihr geschwollenes, in blaue Nylonsocken gezwängtes Fleisch eine Wulst über dem dunkelgrauen Leder des Schuhs bildete. Als er ihren Arm ergriff, überkam ihn die seltsame Vorstellung, irgendwo an der Decke, in der Nähe des Lichtanschlusses, aufgehängt worden zu sein. Denn plötzlich glaubte er, sich und seine Frau von oben betrachten zu können, ohne daß ihm irgendein Detail entging: ihr Zittern unter einer Wehe, seine Finger, die ihren Ellbogen fest und schützend umfaßten, der stetige Schneefall draußen.
Er half ihr in ihren grünen Wollmantel, der an ihrem Bauch auseinanderklaffte, und fand auch die Lederhandschuhe, die sie bei ihrer ersten Begegnung getragen hatte. Daß diese Details stimmten, war ihm wichtig. Einen Moment lang standen sie zusammen auf der Veranda, überwältigt vom Anblick der weißen Welt.
»Warte hier«, sagte er und ging die Stufen hinunter, sich einen Pfad durch die Verwehungen bahnend. Die Türen des alten Autos waren eingefroren, und es kostete ihn einige Minuten, sie aufzumachen. Als eine Tür endlich aufschlug, stob eine glitzernde weiße Wolke auf, und er wühlte vor den Rücksitzen auf dem Boden herum, um den Eiskratzer und die Bürste zu finden. Dann tauchte er wieder auf und sah, wie seine Frau an der Veranda lehnte, die Stirn auf den verschränkten Armen. In diesem Augenblick wurde ihm klar, wie groß ihre Schmerzen sein mußten und daß das Baby tatsächlich kommen würde, und zwar noch in dieser Nacht. Er widerstand dem großen Verlangen, zu ihr zu gehen, und richtete seine ganze Kraft darauf, das Auto freizubekommen. Wenn die Kälte zu schmerzhaft wurde, wärmte er seine Hände abwechselnd unter den Achseln, und ohne innezuhalten, fegte er den Schnee von Windschutzscheibe, Fenstern und Verdeck.
»Du hast mir nie erzählt, daß es so weh tun würde«, klagte sie, als er die Veranda erreichte. Statt einer Antwort schlang er den Arm um ihre Schultern und half ihr die Treppe hinunter. »Ich kann laufen«, insistierte sie, »nur wenn die Schmerzen kommen, geht es nicht.«
»Ich weiß«, murmelte er besänftigend, ohne sie loszulassen.
Als sie das Auto erreicht hatten, berührte sie seinen Arm und machte eine Bewegung in Richtung des weiß verschleierten Hauses, das im Dunkel der Straße wie eine Laterne leuchtete.
»Wenn wir zurückkommen, werden wir unser Baby bei uns haben«, sagte sie. »Dann wird nichts mehr so sein, wie es war.«
Die Scheibenwischer waren festgefroren, und Schnee rieselte über das Rückfenster, als er in die Straße einbog. Er fuhr langsam und dachte dabei, wie schön Lexington war, wenn Bäume und Büsche so dick mit Schnee besetzt waren. Als er auf die Hauptstraße fuhr, trafen die Räder des Wagens auf Eis, und er kam kurz ins Schleudern, bevor er geradewegs über die Kreuzung glitt, um an einer Schneewehe zum Stehen zu kommen.
»Nichts passiert«, verkündete er, sich hastig umschauend. Zum Glück war kein anderes Auto auf der Straße. Das Lenkrad in seinen nackten Händen war hart und kalt wie Stein. Von Zeit zu Zeit wischte er mit seinem Handrücken ein Sichtfenster in die überfrorene Windschutzscheibe und beugte sich nach vorne, um hindurchzuspähen. »Bevor wir losgefahren sind, habe ich Bentley verständigt«, unterrichtete er sie. Bentley war sein Kollege und Geburtshelfer. »Ich habe ihn vorsichtshalber ins Büro bestellt. Es ist näher, deshalb fahren wir dorthin.«
Auf das Armaturenbrett gestützt, atmete sie mit der Wehe tief ein und aus, statt etwas zu erwidern. »Solange ich das Baby nicht in diesem alten Auto bekommen muß«, preßte sie endlich hervor und versuchte dabei scherzhaft zu klingen. »Du weißt, wie sehr ich es schon immer gehaßt habe.«
Obwohl er wußte, daß sie Angst hatte, und obwohl er ihre Angst teilte, lächelte er. Selbst in einem Notfall wie diesem kam er nicht gegen seine Natur an und handelte methodisch und entschlossen: hielt an jeder Ampel und setzte ordentlich den Blinker, wenn er irgendwo abbog, obwohl sich kein anderes Fahrzeug auf der Straße befand. Alle paar Minuten stützte sie sich wieder, tief ein- und ausatmend, gegen das Armaturenbrett, so daß er schlucken mußte, wenn er sie aus dem Augenwinkel beobachtete. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals so nervös gewesen zu sein wie in dieser Nacht. Selbst in seiner ersten Anatomiestunde, in der sie mit dem Leichnam eines Jungen konfrontiert wurden, dessen geöffneter Körper all seine Geheimnisse bloßlegte, war er weniger angespannt gewesen. Auch an seinem Hochzeitstag, als die Familie seiner Frau in der Kirche die eine Seite der Sitzreihen vollkommen ausfüllte und auf der anderen Seite nur eine Handvoll seiner Kollegen saßen – seine Eltern und die Schwester waren bereits tot –, hatte er nicht so viel Angst wie jetzt verspürt.
Auf dem Parkplatz des Klinikgeländes stand nur ein einziges Auto: der blaßblaue Fairline der Krankenschwester, ein gediegener, praktischer Wagen, der neuer als sein eigener war. Kurz nachdem er seinen Kollegen informiert hatte, hatte er auch sie angerufen. Nun, da sie das Büro sicher erreicht hatten, waren sie beide in Hochstimmung und lachten, als sie sich ins grelle Licht des Wartezimmers drängten.
Dort trafen sie auf die Schwester. Ihre großen blauen Augen saßen in einem blassen Gesicht, das keinen Aufschluß über ihr Alter gab. Sie konnte vierzig, aber auch nur fünfundzwanzig Jahre alt sein. Als er sie sah, wußte er sofort, daß etwas schiefgelaufen war, denn wenn ihr etwas gegen den Strich ging, bildete sich auf ihrer Stirn, genau zwischen den Augen, eine dünne, steile Falte. Auch jetzt, als sie von Bentley berichtete, konnte man sie sehen. Das Auto des Geburtshelfers war auf der noch ungeräumten Landstraße in der Nähe seines Hauses ausgeschert, hatte sich auf dem schneebedeckten Eis zweimal um die eigene Achse gedreht und war in einen Graben geschlittert.
»Heißt das, Dr. Bentley wird nicht kommen?« fragte seine Frau ängstlich. Die Schwester schüttelte den Kopf. Sie war groß, dünn und so kantig, daß es schien, als ob ihre Knochen jeden Moment durch die Haut stoßen würden. Ihre riesigen blauen Augen blickten ernst und intelligent. In der Klinik erzählte man sich, daß sie ein bißchen in ihn verliebt sei, und man witzelte darüber. Er hatte die Gerüchte monatelang ignoriert und als müßiges Bürogeschwätz abgetan, das zwangsläufig aufkommen mußte, wenn ein Mann und eine ledige Frau täglich so eng zusammenarbeiteten. Aber eines Tages war er über seinem Schreibtisch eingeschlafen. Er hatte geträumt, daß seine Mutter Gläser mit eingemachten Früchten auf das Wachstuch des Tisches unter dem Fenster stellte. Sie glänzten wie Juwelen. Seine fünfjährige Schwester saß dabei und hielt eine Puppe in der Hand, die sie vergessen zu haben schien. Das flüchtige Bild aus Kindheitstagen erfüllte ihn sowohl mit Trauer als auch mit Sehnsucht. Zwar gehörte das Elternhaus ihm, aber es stand leer, seit seine Schwester gestorben war und seine Eltern weggezogen waren. Die Zimmer, die seine Mutter früher geschrubbt hatte, bis sie matt glänzten, waren nun verkommen und nur noch vom Rascheln der Eichhörnchen und Mäuse erfüllt.
Als er seine Augen aufschlug, waren sie tränennaß. Die Schwester stand im Türrahmen, und ihr Gesicht hatte einen zärtlichen Ausdruck. In diesem Augenblick, mit einem angedeuteten Lächeln auf den Lippen, war sie wunderschön, eine ganz andere Frau als die effiziente Arzthelferin, die jeden Tag so ruhig und kompetent an seiner Seite arbeitete. Ihre Augen trafen sich, und plötzlich kam es ihm so vor, als würde er sie – als würden sie beide sich auf eine tiefe und vertraute Art und Weise kennen. Es gab nichts, was in diesem Moment zwischen ihnen stand, und ihre Vertrautheit war so groß, daß er reglos erstarrte. Da errötete sie heftig und wandte ihren Blick ab. Sie räusperte sich, richtete sich auf und erklärte, daß sie jetzt gehe, da sie bereits zwei Überstunden gemacht habe. Daraufhin vermied sie es viele Tage lang, ihn direkt anzusehen.
Nach diesem Erlebnis unterbrach er seine Kollegen, wenn sie ihn mit ihr aufzogen. »Sie ist eine sehr gute Schwester«, winkte er dann ab und fügte, an den Moment ihrer tiefen Verbundenheit denkend, hinzu: »die beste, mit der ich je gearbeitet habe.« Das entsprach der Wahrheit, und in dieser Nacht war er sehr froh, sie bei sich zu haben.
»Was ist mit der Unfallstation?« fragte sie. »Können wir es dorthin schaffen?« Der Arzt schüttelte den Kopf. Die Wehen kamen nun schon im Minutentakt.
»Dieses Baby will nicht warten«, antwortete er mit einem Blick auf seine Frau. Schnee war in ihrem Haar geschmolzen und funkelte wie ein Diadem aus Diamanten. »Es hat sich schon auf den Weg gemacht.«
»Ist schon in Ordnung«, erklärte seine Frau stoisch. Ihre Stimme war jetzt härter und entschiedener. »Das gibt eine Geschichte, die man ihm noch erzählen kann, wenn er groß ist. Ihm oder ihr«, verbesserte sie sich.
Die Schwester lächelte. Die Falte auf ihrer Stirn war nur noch schwach zu sehen. »Dann bringen wir Sie mal rein und tun etwas gegen Ihre Schmerzen«, schlug sie vor.
Er ging in sein Büro, um einen Kittel zu holen, und als er Bentleys Untersuchungszimmer betrat, lag seine Frau bereits mit angewinkelten und in Bügeln steckenden Beinen auf dem Bett. Der Raum war blaßblau, überall blitzten Chrom, weißes Email und feine Instrumente aus schimmerndem Stahl. Der Arzt trat zum Waschbecken und wusch sich die Hände. Er war äußerst wachsam. Nicht das kleinste Detail entging ihm, und als er dieses alltägliche Ritual vollzog, begann seine Unruhe über Bentleys Ausbleiben nachzulassen. Dann schloß er die Augen, um sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren.
»Wir machen Fortschritte«, unterrichtete ihn die Schwester, als er sich umdrehte. »Es sieht alles sehr gut aus. Ich würde sagen, ihr Muttermund ist schon zehn Zentimeter geöffnet, was meinen Sie?«
Er saß auf dem niedrigen Hocker und führte seine Hände in den weichen, warmen Schoß seiner Frau. Die Fruchtblase war noch intakt, und durch sie hindurch konnte er den Kopf des Babys fühlen. Er war glatt und hart wie ein Baseball. Was er da berührte, war sein Kind. Normalerweise sollte er in irgendeinem Wartezimmer auf und ab gehen. Die Rolläden des einzigen Fensters im Zimmer waren heruntergelassen, und als er seine Hand aus der Wärme ihres Körpers zog, fragte er sich, ob es wohl noch schneite und ob die Stadt und das weite Land dahinter noch immer still unter ihrer weißen Decke lagen.
»Ja«, bestätigte er, »zehn Zentimeter.«
»Phoebe«, sagte seine Frau. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber ihre Stimme war klar. Sie hatten monatelang über Namen nachgedacht, ohne eine Entscheidung zu treffen. »Für ein Mädchen Phoebe. Und wenn es ein Junge ist, wird er Paul heißen, nach meinem Großonkel. Habe ich dir das überhaupt schon erzählt?« fragte sie ihn. »Ich wollte dir längst sagen, daß ich mich für zwei Namen entschieden habe.«
»Das sind schöne Namen«, stimmte die Schwester beruhigend zu.
»Phoebe und Paul«, wiederholte der Arzt, aber er konzentrierte sich nur auf die Wehe, die sich im Fleisch seiner Frau zusammenballte. Er gab der Schwester ein Zeichen, die daraufhin das Lachgas vorbereitete. Während seiner Assistenzzeit hatte man Frauen, die in den Wehen lagen, noch eine Vollnarkose gegeben. Sie waren erst erwacht, wenn die Geburt vorbei war. Aber die Zeiten hatten sich geändert – man schrieb das Jahr 1964 –, und er wußte, daß Bentley Lachgas nur selektiv einsetzte. Um aktiv pressen zu können, sollte Norah besser wach sein. Nur in den Wehenspitzen und beim Austritt des Kindes würde er sie betäuben, um ihr die größten Schmerzen zu nehmen. Seine Frau verkrampfte sich und schrie auf, als das Baby in den Geburtskanal rutschte und dabei die Fruchtblase zum Platzen brachte.
»Jetzt«, rief der Arzt, und die Schwester drückte ihr die Betäubungsmaske auf Mund und Nase. Als das Gas zu wirken begann, erschlafften ihre Hände, und ihre Fäuste öffneten sich. Still, friedlich und ahnungslos lag sie da, während eine Wehe nach der anderen ihren Körper durchfuhr.
»Für eine Erstgeburt kommt das Baby sehr schnell«, stellte die Schwester fest.
»Ja«, stimmte der Arzt zu, »so weit, so gut.«
Es verging eine halbe Stunde, in der seine Frau immer wieder erwachte, stöhnte und preßte. Wenn der Arzt dachte, ihre Schmerzen wären zu groß – oder wenn sie schrie, es sei nicht mehr auszuhalten –, nickte er der Schwester zu, die sie daraufhin mit Lachgas betäubte. Bis auf den ruhigen Austausch von Anweisungen wurde nicht gesprochen. Draußen schneite es noch immer. Der Schnee trieb an den Häusern vorbei und legte sich auf die Straßen.
Der Arzt saß auf einem Stuhl aus Edelstahl und sammelte seine Gedanken. Während seiner Ausbildung hatte er fünf Kinder lebend und gesund auf die Welt gebracht, und diese Geburten rief er sich jetzt ins Gedächtnis, als er in seiner Erinnerung nach den Details für die richtigen Handgriffe suchte. Während er sich konzentrierte, wurde seine Frau, deren Füße in den Bügeln steckten und deren Bauch so hoch aufragte, daß er ihren Kopf nicht sehen konnte, langsam zu einer jener anderen fünf Frauen. Ihre runden Knie, ihre glatten, schmalen Waden und Gelenke lagen vor ihm und waren ihm vertraut und lieb. Trotzdem dachte er nicht daran, sie zu streicheln oder ihr beruhigend die Hand auf das Knie zu legen. Es war die Schwester, die ihre Hand hielt, während sie preßte. Sie wurde zu einer Patientin, die er unter Aufwendung all seiner technischen Fähigkeiten versorgen mußte. Mehr denn je empfand er es als seine Pflicht, seine Gefühle im Zaum zu halten.
Nach einer Weile stand ihm der seltsame Moment, den er in ihrem Schlafzimmer erlebt hatte, wieder vor Augen. Er fühlte sich, als ob er sich vom Schauplatz der Geburt entfernte. Wieder war er anwesend und doch zugleich an einem anderen Ort, von dem aus er alles aus sicherer Entfernung beobachten konnte. Sorgfältig sah er sich einen sehr präzisen Dammschnitt setzen. Ein guter Schnitt, dachte er, als das Blut in einer sauberen Linie hervorquoll, und er vermied es, an die Situationen zu denken, als er dieses Fleisch in sexueller Erregung berührt hatte.
Der Kopf zeigte sich. Nach drei weiteren Preßwehen war er ganz zu sehen, und der Körper glitt in seine wartenden Hände. Das Baby schrie auf, und seine blaue Haut wurde rosig. Es war ein rotgesichtiger, dunkelhaariger Junge mit wachen Augen, der offensichtlich großes Mißtrauen gegen die Lichter und den kalten, klaren Luftzug, der ihm entgegenschlug, hegte. Der Arzt band die Nabelschnur ab und durchtrennte sie. Mein Sohn, erlaubte er sich zu denken. Mein Sohn.
»Er ist wunderschön«, bestätigte die Schwester. Sie wartete, während er das Kind untersuchte und dabei dessen regelmäßigen, kräftigen Herzschlag, seine langgliedrigen Finger und den dunklen Haarschopf bewunderte. Dann trug sie das Kind in den anderen Raum, um es zu baden und ihm Silbernitrat in die Augen zu träufeln. Die schwachen Schreie wurden zu ihnen herübergetragen, und seine Frau regte sich. Der Arzt hielt sich in Erwartung der Nachgeburt bereit und atmete mehrmals tief durch. Mein Sohn, dachte er wieder.
»Wo ist das Baby?« fragte seine Frau, als sie die Augen aufschlug und sich das Haar aus dem gerötetem Gesicht strich. »Ist alles okay?«
»Es ist ein Junge«, erklärte er und lächelte sie an. »Sobald er sauber ist, wird die Schwester ihn bringen. Wir haben einen absolut perfekten kleinen Sohn.«
Die vor Glück und Erschöpfung ermatteten Gesichtszüge seiner Frau spannten sich unter einer weiteren Kontraktion plötzlich an. Sofort kehrte der Arzt zu dem Stuhl zwischen ihren Beinen zurück und drückte sanft auf ihren Unterleib, um die Plazenta zu bergen. Sie schrie auf, und in diesem Augenblick verstand er, was da gerade geschah. Er war so erschrocken, als hätte sich plötzlich ein Abgrund vor ihm aufgetan.
»Es ist alles in Ordnung«, beruhigte er sie, »alles ist in bester Ordnung.« Aber als die nächste Wehe heraufzog, rief er: »Schwester!«
Sie kam sofort, das in weiße Tücher gehüllte Baby auf den Armen.
»Beim Apgar-Test hat er neun Punkte erreicht«, verkündete sie. »Das ist sehr gut.«
Seine Frau hob ihren Arm, um das Baby zu nehmen, aber der Schmerz holte sie ein, und sie sank auf die Liege zurück.
»Schwester?« der Arzt winkte sie heran. »Ich brauche Sie jetzt hier. Es ist dringend.«
Nach einem Moment der Verwirrung legte die Schwester zwei Kissen auf den Boden, auf die sie das Baby bettete. Dann begab sie sich eilig zum Arzt neben die Liege.
»Mehr Gas!« Er sah ihre Überraschung, die von einem raschen Nicken des Verstehens abgelöst wurde, als sie seine Anordnung ausführte. Seine Hand lag nun auf dem Knie seiner Frau, so daß er die Erschlaffung ihrer Muskeln spüren konnte, als das Lachgas zu wirken begann.
»Zwillinge?« fragte die Schwester jetzt leise.
Der Arzt, der sich nach der Geburt des Jungen etwas entspannt hatte, fühlte sich nun schwach und konnte nur matt nicken. Ruhig, ermahnte er sich, als der nächste Kopf erschien. Du bist hier irgendwo im Raum, dachte er, während er das Geschehen von einem günstigen Platz von der Decke aus verfolgte und seine Hände effektiv und präzise arbeiteten. Dies ist eine Geburt wie jede andere.
Dieses Baby war kleiner. Es rutschte so schnell in seine behandschuhten Hände, daß er sich mit durchgedrückter Brust nach vorn beugte, um es aufzufangen.
»Es ist ein Mädchen«, stellte er fest, während er das Kind mit dem Gesicht nach unten wie einen Football in den Armen hielt und ihm so lange auf den Rücken klopfte, bis es aufschrie. Dann drehte er das Neugeborene um und sah ihm ins Gesicht.
Cremigweiße Käseschmiere und feine Spuren von Blut überzogen seine zarte Haut, und es war vom Fruchtwasser noch ganz glitschig. Die blauen Augen wirkten trüb, und das Haar war pechschwarz, aber davon bemerkte er kaum etwas. Etwas anderes nahm ihn gefangen. Er starrte auf die unverkennbaren Gesichtszüge: die Augen, die wie zu einem Lachen nach oben gedreht waren, die Epikanthus-Falte über dem Augenlid und die flache Nase. »Ein klassischer Fall«, hatte sein Professor bei der Untersuchung eines anderen Kindes vor Jahren gesagt. »Es ist ein mongoloides Kind. Wissen Sie, was das bedeutet?« Daraufhin hatte er, der Arzt, gehorsam die Symptome aufgezählt, die er aus einem Fachartikel kannte: schlaffer Muskeltonus, verzögerte körperliche und geistige Entwicklung, mögliche Herzkomplikationen, früher Tod. Der Professor hatte genickt und das Stethoskop auf die nackte weiche Brust des Säuglings gedrückt. »Armes Kind. Die Eltern können nichts anderes tun, als es sauberzuhalten. Sie sollten sich das ersparen und es in ein Heim geben.«
Der Arzt fühlte sich in die Vergangenheit zurückversetzt. Seine Schwester war mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und sehr langsam gewachsen. Ihr Atem ging stockend, und immer wenn sie zu rennen versuchte, mußte sie nach Luft schnappen. Viele Jahre lang, bevor sie nach Morgantown in die Klinik fuhren, wußten sie nicht, was mit ihr los war. Und als sie es schließlich erfuhren, konnten sie nichts für sie tun. Seine Mutter richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf seine Schwester, und trotzdem verstarb sie mit zwölf Jahren. Da war er selbst schon sechzehn gewesen, hatte ein Stipendium erhalten und in der Stadt gelebt. Er war bereits auf seinem Weg nach Pittsburgh gewesen, zum Medizinstudium, zu dem Leben, das er jetzt führte. Dennoch konnte er sich an die tiefe, lang anhaltende Trauer seiner Mutter erinnern. Auch sah er sie wieder vor sich, wie sie jeden Morgen bei Wind und Wetter mit verschränkten Armen den Hügel zum Grab hinaufging.
Die Krankenschwester stand an seiner Seite und betrachtete das Baby.
»Es tut mir so leid für Sie, Herr Doktor«, sagte sie mit aufrichtigem Bedauern.
Er hatte völlig vergessen, was er als nächstes tun mußte, und hielt das Neugeborene noch immer auf dem Arm. Die winzigen Hände des Mädchens waren perfekt geformt. Aber da gab es auch diesen Spalt, der sich wie eine Zahnlücke zwischen ihrem großen Zeh und den anderen auftat, und wenn er ihr tief in die Augen sah, konnte er deutlich die Bushfield-Flecken erkennen, die wie winzige Schneeflocken in ihrer Iris saßen. Er stellte sich ihr Herz vor, das groß wie eine Pflaume und wahrscheinlich defekt war, und er dachte an das Kinderzimmer mit den weichen Kuscheltieren, das so liebevoll bemalt war, und an die einzelne Wiege darin. Zuletzt sah er seine Frau vor sich, wie sie auf dem Bürgersteig vor ihrem verschneiten, mondbeschienenen Haus gestanden und gesagt hatte: »Dann wird nichts mehr so sein, wie es war.«
Die Hand des Kindes streifte seine, und er machte sich an die Arbeit. Willenlos begann er die gewohnten Arbeitsgänge abzuspulen. Er durchschnitt die Nabelschnur, überprüfte Herz und Lungen und dachte dabei die ganze Zeit an den Schnee. Er sah das silberne Auto in den Graben fahren, und die tiefe Stille der leeren Klinik drang in sein Bewußtsein. Wenn er später an diese Nacht zurückdachte – und in den kommenden Monaten und Jahren würde er noch oft an diese Nacht denken, die den Wendepunkt in seinem Leben markierte, und an die Momente, um die sich später alles andere fügen würde –, so erinnerte er sich an diese Stille und an den stetig fallenden Schnee. Die Stille umfing ihn so gänzlich, daß er sich fühlte, als würde er schweben: immer höher, über das Zimmer hinaus und weiter, bis er mit dem Schnee eins wurde und bis das Schauspiel in diesem Zimmer zu einem anderen Leben gehörte – einem Leben, dessen zufälliger Zuschauer er war –, als wäre es nur eine Szene, die man im Vorbeigehen durch ein warm erleuchtetes Fenster erhascht.
»Bitte machen Sie es jetzt sauber«, wandte er sich an die Schwester und entließ das leichte Bündel in ihre Arme. »Behalten Sie es aber im anderen Raum, ich möchte nicht, daß meine Frau schon davon erfährt. Es ist noch zu früh.«
Die Schwester nickte. Sie verschwand und kam dann wieder, um seinen Sohn in die Babyschale zu legen, die sie mitgebracht hatten. Der Arzt war inzwischen damit beschäftigt, die beiden Plazentas zu entbinden. Sie kamen leicht und unbeschädigt heraus, waren dick und dunkel und hatten jeweils die Größe eines kleinen Tellers. Zweieiige Zwillinge, männlich und weiblich, der eine war sichtlich vollkommen, die andere von einem zusätzlichen Chromosom gezeichnet, das in jeder Zelle ihres Körpers steckte. Wie gering die Wahrscheinlichkeit dafür war! Sein Sohn lag in der Babyschale. Von Zeit zu Zeit ruderten seine Arme, mit schnellen, fließenden Schwimmbewegungen, als befände er sich noch im Mutterleib. Der Arzt injizierte seiner Frau ein Beruhigungsmittel und beugte sich herunter, um den Dammschnitt zu nähen. Es dämmerte schon, und die Fenster wurden von schwachem Licht erhellt. Während er die Bewegungen seiner Hände verfolgte, fiel ihm auf, wie gut die winzigen Stiche saßen und daß sie genauso ordentlich und gleichmäßig waren wie die seiner Frau. Es kam ihm wieder in den Sinn, wie sie wegen eines Fehlers, den er nicht einmal erkennen konnte, eine ganze Stoffbahn aus ihrem Quilt gerissen hatte.
Als er fertig war, fand er die Schwester, die das kleine Mädchen in den Armen wiegte, in einem Schaukelstuhl im Wartezimmer sitzend. Wortlos begegnete sie seinem Blick, und er erinnerte sich an die Nacht, in der sie ihn im Schlaf betrachtet hatte.
»Es gibt da einen Ort«, erklärte er sachlich und notierte Namen und Adresse auf die Rückseite eines Briefumschlages. »Ich bitte Sie, das Baby dorthin zu bringen. Natürlich erst morgen früh. Ich werde die Geburtsurkunde ausstellen und dort Bescheid geben, daß Sie kommen.«
»Aber Ihre Frau«, wandte die Schwester ein, und von seiner fernen Warte aus konnte er Überraschung und Mißbilligung in ihrer Stimme hören.
Er dachte an seine dünne, blasse Schwester, an ihr Ringen nach Atem und an seine Mutter, wie sie sich zum Fenster drehte, um ihre Tränen zu verbergen.
»Können Sie das nicht verstehen?« fragte er sanft. »Dieses arme Kind hat ziemlich sicher einen Herzfehler, sehr wahrscheinlich sogar einen tödlichen. Ich erspare uns allen nur schreckliches Leid.«
Man hörte ihm an, daß er von seinen Worten überzeugt war. Die Schwester saß schweigend da und starrte ihn unverwandt an. Obwohl sie überrascht wirkte, war ihre Miene undurchdringlich, während er auf ihre Zustimmung wartete. In seiner momentanen geistigen Verfassung kam es ihm nicht in den Sinn, daß sie sein Anliegen auch ablehnen könnte. Erst als die Nacht vorangeschritten war und in den vielen Nächten, die ihr folgten, war ihm bewußt, wie sehr er sein ganzes Vorhaben gefährdet hatte. Statt dessen dauerte ihm ihre Reaktion jetzt zu lange, und er fühlte sich plötzlich sehr müde. Die ihm sonst so vertraute Klinik kam ihm merkwürdig vor, als ob er sich in einem Traum befände. Die Schwester sah ihn aus unergründlichen blauen Augen an, und er erwiderte ihren Blick unerschrocken. Schließlich machte sie eine schwache Kopfbewegung, die man kaum als Nicken erkennen konnte.
»Der Schnee«, murmelte sie und senkte ihren Blick.
Aber im Verlauf des Morgens begann der Sturm sich zu legen, und in der Ferne hörte man die knirschenden Geräusche von Räumfahrzeugen, die die reglose Luft durchpflügten. Aus einem der oberen Fenster sah er der Schwester dabei zu, wie sie Schnee von ihrem blauen Auto klopfte und in die weiße Welt hinausfuhr. Das Neugeborene war verdeckt, es lag schlafend in einer mit Tüchern ausgelegten Kiste, die auf dem Rücksitz stand. Der Arzt sah, wie sie nach links in die Straße abbog und verschwand. Dann ging er zurück zu seiner Familie.
Seine Frau schlief noch. Ihr Goldhaar floß über das Kissen. Hin und wieder nickte er ein. Wenn er aufwachte, starrte er auf den leeren Parkplatz, sah Rauch aus den Schornsteinen gegenüber aufsteigen und bereitete die Worte vor, die er seiner Frau sagen wollte, nämlich daß niemanden eine Schuld treffe, daß ihre Tochter in guten Händen, unter ihresgleichen sein würde und daß man sich dort ständig um sie kümmern könnte. So sei es für sie alle am besten. Am späten Vormittag, als es endgültig aufgehört hatte zu schneien, schrie sein Sohn vor Hunger auf, und seine Frau erwachte.
»Wo ist das Baby?« fragte sie, stützte sich auf ihre Ellenbogen und strich sich das Haar aus dem Gesicht. Er nahm ihren Sohn, der sich leicht und warm anfühlte, setzte sich neben sie und legte ihr das Baby in die Arme.
»Hallo, meine Süße«, begrüßte er sie. »Sieh dir unseren wunderschönen Sohn an. Du bist sehr tapfer gewesen.«
Sie küßte das Baby auf die Stirn, öffnete ihren Mantel und legte es an die Brust. Sofort saugte sich sein Sohn fest, und seine Frau sah lächelnd zu ihm auf. Er nahm ihre freie Hand und dachte an die Abdrücke, die ihre Finger auf seinen Armen hinterlassen hatten, weil sie sich so fest an ihn geklammert hatte. Auch daran, wie sehr er sie hatte beschützen wollen, erinnerte er sich.
»Ist alles in Ordnung?« fragte sie. »Schatz, was ist mit dir?«
»Wir hatten Zwillinge«, begann er schleppend und hatte die schwarzen Haarschöpfe und die glitschigen Körper, die in seine Hände rutschten, wieder vor Augen. Tränen stiegen ihm in die Augen. »Einen Jungen und …« Er brach den Satz ab.
»Oh«, sie verstand ihn nicht. »Auch ein kleines Mädchen? Paul und Phoebe. Aber wo ist sie?«
Ihre Finger sind so schmal wie die Knochen eines kleinen Vogels, dachte er.
»Mein Schatz«, hob er erneut an. Seine Stimme wurde brüchig, und die Worte, die er sich so sorgfältig zurechtgelegt hatte, waren verschwunden. Er schloß die Augen, und als er wieder sprechen konnte, brach es aus ihm heraus: »Es tut mir so leid, mein Liebling. Du warst so großartig, so tapfer, aber unsere kleine Tochter ist bei der Geburt gestorben.«
2. Kapitel
März 1964
CAROLINE GILL STAPFTE VORSICHTIG UND UNBEHOLFEN über den Parkplatz. Der Schnee reichte ihr bis zu den Knöcheln, an einigen Stellen sogar bis zum Knie. Sie trug das in Tücher gewickelte Baby in einem Pappkarton, der früher Probepackungen mit Säuglingsnahrung enthalten hatte. Er war mit roten Buchstaben und puttenhaften Babygesichtern bedruckt, und seine abstehenden Klappen hoben und senkten sich mit jedem Schritt. Über dem fast leeren Parkplatz lag eine unnatürliche, kalte Stille, die sich wie Wellenringe auszubreiten schien, die von einem ins Wasser geworfenen Stein wegstreben. Schnee stob auf und brannte in ihrem Gesicht, als sie die Autotür öffnete. Instinktiv beugte sie sich schützend über die Schachtel und klemmte sie auf dem Rücksitz fest, wo die rosafarbenen Tücher sanft auf die weißen Kunststoffpolster sanken. Das Baby schlief den unerschütterlichen Schlaf eines Neugeborenen. Seine Augen waren nur Schlitze, Nase und Kinn bloße Aufwerfungen in seinem zusammengeballten Gesicht. Man würde es nicht erkennen, wenn man es nicht wüßte, dachte Caroline. Sie hatte den Zustand des Mädchens, nach dem Apgar-Test, mit acht von zehn Punkten bewertet.
Die Fahrt auf den schlecht geräumten Straßen war beschwerlich. Zweimal geriet der Wagen ins Schleudern, und Caroline wäre fast umgekehrt. Doch die Interstate war besser geräumt, und sobald Caroline sie erreichte, kam sie beständig voran. Die heruntergekommenen Außenbezirke Lexingtons wurden von den hügeligen Ländereien der Pferdefarmen abgelöst. Kilometerlange weiße Zäune warfen lebhafte Schatten auf den Schnee, und Pferde hoben sich dunkel von den Weiden ab. Dichte graue Wolken zogen tief über den Himmel. Caroline machte das Radio an, suchte nach einem Sender und schaltete es wieder aus. Die Welt flog in bekannten Bildern an ihr vorbei, und doch hatte sie sich vollkommen verändert.
Von dem Augenblick an, da sie Dr. Henrys überraschender Bitte mit einem kaum merklichen Nicken zustimmte, hatte Caroline sich gefühlt, als würde sie in Zeitlupe durch die Luft fallen, dem Aufprall entgegen. Was er von ihr verlangt hatte – daß sie seine neugeborene Tochter fortbringen sollte, ohne seine Frau von ihrer Existenz zu unterrichten –, war unbeschreiblich. Aber der Schmerz und die Verwirrung, die sich bei der Untersuchung auf seinem Gesicht abgezeichnet hatten, und die langsame und benommene Art, mit der er sich danach bewegte, hatten Caroline so gerührt, daß sie seinem Wunsch nachgab. Sie sagte sich, daß er noch früh genug zur Besinnung kommen würde. Er befand sich in einem Schockzustand, und wer konnte ihm das verdenken?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!