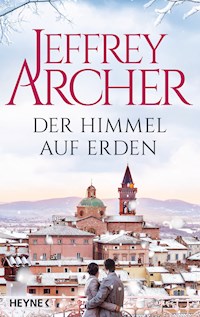
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein glückloser italienischer Polizist reist von Neapel in ein kleines Bergdorf, um den Mörder des dortigen Bürgermeisters zu überführen. Ein selbstgefälliger Schüler lüftet das Geheimnis um den Reichtum seiner Familie und ändert daraufhin sein Leben für immer. Eine Dozentin bietet in den Dreißigerjahren ihren männlichen Kollegen an einer Ivy League Universität die Stirn. Eine junge Anhalterin erlebt die Überraschung ihres Lebens.
In 15 raffinierten und denkwürdigen Geschichten führt uns Bestsellerautor Jeffrey Archer auf unterhaltsame Weise die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins vor Augen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Ein glückloser italienischer Polizist reist von Neapel in ein kleines Bergdorf, um den Mörder des dortigen Bürgermeisters zu überführen. Ein selbstgefälliger Schüler lüftet das Geheimnis um den Reichtum seiner Familie und ändert daraufhin sein Leben für immer. Eine Dozentin bietet in den Dreißigerjahren ihren männlichen Kollegen an einer Ivy-League-Universität die Stirn. Und eine junge Anhalterin erlebt die Überraschung ihres Lebens.
In 15 raffinierten und denkwürdigen Geschichten führt uns Bestsellerautor Jeffrey Archer auf unterhaltsame Weise die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins vor Augen.
Der Autor
Jeffrey Archer, geboren 1940 in London, verbrachte seine Kindheit in Weston-super-Mare und studierte in Oxford. Archer schlug zunächst eine bewegte Politiker-Karriere ein. Weltberühmt wurde er als Schriftsteller. Als einziger britischer Autor erreichte er Platz eins der Bestsellerliste sowohl mit Romanen (zwanzigmal) als auch mit Erzählungen (viermal) sowie mit einem Sachbuch. Archer ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in London, Cambridge und auf Mallorca.
JEFFREY ARCHER
DER HIMMELAUF ERDEN
Erzählungen
Aus dem Englischen vonMartin Ruf und Jens Plassmann
Die Originalausgabe TELL TALE erschien erstmals 2017bei Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 11/2020
Copyright © 2017 by Jeffrey Archer
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung des Originalumschlagsvon James Annal, Pan Macmillan Art DepartmentAbbildungen: © Bill Cheyrou / Alamy Stock Foto und © shutterstock
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-22713-5V001
www.heyne.de
Für Paula
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einzigartig
Beichte**
Die Ansicht von Auvers-sur-Oise*
Ein Gentleman und Gelehrter*
In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt
Der Parkwächter*
Eine verlorene Stunde*
Auf dem Weg nach Damaskus*
Der Betrogene
Der Urlaub ihres Lebens*
Verdoppeln oder aufhören
Der Senior-Vizepräsident
Eine glücklich verlorene Seitenwahl*
Wer hat den Bürgermeister umgebracht?*
Der perfekte Mord
Danksagung
* Angeregt von wahren Ereignissen
** Angeregt von Rupert Colley
Vorwort
Dies ist die erste Reihe von Erzählungen, die ich seit der Clifton-Saga geschrieben habe.
Wie schon bei meinen früheren Sammlungen, basieren einige von ihnen lose auf Ereignissen, von denen ich auf meinen Reisen von Grantchester bis Kalkutta und von Christchurch bis Kapstadt gehört habe. Diese Geschichten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Alle anderen entspringen ausschließlich meiner Fantasie.
Als die englische Erstausgabe bereits veröffentlicht war, steuerte Rupert Colley noch eine Idee bei, die so unwiderstehlich war, dass ich auf keinen Fall damit warten wollte. Daraus wurde die Erzählung »Beichte«, die dieser Ausgabe hinzugefügt ist.
Inzwischen habe ich »Beichte« als Einakter adaptiert, der zusammen mit »Wer hat den Bürgermeister umgebracht?« einen wundervollen Theaterabend ergibt.
Jeffrey Archer, 2018
Einzigartig
Eine Herausforderung
Vor vielen Jahren bat mich ein Redakteur des Reader’s Digest in New York, eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Schluss zu schreiben, die exakt 100 Wörter umfassen sollte. Als sei das nicht schon schwierig genug, bestand er darauf, dass sie weder 99 noch 101 Wörter umfassen durfte.
Nicht einmal das genügte. Überdies bat er nämlich darum, die Geschichte innerhalb von vierundzwanzig Stunden einzureichen.
Bei meinem ersten Versuch kam ich auf 118 Wörter, beim zweiten auf 106, beim dritten auf 98. Ich frage mich, ob Sie erraten, was ich wieder einfügen musste.
Das Ergebnis war »Einzigartig«.
Vielleicht interessiert es den Leser, dass diese Vorbemerkung ebenfalls genau 100 Wörter umfasst.
Paris, 14. März 1921
Erneut entzündete der Sammler seine Zigarre, griff nach der Lupe und musterte die dreieckige 1874 Kap der Guten Hoffnung.
»Ich habe Ihnen ja gesagt, dass es zwei gibt«, erklärte der Händler. »Deshalb ist Ihre nicht einzigartig.«
»Wie viel wollen Sie dafür?«
»Zehntausend Francs.«
Der Sammler schrieb sogleich einen Scheck aus, zog kräftig an seiner Zigarre, die jedoch bereits nicht mehr brannte. Er riss ein neues Streichholz an und hielt es an die Briefmarke.
Ungläubig sah der Händler zu, wie die Marke in Rauch aufging.
Der Sammler lächelte. »Sie hatten unrecht, mein Freund. Meine ist wirklich einzigartig.«
Beichte
1
Saint Rochelle, Juni 1941
Nichts konnte sie von ihrer Pokerrunde am Freitagabend abhalten. Nicht einmal der Kriegsausbruch.
Die vier Männer waren seit Jahrzehnten miteinander befreundet – oder zumindest gut bekannt. Max Lascelles, eine massige Gestalt, machtbewusst und durchsetzungsfähig, hatte mit unerschütterlicher Selbstverständlichkeit den Platz am Kopfende des alten Holztischs eingenommen. Immerhin war er Anwalt und zudem Bürgermeister von Saint Rochelle, während die anderen drei nur Stadträte waren.
Ihm gegenüber saß Claude Tessier, Direktor des Bankhauses Tessiers, der seine Position weniger seinen Verdiensten als seinem Stammbaum verdankte. Ein scharfsinniger, verschlagener und zynischer Mensch, der fest davon überzeugt war, dass jeder sich selbst der Nächste sein sollte.
Rechts von Tessier saß André Parmentier, der Schulleiter des Collège Saint Rochelle. Schlank, hoch aufgeschossen und mit einem buschigen roten Schnauzbart, der eine Vorstellung davon gab, welche Farbe seine Haare gehabt hatten, bevor er kahlköpfig geworden war. Hochgeachtet und geschätzt von den Bürgern der Stadt.
Und zuletzt zur Rechten des Bürgermeisters: Dr. Philippe Doucet, Oberarzt am Städtischen Krankenhaus von Saint Rochelle. Ein gut aussehender, schüchterner Mann, dessen volles schwarzes Haar und warmherziges, offenes Lächeln so manche Krankenschwester davon träumen ließ, die künftige Madame Doucet zu werden. Doch sie träumten alle vergeblich.
Jeder der vier Männer schob zehn Francs in die Tischmitte, und Tessier teilte die nächste Runde aus. Philippe Doucet lächelte beim Anblick seines Blatts, was keinem der anderen drei entging. Der Arzt zählte zu den Menschen, die ihre Gefühle nicht verbergen konnten, was auch erklärte, warum er in all den Jahren am meisten Geld verloren hatte. Wie viele Spieler konzentrierte er sich jedoch lieber darauf, kurzfristige Glückssträhnen zu genießen, statt über langfristige Verluste ins Grübeln zu geraten. Er warf eine Karte ab und bat um eine neue, die der Bankdirektor ihm rasch zuschob. Das Lächeln blieb auf Philippes Gesicht. Ein Bluff war es nicht. Ärzte bluffen nicht.
»Zwei«, sagte Max Lascelles, der links neben dem Arzt saß. Ohne jede Regung studierte der Bürgermeister sein neues Blatt.
»Drei«, erklärte André, der sich stets über seinen buschigen Schnauzer strich, wenn er eine gute Gewinnchance sah. Tessier teilte dem Schulleiter drei neue Karten zu. Dem genügte ein kurzer Blick darauf, dann legte er sein Blatt zugedeckt vor sich auf den Tisch. Wenn die Karten derart mies sind, nutzt jedes Bluffen nichts.
»Ich nehme ebenfalls drei«, sagte Claude Tessier. Wie beim Bürgermeister blieb seine Miene beim Studium des neuen Blatts vollkommen ausdruckslos.
»Gehen Sie mit, Herr Bürgermeister?«, fragte Tessier mit Blick auf sein Gegenüber.
Lascelles warf einen weiteren Zehn-Francs-Schein in den Pott, um zu signalisieren, dass er im Spiel blieb.
»Was ist mit Ihnen, Philippe?«, erkundigte sich Tessier.
Der Arzt wägte sein Blatt noch eine Weile sorgfältig ab und erklärte dann in selbstbewusstem Ton: »Ich halte Ihre zehn und erhöhe um weitere zehn.« Er deponierte seine letzten beiden schmuddeligen Scheine auf dem anwachsenden Stapel.
»Mir zu teuer«, entschied Parmentier mit einem kurzen Kopfschütteln.
»Mir auch«, schloss der Bankier sich an und legte seine Karten verdeckt auf den Tisch.
»Womit nur noch wir beide übrig wären, Philippe«, sagte der Bürgermeister und versuchte einzuschätzen, ob der Arzt sogar bereit sein könnte, noch mehr Geld zu riskieren.
Philippe starrte weiter gebannt auf seine Karten, während er wartete, was der Bürgermeister tun würde.
»Ich möchte sehen«, erklärte Lascelles und schnippte mit beiläufiger Handbewegung noch einmal fünfundzwanzig Francs in die Tischmitte.
Lächelnd deckte der Arzt sein Blatt auf. Zum Vorschein kamen ein Paar Asse, ein Paar Damen und eine Zehn. Sein Lächeln blieb unverändert.
Der Bürgermeister begann, seine Karten eine nach der anderen umzudrehen, und dehnte dabei die Qual genüsslich. Eine Neun, eine Sieben, eine Neun, eine Sieben. Philippe lächelte weiter, bis der Bürgermeister seine letzte Karte aufdeckte. Eine dritte Neun.
»Ein Full House«, verkündete Tessier. »Der Bürgermeister gewinnt.« Mit finsterer Miene verfolgte der Arzt, wie der Bürgermeister seinen Gewinn ohne jede sichtbare Gefühlsregung einsammelte.
»Sie sind ein verdammter Glückspilz, Max«, sagte Philippe.
Der Bürgermeister hätte Philippe gerne verständlich gemacht, dass beim Pokern nicht vorrangig das Glück den Ausschlag gab. In neun von zehn Fällen entschieden vielmehr statistische Wahrscheinlichkeit sowie die Fähigkeit zu bluffen über den Ausgang.
Der Schulleiter mischte neu und wollte gerade die nächste Runde austeilen, als sie hörten, wie ein Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Der Bürgermeister warf einen kurzen Blick auf seine goldene Taschenuhr. Wenige Minuten nach Mitternacht.
»Wer könnte uns denn um diese Uhrzeit noch stören wollen?«, bemerkte er.
Alle schauten zur Tür, verärgert darüber, in ihrem Spiel unterbrochen zu werden.
Als die Tür aufflog und der Gefängniskommandant eintrat, erhoben sich die vier sofort von ihren Plätzen. Oberst Müller marschierte bis zur Mitte der Zelle und stemmte die Hände in die Hüften. In seinem Gefolge erschienen Hauptmann Hoffmann und sein Adjutant Leutnant Dieter. Auch eine Art Full House. Alle drei Männer trugen die schwarze Uniform der SS. Das Einzige, was an ihnen strahlte, waren die gewichsten Stiefel.
»Heil Hitler!«, rief der Kommandant, aber keiner der Gefangenen reagierte. Gespannt warteten sie darauf, den Grund für diesen nächtlichen Besuch zu erfahren. Sie befürchteten das Schlimmste.
»Herr Bürgermeister, meine Herren, bitte nehmen Sie doch wieder Platz«, sagte der Kommandant, während Hauptmann Hoffmann eine Flasche Wein auf den Tisch stellte und sein Adjutant wie ein routinierter Sommelier jedem ein Glas vorsetzte.
Bis auf den Arzt, der seine Verblüffung erneut nicht verbergen konnte, behielt die Runde ihre ausdruckslosen Pokermienen auf.
»Wie Ihnen bekannt ist«, fuhr der Kommandant fort, »haben Sie Ihre Haftstrafe nun verbüßt und werden morgen früh um sechs entlassen.« Vier misstrauisch blickende Augenpaare ruhten unverwandt auf dem Kommandanten. »Hauptmann Hoffman wird Sie zum Bahnhof geleiten, wo Sie den Zug zurück nach Saint Rochelle nehmen. Zu Hause werden Sie sich dann wieder Ihren gewohnten Aufgaben als Mitglieder des Stadtrats widmen, und solange Sie dabei die nötige Zurückhaltung an den Tag legen, werden Sie auch künftig jede unliebsame Begegnung mit einer verirrten Kugel vermeiden können, da bin ich mir sicher.«
Die beiden rangniederen Offiziere lachten artig, während die vier Gefangenen stumm blieben.
»Dennoch ist es meine Pflicht«, nahm der Kommandant den Faden wieder auf, »Sie, meine Herren, daran zu erinnern, dass weiterhin Kriegsrecht herrscht und dass jeder, unabhängig von Rang oder gesellschaftlicher Position, diesem Kriegsrecht unterworfen ist. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«
»Ja, Herr Oberst«, versicherte der Bürgermeister im Namen aller.
»Ausgezeichnet«, sagte der Kommandant. »Dann überlasse ich Sie jetzt wieder Ihrem Spiel, und wir sehen uns alle in der Frühe.« Ohne ein weiteres Wort machte der Oberst auf dem Absatz kehrt und verließ, dicht gefolgt von Hauptmann Hoffmann und Leutnant Dieter, die Zelle.
Die vier Gefangenen blieben stehen, bis die schwere Tür zugeschlagen und verriegelt war.
»Haben Sie bemerkt«, begann der Bürgermeister, nachdem er seine massige Gestalt wieder auf den Stuhl gesenkt hatte, »dass der Kommandant uns zum ersten Mal mit ›meine Herren‹ angeredet hat?«
»Und Sie als ›Herr Bürgermeister‹«, ergänzte der Schulleiter und strich nervös über seinen Schnauzer. »Aber woher dieser plötzliche Sinneswandel?«
»Schätze, die Verwaltung der Stadt lief ohne uns nicht unbedingt reibungslos«, erklärte der Bürgermeister. »Vermutlich ist es dem Oberst nur zu recht, uns wieder in Saint Rochelle zu sehen. Ihm fehlen einfach die Leute, um sich auch noch um die Stadtverwaltung zu kümmern.«
»Da könnten Sie recht haben«, sagte Tessier. »Bloß bedeutet das noch lange nicht, dass wir mitspielen müssen.«
»Sehr richtig«, pflichtete der Bürgermeister bei. »Insbesondere, wenn der Oberst nicht länger alle Trümpfe in der Hand hält.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«, fragte Dr. Doucet.
»Die Flasche Wein etwa«, antwortete der Bürgermeister, begutachtete das Etikett und lächelte zum ersten Mal an diesem Tag. »Kein wirklich edler Tropfen, aber akzeptabel.« Er füllte sein eigenes Glas und reichte die Flasche hinüber zu Tessier.
»Nicht zu vergessen sein Auftreten«, fügte der Bankier hinzu. »Frei von der sonst üblichen bombastischen Rhetorik, die immer so klingt, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Herrenrasse auch das restliche Europa unterworfen hat.«
»Da hat Claude recht«, sagte Parmentier. »Ich merke immer sofort, wenn einer meiner Jungs zwar genau weiß, dass ihm eine Strafe bevorsteht, er aber trotzdem hofft, sich glimpflich aus der Affäre ziehen zu können.«
»Ich hege allerdings nicht die Absicht, irgendjemand glimpflich davonkommen zu lassen, wenn Frankreich seine Freiheit zurückgewonnen hat«, warf der Bürgermeister ein. »Sobald der Boche sich wieder dahin zurückgezogen hat, wo er hingehört, nämlich in die Grenzen seines Vaterlands, werde ich mir sämtliche Quislinge und Kollaborateure schnappen und meine eigene Form von Kriegsrecht ausüben.«
»Was schwebt Ihnen denn da vor, Herr Bürgermeister?«, erkundigte sich der Schulleiter.
»Den Schlampen, die sich jedem Uniformträger bereitwillig hingegeben haben, werden öffentlich die Köpfe geschoren. Und wer den Feind unterstützt hat, wird ohne langes Federlesen auf dem Marktplatz aufgeknüpft.«
»Ich hätte gedacht, dass Sie als Anwalt erst auf einer fairen, öffentlichen Verhandlung bestehen würden, bevor ein Urteil gefällt wird, Max«, bemerkte der Arzt. »Schließlich können wir gar nicht wissen, welchem Druck manche unserer Landsleute ausgesetzt waren. Als Arzt kann ich Ihnen versichern, dass bisweilen ein schmaler Grat zwischen Einwilligung und Nötigung liegt.«
»Da bin ich anderer Ansicht, Philippe«, erwiderte der Bürgermeister. »Aber Sie neigen ja generell dazu, im Zweifelsfall für alles und jeden Verständnis aufzubringen. Solch einen Luxus kann ich mir nicht leisten. Ich werde ausnahmslos jeden zur Rechenschaft ziehen, den ich für einen Verräter halte, und zugleich unsere tapferen Widerstandskämpfer ehren, die sich – ebenso wie wir – ohne Rücksicht auf die Kosten dem Feind entgegengestellt haben.«
Philippe senkte den Kopf.
»Ich kann nicht behaupten, mich ihnen stets entgegengestellt zu haben«, gestand der Schulleiter. »Und ich bin mir zudem darüber im Klaren, dass wir als Stadträte häufig bevorzugt behandelt worden sind.«
»Nur weil es unsere Pflicht war, im Interesse der Menschen, die uns gewählt haben, das reibungslose Funktionieren der städtischen Verwaltung zu gewährleisten.«
»Allerdings sollte man nicht vergessen, dass einige unserer Ratskollegen es für ehrenhafter hielten, von ihren Ämtern zurückzutreten, statt mit dem Feind zu kollaborieren.«
»Ich bin kein Kollaborateur, Philippe, bin nie einer gewesen«, widersprach der Bürgermeister und knallte die Faust auf den Tisch. »Im Gegenteil. Ich habe mich stets darum bemüht, ein Dorn in ihrem Fleisch zu sein, und ich kann mit Fug und Recht behaupten, bei verschiedenen Gelegenheiten Wirkungstreffer gelandet zu haben, und genau das werde ich auch künftig bei jeder sich bietenden Gelegenheit tun.«
»Gar nicht so einfach, wenn zugleich ständig die Hakenkreuzfahne auf dem Rathausdach weht«, sagte Tessier.
»Seien Sie versichert, Claude«, konterte der Bürgermeister, »dass ich dieses finstere Symbol höchstpersönlich noch im selben Moment in Brand stecken werde, in dem die Deutschen abmarschieren.«
»Was noch eine Weile dauern kann«, murmelte der Schulleiter.
»Schon möglich, aber kein Grund zu vergessen, dass wir Franzosen sind«, erklärte der Bürgermeister und hob sein Glas. »Vive la France!«
»Vive la France!«, riefen die vier Männer mit erhobenen Gläsern im Chor.
»Was werden Sie bei unserer Rückkehr als Erstes tun, André?«, erkundigte sich der Arzt, um die Stimmung etwas aufzulockern.
»Ein Bad nehmen«, antwortete der Schulleiter. Alle lachten. »Dann kehre ich zurück in meinen Klassenraum und werde versuchen, der nächsten Generation beizubringen, dass Krieg wenig bis gar keinen Sinn ergibt. Weder für Sieger noch für Besiegte. Und Sie, Philippe?«
»Meine Arbeit im Krankenhaus wieder aufnehmen, wo mich auf den Stationen vermutlich reihenweise junge Soldaten erwarten, alle vom Fronteinsatz auf unterschiedliche, jede Vorstellungskraft übersteigende Art und Weise gezeichnet. Und dann werden da noch die Alten und Kranken sein, die gehofft hatten, im Ruhestand die Früchte eines Arbeitslebens zu genießen, und die sich nun plötzlich von einer fremden Macht überrollt sehen.«
»Alles höchst löblich«, sagte Tessier. »Aber mich wird das nicht davon abhalten, auf kürzestem Weg nach Hause zu gehen und mit meiner Frau ins Bett zu steigen. Und ganz sicher werde ich keine Zeit damit vertrödeln, erst ein Bad zu nehmen.«
Die Runde brach in schallendes Gelächter aus.
»Genau, genau«, sagte der Schuldirektor glucksend. »Und wenn meine Frau ebenfalls zwanzig Jahre jünger wäre als ich, würde ich das auch so halten.«
»Doch im Unterschied zu Claude«, ergänzte der Bürgermeister, »hat André nicht die Hälfte aller jungen Frauen in Saint Rochelle entjungfert, indem er ihnen einen Überziehungskredit versprach.«
»Na, immerhin sind es bei mir junge Frauen, an denen ich interessiert bin«, erwiderte Tessier, sobald der Bürgermeister ausgelacht hatte.
»Ist denn wenigstens damit zu rechnen, dass Sie anschließend in die Bank zurückkehren und den korrekten Bestand all unserer Einlagen überprüfen?«, bohrte der Bürgermeister in deutlich schärferem Ton nach. »Ich weiß nämlich noch exakt, wie viel Geld am Tag unserer Verhaftung auf meinem Konto war.«
»Und jeder einzelne Franc wird noch da sein«, versicherte Tessier und sah dem Bürgermeister dabei direkt in die Augen.
»Zuzüglich der Zinsen von sechs Monaten?«
»Und was ist mit Ihnen, Max?«, fragte der Bankier jetzt mit derselben Schärfe. »Was werden Sie tun, nachdem Sie halb Saint Rochelle aufgeknüpft und der anderen Hälfte die Köpfe geschoren haben?«
»Ich werde mich wieder meiner Arbeit als Anwalt widmen«, erklärte der Bürgermeister, ohne auf den Seitenhieb seines Freundes einzugehen. Während er reihum nachschenkte, fügte er hinzu: »Und ich gehe davon aus, dass sich vor meiner Kanzlei eine lange Schlange derer bildet, die meiner Hilfe bedürfen.«
»Mich eingeschlossen«, bemerkte Philippe. »Denn ich bräuchte jemand zu meiner Verteidigung, wenn ich all meine Spielschulden nicht begleichen kann.« Seine Stimme war frei von jedem Selbstmitleid.
»Vielleicht sollten wir ja zum Abschluss eine versöhnliche Übereinkunft treffen«, schlug der Schulleiter vor. »Wir vergessen einfach die letzten sechs Monate und fangen wieder bei null an.«
»Ganz bestimmt nicht«, konterte der Bürgermeister sofort. »Wir alle haben zugestimmt, nach denselben Regeln zu spielen, die zuvor auch draußen galten. ›Spielschulden sind Ehrenschulden‹, haben Sie selbst noch wörtlich gesagt, André.«
»Aber das würde mich um all meine Ersparnisse bringen«, sagte Philippe mit einem Blick auf seine persönliche Bilanz in dem schwarzen Büchlein des Bankiers. Er verkniff sich den Kommentar, dass während ihrer Gefangenschaft schließlich jeder Abend ein Freitagabend gewesen war, was ihm zugleich zum ersten Mal vor Augen geführt hatte, welche Summen der Bürgermeister über die vergangenen Jahre hinweg eingestrichen haben musste.
»Jetzt ist die Zeit, die Gedanken auf Künftiges zu richten, nicht auf Vergangenes«, versuchte der Bürgermeister, das Thema zu wechseln. »Ich habe die Absicht, unmittelbar nach unserer Rückkehr eine Sitzung des Stadtrats von Saint Rochelle einzuberufen, und erwarte die Anwesenheit von jedem von Ihnen.«
»Und was wird der oberste Tagesordnungspunkt sein, Herr Bürgermeister?«, fragte Tessier.
»Wir müssen eine Resolution beschließen, in der wir Marschall Pétain und das Vichy-Regime aufs Schärfste verurteilen und klarstellen, dass wir in ihnen nur einen Haufen Quislinge sehen und dass wir künftig General de Gaulle als nächsten Präsidenten Frankreichs unterstützen werden.«
»Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Sie in unseren letzten Ratssitzungen eine solche Haltung zum Ausdruck gebracht hätten«, sagte Tessier, ohne sich die Mühe zu machen, seinen Sarkasmus zu verbergen.
»Niemand weiß so gut wie Sie, Claude, welchen Zwängen ich bei meinen Bemühungen ausgesetzt bin, den ganzen Laden am Laufen zu halten«, entgegnete der Bürgermeister. »Was nicht zuletzt auch zu meiner Verhaftung und dieser Gefängnisstrafe wegen Kollaboration mit dem Widerstand geführt hat.«
»Gemeinsam mit uns allen, die wir nichts anderes getan haben, als an einem privaten Treffen teilzunehmen, zu dem Sie uns ohne weitere Erklärung eingeladen haben«, bemerkte Tessier. »Nur für den Fall, dass Sie das vergessen haben sollten.«
»Ich habe angeboten, für alle von Ihnen die Haftstrafen abzusitzen, aber der Kommandant wollte nichts davon wissen.«
»Woran Sie uns seitdem pausenlos erinnern«, sagte der Arzt.
»Ich bedauere meine Entscheidung nicht«, erklärte der Bürgermeister stolz. »Und nach meiner Entlassung werde ich den Feind weiterhin traktieren, wann immer sich eine Gelegenheit bietet.«
»Was in der Vergangenheit nicht sonderlich oft der Fall gewesen ist, wenn ich mich recht erinnere«, sagte Tessier.
»Kinder, Kinder«, beschwichtigte der Schulleiter, dem bewusst war, dass sich durch die sechsmonatige gemeinsame Haftzeit ihre Beziehung untereinander nicht unbedingt verbessert hatte. »Vergessen wir doch bitte nicht, dass wir alle auf derselben Seite stehen.«
»Nicht alle Deutschen haben uns schlecht behandelt«, sagte der Arzt. »Ein oder zwei von ihnen sind mir richtig sympathisch geworden, wie ich zugeben muss. Etwa Hauptmann Hoffman.«
»Was sind Sie bloß für ein riesiger Einfaltspinsel, Philippe«, kanzelte ihn der Bürgermeister ab. »Hoffman würde uns alle aufknüpfen, ohne eine Sekunde ins Grübeln zu geraten, wenn es in seinen Augen zum Vorteil des Vaterlands wäre. Der Boche rutscht entweder vor dir auf den Knien, oder er will dir an die Gurgel, das darf man nie vergessen.«
»Und in Bezug auf unsere tapferen Widerstandskämpfer folgen diese Leute ganz sicher nicht dem Prinzip ›Aug um Aug‹«, fügte Tessier hinzu. »Für jeden toten Deutschen hängen die zur Vergeltung mit dem größten Vergnügen zwei von uns.«
»Stimmt«, sagte der Bürgermeister. »Und sollte es nach Kriegsende irgendeiner von denen nicht rechtzeitig zurück über die Grenze schaffen, werde ich als Erster die Guillotine schärfen. So wahr mir Gott helfe!«
Die Erwähnung des Allmächtigen ließ alle abrupt verstummen. Schulleiter und Arzt bekreuzigten sich.
»Na ja, zumindest gibt es für uns nicht viel zu beichten nach den sechs Monaten in diesem Loch«, durchbrach der Schulleiter schließlich die unheimliche Stille.
»Mit unserer Pokerrunde wäre Père Pierre allerdings gewiss nicht einverstanden«, sagte Philippe. »Hat nicht schon Jesus die Geldverleiher aus dem Tempel gejagt?«
»Erzählen Sie’s ihm einfach nicht«, erklärte der Bürgermeister und goss sich selbst den Rest aus der Flasche ein. »Von mir wird der Pfarrer es jedenfalls nicht erfahren.«
»Immer vorausgesetzt, Père Pierre wird bei unserer Rückkehr überhaupt noch da sein«, fügte Philippe hinzu. »Als ich ihn das letzte Mal im Krankenhaus traf, absolvierte er ein Pensum, das kein normaler Mensch lange durchhält. Ich bat ihn noch, kürzerzutreten, aber er hat mich nicht einmal einer Antwort gewürdigt.«
In der Ferne schlug die Kirchturmuhr eins.
»Noch eine letzte Runde vor dem Schlafen?«, schlug Tessier vor und reichte dem Bürgermeister das Kartenspiel.
»Ich bin draußen«, verkündete Philippe. »Sonst muss ich mich tatsächlich für bankrott erklären.«
»Vielleicht beginnt jetzt Ihre Glückssträhne«, lockte der Bürgermeister und begann, die Karten zu mischen. »Vielleicht gewinnen Sie mit dem nächsten Blatt alles zurück.«
»Das wird nicht geschehen, und das wissen Sie genau, Max. Daher ziehe ich mich für heute zurück. Auch wenn ich bestimmt nicht viel schlafen werde. Ich fühle mich wie ein Schuljunge am letzten Schultag, der es kaum erwarten kann, endlich nach Hause zu kommen.«
»Na, hoffentlich ist es an meiner Schule nicht ganz so schrecklich«, bemerkte der Schulleiter, nahm den Stapel vom Bürgermeister und begann auszuteilen.
Philippe stand auf, durchquerte langsam die Zelle zum Stockbett auf der gegenüberliegenden Seite und kletterte auf die obere Pritsche. Er wollte sich eben ausstrecken, als er ihn mitten im Raum stehen sah. Der Arzt starrte ihn erst kurz ungläubig an, bevor er sagte: »Guten Abend, Hochwürden. Ich habe Sie gar nicht eintreten hören.«
»Gott sei mit dir, mein Sohn«, erwiderte Père Pierre und machte mit der rechten Hand das Kreuzzeichen.
Der Schulleiter hielt im Austeilen der Karten inne, sobald er die vertraute Stimme vernahm. Alle drei Spieler drehten sich erstaunt zu dem Priester um.
Père Pierre stand direkt unter der Deckenlampe und wurde von deren Lichtkegel umhüllt. Er trug seine gewohnte schwarze Soutane mit breiter seidener Binde und ein weißes Kollar. Ein schlichtes silbernes Kreuz hing um seinen Hals, wie es das seit dem Tag seiner Priesterweihe tat.
Die vier Männer musterten den Priester weiter gespannt, brachten aber kein Wort heraus. Wie ein Kind, das man beim Plündern der Keksdose erwischt hat, versuchte Tessier, die Karten unter dem Tisch zu verstecken.
»Gottes Segen mit euch, meine Kinder«, sagte der Priester und machte erneut das Kreuzzeichen. »Ich hoffe, allen geht es gut. Ich fürchte allerdings, heute der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein.« Die vier erstarrten vor Schreck wie Kaninchen im Scheinwerferlicht. Jeder von ihnen nahm an, dass sie am Morgen doch nicht entlassen würden.
»Vor wenigen Stunden«, fuhr der Priester fort, »haben örtliche Widerstandskämpfer einen Bombenanschlag auf einen Zug verübt, der auf dem Weg nach Saint Rochelle war. Drei deutsche Offiziere wurden getötet, zusammen mit drei unserer Landsleute.« Er zögerte einen Moment, bevor er hinzufügte: »Es dürfte Sie daher nicht überraschen, meine Herren, dass das deutsche Oberkommando Vergeltung fordert.«
»Aber es sind doch schon drei Franzosen umgekommen«, warf Tessier ein. »Genügt das nicht?«
»Ich fürchte nicht«, antwortete der Priester. »Wie in der Vergangenheit verlangen die Deutschen, dass zwei Franzosen für jeden getöteten Deutschen sterben.«
»Aber was hat das mit uns zu tun?«, wollte der Bürgermeister wissen. »Wir sind hier eingesperrt gewesen, als der Anschlag verübt wurde, wie sollten wir also etwas damit zu tun haben?«
»Auf diesen Punkt habe ich den Kommandanten auch hingewiesen, doch er hielt unerbittlich daran fest, dass es nur dann ein deutliches Zeichen an jeden Franzosen senden würde, der Pläne für eine ähnliche Tat im Sinn hat, wenn an drei führenden Amtsträgern der Stadt ein Exempel statuiert wird. Seien Sie versichert, dass ihn von dieser Überzeugung kein Bitten und Flehen um Gnade für Sie abbringen konnte. Laut Verfügung von Oberst Müller werden drei von Ihnen morgen früh um sechs auf dem Platz vor dem Rathaus gehängt.«
Die vier Männer begannen, aufgeregt durcheinanderzureden, und verstummten erst, als der Bürgermeister die Hand hob. »Wir wollen nur eins wissen, Hochwürden. Wie werden die drei ausgewählt?«, fragte er, und Schweißperlen traten ihm auf die Stirn, obwohl es in der Zelle eiskalt war.
»Oberst Müller hat dazu drei Vorschläge gemacht, überlässt die endgültige Entscheidung über das Verfahren jedoch Ihnen.«
»Wie überaus verständnisvoll von ihm«, bemerkte Tessier. »Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was er sich ausgedacht hat.«
»Die einfachste Möglichkeit bestünde seiner Meinung nach darin, Streichhölzer zu ziehen.«
»Ich verlasse mich ungern auf mein Glück allein«, sagte der Bürgermeister. »Und die Alternativen?«
»Eine letzte Runde Poker, bei welcher der Einsatz, wie der Oberst es formulierte, nicht höher sein könnte.«
»In die Variante würde ich doch liebend gerne einwilligen«, sagte der Bürgermeister.
»Kann ich mir denken, Max«, kommentierte Claude nüchtern. »Schließlich hätten Sie da die besten Chancen. Worin besteht die dritte Möglichkeit?«
»Ich zögere ein wenig, sie zu nennen«, sagte der Priester. »Es ist der Weg, der mir am meisten Unbehagen bereitet.«
»Erzählen Sie schon, Hochwürden«, drängte der Bürgermeister, der seine wahren Gefühle nicht länger zu verbergen vermochte.
»Jeder von Ihnen erklärt sich bereit, eine letzte Beichte abzulegen, bevor er seinem Schöpfer gegenübertritt. Mir obliegt dann die wenig beneidenswerte Aufgabe zu entscheiden, wer von Ihnen verschont wird.«
»Ich bin auf jeden Fall für dieses Verfahren«, rief der Schulleiter sofort.
»Sollten Sie tatsächlich diesen Weg wählen, gäbe es da jedoch eine Bedingung, auf der ich bestehen würde«, warnte der Priester.
»Und die wäre?«, fragte der Bürgermeister.
»Jeder von Ihnen müsste die schlimmste Sünde beichten, die er je begangen hat. Und Sie sollten dabei besser bedenken, dass ich Ihnen seit Jahren die Beichte abgenommen habe und es kaum etwas gibt, was ich nicht von Ihnen weiß. Vor allem aber bin ich zudem in die Beichtgeständnisse von über tausend meiner Gemeindemitglieder eingeweiht, von denen einige es für ihre heilige Pflicht hielten, mir ihre tiefsten Geheimnisse zu offenbaren. Darunter auch solche, die auf hier Anwesende kein sonderlich gutes Licht werfen. So war etwa in der Beichte eines absolut zuverlässigen Kirchenmitglieds die Rede davon, dass einer von Ihnen ein Kollaborateur ist. Daher meine ausdrückliche Warnung: Sollte jemand lügen, werde ich nicht zögern, seinen Namen von der Liste zu streichen. Also überlegen Sie noch einmal gut: Welche der drei Optionen bevorzugen Sie?«
»Ich bin mit Streichholzziehen vollkommen zufrieden«, antwortete Tessier.
»Ich wähle eine letzte Runde Poker«, sagte der Bürgermeister. »Möge der liebe Gott über die Verteilung der Karten entscheiden.«
»Ich bin bereit, die schlimmste Sünde zu beichten, die ich je begangen habe«, sagte der Schulleiter. »Und dafür die Konsequenzen zu tragen.«
Alle Blicke wandten sich Philippe zu, der noch unschlüssig erschien.
»Wenn Sie sich für eine letzte Runde Poker entscheiden, werde ich Ihnen im Gegenzug sämtliche Schulden erlassen«, versprach der Bürgermeister.
»Hören Sie nicht auf ihn, Philippe«, mahnte Tessier. »Folgen Sie meinem Rat und lassen Sie uns Streichhölzer ziehen. Auf diese Weise haben Sie zumindest eine Chance.«
»Mag sein, Claude, aber bei meinem Glück würde auch Streichholzziehen vermutlich nichts am Ausgang ändern. Nein, ich stimme mit meinem Freund André überein. Ich werde die schlimmste Sünde beichten, die ich je begangen habe, und es dann Ihnen, Hochwürden, überlassen, ein abschließendes Urteil zu fällen.«
»Damit wäre das geklärt«, sagte Tessier und rutschte dabei unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. »Wie geht es jetzt weiter?«
»Jetzt müssen Sie noch entscheiden, wer von Ihnen den Anfang macht«, erklärte Père Pierre.
»Lassen wir doch die Karten entscheiden«, schlug der Bürgermeister vor und verteilte sofort ringsum eine aufgedeckte Karte. Als er seine Herzdame sah, fügte er hinzu: »Wer die niedrigste hat, fängt an.«
Der Schulleiter erhob sich und ging zum Priester.
André Parmentier, Schuldirektor
Der Priester segnete den vor ihm knienden Schulleiter.
»Gesegnet seien die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Möge Gott, der Vater aller Barmherzigkeit, dir beim Ablegen dieser letzten Beichte zur Seite stehen.« Père Pierre lächelte dem Mann, dessen Wirken er seit vielen Jahren bewunderte, ermutigend zu. Mit Freude und Zufriedenheit hatte er Andrés Lebensweg verfolgt, den man geradezu mustergültig nennen konnte. In jungen Jahren war Parmentier selbst in jenem Collège de Garçons von Saint Rochelle zur Schule gegangen, in dem sich jetzt in der Position des Schulleiters sein Lebenskreis schloss. Nur sein Studium an der Sorbonne in Paris und ein Sabbatjahr als Aushilfslehrer in Algerien hatten seine Zeit dort unterbrochen.
Nach seiner Rückkehr hatte André in Saint Rochelle eine Stelle als Geschichtslehrer angetreten, und der Rest ist Geschichte, wie es dann immer heißt. Zügig hatte sich Beförderung an Beförderung gereiht, und als ihm der Verwaltungsrat das Amt des Schuldirektors anbot, hatte dies niemanden mehr groß überrascht.
Ein Jahrzehnt stand er inzwischen bereits dem Collège vor, und viele seiner Kollegen wunderten sich darüber, dass er Saint Rochelle nicht längst für irgendeine vornehmere Adresse verlassen hatte, da – wie allgemein bekannt war – in den vergangenen Jahren mehrere prominente Schulen bei ihm angeklopft hatten. Aber ganz gleich, wie verführerisch die Angebote auch waren, stets hatte er abgelehnt. Manch einer vermutete dahinter familiäre Probleme, andere dagegen akzeptierten die Begründung, dass er in Saint Rochelle eben seine Berufung gefunden habe und am liebsten einfach hierbleiben wolle.
Bei Kriegsausbruch zählte das Collège Saint Rochelle zu den angesehensten Schulen in Frankreich und lockte engagierte Nachwuchslehrer aus dem ganzen Land an. Kürzlich hatte der Verwaltungsrat sich erstmals mit der Frage beschäftigt, wer denn diesem hochgeschätzten Schuldirektor folgen könnte, wenn er in zwei Jahren pensioniert würde.
Als die Deutschen in Saint Rochelle einmarschierten, hatte sich André den neuen Herausforderungen mit derselben standfesten Entschlossenheit gestellt, die er auch in der Vergangenheit stets bewiesen hatte. In seinen Augen war die Besetzung durch eine ausländische Macht eine Unannehmlichkeit, die keinesfalls als Ausrede missbraucht werden sollte, die selbst gesteckten Ansprüche zu senken.
André Parmentier hatte nie geheiratet. Jeden seiner Schützlinge behandelte er, als wäre er sein Erstgeborener. Es überraschte ihn nicht, dass viele von denen, die in der Schule nicht reüssiert hatten, auf dem Schlachtfeld Herausragendes leisteten. Schließlich war das nicht der erste brutale und sinnlose Krieg, mit dem er sich zu arrangieren hatte.
Leider waren viele seiner Schützlinge dazu verdammt, im Schlachtgetümmel zu sterben, und um jeden von ihnen weinte er wie ein trauernder Vater. Irgendwie gelang es André in dieser Zeit, den Mut nicht zu verlieren. Irgendwann würde auch dieser barbarische Krieg wie der vorangegangene gewiss ein Ende finden. Und wenn es so weit war, würde er Gelegenheit haben, die kommende Generation zu lehren, nicht die Fehler ihrer Väter und Vorväter zu wiederholen. Aber das hatte gegolten, bevor eine Verfügung der Deutschen befahl, dass drei von ihnen am nächsten Morgen um sechs gehängt werden sollten. Und es brauchte keinen Mathematiklehrer, um zu wissen, wie schlecht die Chancen für ihn standen.
»Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt und erflehe Deine Vergebung«, begann der Schulleiter. »Meine letzte Beiche habe ich unmittelbar vor meiner Verhaftung und Verurteilung abgelegt.«
Père Pierre fiel schon allein die Vorstellung schwer, dass André jemals in seinem Leben etwas Verwerfliches getan hatte.
»Deine Reue findet Erhörung, mein Sohn, nicht zuletzt, da mir die wertvolle Arbeit, die du in unserer Stadt seit vielen Jahren leistest, wohlvertraut ist«, erwiderte der Priester. »Doch weil dies die letzte Beichte ist, musst du die schwerwiegendste Missetat bekennen, die du jemals begangen hast, damit ich urteilen kann, ob dein Leben verschont bleibt oder ob du zu den dreien zählst, deren Tod der Kommandant verfügt hat.«
»Wenn Sie meine Beichte gehört haben, Hochwürden, wird es Ihnen unmöglich sein, mich zu verschonen, denn meine Verfehlung ist eine Todsünde, und ich habe schon lange alle Hoffnung aufgegeben, irgendwann ins himmlische Königreich einzuziehen.«
»Dass du der Kollaborateur bist, fällt mir schwer zu glauben, mein Sohn«, sagte Père Pierre.
»Weit schlimmer, Hochwürden. Ich habe in der Vergangenheit schon häufig mit dem Gedanken gespielt, Ihnen mein Geheimnis anzuvertrauen, aber wie ein Feigling auf dem Schlachtfeld habe auch ich mich beim ersten Klang von Geschützfeuer stets gedrückt. Doch nun bin ich froh um diese letzte Chance auf Erlösung, bevor ich meinem Schöpfer gegenübertreten muss. Seien Sie versichert, dass der Tod für mich, wie es bei Paulus heißt, keinen Stachel hat und das Grab kein Sieg ist, dem ich mich unterwerfen muss.« Der Schulleiter ließ den Kopf hängen und weinte hemmungslos.
Der Priester konnte zwar nicht glauben, was er da hörte, unterließ es aber, ihn zu unterbrechen.
»Wie Sie wissen, Hochwürden«, fuhr der Schuldirektor fort, »habe ich einen jüngeren Bruder.«
»Guillaume«, sagte der Priester. »Den du seit vielen Jahren brüderlich unterstützt, trotz der tragischen Verfehlung, die dieser in seiner Jugend beging und für die er so bitter bezahlte.«
»Es war nicht seine Verfehlung, Hochwürden, sondern meine. Und ich hätte dafür so bitter bezahlen sollen.«
»Was erzählst du da, mein Sohn? Jeder weiß, dass dein jüngerer Bruder zu Recht ins Gefängnis geschickt wurde für die schreckliche Tat, die er begangen hatte.«
»Ich bin es gewesen, der diese schreckliche Tat beging, Hochwürden. Und ich hätte ins Gefängnis gehen sollen.«
»Ich verstehe nicht.«
»Wie sollten Sie auch, wenn Sie nur das Offensichtliche sehen konnten und keinen Anlass hatten, tiefer nachzugraben.«
»Aber du warst nicht einmal mit deinem Bruder zusammen, als er das junge Mädchen tötete.«
»Doch, das war ich«, sagte André. »Erlauben Sie mir, das zu erklären. Mein Bruder und ich waren an diesem Abend ausgegangen, um seinen einundzwanzigsten Geburtstag zu feiern, und wir hatten beide etwas zu viel getrunken. Als man uns aus der letzten Kneipe hinauswarf, war Guillaume so besinnungslos volltrunken, dass ich ihn mit seinem Wagen nach Hause fahren musste.«
»Aber laut Polizei hat er doch hinter dem Steuer gesessen.«
»Ich bin es gewesen, der die Kontrolle über den Wagen verlor, auf den Bürgersteig geriet und das Mädchen anfuhr. Jenes Mädchen, das erst noch lebte, wie ich später erfuhr. Wäre sie womöglich heute noch am Leben, wenn ich nicht die Flucht ergriffen, sondern sofort Hilfe gerufen hätte? Doch ich tat es nicht. Stattdessen raste ich in Panik davon und steuerte den Wagen unweit von Guillaumes Wohnung vorsätzlich gegen einen Baum. Als die Polizei dann eintraf, saß mein Bruder hinter dem Steuer und niemand sonst im Auto.«
»Aber genau das haben Sie doch tatsächlich vorgefunden«, sagte Père Pierre.
»Die Polizei hat nur vorgefunden, was ich sie finden lassen wollte. Andererseits hatten sie auch nie einen Grund, etwas anderes zu vermuten. Ich bin aus dem Wagen gestiegen, habe meinen Bruder auf den Fahrersitz gezerrt und ihn so zurückgelassen. Sein Kopf lag auf dem Lenkrad, und die Hupe dröhnte so laut, dass alle es hören konnten.«
Der Priester bekreuzigte sich.
»Ich bin rasch in meine Wohnung am anderen Ende der Stadt gelaufen, wobei ich jede Deckung nutzte und darauf achtete, von niemandem gesehen zu werden. Zu der frühen Uhrzeit waren allerdings auch nur wenige Menschen unterwegs. Als ich endlich an meinem Haus war, bin ich durch die Hintertür rein, leise die Treppe hoch und schnell ins Bett. Schlafen konnte ich nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich seitdem keine einzige Nacht mehr gut schlafen können.«
Der Schulleiter stützte den Kopf in die Hände und blieb eine Weile stumm, bevor er fortfuhr: »Ich wartete die ganze Nacht darauf, dass die Polizei an meine Tür klopfen und mich verhaften und einsperren würde, aber sie kamen nicht. Da wusste ich, dass ich unentdeckt geblieben war. Sie gaben sich damit zufrieden, Guillaume hinter dem Steuer gefunden zu haben, nur wenige Hundert Meter von seiner Adresse entfernt. Außerdem bestätigten am nächsten Tag mehrere Zeugen, dass sie ihn in der betreffenden Nacht gesehen hatten und dass er in einem vollkommen fahruntüchtigen Zustand gewesen war.«
»Aber hat die Polizei dich nicht irgendwann dazu befragt?«
»Doch, sie sind gleich am nächsten Tag in der Schule vorbeigekommen.«
»Und da hättest du ihnen sagen können, dass du den Wagen gesteuert hast, nicht dein Bruder.«
»Ich habe jedoch nur ausgesagt, dass ich zu viel getrunken hatte und zu Fuß nach Hause bin. Meinen Bruder hätte ich da das letzte Mal gesehen.«
»Und das hat man geglaubt?«
»Das haben auch Sie geglaubt, Hochwürden.«
Der Priester senkte den Kopf.
»Die Lokalzeitung hat die Sache damals groß aufgemacht«, erzählte der Schulleiter weiter. »Viele Fotos von dieser jungen Frau. Ihr ganzes Leben lag noch vor ihr – die Schlagzeile ist mir bis heute ins Gedächtnis gebrannt. Ein zertrümmerter Unfallwagen und ein junger Mann, der um zwei Uhr morgens vom Fahrersitz gezogen wird. Ich wurde lediglich kurz erwähnt als der arme, bedauernswerte Bruder, der am örtlichen Collège unterrichtet und dort ein allseits beliebter und geschätzter junger Kollege ist. Ich habe sogar die Beerdigung der jungen Frau besucht und damit mein Verbrechen nur noch verschlimmert. Als dann die Gerichtsverhandlung begann, stand der Schuldspruch schon lange vor der Urteilsverkündung fest.«
»Aber die Verhandlung hat erst Monate später stattgefunden. Du hättest den Geschworenen also noch die Wahrheit sagen können.«
»Ich habe ihnen nur gesagt, was sie in den Zeitungsberichten gelesen hatten«, sagte André, den Blick zu Boden gerichtet.
»Und dein Bruder wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt?«
»Eigentlich erhielt er lebenslänglich, Hochwürden, denn der einzige Job, den er nach seiner Entlassung noch bekam, war der als Schulhausmeister, weil ich dabei meine Beziehungen ein wenig spielen lassen konnte. Kaum jemand weiß heute noch, dass Guillaume zum Zeitpunkt des Unfalls eine Ausbildung zum Architekten absolvierte und selbst vor einer vielversprechenden Karriere stand, die ich ihm zerstörte. Aber nun wird mir eine letzte Gelegenheit gewährt, die Lüge zu korrigieren.« André hob den Kopf und blickte dem Priester zum ersten Mal direkt in die Augen. »Bitte versprechen Sie mir, Hochwürden, dass Sie nach meiner Hinrichtung morgen früh allen, die an meiner Beerdigung teilnehmen, erzählen, was in dieser Nacht wirklich geschehen ist, damit mein Bruder wenigstens den Rest seiner Tage seinen Seelenfrieden hat und sich nicht weiter für ein Verbrechen schuldig fühlt, das er überhaupt nicht begangen hat.«
»Vielleicht wird der Herr ja auch entscheiden, dich zu verschonen, mein Sohn«, antwortete der Priester. »Dann kannst du selbst der Welt die Wahrheit erzählen und am eigenen Leib erfahren, welche Qual dein Bruder in all den Jahren hat erleiden müssen.«
»Der Tod wäre mir lieber.«
»Sollten wir diese Entscheidung nicht besser dem Allmächtigen überlassen?« Mit diesen Worten beugte sich der Priester zu André und half ihm, wieder aufzustehen. Mit gesenktem Kopf wandte der Schulleiter sich ab und ging langsam davon.
»Was um alles in der Welt kann er denn Père Pierre bloß gebeichtet haben, das wir nicht schon von ihm wissen?«, brummte der Bürgermeister vor sich hin, als er sah, wie André auf seiner Pritsche zusammensackte und das Gesicht zur Wand drehte wie ein schwer verletzter Soldat, dem klar ist, dass ihn nichts mehr retten kann.
Der Priester richtete seine Aufmerksamkeit auf das Trio, das am Tisch saß.
»Wer ist der Nächste?«
Der Bürgermeister verteilte drei Karten.
Claude Tessier, Bankdirektor
»Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt«, begann Claude. »Ich erbitte Gottes Verständnis und Gottes Vergebung.«
»Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich.« Père Pierre konnte sich nicht erinnern, wann Tessier zuletzt die Messe oder gar die Beichte besucht hatte. Dennoch gab es kaum etwas, das er nicht über diesen Mann wusste. Nur ein Geheimnis gab es, das dringend nach Aufklärung verlangte, und der Priester hoffte, dass die drohende Gefahr ewiger Verdammnis den Bankier dazu veranlassen könnte, endlich die Wahrheit zu gestehen.
Claude Tessier war zum Direktor der familieneigenen Privatbank aufgestiegen, als sein Vater 1940 verstarb, nur wenige Tage bevor deutsche Truppen die Champs-Élysées hinuntermarschierten. Lucien Tessier hatte unter seinen Mitbürgern stets allgemeine Anerkennung und hohes Ansehen genossen. Tessiers mochte nicht die größte Bank der Stadt sein, aber man vertraute Lucien, und seine Kunden hegten niemals Zweifel, dass ihre Ersparnisse bei ihm in guten Händen waren. Von seinem Sohn ließ sich dasselbe nicht unbedingt behaupten.
Seiner Frau gegenüber hatte der Senior sogar offen infrage gestellt, ob Claude überhaupt der richtige Nachfolger auf dem Posten des Direktors sei. »Inkompetent und vermessen« lauteten die Worte, die er auf dem Totenbett murmelte, und dann hatte er dem Priester zugeraunt, dass er sich um das Auskommen seiner Witwe sorge, wenn er nicht mehr da sei und alle finanziellen Transaktionen überwache.
Verschlimmert wurden die Zweifel Lucien Tessiers durch die Tatsache, dass er eine Tochter besaß, die nicht nur intelligenter war als Claude, sondern zudem in einem Maße grundehrlich, das bisweilen an Peinlichkeit grenzte. Zugleich war dem alten Mann bewusst, dass man in Saint Rochelle noch nicht bereit war, eine Frau an der Spitze eines Geldinstituts zu akzeptieren.
Die einzige örtliche Konkurrenz der Tessiers bildeten die Bouchards, deren gut geführtem Bankhaus der alte Tessier stets größte Wertschätzung entgegenbrachte. Dessen Direktor Jacques Bouchard besaß ebenfalls einen Sohn, Thomas, der seine Befähigung, einst die Nachfolge seines Vaters anzutreten, schon wiederholt unter Beweis gestellt hatte.
Die Leben von Claude Tessier und Thomas Bouchard waren in vielerlei Hinsicht parallel verlaufen, wenn auch zugegebenermaßen in unterschiedlichem Tempo auf den vorgezeichneten Bahnen. Gemeinsam auf der Schule, dann Wehrdienst und Studium, bevor beide nach Saint Rochelle zurückkehrten, um ins Bankgeschäft einzusteigen.
Der Vater von Thomas Bouchard hatte die Idee gehabt – und rasch bereut –, die beiden Jungs ihre Banklehre im jeweiligen Konkurrenzinstitut absolvieren zu lassen. Claudes Vater hatte dem Vorschlag nur allzu gerne zugestimmt und erwartungsgemäß damit das bessere Los gezogen. Während Jacques Bouchard sich nach zwei Jahren nur inständig wünschte, den jungen Claude nie wieder zu Gesicht zu bekommen, hätte Lucien den jungen Thomas am liebsten direkt in den Vorstand seines Bankhauses aufgenommen. An ihrem Verhältnis zueinander änderte sich auch wenig, als die beiden Söhne später die jeweiligen Direktorenposten von ihren Vätern erbten. Erst mit den Panzern der deutschen Besatzer auf dem Marktplatz kam der Wandel.
»Möge Gott, der Vater aller Barmherzigkeit, dir zur Seite stehen, wenn du deine letzte Beichte ablegst«, sagte der Priester und segnete Tessier.
»Noch hoffe ich, Hochwürden, dass es nicht meine letzte Beichte ist«, gestand Claude.
»Dann wollen wir in deinem Sinne einmal hoffen, dass du damit recht behältst, mein Sohn. Dennoch könnte dies deine letzte Gelegenheit darstellen, den schwersten Fehltritt einzugestehen, der dir je unterlaufen ist.«





























