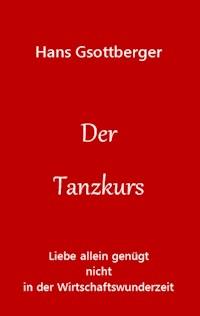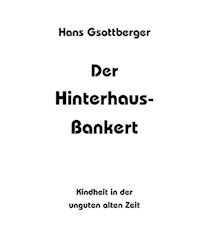
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines Durchschschnittsmenschen. Ohne besondere Fähigkeiten in die schlechteste aller Zeiten hineingeboren. Vorfahren und nächste Verwandtschaft werden kurz vorgestellt. Wie schlägt sich ein Linkshänder durch die von Rechtshändern bestimmte Schule. Wie wird der Krieg mit seinen 55 Luftangriffen auf München überstanden. Das Leben nach dem Krieg und die Zeit des Hungers, die den Autor beinahe das Leben kosteten. Mit 8 Jahren kurz vor dem Verhungern in Erholung geschickt, 6 Kilo zugenommen und immer noch unterernährt. Er lernt auch die andere Seite der Besatzer kennen. Soldaten, egal in welcher Uniform, sind keine Gutmenschen. Freiheit in der Münchner Vorstadt nach dem Schulunterricht. Der Religionsunterricht mit den Schreckensbildern des Fegefeuers und der Hölle. Der Knabe will Märtyrer werden, um dem Fegefeuer auszukommen. Wilde Spiele, Nebenerwerbstätigkeit auf dem Schuttberg, um ein bisschen eigenes Geld zu haben. Die Währungsreform, wie sie bei kleinen Leuten wirklich war. Trotz alledem kein trauriges Buch, weder Held noch Opfer. Die Sorge: wie geht es weiter, finde ich eine Lehrstelle und wie! Im Ganzen ein Zeitdokument, nichts beschönigt und nicht verschlechtert, als es wirklich war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Warum schreibst Du eigentlich dieses Buch, es wird doch wahrscheinlich nie verlegt werden! Richtig, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich keinen Verleger finden werde. Wer will schon eine Geschichte lesen, die von einem ganz einfachen und ganz durchschnittlichen Menschen handelt, der nichts besonders gut kann und am Ende der Geschichte nicht als Sieger, als Held hervor geht? Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich mich jahrelang mit meiner Kindheit immer nur teilweise auseinandersetzen konnte. Jetzt habe ich endlich die Zeit, die gesamte Kindheit mit allem, was mir davon in Erinnerung geblieben ist nochmal zu beleuchten, nochmal zu durchdenken. Die Kindheit, das sind in meinem Bewusstsein nicht 14 Jahre, das ist die erste Hälfte meines Lebens. Ich finde das Leben verläuft nicht linear, sondern logarithmisch, die Jahre werden immer kürzer, je länger man lebt. Die Kindheit bleibt im Gedächtnis, in der Seele. Die Kindheit bestimmt, was aus uns wird und wie wir das werden, was wir später sind.
Ich habe mich sehr bemüht, mich an die Wahrheit zu halten. Dass ich sie immer genau getroffen habe, will ich nicht behaupten, denn die Erinnerung ist ein Betrüger, je nach Erlebnis macht es die Ereignisse besser oder schlechter als sie wirklich waren. Ich kann nur sagen: Jawohl genauso habe ich es empfunden, ich habe Gewissenserforschung betrieben und bin zu den Ergebnissen gekommen, die ich niedergeschrieben habe. Grundsätzlich muss man ja allen Autobiografien gegenüber misstrauisch sein. Denn der Normalfall ist, das der Autobiograf sich selbst so darstellt, wie er möchte, dass er gesehen wird. Das habe ich nach bestem Wissen und Gewissen vermieden.
Was ist das Besondere an meiner Geschichte? Es gab doch Hunderttausende von Menschen, die schlimmeres erlebt haben und besseres daraus gemacht haben als ich. Genau darum ging es mir. Das Schicksal eines Durchschnittsmenschen aufzuschreiben, ich wollte keinen Helden aus mir machen und auch kein Opfer.
Der Durchschnittsmensch zählt heute nichts mehr. In den Schulen werden die Hochbegabten gefördert, der Durchschnitt fällt hinten runter.
Die Schwachen haben überhaupt keine Chance. Unsere politisch Mächtigen, also die Leute, die sich für die Elite halten, plädieren dafür Eliten zu fördern. Wir brauchen in allen Bereichen des täglichen Lebens Genies. Wir brauchen Olympiasieger, nicht Breitensport, wir brauchen Nobelpreisträger, keine guten Wissenschaftler, keine guten Handwerker sondern hervorragende. An diesem Wahnsinn krankt unsere Gesellschaft. Wir wollen Idole, die wir bewundern können, denn dann brauchen wir selbst nichts tun, die Idole machen das für uns. Gehen Sie zu den Sportveranstaltungen, den modernen Gladiatoren-Kämpfen, gehen Sie in die Konzerte und Musicals, dann können Sie Begeisterung und Identifikation hautnah erleben. Die Menschen erfreuen sich an den Höchstleistungen anderer und fühlen sich, als hätten sie selbst diese Leistungen vollbracht. Alle Geschichten in den erfolgreichen Büchern unserer Gegenwart handeln entweder von ganz erfolgreichen, hochbegabten Multitalenten, die alles richtig machen, oder sie handeln von ganz großen Schurken, die auch wiederum in irgendeiner Weise genial sein müssen. Der Leser will sich gewissermaßen mit seinen Protagonisten identifizieren, oder ihn mit voller Überzeugung und vollem Recht hassen. Er will davon träumen, genauso erfolgreich zu sein. Mit mir Durchschnittsmenschen will sich niemand identifizieren. Das ist auch gar nicht nötig, ich möchte nur zeigen: so war es.
Es ist nicht meine Schuld, dass ich in schlechten Zeiten aufgewachsen bin, es ist auch nicht meine Schuld, dass ich diesem Schicksal nicht entkommen konnte. Ich hatte nur die Begabungen, welche mir die Natur mitgegeben hat, mehr war nicht, wer zur Ärmelweste geboren ist, wird es nie zum Frack bringen, sagt ein altes Sprichwort. Das stimmt!
Ich habe diese Geschichten auch aufgeschrieben um meinen Enkelkindern zu zeigen: seht her, so war die Zeit damals und nicht so, wie sie euch von den Medien vorgegaukelt wird. Es gab keine goldenen 50er Jahre. Es gab zu keiner Zeit goldene Zeiten für die einfachen Menschen. In meiner Kindheit war immer die Rede von der guten alten Zeit. Mein Großvater wurde 1875 geboren und sagte mir, eine „gute alte Zeit“ habe ich nicht erlebt, es gab nur schlechte Zeiten, die manchmal auch ein bisschen weniger schlecht waren.
Die Jahre von 1939 bis 1953 waren ganz gewiss keine guten Jahre. Vieles, was sich damals abspielte wurde später verklärt und nicht der Wahrheit entsprechend dargestellt. Manche schlimmen Ereignisse, wie das Elend der Flüchtlinge und Vertriebenen wurde und wird immer noch klein geredet. Dafür wird der Lastenausgleich, jene lächerlichen 18,2%, die die Flüchtlinge und Vertriebenen für den Verlust von Hab und Gut, den Verlust der Heimat, den Verlust des Ansehens, den Verlust eines Lebens in geregelten Bahnen erhielten, ins unermessliche überhöht.
Es wird auch immer wieder in den Schulen gelehrt, dass die Währungsreform 1948 und die Gründung der Bundesrepublik 1949 alle Probleme gelöst hätten. Das war ganz bestimmt nicht der Fall.
Am meisten wurde und wird immer noch gelogen, wenn man nach der NS-Vergangenheit der Politiker und der Industriellen forscht.
Adenauer hatte keine Skrupel den Kommentator der NS-Rassengesetze Globke zu seinem Kanzleramtschef zu machen. Er hatte überhaupt keine Berührungsängste mit Nationalsozialisten, dagegen waren Kommunisten für ihn der Ausgeburt der Hölle, die man bekämpfen muss, mit allen Mitteln, mit aller Gewalt. Mit jedem Jahr nach 1946 kamen die alten Nazis mehr und mehr in ihre alten Positionen, auch und besonders in der Justiz, sogar in das Bundesverfassungsgericht. In der Wirtschaft sowieso. Sie eroberten und verteidigen ihre Macht und keine Demokratie kann sie aufhalten.
In dieser Geschichte spielen auch andere Menschen eine Rolle. Die Familie, die Lehrer, Nachbarn, Freunde. Nicht jeden davon kann ich, wenn ich mich um die Wahrheit bemühe, als tadellose Persönlichkeit darstellen. Deshalb habe ich manche Namen verändert. Die wirklichen Personen bekamen bei mir aber nur falsche Namen und nicht falsche Handlungen. Vielleicht bekommen handelnde Personen dieses Buch in die Hand und erkennen sich wieder. Außenstehende können nicht herausfinden, wer der oder diejenigen waren. Einige Male nenne ich aber auch bewusst Personen mit ihrem richtigen Namen, weil sie in meinen Augen absolut untadelige Menschen waren, deren Andenken ich gerne bewahren möchte.
Eigentlich bin ich ja kein Bankert, denn bei meiner Geburt habe ich eine Mutter, welche mit meinem Vater ganz richtig verheiratet war vorgefunden, und das nicht nur wegen mir. Aber gerade meine Mutter, der es ja eigentlich zur Unehre gereichen würde, einen Bankert zu haben, be- zeichnete mich immer, wenn ich etwas tat, das nicht ihren Gefallen fand, und das kommt halt im Laufe eines Bubenlebens öfter ein Mal vor, einen Bankert. In der Regel benötigte sie für den Bankert noch verschiedene Vornamen wie Mist-, Sau-, oder Malefiz. Wenn Leute aus dem, wie sie glaubten etwas feinerem, Vorderhaus mich als Bankerten bezeichneten, so gebrauchten sie den Vornamen Hinterhaus dazu. Also waren ich und auch andere Buben vom Rückgebäude die Hinterhausbankerten. Paradoxerweise bezeichnet der Volksmund die unehelich geborenen Kinder, die tatsächlichen „Bankerten“ als Kinder der Liebe und die „Normal“, also ehelich geborenen als „Pflicht- und Schuldigkeitskinder“.
In Deutschland, wahrscheinlich ist das in anderen Ländern genauso oder zumindest ähnlich, dünkt sich ja jeder besser als der andere. Der Meister hält sich für besser als der Geselle, der wiederum hält sich für besser als der Hilfsarbeiter, der dafür auf den Arbeitslosen herabschaut. Es gibt nicht nur die Klassenunterschiede zwischen arm und reich, darunter befinden sich noch hunderte von Feinabstimmungen, wo jeder einen sucht und findet, der weniger wert ist als er. Dieses Gefälle gibt es unabhängig von der eigenen Vermögenslage auch bei den Bewohnern der Mietskasernen. Am besten dünkt sich der Bewohner vom Vorderhaus, der im ersten Stockwerk wohnt, am minderwertigsten ist der Bewohner des Hinterhauses, der unterm Dach wohnt. Wir haben unterm Dach gewohnt.
Den nächsten Namen, den ich zu Unrecht erhielt, war der „Grippe“, das ist bairisch und heißt eigentlich Krüppel. Dazu gab es ebenfalls die verschiedenen Vornamen. Sau und Mist wurden vom Bankert her übernommen, manchmal auch der Malefiz. Am häufigsten aber musste der völlig unschuldige Hund als Vorname dienen. Demnach war ich also der „Hundsgrippe“. Kein Mensch kann mir erklären, warum ausgerechnet ich so bezeichnet wurde, obwohl ich weder einen Buckel, noch einen Klumpfuß, ja nicht einmal einen Wolfsrachen oder einen Kropf hatte.
Sogar heute habe ich immer noch meine geraden Glieder und sie bleiben immer gerade, weil ich sie vor lauter Verkalkung in den Gelenken gar nicht mehr nach meinem freien Willen krümmen kann.
Eine Missgeburt, war ich nur insoweit, als meine Eltern sich an meiner Stelle ein Mädchen gewünscht haben. Ein Sohn, der „Stammhalter“, Obwohl wir so bescheidene, arme Leute waren, dass da kein „Stamm“ zu halten war, existierte bereits seit beinahe vier Jahren. Eine Tochter wäre halt jetzt viel besser gewesen, als wieder ein Sohn. Wo man doch schon die abgetragenen blauen Strampelhosen an die nahe Verwandtschaft weitergegeben hatte.
Die Enttäuschung über meine unmädchenhafte Sexualität saß tief. Das bekam ich schon in den ersten Tagen meines jungen Lebens zu spüren. Man war nicht stolz auf mich, im Gegensatz zu meinem Bruder Harald, dem Erstgeborenen, der schon bei der Geburt den Vorteil eines um mehr als anderthalb Kilo höheren Startgewichtes hatte, Er war ein „Zehnpfünder“, ich dagegen wog „nicht einmal 8 Pfund“! Meine Geburt dauerte auch nicht sehr lange, war nicht besonders schmerzhaft, völlig unkompliziert, was für eine Mutter immer enttäuschend ist. Wovon soll sie später mit den anderen Frauen reden, wenn nicht von den schweren Schwangerschaften und den noch schwereren Geburten. Mit mir hatte sie nicht einmal eine schwierige Schwangerschaft, auch zu Beginn der Schwangerschaft musste sie nicht arg brechen, es war ihr so viel wie gar nicht übel. Schon als Fötus wollte ich meiner Mutter keine Schwierigkeiten machen, es wurde mir aber schlecht gelohnt, ich war einfach eine Enttäuschung. Keine Schwangerschaftsprobleme, keine Geburtsprobleme und - kein Mädchen!
Man mag es fast nicht glauben, dass für meine Eltern in jener Zeit ein Mädchen etwas Besseres sein sollte, als ein Knabe, wo doch der männliche Nachwuchs allgemein so viel höher im Kurs stand und immer noch steht - aber es war tatsächlich so. Später habe ich sehr wohl verstanden, was sich hinter dem elterlichen Wunsche nach einem Mädchen verbarg. Ein Mädchen kann im Haushalt mehr tun als ein Knabe und so wäre die Hausarbeit im Dienste der Männer auf mehrere weibliche Schultern verteilt worden. Es kam aber alles ganz anders. Im Haushalt wurde ich zum Mädchen umfunktioniert, aber davon später.
Wenn ich sage, dass ich nicht geliebt wurde, darf man nicht daraus schließen, dass ich gehasst wurde. Das nicht. Nur einfach nicht geliebt, nicht geschmust, nicht in den Arm genommen und bei keiner Gelegenheit verwöhnt. Nicht einmal an meinen Geburtstagen.
Noch bevor ich die erste Windel vollgemacht hatte, war schon alles zu meinem Schlechtesten gelaufen. Trotzdem, bei meiner Geburt herrschte große Aufregung. Leider nicht wegen mir! Wie lange würde sich der „Führer“ noch die Unverschämtheiten der „Polacken“ gefallen lassen? Nicht lange. Schon beim ersten Sonnenaufgang meines gerade Begonnenen Lebens wurde „seit 5.Uhr 45 zurückgeschossen und Bombe mit Bombe vergolten“.
Was wird jetzt mit meinem Vater? Muss er Soldat werden? Er musste nicht. Zum Glück den ganzen schrecklichen, langen Krieg nicht. Er war Lokomotivführer, hatte nicht „gedient“, konnte auch nicht schießen und hatte als intelligenter Mensch eine abgrundtiefe Abneigung gegen diesen braunen Wanderverein.
Mein Leben wurde und wird immer noch von Frauen beherrscht. Die erste und wichtigste Frau in meinem Leben war logischerweise meine Mutter. Die zweite sehr wichtige Frau, an die ich mich erinnern kann, war meine Taufpatin. Sie war auch unsere Nachbarin, eine Generation älter als meine Mutter. Eine ganz besondere Frau. Sie hatte jahrzehntelang 2 Männer gleichzeitig. Mit dem Einem war sie verheiratet, den Anderen, es war ihr „Zimmerherr“, (heute gibt es das nicht mehr, das heißt jetzt Untermieter, aber auch das wird es bald nicht mehr geben) hat sie geliebt. Viele Jahre später hat sie ihren kranken Ehemann über lange Jahre gepflegt, bis er endlich sterben konnte, danach geschah ihr das Gleiche mit ihren Zimmerherrn - auch über Jahre hinweg. Wenn es wirklich Unrecht war, dass sie zwei Männer gleichzeitig hatte, sie hat es schwer gebüßt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie beim Jüngsten Gericht deshalb verurteilt wird. Ich jedenfalls plädiere auf Freispruch!
Durch meine Mutter erblickte ich das Licht der Welt. Durch meine Taufpatin blieb mir mein Augenlicht erhalten, aber das erzähle ich später. Meine Taufpatin, die Mauchertant, wurde die zweitwichtigste Frau meiner Kindheit. Ich habe sie sehr geliebt und sie hat mich gern gehabt, war meine Vertraute, Lehrerin, Ersatzoma und Trösterin bei allem Kummer den so ein kleiner Bub als ungeliebter Zweitgeborener hat. Dafür war ich ihr „Sonnenschein“. Ihr konnte ich meine Träume erzählen und die vielen Phantasien, die durch meinen Kinderkopf gingen, ohne dass ich dafür ausgelacht wurde. Sie lehrte mich, wie man mit Messer und Gabel isst und wie man sich benehmen muss: - Immer Bitte und Danke sagen, Erwachsenen nicht widersprechen, Mund halten, wenn „Große“ reden. Und bei Erwachsenen überhaupt nur reden, wenn man gefragt wird.
Weitere Frauen in meinem Leben gab es erst viel, viel später, aber mit Ausnahme einmal meiner späteren Ehefrau, hatte keine auch nur annähernd so viel Bedeutung wie meine Mauchertant.
Mein Stammbaum, von der Vaterseite her
Zwei Großmütter hatte ich auch. Die eine, hieß „Münchner Oma“, die Mutter meines Vaters die sah ich regelmäßig an ihrem Geburtstag, am Muttertag und an Neujahr. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals irgendetwas zu mir gesagt hätte. Auch mit meinen Brüdern sprach sie nie ein Wort. Sie redete nur mit unserem Vater. Meine Mutter war kein einziges Mal mit uns beim Besuch ihrer Schwiegereltern dabei. Es war immer nur mein Vater, der uns führte. Meine Mutter blieb zu Hause, sie musste kochen.
Bei der „Münchner Oma“ bekamen wir auch nie irgendetwas hingestellt, nicht einmal was zum Trinken. Sie war eine kleine, kugelrunde Frau. Wie alt sie war habe ich erst lange nach ihrem Tod durch die Geburtsurkunde herausgefunden. Für mich war sie immer alt, aber nie sehr alt, vor allem aber war sie mir immer so vorgekommen, als würde sie nie älter werden und wäre schon immer so alt gewesen. Eine Oma war sie nie, eigentlich nicht einmal eine Großmutter, nur eben die Mutter meines Vaters, zu der wir Oma sagen mussten, weil mein Vater es so wollte. Meine Mutter sprach nie über sie, mein Vater hat sie sicher sehr gern gehabt, obwohl er wusste, dass sie seinen Bruder den Seppl, der in Russland gefallen ist, lieber gemocht hatte. Das war auch einigermaßen logisch, weil sie dieses Kind als Einziges vom ersten Tag an aufgezogen hat. Sie hatte auch noch einen dritten Sohn, den Konrad. Der ist aber nicht mit seinen beiden Brüdern aufgewachsen, sondern von Verwandten auf dem Lande, in der Nähe von Altötting, großgezogen worden. Er war ein großer, stattlicher Mann. Auf Wunsch seiner jungen, hübschen und lebenslustigen Frau zog er Mitte der 30er Jahre die schwarze Uniform der SS an. Sie meinte, die würde ihm besser stehen als die braune Müllmänneruniform der SA. Was da politisch dahinter stand, interessierte sie nicht im Geringsten. Das Erscheinungsbild ihres Mannes, darauf kam es ihr an. Lange währte dieses Eheglück nicht. Der böhmische Gefreite, größter Feldherr aller Zeiten, schickte den Onkel Konrad mit Millionen anderen, gen Osten. Dort versank er mit seiner schönen schwarzen Uniform im Morast. Im heldenhaften Kampf, für Führer, Volk und Vaterland ließ er sein Leben, noch bevor er 33 Jahre alt war.
Neben seiner Frau hinterließ er einen Sohn, wieder ein Konrad. Nach dem Krieg lebte die einst so hübsche Frau als Witwe mit einem Kriegsinvaliden zusammen. Heiraten konnten sie aus finanziellen Gründen nicht. Sie hätte sonst ihre Kriegerwitwenrente verloren und die Invalidenrente ihres Lebensgefährten hätte für die Familie alleine nicht ausgereicht. Männer waren in diesen Jahren rar, sogar Kriegsinvaliden. So ganz Invalide war er aber doch nicht, denn seine Kraft reichte noch zur Zeugung von zwei Kindern. Diese neue Familie wohnte nach dem Krieg in derselben Mietskaserne, wie meine Münchner Großeltern. Konrad war in der eigenen Familie plötzlich der Außenseiter daher freundete er sich bald mit seinem Opa an und kam über viele Jahre recht gut mit ihm aus, bis er eines Tages mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern in die Berge zog und Wirt einer Alpenvereinshütte wurde.
Die Verhältnisse zwischen meiner Großmutter und ihren Söhnen haben sich auch auf uns Kinder übertragen. Mit den Kindern vom Seppl, die sie öfter besuchten, soll sie sogar ein wenig gespielt haben, gelacht hat sie sicher auch mit denen nicht. Die konnte gar nicht lachen.
Nach dem Krieg bekamen wir von der Münchner Oma ab und an eine Postkarte auf der stand, dass einer von uns kommen sollte, sie hätte etwas für uns. Sie schrieb aber nie, was sie für uns hätte. Das erste Mal hatte sie wirklich etwas Besonderes, es war im Jahre 1946. Geräuchertes Fleisch! Eine unvorstellbare Kostbarkeit, und das von „Ihr“. Mein Vater ist mit seinem Rad hingefahren und hat sich sehr gewundert über diese ungewöhnliche Großzügigkeit, getraut hat er der Sache nicht recht. „Brauchst nicht auspacken, ‘s ist das ganze Vieh, samt Kopf“ hat meine Münchner Oma zu ihm gesagt. Mein Vater nahm das Paket in die Hände, es war so groß, dass er tatsächlich beide Hände brauchte, tastete es ab. „Hund oder Katz?“ Fragte er dann. „Habt’s Hunger oder nicht“, war die Antwort. Wir hatten Hunger und es war ein Dackel, nicht zu fett und nicht zu mager und ganz zart mit Wacholder geräuchert. Niemand von uns hat den Hund geschmeckt, nur mein kleinster Bruder, der damals gerade erst 3 Jahre alt war, meinte: „Mutti, das riecht wie ein Hund“. Dafür bekam er eine Ohrfeige, zur Vorbeugung. Aber uns anderen hat es geschmeckt, wir haben uns nur gewundert, dass wir so viel Fleisch und noch dazu geräuchertes auf einmal essen durften und unsere Eltern gar nichts wollten. Groß nachgedacht haben wir aber nicht darüber. Hauptsache satt essen, ich glaube mir wär’s egal gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass es ein Dackel war, der uns so gut zu den „Dotschen“ geschmeckt hat. Die „Dotschen“, das waren die großen Futterrüben, welche die Butter so schön zartgelb machen, wenn sie Bestandteil des Kuhfutters waren. Jesus hat ja bekanntlich Heuschrecken gegessen und die auch noch roh. Was ist ein Hund oder eine Katze denn schon anderes als ein Hase oder ein Kaninchen? Nur seine Wertstellung als bester Freund des Menschen macht den Hund für Westeuropäer ungenießbar, sein Fleisch nicht.
In jener Zeit aber aßen wir vielen Tieren das Futter weg. Den Gänsen die jungen Brennnessel, die uns den Spinat ersetzten, den Ziegen und Schafen den jungen Löwenzahn. Den Kühen die Futterrüben und den Schweinen Kartoffel und Kleie. Dazu kam noch der Sauerampfer und etliche Gräser, die wir ausrupften und die zarten Enden kauten. Von einigen Blumen zupften wir die Blüten ab und lutschten den Nektar heraus, die Insekten hatten das Nachsehen. Besonders beliebt waren da die Taubnesseln. Alle irgendwie genießbaren Beeren, sogar der Rotdorn, dienten uns hungrigen Kindern vom Stadtrand bei Gelegenheit zur Nahrung.
Wenn ich daran denke, was ich in den vielen fetten Jahren meines späteren Lebens im Urlaub für teures Geld alles gegessen habe, dagegen ist ein geräucherter Dackel sicher nicht das schlechteste gewesen. Die Chinesen sollen immer noch Schlachthunde züchten, sogar die in der Schweiz beinahe heiliggesprochenen „Bernhardiner“. Warum eigentlich nicht?
Spätere Postkarten, die uns von unserer Großmutter erreichten, kündigten aber immer nur die Übergabe „angestoßener“ (angefaulter) Äpfel an, die sie in der Großmarkthalle am Samstag nachmittags kistenweise geschenkt bekommen hatte, weil sie niemand mehr kaufen wollte. Am Montag hätten die Händler sie nur noch wegwerfen können und den Abfall gebührenpflichtig entsorgen müssen. Da war her schenken immer noch billiger. Sie selbst brauchte von denen ja nur ein paar für sich. Bis dann einer von uns am Montagnachmittag die Äpfel nach Hause brachte, waren sie schon wieder ein bisschen mehr verfault. Heut würde man sagen, da lohnt sich’s wegwerfen gar nicht. Damals schnitt man eben das verfaulte so knapp es ging weg, alles andere wurde auf „Butz und Stin- gel“ gegessen. Meine Mutter, die handwerklich sehr geschickt war, machte die Schalen immer ganz dünn und schnitt auch das Kernhaus haarscharf heraus, damit möglichst viel zu Apfelbrei oder Scheiben für „Scheiterhaufen“ oder gar einen Apfelstrudel wurde. Kernhaus und Schalen wanderten sofort in die Kindermägen. Nur, wenn im Winter der Überfluss an Schalen groß war, legten wir ein paar davon auf die heiße Herdplatte und erfreuten uns an dem Duft, der daraus entstieg, aßen sie praktisch gegrillt anstelle von Bratäpfeln. Aber wehe, wenn man nicht aufpasste, und die schönen Schalen verkohlten, dann war’s mit dem guten Duft und der Ruhe vorbei. Erst stank es fürchterlich und dann gab’s Watschen, (Ohrfeigen) nicht immer nur für den Schuldigen, sondern meistens für den, der gerade am nächsten stand. Wenn der dann laut klagend seine Unschuld beteuerte, erhielt er zur Antwort: „Die hat dir nicht geschadet, und wenn du nicht gleich schdad (still) bist, kriegst noch eine. So einen Gestank hermachen, Hundsgrippe mistiger, ist aber wahr auch so was, na.“. Da war er wieder, der unschuldige Hund.
Zu meiner „Münchner Oma“ gab’s natürlich auch einen „Münchner Opa“. Der war ein großer, kräftiger Mann mit einem mächtigen, sehr gepflegten Schnurrbart. Wenn ich mir heute sein Hochzeitsbild anschaue, glaube ich, dass er auch einmal ein hübscher Mann war, zumindest in seinen jungen Jahren, als seine Augen noch nicht vom vielen Bier getrübt waren. Meine Mutter mochte ihn gut leiden, besuchte ihn aber trotzdem nicht. Mein Vater hatte Respekt, vor allem vor seiner Kraft und seiner Arbeitsamkeit. Andererseits hatte er eine starke Abneigung gegen ihn wegen des enormen Bierkonsums, der meinem Vater eine schlechte Kindheit bescherte, und wegen seines Geizes. Obwohl Geiz möglicherweise nicht der richtige Ausdruck ist. Er wollte es zu was bringen, deswegen sparte er an allem, wo es ging. Nur nicht am Bier. Aber das meiste Bier, das mein Großvater trank, solange er noch arbeitete, war sowieso „Freibier“ Das kennen heute nur noch die Wenigsten. Lediglich die Politiker, welche jedes Jahr zum Salvator-Anstich eingeladen sind, müssten die Bedeutung dieses Ausdruckes noch kennen.
***
Mein Großvater arbeitete bei der Müllabfuhr und die geschah vor dem Krieg noch mit einachsigen, hochrädrigen Karren, die von einem Pferd gezogen wurden. Die Mülltonnen wurden von Hand in die Karren gekippt. Der Arbeitsbezirk meines Großvaters war die Münchner Altstadt, wo beinahe jedes zweite Haus ein Wirtshaus war. Müll war damals ganz etwas anderes als heute. Verpackungen, Kunststoffe, Flaschen und Büchsen gab es noch nicht. Alles, was irgendwie verwertbar war, wurde von eigenen Sammlern („Haderlumpen, Flaschen Knochen, Papier“, schallte es immer wieder durch die Höfe) abgeholt. Gemüseabfälle wurden von Privathaushalten meist an Bekannte weitergereicht, die Hasen auf dem Balkon oder Ziegen und Hühner im Garten hatten. Wenn bei einer Gaststätte regelmäßig größere Mengen an Lebensmittelabfällen anfielen, so kam ein Bauer aus der Nähe, der diese Abfälle mit dem Fuhrwerk abholte und an seine Schweine verfütterte. Knochen holte der Seifensieder und Ruß nahm der Kaminkehrer selber mit, Ruß war Rohstoff für Farben und Gummi. Müll war in erster Linie Asche und dazu Gegenstände, die unbrennbar und so kaputt waren, dass sie kein Mensch mehr reparieren konnte. War der Müllmann mit seiner Arbeit in einem Haus fertig, so wurde ihm häufig vom Wirt ein Bier spendiert. Üblicherweise eine Maß, damit der Staub und Dreck wieder hinuntergespült werden konnte. Mein Großvater war bei seinen Kunden sehr beliebt, da er sauber arbeitete, keinen Dreck hinterließ und auch einmal etwas mitnahm, das man heute als Sperrmüll oder gar als Sondermüll bezeichnen würde.
Später war er dann Stallmeister und hatte für 72 Pferde zu sorgen. Der Stall war in der Maistraße, sinnigerweise nicht weit weg vom Schlachthof. Im Krieg wurde der Stall von Brandbomben getroffen und fast alle Pferde verbrannten. Mein Großvater konnte nur ein paar Tiere retten. Es war das schlimmste Erlebnis seines Lebens. Es ist ihm bis in den Tod hinein nachgegangen, wie die Pferde geschrien haben. Am Sterbebett schrie er in seinen letzten Stunden immer wieder: „Lasst mich raus, meine Ross verbrennen“.
Mein Großvater stammte vom Land, gerade aus der Gegend, in welcher Ludwig Thomas’ Stücke spielten. Er muss eine Menge Geschwister gehabt haben, wir kannten aber niemand davon und es wurde auch nie darüber geredet. Nur über einen älteren Bruder, der früh verstarb und dessen Kinder schon vor 1933 nach Amerika ausgewandert sind. Nach dem Krieg wäre das für uns sehr von Nutzen gewesen, wenn wir deren Adressen gehabt hätten, wegen der „Care-Pakete“. Dafür hätte ich wahrscheinlich sogar extra Englisch gelernt, das konnte man damals in der Volksschule, aber nur freiwillig, wenn man zusätzlich in eine bestimmte Schule ging, und auch nur in der 7. Klasse. Eine gute halbe Stunde hätte ich da für einen Weg zu laufen gehabt, das war mir bald zu viel und so hab ich’s dann bleiben lassen. Für die Care-Pakete wär’s eh schon zu spät gewesen und sonst war damals für mich auch nicht viel mit der fremden Sprache anzufangen gewesen. So habe ich englisch erst viel, viel später, aus ganz anderem Anlass, mit großem Fleiß, aber auch nur sehr mangelhaft, gelernt.
Die „Amerikanischen Verwandten“ wussten zwar von unserer Existenz, hatten aber nie unsere Adresse herausgefunden. Zehn Jahre später, als bereits das „Wirtschaftswunder“ zu wirken begann, trug ich mich mit dem Gedanken, nach Amerika auszuwandern. Durch puren Zufall, erfuhr ich dann, wie das so gekommen war, dass wir nie in den Besitz eines „Care Paketes“ kamen:
Mein Vater wusste von einer seiner Cousinen, dass sie im Oberland wohnte. Da mein Vater und ich Mopeds hatten und gerne damit in die Berge fuhren, solange das Geld für den Sprit ausreichte, beschlossen wir, diese Cousine zu besuchen. Mein Vater glaubte zwar, den Ort zu wissen, wo sie wohnte, aber Straße und Hausnummer waren ihm unbekannt. Also fuhren wir hin und fragten: „d‘ Leut sind deutsch, die werden uns schon was sagen, wenn wir fragen. Man muss halt reden mit den Leuten, mit den Ochsen redet man ja auch“. Tatsächlich fanden wir die Frau nach längerem Suchen im Nachbardorf. Sie glaubte sogar, meinen Vater von ihrer Kindheit und Jugend her zu erkennen. Als Einzige der Geschwister, schuld war selbstverständlich ein Mann, in den sie zu jener Zeit verliebt war, ist sie nicht mit nach Amerika ausgewandert. Aber schon in den frühen 50er Jahren ist sie mit dem Schiff und der Eisenbahn zu ihren Geschwistern, die unpraktischerweise am anderen Ende von Amerika, in Los Angeles wohnten, gereist. Die Verwandtschaft hatte es „drüben“ zu was gebracht. Sie betrieben, welch unvorstellbarer Reichtum, eine eigene Bäckerei. Die Tante erzählte uns einen ganzen Nachmittag lang von dem ganz anderen Leben in Amerika. Vieles konnte ich mir damals gar nicht recht vorstellen, obwohl ich schon einiges über die Vereinigten Staaten von Amerika erfahren habe.
Mein Lehrer in der 7. Klasse Volksschule war als Austauschstudent in Amerika. Wir waren seine erste Schulklasse nach Rückkehr und Praktikantenjahr. Er hat auch viel berichtet und sogar Dias von seiner Rundreise zum Abschluss des Studiums vorgeführt. Farbdias, das war noch etwas ganz Besonderes. Mein ganzes Leben lang habe ich seine Bilder vom Grand Canyon nicht vergessen und wusste, eines Tages werde ich auch dort sein und dieses Wunder mit eigenen Augen sehen. Dass das aber noch 40 Jahre dauern sollte, ahnte ich nicht. Der Reichtum der Amerikaner schien unermesslich zu sein, jede Familie hat ein Auto; und was für eines! Bei uns kamen damals gerade das Goggomobil und der Lloyd 300, die Isetta, der Gutbrod Superior, der Messerschmitt Kabinenroller und wie diese ganzen Miniautos alle hießen, in Mode. Jeder dieser kleinen Stinker hätte spielend in den Kofferraum der Autos („Amischlit- ten“ gepasst, welche die Amerikaner damals fuhren.
Für meine Verhältnisse war ich damals schon sehr reich, ich verdiente DM 85.- brutto im Monat, als Lehrling im 3. Lehrjahr, wobei ich die Hälfte meines Lohnes zum Familieneinkommen beisteuern musste. Trotzdem hatte ich mir schon ein Moped, eine NSU Quickly, nagelneu, für DM 540.- auf Raten, mit 200 Mark Anzahlung, versteht sich, Zusammengespart. Damals kaufte jedermann alles auf Raten, das war dann das „Wirtschaftswunder“. Vom Lehrlingsgehalt alleine wäre das Moped nicht zu finanzieren gewesen aber alle 2 Wochen durfte ich Samstag abends, bis Sonntag 2 Uhr früh, Kegel aufstellen in einer Wirtschaft. Heute gibt es so etwas nicht mehr, nicht des Jugendschutzes wegen, sondern, weil die Kegel automatisch aufgestellt werden. Das kegelaufstellen hat Netto mehr gebracht, als der Lehrlingslohn für die wöchentlich 45 Stunden + immer morgens % Stunde früher kommen und abends V2 Stunde länger aufräumen und die Werkzeuge der Gehilfen putzen. So gings den meisten Lehrlingen in den Anfängen des „Wirtschaftswunders“. (Lehrjahre sind keine Herrenjahre!)
Aber zurück zur Tante aus Amerika und der missratenen Großmutter. Im Laufe der Unterhaltung kam das Gespräch auch auf die niemals erhaltenen und doch möglich gewesen wärenden „Care-Pakete“. Wir Münchner, die kein Englisch konnten, bezeichneten sie als Kaare-Packl, (mit sehr hellem, langem A, damit's keine Verwechslung mit dem Kare, also dem Karl, den man mit einem dunklen A spricht, gibt). Meine Überraschung war groß, als ich erfuhr, dass meine Cousins und Cousinen welche erhielten und wir nur deshalb nicht, weil unsere Adresse nicht bekannt war! Wir waren im Oktober 1945 von Sendling nach Thalkirchen gezogen, die Adresse in Sendling war der Verwandtschaft in Amerika bekannt, die in Thalkirchen nicht. Das erste, an die alte Adresse gesendete, Paket ist selbstverständlich nicht zurückgeschickt worden, nachgeschickt nach Thalkirchen wurde es aber trotz eines gültigen, und immer wieder verlängerten Nachsendeauftrages bei der Post, auch nicht. Vielleicht ist es ja beim Postamt, oder beim Postler hängengeblieben. Jedenfalls warteten die Amis vergeblich auf ein Dankeschön von uns und beklagten sich bei meiner „Münchner Oma“ über unsere offensichtliche Undankbarkeit. Die teilte dann mit, dass wir umgezogen seien, aber sie wisse leider auch nicht wohin! Als ich das erfuhr, war die Oma schon ein Jahr tot, ich konnte sie nicht mehr zur Rede stellen, dafür bin ich aber nie mehr zu ihr auf den Friedhof gegangen, auch nicht an Allerheiligen und nicht am Muttertag, der ihr so wichtig war. Bis heute nicht.
Mein Vater liebte seine Mutter, obwohl er genau wusste, dass sie ihn nicht liebte und meine Mutter mochte die schon zweimal nicht. Dieser Zwiespalt hat meinem Vater sehr zu schaffen gemacht. Solange ich ein Kind war, hat er nie darüber gesprochen, später erzählte mein Vater mir so manche Geschichte aus seiner Kindheit und Jugend, die mein Bild von den Münchner Großeltern noch düsterer machten, als es schon war. Düster war auch die Wohnung der Großeltern. Sie war auch in Sendling, in einer Wohnbau-Genossenschaft, in welche mein Großvater schon als lediger Bursch eingezahlt hat. Die Wohnung bestand aus einem finsteren, unbeleuchteten Gang, zwei ineinander gehenden Zimmern, eines davon war der Schlafraum, den ich zu Lebzeiten meiner „Münchner Oma“ nie sehen durfte, einem Wohn-und Küchenraum, dann noch ein Klosett mit einem Waschbecken. In der Wohnküche gab es kein Wasser, das wurde aus dem Waschbecken im Klo geholt. An den Wänden dieses Multifunktionsraumes hingen Dutzende von Uhren. Taschenuhren, Wanduhren, Kuckucksuhren, fast alle hatten ein Läutwerk, das so gestellt war, dass die Uhren immer nacheinander läuteten. Es war fast wie Musik, zusammen mit dem ständigen Ticken. Mein Großvater bekam sie alle geschenkt, weil sie kaputt waren. Ein Freund, der Uhrmachermeister war, reparierte sie ihm für Gegenleistungen.
Das Schönste an der Wohnung aber war der Balkon. Der war an die 20 Quadratmeter groß, lag zur Hofseite des großen Wohnblocks, genau über dem Nebenzimmer der darunterliegenden Gastwirtschaft. Selbstverständlich war mein Großvater dort Stammgast. Trotzdem hatte er schon vor dem Krieg auf dem Balkon einen „Eisschrank“ für sein Flaschenbier von der Brauerei. In den kamen zum Bier jede Woche zwei Viertelstangen Eis zur Kühlung. Das abgetaute Wasser wurde dann zum Gießen der Balkonblumen, Geranien und Fuchsien, verwendet. Als es zu Kriegsende und in den ersten Nachkriegsjahren nur noch Dünnbier gab, litt mein Großvater sehr darunter. Sein Bauch zog sich in sich zurück und die Hosen schlotterten an ihm herum wie eine Fahne im Wind. Aber nicht einmal dieser „Plempel“ war so einfach, zu beschaffen. Die Haltbarkeit war ebenfalls sehr begrenzt. Die Alternative wäre nur noch die „Molke“ gewesen, was für eine entsetzliche Vorstellung für einen echten bayrischen Biertrinker!
Immerhin bekamen wir vom Großvater bei jedem Besuch, also dreimal im Jahr eine Mark geschenkt, das war viel Geld.
***
Meine Großmutter war schon durch ihre Geburt benachteiligt. Sie war das ledige (uneheliche) Kind einer ledig geborenen Mutter. Ihren Vater hat sie nie gekannt, von ihrer Mutter wurde sie mit 13 Jahren, nach der Volksschule in eine „Stellung“ geschickt. Das heißt, sie arbeitete im Haushalt, bei Leuten, die sich das leisten konnten. Das wichtigste an so einer „Stellung“ war, dass man da nicht zu hungern brauchte. Auch bei den geizigsten „Herrschaften“ findet eine clevere Magd genügend, um satt zu werden. Die große Gefahr bei diesen „Herrschaftsleuten“ waren immer für so ein Mädel, das üblicherweise vom Land rein kam, sehr fromm, ungenügend aufgeklärt und gutgläubig war, die männlichen Familienmitglieder. Entweder der „Gnädige Herr“ selbst oder einer seiner männlichen Nachkommen. Die „Fannys“ sollten die Betten nicht nur frisch beziehen, sie sollten sie auch belegen. Die Zahl der ledigen Kinder dieser Dienstverhältnisse ist Legion. Je nach Charakter der Herrschaften ging die Geschichte mehr oder weniger schlecht an den armen Mädels aus. Bei meiner Großmutter ging es insofern gut aus, als sie ihr lediges Kind den Herrschaften überlassen durfte, wenn sie gleich nach der Geburt die „Stellung“ verließ. (Vielleicht diente sie damals bereits als „Leihmutter“?) Sie verließ und niemand aus meiner Familie weiß irgendetwas über den Verbleib meiner Tante. Dass sie überhaupt existierte, erfuhr mein Vater zufällig durch einen nächtlichen Streit seiner Eltern.
Die nächste Anstellung, die meine Großmutter nach der Geburt ihrer Tochter bekam, war die als „Biermops“ in einer Gaststätte. Der „Biermops“ ist die Hilfskellnerin, welche die Tische abräumt, saubermacht, die Gläser spült und das Bier mit einem kräftigen „Zum Wohlsein, der Herr“ auf den Tisch stellt und dabei möglichst freundlich lächelt. Dafür erhält sie dann meist einen Klaps auf den Hintern oder eine anzügliche Bemerkung. Ein paar Pfennig in die Hand gedrückt, oder in den Ausschnitt gesteckt, wäre ihr lieber gewesen. Am Lächeln hat’s bei meiner Großmutter wahrscheinlich ein wenig gefehlt. Aber einem Gast hat sie dann doch gefallen und der wurde mein Großvater.
Als mein ältester Onkel sich gerade durch das Ausbleiben der Monatsregel bemerkbar machte, haben die beiden schnell geheiratet. Er hat nichts gehabt und sie noch ein bisschen weniger. Für ein möbliertes Zimmer hat’s gerade noch gereicht. Mein Großvater hat ein gutes Jahr vorher auch seine „Stellung“ als Großknecht bei einem Bauern in Großhadern, das Haus steht heute noch, ist aber jetzt ein Getränkemarkt, verloren. Der Grund ist leicht erklärt: Die Bäuerin ist schwanger geworden und der Bauer ist dahintergekommen, dass er nicht der Verursacher war. Es waren halt schwierige Zeiten damals, ohne Pille und Spirale. Kondome hätt’s in der Apotheke gegeben, aber die waren erstens zu teuer und zweitens im dringenden Bedarfsfall nicht schnell genug zur Hand. Der Koitus Interruptus hat halt so seine Tücken.
In einem möblierten Zimmer ist naturgemäß die „Aufzucht“ eines Kindes schwierig und bedingt auch, dass die Mutter nicht mehr berufstätig sein kann. So wurde beschlossen, meinen ältesten Onkel Konrad zu Kinderlosen Verwandten aufs Land zu geben. Mein Großvater sah ihn jedes Jahr an den 3 Tagen, die man zu dieser Zeit noch als Jahresurlaub hatte. An diesen 3 Tagen arbeitete mein Großvater bei der Einbringung der Getreideernte seiner Verwandten mit. Da wird er meinen Onkel, seinen ersten ehelichen Sohn, auch nicht gerade viel gesehen haben. Seinen unehelichen Sohn hat er nie zu Gesicht bekommen. Meine Großmutter hat ihren Erstgeborenen Sohn wieder gesehen, als der bereits ein Mann war. Mein Vater sah seinen Bruder zum ersten Mal als er neun Jahre alt war in den Schulferien, er hat sich nie mit ihm angefreundet. Ich selbst habe keine Erinnerung an den Onkel Konrad, da er schon 1943 in Russland geblieben ist. Man weiß nicht genau, wie er gefallen ist, der Kommandant teilte meiner Tante etwas anderes mit, als sie später von einem Kameraden hörte. Nicht einmal sein Grab ist bekannt, auch nicht, ob er überhaupt ein Grab erhielt oder ihn nur das Moor verschlang und nicht mehr hergab.
Als mein nächster Onkel unterwegs war, bekamen meine Großeltern eine eigene Wohnung in Untersendling. Die hatte 2 Zimmer und einen kleinen Flur, Wasser und Toilette waren im Treppenhaus. Der Onkel Sepp wuchs dann komplett bei seinen Eltern auf. Meine Großmutter arbeitete als Putzfrau und konnte ihn im „Wagerl“ zur Arbeit mitnehmen. Um aus dem Elend raus zu kommen sparten meine Großeltern auf ein „Sacherl“, ein kleines Anwesen, das neben der Berufsarbeit, heute würde man sagen als „Nebenerwerbslandwirtschaft“ betrieben werden sollte. In unserer Zeit ist so etwas nicht mehr so schwierig. Bauernland kann man genug pachten und ein altes, kleines, abgelegenes Häusel findet man auch, notfalls zur Miete. Wenn man etwas gespart hat, kann man auch die monatlichen Zins- und Tilgungsraten bezahlen. Damals aber musste so ein „Sacherl“ komplett bar bezahlt werden. Es gab für kleine Leute keine Bank, die ihnen Geld zu erträglichen Zinsen geliehen hätte. Ihr Erspartes brachten meine Großeltern zur Bank und als treue Deutsche kauften sie 1914 Kriegsanleihen. Die Geschichte ist bekannt, der Krieg ging verloren, der Kaiser nach Holland und die Ersparnisse von 15 Jahren Arbeit waren nichts mehr wert.
***
Kurz vor dem ersten Weltkrieg ist dann zu allem Unglück noch mein Vater als dritter und letzter Sohn zur Welt gekommen. Das war dann auch wieder problematisch. Mit 2 Kindern konnte die Großmutter nicht zur Arbeit gehen. Was tun? Mein Vater war, wie man bei uns so sagte, ein „Verreckerl“, ein unterentwickelter, schwächlicher Säugling. Eigentlich hätt’s ihn auch gar nicht mehr gebraucht.
Er hatte Glück im Unglück und kam zu einer Pflegemutter, die ihn durch den Krieg mit seiner Hungersnot gebracht hat. Als der große Bruder schon in der 2. Klasse war durfte mein Vater zurück in den Schoß der Familie. Ein Glück war das für ihn sicher nicht. So lange er zu Hause lebte, musste er sein Bett in der Wohnküche mit dem Bruder teilen.
Und immer noch wollten meine Großeltern aus der Stadt raus und sparten auf ein Sacherl. Die Kinder mussten am meisten darunter leiden. Lebensmittel waren teuer. Für arme Leute gab‘s die „Volksküchen“ im Volksmund „Suppenschule“ genannt, weil sie meist in Schulen untergebracht waren und überwiegend Suppen und Eintopf ausgaben. Meine Münchner Oma holte sich täglich von dort das Essen für die Familie und unter Verwendung eines „Mehl Teigerls“ (Helle Einbrenne ohne Fett) wurde daraus eine dicke Pampe, und wenn’s nicht mehr ganz so frisch war, kam ein Spritzer Essig daran. Nach Essig roch es bei meinen Münchner Großeltern solange ich mich erinnern kann. Fleisch gab es nur für meinen Großvater, der bekam auch sonst immer etwas besseres Essen als die übrigen Familienmitglieder. Männer brauchen halt was Handfestes, sie müssen ja auch schwer arbeiten!
So wuchsen mein Vater und sein Bruder arg kümmerlich auf. Die allgemeine Wirtschaftslage nach Inflation, Reparationszahlungen wegen des verlorenen Krieges und mehrfachem Regierungswechsel wurde immer schlechter. Die Inflation fraß auf, was sich die Großeltern nach dem Krieg ersparten. Als die Volksschulpflicht erledigt war, sollte mein Vater einen Beruf erlernen. Schneider wäre er gerne geworden. Aber das ging nicht. Als kleiner Bub ist er aber ein Mal unter die fahrende Straßenbahn gekommen und, das gab’s damals noch, mit dem Schneefanggitter aufgefangen worden. Sonst wäre er unter die Räder gekommen. Es ging glimpflich ab, nur seine rechte Hand, er war Rechtshänder, wurde ein wenig verkrüppelt, er konnte sie nicht ganz ausstrecken und nicht sehr geschickt damit umgehen. Wie er überhaupt, im Gegensatz zu seinem Bruder Sepp vorsichtig ausgedrückt, nicht besonders handwerklich veranlagt war. Deshalb konnte er keine Lehrstelle als Schneider finden. So ist er Schlosser geworden, in einer Geldschrankfabrik, dafür reichte sein Geschick aus. Die Arbeitszeit war damals noch 54 Stunden die Woche, obwohl es seit Gründung der „Weimarer Republik“ nur 48 Stunden hätten sein sollen. Den Unternehmern waren die Verfassung und die ganze Republikerei wurscht. Als besondere Sozialleistung wurden 3 Tage Jahresurlaub gewährt. Die Lehrlinge bekamen diese aber meistens nicht, da ihnen Krankheitstage vom Urlaub abgezogen wurden. Die Gesellenprüfung konnte er im Anschluss an seine Lehre auch nicht mehr machen. Sofort nach der Lehrzeit wurde er „abgebaut“, also entlassen. Die Prüfung wäre nur ein paar Wochen später gewesen. Es war der Beginn der großen Wirtschaftskrise. Da kam es einem Betrieb viel billiger, ein paar Lehrlinge zu beschäftigen als einen jungen Gesellen bis zu seiner Prüfung durchzufüttern.
Mit Gelegenheitsarbeiten schlug er sich noch ein paar Monate durch, dann war auch das vorbei. Seinen Eltern auf der Tasche zu liegen wäre weder ihm eingefallen, noch hätte es sein Vater geduldet. So ging er, wie Hunderttausende andere auch, auf Wanderschaft, die „Walz“ wie man das nannte. Das Deutsche Reich war immer noch groß und irgendwie werde er schon durchkommen, sagte er sich. Bettelnd und vagabundierend kam er zu Fuß, per Anhalter oder als Schwarzfahrer ins Ruhrgebiet, nach Bremen und Hamburg, in die Hauptstadt Berlin und von da weiter nach Ostpreußen, bis Königsberg. Dort fiel er einer Polizeistreife in die Hände, die ihn, da er noch keine 21 Jahre alt war, wieder nach Hause schicken wollte. „Per Schub“, wie das damals hieß. Er widersetzte sich mit den Worten, „wenn ihr mich jetzt heim schickt, bin ich in 4 Wochen wieder hier, was soll ich daheim machen, Arbeit gibt’s keine für mich, Arbeitslosengeld auch nicht und den Eltern auf der Tasche liegen kann ich nicht.“ Es half nichts, er wurde abgeschoben und war dann wie angekündigt, 4 Wochen später wieder unterwegs. In Berlin hatte er das Glück, bei der Heilsarmee eine Anstellung als Hausmeisterhelfer zu bekommen. Der Machtwechsel deutete sich bereits an. Die Nazis wurden 1932 stärkste Partei im Reichstag. Anfang Januar 1933 verließ mein Vater Berlin, denn ein Münchner kann auf Dauer nur in München leben, auch wenn er nicht weiß wie und wovon. Sein Bruder, ein äußerst geschickter Handwerker, hatte immer Arbeit gefunden, bei ihm konnte er wohnen. Das ging aber nicht lange gut.
***
Im März 1933 machte die SA in München Großrazzia nach Sozis und Kommunisten. Mit 250 Mann sperrten sie morgens um 5.00Uhr die 4 Straßen rund um das kleine Hinterhaus, einen umgebauten Ziegenstall, in dem mein Vater und sein Bruder hausten, ab und durchkämmten alle Wohnungen. Keine Maus hätte ihnen entwischen können. Sie hatten Listen mit den Namen der gesuchten Personen. Mein Onkel war auf dieser Liste, mein Vater, der ja erst seit ein paar Wochen wieder in München war, noch nicht. Mitgenommen hätten sie ihn aber trotzdem, wenn er sich nicht als Idiot, der sich nicht alleine anziehen kann, hingestellt hätte. So erhielt er nur ein paar Faustschläge, Beschimpfungen und die Androhung: „dich holen wir auch noch, na kommst nach Eglfing“ (Eglfing, ein Ortsteil des Münchener Vorortes Haar, dort war das „Irrenhaus“, heute Bezirkskrankenhaus)
Mein Onkel kam in das neu errichtete KZ Dachau. Ein Gerichtsverfahren oder eine richterliche Anordnung gab es nicht, wozu auch. Wäre er nicht ein so überaus talentierter Handwerker gewesen, er wäre nie mehr lebend herausgekommen. Aber ausgerechnet sein ehemaliger Chef erhielt später den Auftrag alle Kunstschmiedearbeiten des „Braunen Hauses“ in München zu fertigen. Dazu brauchte er meinen Onkel dringend. Dadurch kam der im Herbst 1935 wieder frei. Über seine Inhaftierung durfte er mit niemanden reden, nicht einmal mit seinen nächsten Familienangehörigen. Die von einem jungen Kommunisten gefertigten Lampen, Gitter und Geländer erfreuten die Augen des Führers! Ob der je erfahren hat, wer da seinem Geschmack entsprechende Gegenstände herstellte?
Die Zeit im KZ veränderte sowohl den Onkel, wie auch das Verhältnis der beiden Brüder zueinander. Mein Vater glaubte noch, dass es mithilfe des Auslandes aufgrund der Versailler Verträge gelingen könnte, die Demokratie zu retten und arbeitete noch jahrelang im Untergrund für die „Rote Hilfe“, eine Organisation, welche die Familien der Inhaftierten finanziell unterstützte. Um nicht aufzufallen trat er dem „Stahlhelm“ bei. Im Zuge der Gleichschaltung wurde dieser Verein später in die SA eingegliedert. So fand sich der überzeugte Antifaschist plötzlich in der braunen Uniform wieder.
Mit Hitler kam auch wieder Beschäftigung. Erst fand mein Vater, der von Kindheit an, weil er eben nicht besonders groß war, Krafttraining betrieb, einen Job als Kohlenträger. Die Kohlenheizung war in der Zeit allgemein üblich. Nicht alleine aus Geldmangel kauften ältere Leute nur so viel Kohlen, Briketts und Bündelholz, wie sie in einem Monat verbrauchten. Und das musste ihnen in die Wohnung getragen werden. Die Häuser hatten in der Regel 4-6 Stockwerke. In den oberen Stockwerken waren die Wohnungen ein klein wenig billiger. Trinkgeld bekam er nie, höchstens ein Glas Wasser. Die Leute waren froh, wenn sie die Rechnungen bezahlen konnten. Mein Vater erreichte das stolze Körpermaß von 166 cm und ein Gewicht von 58 kg. Die Briketts wogen 40 kg, die Kohlen 50 kg per Sack. Leichter war nur das Bündelholz, kleine Scheite aus Brettabfällen, die mit einem Draht zu einem Paket von 30 cm Durchmesser zusammengebunden wurden. Im Frühjahr 1934 war das Geschäft auch wieder vorbei. Als Bauhilfsarbeiter für 49 Pfennig in der Stunde kam er unter. Auch das ein Knochenjob in der Zeit, als es noch kaum einen Kran an der Baustelle gab. Das Baumaterial wurde mit handbetriebenen Winden hinaufgezogen. Vieles aber auch mit dem „Vogel“, einem Holzbehälter, auf der Schulter über die Gerüstleitern geschleppt. Als dann die Autobahn München-Salzburg gebaut wurde, arbeitete er dort. Auch da waren Maschinen selten, Pickel, Schaufel und Schubkarren beherrschten das Bild. Wie hätte auch sonst das Heer von über 6 Millionen Arbeitslosen so schnell beseitigt werden können. Erst allmählich begann auch die Rüstungsmaschinerie auf Touren zu kommen die benötigte dann Unmengen neuer Arbeitskräfte.
Die Nazis versuchten auf allen Gebieten der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens den Einfluss der Staatsmacht zu vergrößern. So wurden auch die wenigen noch bestehenden Privateisenbahnen der Reichsbahn einverleibt. Dafür wurden wiederum mehr Leute gebraucht. Staatsbetriebe haben bei vergleichbarer Leistung, immer einen höheren Personalbedarf als Privatbetriebe. Verwaltungen sind Ur-Lebewesen, sie vermehren sich durch Zellteilung. Mein Vater sah seine Chance, als Lokheizer im Fahrdienst mit der Möglichkeit zum Lokomotivführer aufzusteigen, endlich einen sicheren Arbeitsplatz zu bekommen. Hier war seine Mitgliedschaft in der SA von Vorteil. Er galt dadurch als politisch zuverlässig. Das war Anfang 1937. Diese neue Arbeit veränderte vieles in seinem Leben. Durch den unregelmäßigen Schichtdienst hatte er den Vorwand, wieder aus der verhassten SA austreten zu können. Die illegale Tätigkeit reduzierte sich immer mehr, da viele seiner Freunde aufgeflogen sind und eingesperrt wurden, wenn sie nicht rechtzeitig ins Ausland entkamen. Nur in einem ganz kleinen Zirkel konnte man sich noch treffen. Große Aktionen waren so gut wie unmöglich. Später, im Jahre 1944 wurde auch diese Gruppe aufgelöst, nachdem zwei Mitglieder, Willy Ol- schewski und Otto Binder, verhaftet, zum Tode durch Enthauptung verurteilt und hingerichtet wurden.
Für den beruflichen Aufstieg zum „Reservelokomotivführer“ war sein Gesellenbrief als Schlosser, den er nicht hatte, notwendig. Prüfung und Gesellenstück musste er jetzt, 7 Jahre nach seiner Lehrzeit und ohne jemals in dieser Zeit auf seinem Beruf gearbeitet zu haben, nachmachen. Er hats geschafft, nicht großartig, aber immerhin. Die Anstellung bei der Bahn brachte es auch mit sich, dass er nicht zum Militärdienst eingezogen wurde. Schießübungen mussten trotzdem sein. Hier kam ihm nun seine leicht verkrüppelte Hand zu Gute. Eine schmale Gratwanderung, soviel Behinderung, dass er nicht richtig schießen konnte, aber so viel Bewegungsfähigkeit, dass seine berufliche Tätigkeit nicht infrage gestellt wurde.
Die Familie meiner Mutter
Die andere Hälfte meiner Großeltern, die Eltern meiner Mutter, stammten aus Niederbayern. Mein Opa wurde im Jahre 1875 in Passau geboren. Seine Mutter war Marktfrau, aufgrund ihrer ungewöhnlichen Körperkraft und ihres gewaltigen Mundwerks in der ganzen Stadt bekannt, manchmal auch gefürchtet. Wer sein Vater war, ist zwar bekannt gewesen, aber dessen Familienname war zwischen seiner Mutter und seiner Großmutter strittig. Später bekamen er und alle seine Kinder damit noch große Probleme, da der „Ariernachweis“ nicht komplett erbracht werden konnte. Ersatzweise wurden sie dann alle „streng wissenschaftlich“ begutachtet, ob sie nicht doch Halb- oder Vierteljuden seien.
Damit ist auch schon gesagt, dass mein Großvater alleine von seiner Mutter und seiner Großmutter aufgezogen wurde. Seinen Vater hat er nie zu Gesicht bekommen, hat auch später nie nach ihm geforscht. Einfach war das nicht, weder für seine Mutter noch für ihn, denn er musste ja überallhin mitgenommen werden. Ein unruhiges, plärrendes Kind neben dem Verkaufsstand, das ging nicht. Er musste sich stets ruhig und unauffällig verhalten. Damit er das tat, wurde sein Schnuller regelmäßig in Bier getaucht, das beruhigte. Der Schnuller jener Zeit war ein Leinenlappen, in den ein wenig Brot, am besten Brotrinde, das hielt länger her, eingewickelt war. Hinten war er zugebunden. An dem zutzelten dann die Kleinen. Bei normalen Familien wurde dieser Schnuller ab und zu in Milch oder in Honig getaucht, bei meinem Großvater in Bier.
Er wuchs heran, wurde groß und kräftig, lernte allerhand Verrichtungen, kannte seine Heimatstadt in- und auswendig. Seiner Schulpflicht tat er Genüge und hatte die Chance, einen Beruf zu erlernen, obwohl er kein Lehrgeld bezahlen konnte. Schuhmacher sollte er werden. Es wurde vereinbart, dass er deshalb statt der üblichen 4 Jahre deren sechs, unentgeltlich, nur für Kost und Logis, bei dem Meister arbeiten sollte. Nachdem 4 Jahre um waren und die anderen Lehrlinge, die mit ihm die Lehre begonnen hatten ihre „Freisprechungsfeier“ abhielten, bei der er auch eingeladen war, kam er erstmalig in den Genuss einer größeren Menge Bieres. Am nächsten Tag war er nicht in der Lage zu arbeiten. Es kam zum Streit mit seinem Meister, der mit dem Hinauswurf endete. Als Schuhmacher konnte er in Passau nicht mehr arbeiten. Zum Einen fehlte ihm der Gesellenbrief, zum Anderen hätte niemand einen Mann eingestellt, der von einem Kollegen hinausgeworfen wurde. Seiner Mutter musste er auch aus dem Weg gehen, die konnte die „Schande“ die er ihr damit angetan hatte nicht verwinden. Er verdingte sich als Lastenträger im Hafen, be- und entlud Schiffe und Lastkähne. Dabei lernte er allerhand Handelsschaften, die ihn eines Tages auf die Idee brachten, auf eigene Rechnung Kies aus der Donau und dem Inn abzubauen. Er hätte ein wohlhabender, kein reicher, eben ein wohlhabender Mann werden können, wenn... Ja, wenn ihm nicht der Teufel Alkohol immer wieder begegnet wäre.
Ein besonderes Erlebnis war, dass er eines weniger schönen Tages, eine männliche Leiche aus der Donau zog. Es war ein Landwirt, der nicht schwimmen konnte und bei seiner Arbeit mit dem Pflug ausgerutscht war, die Böschung hinunterfiel, von der Donau mitgerissen wurde und ertrank. Die Tochter dieses Mannes, welch ein Zufall, wurde 10 Jahre später seine Frau, meine Großmutter, meine richtige Oma.
So lautete die Fassung meiner Mutter. Eine Tante erzählte mir später über den Tod meines Urgroßvaters eine ganz andere Geschichte: Omas Vater besserte sein Einkommen als kleiner Landwirt durch Arbeit im Steinbruch auf. Der Granit des Bayerischen Waldes wurde in ganz Deutschland gebraucht. Meistens wurden Pflastersteine, das berüchtigte Katzenkopfpflaster daraus. Das dafür nötige schwere Werkzeug nahm er jeden Tag im Rucksack wieder mit heim. Diese Arbeit macht durstig. Aus einem Ziehbrunnen am Wege wollte er Wasser trinken, beugte sich weit hinab, der schwere Rucksack rutschte plötzlich über den Kopf, er verlor das Gleichgewicht, fiel in den Brunnen und konnte sich nicht mehr retten.
Die Geschichte meiner Mutter ist sicherlich romantischer, soweit der Tod überhaupt romantisch sein kann. Aber die meiner Tante ist möglicherweise näher an der Wahrheit. Wie auch immer, das Ergebnis war für meine Oma das Gleiche. Dazu komme ich gleich, aber bleiben wir vorerst weiter beim Opa.
Das Geschäft mit dem Kies musste er wieder abgeben und so suchte er sich eine Arbeit am Bau. In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts wurde viel gebaut. Die Mechanisierung machte große Fortschritte und durch die hohen Reparationszahlungen Frankreichs aus dem Krieg von 1870/71 war Geld ins Land gekommen. In München wurde das Deutsche Museum gebaut und der „Mosacher Gaskessel“ errichtet. Es wurden Arbeitskräfte gebraucht und so ging er nach München. Die Männer aus Niederbayern und dem Bayerischen Wald hatten den Ruf, als fleißige Leute. „De schiebn mitm Hirn an“ (Soll heißen, die arbeiten wie die Ochsen) Eine Arbeitsstelle war also schnell gefunden. Beton kam als neuer Baustoff zur Anwendung. Mein Großvater stürzte sich förmlich auf diese Technik und war als gelernter Schuhmacher bald Vorarbeiter der Betonierer. Eines Tages arbeitete er an der UniversitätsFrauenklinik, lernte ein junges Mädel kennen, das dort als „Hausschwangere“ arbeitete. Dass der ein anderer Mann die Ehe versprochen hatte kümmerte ihn nicht. Er wusste, versprechen und halten sind zwei Paar Stiefel. So kam es dann auch. Der Andere ließ die junge Frau mit ihrem (seinem!) Kind, einem Buben, einfach sitzen. Mein Großvater kümmerte sich sehr um das 17 Jahre jüngere und schon „Gefallene Mädchen“. Sie wurden ein Paar. Es blieb nicht aus, dass auch diese Verbindung ihre Früchte trug. Es war wieder ein Sohn. Nach seiner Taufe heirateten die beiden und zogen wieder nach Passau.