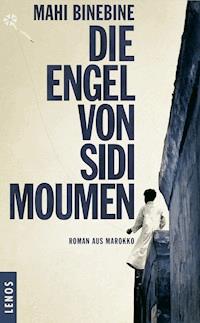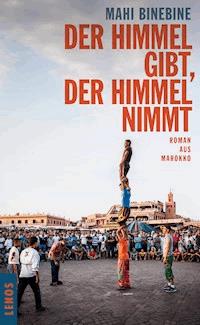15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Arabische Welten
- Sprache: Deutsch
Aus einfachsten Verhältnissen stammend, steigt Muhammad dank seines einzigartigen Gedächtnisses in die höchsten Sphären der Macht auf: Er ist Geschichtenerzähler, Lyriker, Spaßmacher und geistreicher Gefährte des marokkanischen Königs - ein Hofnarr des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine schillernden Episoden aus dem Palast zeigen eine luxuriöse, vom Alltag der Bevölkerung entrückte Welt, wo der bewunderte und gefürchtete Monarch launisch und unberechenbar regiert. Seine Höflinge sind Tag und Nacht um sein Wohl und seine Gunst bemüht, doch auch Intrigen und Verrat keimen angesichts seines nahen Todes. Inspiriert vom Leben seines Vaters am Hof Hassans II., gelingt es Mahi Binebine, die Doppelbödigkeit dieses jahrhundertealten Regimes aufzuzeigen, ohne moralisch zu urteilen. Auch dieser Roman sprüht vor Fabulierlust und jener genussvollen Verknüpfung von Humor und Tragik, die sein Schreiben auszeichnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
www.lenos.ch
Mahi Binebine
Der Hofnarr
Roman aus Marokko
Aus dem Französischen übersetztund mit einem Nachwort versehenvon Regina Keil-Sagawe
Die Übersetzerin
Regina Keil-Sagawe, geboren 1957 in Bochum, arbeitete nach ihrem Studium der Romanistik und der Germanistik als Universitätsdozentin und Kulturjournalistin. Seit rund dreissig Jahren übersetzt sie maghrebinische Belletristik, u.a. von Kaouther Adimi, Boualem Sansal, Yasmina Khadra, Azouz Begag, Leïla Marouane, Albert Memmi, Driss Chraïbi, Cécile Oumhani und Youssouf Amine Elalamy; Lyrik u.a. von Habib Tengour und Mohammed Dib. Als Mitglied der Weltlesebühne e.V. organisiert und moderiert Regina Keil-Sagawe Übersetzungslesungen und leitet Workshops zu literarischen Übersetzungen. Sie lebt in Heidelberg.
Der Autor
Mahi Binebine, geboren 1959 in Marrakesch. Studium der Mathematik in Paris. Lehrer. Hinwendung zur Literatur und Malerei. Heute gilt er als bekanntester Maler Marokkos, seine Bilder hängen u.a. im New Yorker Guggenheim-Museum. Sein umfangreiches schriftstellerisches Werk wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Nach Jahren in Frankreich und den USA lebt Mahi Binebine seit 2002 wieder in Marrakesch.
www.mahibinebine.com.
Bisher bei Lenos:
Die Engel von Sidi Moumen (2011)
Der Himmel gibt, der Himmel nimmt (2016)
Willkommen im Paradies (2017)
Titel der französischen Originalausgabe:
Le fou du roi
Copyright © 2017 by Editions Stock
E-Book-Ausgabe 2018
Copyright © der deutschen Übersetzung
2018 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Neeser & Müller, Basel
eISBN 978 3 85787 965 4
Für Papa
Arme Pappnase! Nichts als ewiger, unheilbarer Schmerz in des Narren Heiterkeit! Welch tristes Metier das Lachen doch ist!
Victor Hugo
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Licht und Schatten im Reich des marokkanischen Sonnenkönigs oder: Das marokkanische Paradoxon
1
Alles schien ganz normal zu sein, aber nichts war es wirklich. Im weiten Palastinnenhof hüllte eine mondlose, von einem Schweif bleicher Sterne erhellte Nacht zwei Silhouetten ein. Sidi bewegte sich langsamen Schrittes durch die mit Laternen bestandenen, von Zwergpalmen, Orangen- und Mandelbäumen gesäumten Alleen. Ich ging dicht hinter ihm wie stets, den Rücken leicht gebeugt, einen Hauch untertänig, wie es sich gehört, wenn man den König begleitet. Ein Duft von Jasmin schwebte in der feuchten Luft des Juliabends. Sidi hielt sich mit beiden Händen seinen schmerzenden Leib und stöhnte von Zeit zu Zeit dumpf auf. Er hatte Mühe, sich aufrecht zu halten, gnadenlos setzte ihm das unsichtbare Ungetüm zu, das in seinem Inneren wütete. Es schmerzte mich, ihn so leiden zu sehen, aber ich hütete mich, es zu zeigen. Ich versuchte nach Kräften, witzig zu sein, denn schliesslich ist es mein Beruf, meinen Herrn und Meister zum Lachen zu bringen. Doch Sidi stand der Sinn nach nichts. Er hörte mir zerstreut zu, während sich sein Gesicht unversehens zu einem Geflecht von Falten zusammenzog.
Alles schien ganz normal zu sein, aber nichts ist normal, wenn der Löwe auf die Knie gezwungen wird, wenn seine Pranken nur noch stumpfe Holzstücke sind, vor denen niemand mehr erbebt, das ersterbende Feuer seines Blicks eher Mitleid als Schrecken einflösst; ein kraftloser Blick, nach innen gekehrt, ins Dunkel eines zerstörten, gebrochenen Körpers, wo aus dem Gebrüll von einst das zaghafte Echo eines Lebens wurde, das von beiden Enden her brannte, von Exzessen jeglicher Art erfüllt: bitterer Reue und uneingestandenen Niederlagen, schallenden Halbsiegen und tönenden Freuden, tiefstem Leid, Entsagung und Gewissensbissen; eines wildbewegten Lebens, auf dessen gewundenen, dornigen Pfaden einvernehmlich Engel und Dämonen wandeln und wo das grausige Gesetz des Sensenmanns herrscht.
Alles schien ganz normal zu sein, aber tief in der Brust spürte ich einen Kloss. Bekümmert flehte ich früh und spät zu Gott, er möge meinen Gebieter von seinem Leid erlösen und es mir aufbürden, wenn es denn sein müsse, es keinen anderen Ausweg gebe. Ich war bereit, seinen physischen Schmerz auf mich zu nehmen, die Krämpfe, die in seinen Eingeweiden tobten, die spitzen Gabeln, die ihm die Seiten durchstachen. War ich nicht fünfunddreissig Jahre lang sein ergebener Diener gewesen, sein Spassmacher mit der nie versiegenden Phantasie und sein offiziell bestallter Theologe, wenngleich er selber den Titel »Befehlshaber der Gläubigen« trug. Sein literarischer Ratgeber war ich gewesen, seine unbestrittene Autorität in der fabelhaften Welt der Poesie, Zeuge einer Epoche, da die Araber sich im dichterischen Wettstreit mit Vierzeilern bekriegten, die Grammatiker monatelang über Fragen der Vokalisierung, der Deklinationsform oder einen unbedeutenden Akzent stritten, da mathematische oder astrologische Formeln den Platz der Religion einnahmen … jener gesegneten Epoche, die niemals existiert zu haben scheint.
Alles schien ganz normal zu sein, aber nichts war normal für meine Wenigkeit, Muhammad bin Muhammad, den fauligen Abschaum und Bodensatz der Stadt Marrakesch, den nichts dazu vorherbestimmt hatte, Seite an Seite mit den Auserwählten zu leben, der ich den tiefsten Verliesen und Kellergeschossen des Menschseins entflohen war und mich an diesem Juliabend nun hier, hinter meinem sterbenden Gebieter, befand und in meinem Herzen das furchtbare Verdikt des Leibarztes bewegte: »Zwei oder drei Tage höchstens, und wir sind alle Waisenkinder!«
Sidis Aufmerksamkeit wurde von einem ungewöhnlichen Lichtschein angezogen, der aus dem Saal der Geschenke drang: einer immensen Lagerhalle, in der sich Tausende nie ausgepackter Geschenke türmten, die Seiner Erhabenen Majestät von Fest zu Fest dargebracht worden waren.
»Komm«, sprach der König zu mir, »lass uns mal nachsehen, was da los ist!«
»Es ist schon spät, Sidi. Wir sollten zurückkehren, die Nacht ist ein wenig frisch.«
»Nicht bevor wir den Kerl gestellt haben, der mich schon zu Lebzeiten ausplündert«, knurrte er und setzte seinen Weg fort.
»Vermutlich wird da drinnen nur geputzt, Sidi.«
»Um diese Zeit?«
Ich verstummte. Der König schien entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Wenn man abends im Palast umhergeht, ist das Gefühl, allein zu sein, ein trügerisches. Dutzende von Augenpaaren beobachten einen, spionieren einem nach, verfolgen jede deiner Gesten und Bewegungen. Das wusste ich, weil ich mehrere Jahrzehnte zwischen diesen Mauern mit den die Sinne verwirrenden Mosaiken verbracht hatte, inmitten dieser Gärten, in denen Springbrunnen prangten, die an jeder Wegkreuzung denselben Refrain murmelten. Einerseits erschien es mir unglaublich, dass ein Waghalsiger sich erdreisten könnte, im Herzen des Hofes einen Diebstahl zu begehen. Auf der anderen Seite war es keinem verborgen geblieben, dass der dahinsiechende König nur noch der Schatten seiner selbst war, und von daher fühlte mancher sich schon jetzt so frei, die schlimmsten Verrücktheiten zu unternehmen.
Mit Müh und Not erreichten wir den Nordflügel des Palastes, erklommen einige Stufen, bogen in einen langen, überwölbten Korridor ein, der dem Personal vorbehalten war, und erblickten die Tür zur Höhle Ali Babas, die angelehnt war. Sidi stiess sie sachte auf, schob seinen Kopf durch den Türschlitz hindurch und verharrte einen Moment lang reglos. Dann trat er geräuschlos ein. Ich ihm nach. Das Schauspiel, das sich uns bot, war zumindest ergötzlich, einige Wochen zuvor indes noch ganz undenkbar: Ein alter Sklave hatte den Saum seiner Dschellaba zusammengerafft und stopfte in dieses improvisierte Bündel, so viel er nur konnte an kostbaren Kästchen, Schmuckschatullen und Gegenständen jeder Art. Er musste wohl schwerhörig sein, um unsere Anwesenheit so gar nicht zu bemerken. Als Sidi sich vernehmlich räusperte, drehte der Mann sich um, zuckte gehörig zusammen und wäre, als er sich unverhofft dem König gegenübersah, fast in Ohnmacht gefallen. Wie er so vor uns stand, erstarrt und zugleich bebend, schien er etwas sagen zu wollen, aber kein Ton drang aus seinem Mund. Das Ebenholz seines Teints hatte sich ins Violette verfärbt, dessen Glanz, von den Schweissperlen auf seiner Stirn noch verstärkt, Reflexe abgrundtiefen Entsetzens zurückwarf. So wie ich Sidi kannte, hätte ich für die Haut dieses Frechdachses, der noch immer die Beute gegen seinen Brustkorb presste, nicht viel gegeben. Im besten Fall, sagte ich mir, würde er hundert Peitschenhiebe einstecken, die von den allseits gefürchteten Feuersklaven verabreicht werden. Und war für Peitschen das waren! Geflochtener Ochsenschwanz, in Eiswasser getaucht, dessen klatschender Ton für sich allein schon eine Bestrafung darstellt. Ans Schlimmste wagte ich gar nicht zu denken. Doch der König war durchaus unvorhersehbar, niemand konnte seine Reaktionen mit Bestimmtheit voraussagen: Zwar konnte er irgendein Bagatellvergehen mit brutalster Härte strafen, andererseits war er imstande, über schwerste Fehler einfach so hinwegzusehen. Dies stellte er auch an jenem Abend wieder unter Beweis.
»Los«, ermunterte er den Dieb, »beeil dich, und lauf schnell davon! Wenn du das Pech hast, von den königlichen Wachen erwischt zu werden, dann bist du reif für den Galgen.«
Der Sklave wusste nicht ein noch aus, hatte keine Ahnung, ob er dem Herrscher nun glauben sollte oder nicht. Da er sich nicht vom Fleck rührte, ging ich auf ihn zu, schnappte mir aus seinem Bündel, was nach dem Etui einer wertvollen Uhr aussah, und liess es in der Kapuze meiner Dschellaba verschwinden.
»Hab wenigstens so viel Anstand, anderen was von deiner Beute abzugeben, du Fettwanst! Und mach dich davon, bevor Sidi es sich anders überlegt!« Als ich den Anflug eines Lächelns auf den königlichen Gesichtszügen keimen sah, fuhr ich sogleich fort: »Du kannst dich glücklich schätzen, dass Sidi heute Abend guter Laune ist, meiner unmassgeblichen Meinung nach solltest du die Gunst der Stunde nutzen und ihn rasch noch um andere Dinge bitten.«
Der Sklave musterte mich ungläubig, derweil der König lächelte.
»Vielleicht um eine Transportlizenz, irgendeine Konzession, um deine alten Tage finanziell abzusichern.«
»Welcherart Konzession?«, fragte der König belustigt.
Ich näherte mich dem Sklaven und flüsterte ihm ins Ohr: »Eine Transportlizenz für den Bahnverkehr!«
»Bahnverkehr, mein Gebieter!«, stammelte der Unglückliche, ohne nachzudenken.
Und der König brach in herzliches Gelächter aus, das seinen Schmerz erneut aufflammen liess, aber er hörte trotzdem nicht auf. Er lachte und lachte, und es war, als flattere ein Schmetterlingsschwarm davon.
Und ich lachte auch und setzte noch einen drauf: »Eine Lizenz für den Luftverkehr wäre für unseren guten Mann vielleicht einträglicher!«
»Los, beeil dich!«, scheuchte ich den Sklaven. »Du hast dir deinen Schatz wacker verdient.«
Und wir sahen ihm nach, wie er davonschwankte, während ein dünner Faden Urin seinen Weg markierte.
Sidi blieb noch eine Weile in dem riesigen Saal, der unter Bergen von Präsenten erstickte, die auszupacken er weder Zeit noch Lust gehabt hatte. Dieser nutzlose Überfluss bereitete ihm kein Vergnügen. Dort, wohin er sich bald begeben würde, würde er nicht mehr viel brauchen. Das wussten wir beide. Doch den Sklaven noch einmal davonkommen zu lassen hatte ihn durch und durch aufgeheitert.
»Komm«, bemerkte er mit besänftigter Stimme zu mir, »lass uns umkehren.«
2
Nun geht das schon Wochen so, dass alle am Hof so tun, als ob. Eine drückende Atmosphäre hatte nach und nach den üblichen Tumult abgelöst. In sämtlichen Höfen und Korridoren, Küchen und Salongemächern herrschte eine merkwürdige Stille. Hier und dort drang ein zaghaftes Echo, drang verstohlenes Getuschel durch. Die Wachen, deren Stiefelpoltern uns Sicherheit gab, bewegten sich nur noch auf Zehenspitzen voran. Die Sklaven, die wegen allem und jedem in ein donnerndes »Lang lebe Seine Majestät der König!« ausbrachen, sprachen nur noch mit gedämpfter Stimme. Das Kommen und Gehen von Ministern und hochrangigen Persönlichkeiten, des Kronprinzen und anderer Mitglieder der Familie schien mir ein böses Omen zu sein. Auch sie taten so, als ob. Ganz wie der Muezzin der inneren Moschee, dessen melancholisches Timbre vom hellen Klang der Muezzinstimmen aus der Stadt übertönt wurde. Bei Tisch gaben wir vor, normal zu essen und zu reden, das aktuelle Geschehen zu kommentieren, bei dem die Gewalt täglich mehr Raum einnahm, und über alles und jedes zu lachen. Sofia, Sidis Lieblingsenkeltochter, gelang es sehr viel besser als mir, ihm ein Lächeln zu entlocken. Sie stellte mich in den Schatten, drang ungeniert in meine ureigene Domäne vor. Ich schäme mich fast, es einzugestehen, aber von der Warte meiner siebzig Jahre aus war ich doch tatsächlich bisweilen eifersüchtig auf diesen unbekümmerten, heiteren Blondschopf, dessen Capricen meinen Gebieter entzückten. Ich ertappte seinen Blick, der auf ihren roten Apfelbacken, ihrem langen goldenen Haar, den haselnussfarbenen Augen und dem verhätschelten Schmollgesicht ruhte. »Mein kleiner Opal« nannte er sie dann, und sein Gesicht begann zu strahlen, wie es nur das Gesicht eines dunkelhäutigen Wüstenbeduinen mit negroiden Zügen vermag, der unversehens ein Juwel aus nördlichen Gefilden entdeckt. Jenes zarte Geschöpf, das mit seiner milchigen Haut wie eine Rûmia1 aussah und schon mit acht Jahren die seltsamen Sprachen seiner zahllosen Gouvernanten sprach, ein Kauderwelsch, in dem ich nicht das geringste Wort verstand. Sie und ich, wir kämpften mit ungleichen Waffen. Ich musste ein ganzes Feuerwerk an Phantasie entfachen, um mit ihrem Talent, den Gebieter zu erfreuen, gleichzuziehen oder es gar zu überbieten, währenddessen es ihm eine diebische Freude bereitete, unserem geheimen Wettkampf zuzusehen. Wie auch immer, ich bin keiner von denen, die resigniert den Kopf hängen lassen. Ich habe lange genug im Innersten des Serails gelebt, um sämtliche Codes zu beherrschen und die tausendundein Listen und Ränke zu kennen, die es einem erlauben zu überleben. Das Wetteifern war schon immer mein täglich Brot gewesen. Es kam nicht in Frage, mich von einer Rotznase austricksen zu lassen.
Nein, ich hatte Sofia wirklich nicht in mein Herz geschlossen. Aber königliches Geblüt war sakrosankt, im Palast wie ausserhalb. Also lächelte ich wie ein jeder und schmeichelte mit Nachdruck den aussergewöhnlichen Talenten dieses Engels, mit dem der Himmel Seine Erhabene Majestät beschenkt hatte; ihrer Schönheit, ihrer Verschmitztheit, ihrem erstaunlichen Sinn für Humor und der wachen Intelligenz, die der liebe Herrgott in seiner grossen Güte seinen Auserwählten zukommen lässt. Alter Heuchler, mag man einwenden, gewiss, aber nach Art des ganzen Schwarms von Schmeissfliegen, der um die Sterne dieser noblen Residenz kreiste.
Die Abende hingegen gehörten mir. Wenn die kleine Hexe schlafen ging, wurde ich wieder zum Mittelpunkt der Welt. Dann hatte ich meinen Gebieter ganz für mich. Seine Blicke, seine Bewunderung galten nur mir, mit Vergnügen lieh er mir sein Ohr, erwartete von mir hier ein Bonmot, dort eine feinsinnige Replik oder eine gelehrte Querverbindung zwischen einem Ereignis der Gegenwart und einem historischen Geschehen, wie es sich einstmals am Hof eines Kalifen aus der Umajjadenzeit zugetragen hatte und das ich mit pikanten Anekdoten, unerwarteten Wendungen und viel Spannung würzte. Ich liess meiner Phantasie freien Lauf und holte die Zeit, die das kleine Luder mir tagsüber gestohlen hatte, so gut es ging, wieder herein. Endlich unbehelligt von ihren widerlichen Störmanövern, schlüpfte ich ins bequeme Gewand meiner offiziellen Funktion und tauchte tief ein ins Reich der Fabulierkunst, dem ich nach Kräften den Anstrich des Glaubhaften verlieh. Ich vermählte die Wirklichkeit mit der Fiktion und steuerte auf Sicht durch die märchenhaften Gewässer des Wachtraums. Ja, ich wurde wieder zum Magier. Jenem einmaligen Wesen, dessen Dienste sich allein der König leisten konnte. Ich zog Lebensgeschichten aus meinem Hut hervor, die bis dato dem Vergessen anheimgefallen waren, Geschichten, die meinem Kopf und den darüber schwebenden Wolken entsprangen. Phantastische Erzählungen, in einschmeichelnde Worte, ungewöhnliche Bilder gekleidet, die nur auf die Träumerei eines Dichters warteten, um sich betören zu lassen, eine bebende Hand, die sie pflückte und zum Bouquet bände, das ich demutsvoll meinem Gebieter darbrächte.
Wie ihr seht, ist das oberste Ziel meiner merkwürdigen Existenz weiter nichts, als den König glücklich zu machen. Nur dafür lebe ich. Und nichts verschafft mir grössere Freude, grössere Genugtuung als das strahlende Gesicht meines Sidi.
Ein seltsames Schicksal, das ich da habe! Ich, Muhammad bin Muhammad, ein Kind aus dem Volke ohne besonderes künstlerisches Talent, abgesehen von der Fähigkeit, mir alles zu merken, was mir je zu Ohren kommt. Der Himmel hat mir ein Elefantengedächtnis verliehen, wie es bei Zweifüssern höchst selten vorkommt, ein Gedächtnis, das noch den leisesten Hauch aufsaugt, der meine Ohren streift. Einfach alles. Absolut alles. Ich könnte jede noch so banale Unterhaltung, die ich fünfzig Jahre zuvor mit einem entfernten Bekannten geführt hätte, mit einer geradezu verteufelten Präzision und Detailtreue wiedergeben. Und die Bücher, die ich gelesen habe – und ich habe ihrer viele gelesen –, kann ich wörtlich bis auf Punkt und Komma rezitieren, einschliesslich des Vorworts. Ob ihr es glaubt oder nicht, Gott hat mir diese erstaunliche Fähigkeit verliehen, die manche wohl als Gabe bezeichnen würden. Was aber nur zum Teil stimmt, denn ich merke mir alles, Gutes wie Böses. Ich erspare euch die gewaltige Arbeit, die ich an mir selbst leisten musste, um den Groll und den Hass abzustreifen, die ätzenden Rachegelüste, die jene befallen, die nicht vergessen können. Denn ganz ohne Vergessen gibt es kein Vergeben. Zwangsläufig. Ohne das wird es schwierig, ja eigentlich unmöglich. Wenn alte Wunden in haarscharfen Details aufscheinen, wenn die Erinnerung die Glut stets aufs Neue entfacht, verschlingt dies jenen Teil an Menschlichkeit, der zu verzeihen imstande wäre. Da fällt es schwer, die Augen zu verschliessen und das Blatt zu wenden. Doch das ist eine ganz andere Geschichte. Heute möchte ich euch nur von den Vorzügen eines solchen Gedächtnisses erzählen, denen ich meinen kometenhaften Aufstieg in die höchsten Sphären der Macht verdanke, von jener Segnung, die mich zu dem gemacht hat, der ich bin: erster Höfling des mächtigsten Mannes im Königreich. Und ich sage es ohne jede Anmassung: Mein Gebieter schätzt mich mehr als den ganzen Trupp von Musikern, Märchenerzählern und sonstigen Schleimern, der den Hof ausmacht. Ich bin der Dreh- und Angelpunkt, um den sämtliche Gespräche kreisen, der Gelehrte, dessen Wissen die scharfsinnigsten Geister in den Bann zieht. Ja, ich verdanke alles diesem Gedächtnis, aus dem ich instinktiv seit frühester Jugend Profit gezogen habe. Den Koran oder die Hadithe, die von den Gefährten des Propheten überlieferten Sprüche, zu studieren war mir ein Kinderspiel. Tausend Verse auswendig zu lernen, um die arabische Grammatik zu beherrschen, war ein Spaziergang für mich, um den mich viele meiner Mitstudenten von der Madrasa Bin Jûssuf beneideten. Und erst die Dichtung, da gibt es nicht einen Autor, dessen Œuvre ich nicht in- und auswendig wüsste. So ist es nun eben, und das ist nicht mein Verdienst. Wollte ich meinen Geist von all dem Müll, mit dem er überfrachtet war, befreien, wäre das verlorene Liebesmüh. Da liess sich nichts ändern. Die zahllosen Schubladen, aus denen er bestand, schnappten jäh zu und weigerten sich, auch nur das kleinste Quäntchen freizugeben. Nolens volens behielt ich somit alles im Gedächtnis: Nützliches wie Unnützes, das Wichtige und das Alberne; eine Masse von Informationen, die im Kopf jedes anderen einen gewaltigen Stau verursacht hätte, während der meine, wiewohl er nicht eben voluminös war, problemlos damit zurechtkam. Ich musste nur irgendwo an einem Faden ziehen, und schon rollte ich die komplette Spule ab, ohne mich auch nur einmal zu verhaspeln. Vor mir breitete sich die Vergangenheit aus, nahm den Raum in Besitz, schob die Gegenwart mit dem ganzen Gewicht und Stolz des Urahnen angesichts seiner Nachkommenschaft zur Seite. So, das vorab einmal klarzustellen, das war mir doch wichtig, damit ihr besser versteht, wie ein Mann meiner Herkunft seinen Platz in der gnadenlosen Welt eines Königshofs finden konnte, noch dazu als dessen umschwärmter Mittelpunkt.
Diese höchst erstaunliche Geschichte ist die meine. Ich habe sie mir nicht wirklich ausgesucht, mich aber auch nicht dagegengestemmt, ich habe die Dinge einfach laufen lassen, wie die meisten Menschen es tun.
Angefangen hat das alles mit einer ziemlich unwahrscheinlichen Freundschaft. Bin Brahîm war nicht die Art Freund, den ich mir normalerweise ausgesucht hätte. Zum einen war er ein gutes Jahrzehnt älter als ich. Dann passte auch seine ausgeprägte Neigung zum Alkohol und seine Vorliebe für junge Knaben in keiner Weise zu der puritanischen Erziehung, die ich genossen hatte. Meine eigene sexuelle Orientierung war denkbar klassisch, und schon der Gedanke, meine Handlungen nicht vollends im Griff zu haben, war mir zuwider; mit einem solchen Individuum Umgang zu pflegen verstiess gewissermassen gegen meine Natur. Und das umso mehr, als diese Beziehung nur allzu leicht falsch interpretiert werden konnte. Da üble Nachrede bei uns als Nationalsport gilt, öffnete es der Spekulation Tür und Tor, wenn man mit einem wie Bin Brahîm durch die Strassen zog. Andererseits aber war dieser Mann – und ich wäge meine Worte – der ohne jeden Zweifel bedeutendste Dichter, den unser Land jemals kannte.
Wie von der Entstehung dieser Freundschaft erzählen, ohne meinen Vater Muhammad zu erwähnen, seines Zeichens Barbier? Und noch so einiges mehr. Er war zudem Musiker, war Erzähler und von ungewöhnlich angenehmem Wesen. Mit anderen Worten, auf Personen seines Schlags und Talents traf man nicht alle Tage. Und so blieb es nicht aus, dass mein Vater sich irgendwann am Hof von al-Glawi wiederfand, jenem Pascha, der zur Zeit des französischen Protektorats Herrscher über den gesamten Süden des Landes war. Eine Art Kleinkönig, auf den die Besatzer sich gestützt hatten, um grosse Teile jenes prächtigen, von der Schöpfung begünstigten Reiches, welches das unsere war, zu befrieden und zu zivilisieren