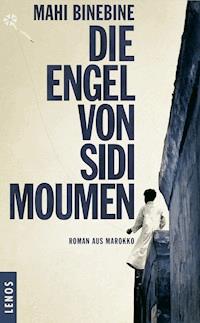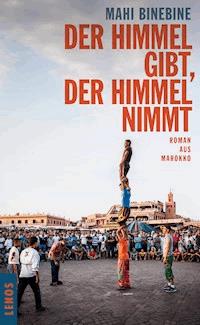14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lenos Babel
- Sprache: Deutsch
In der ärmlichen Rue du Pardon in Marrakesch ist Hayat aufgewachsen, die Erzählerin in Mahi Binebines neuestem Roman. Wegen ihrer blonden Haare wird sie verachtet, und auch in ihrer Familie erfährt sie Gewalt. Hayat flüchtet und gewinnt dank Mamyta, der größten orientalischen Tänzerin Marokkos, ein neues Leben. Mamyta ist eine Art Geisha - Sängerin, Tänzerin, Liebhaberin. Eine freie Frau in einer Gesellschaft, in der vieles verboten ist. Sie tanzt an Festen und in den beliebten Kabaretts. Verunglimpft und bewundert zugleich, sind ihre Lieder eine Mischung aus Unanständigem und Heiligem. Wenn man Mahi Binebine liest, glaubt man, diese stolzen Frauen vor sich tanzen zu sehen, und wird verzaubert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
www.lenos.ch
Mahi Binebine
Rue du Pardon
Roman
Aus dem Französischenvon Christiane Kayser
Der Autor
Mahi Binebine, geboren 1959 in Marrakesch (Marokko). Studium der Mathematik in Paris. Lehrer. Hinwendung zur Literatur und Malerei. Heute gilt er als bekanntester Maler Marokkos, seine Bilder hängen u.a. im New Yorker Guggenheim-Museum. Sein umfangreiches schriftstellerisches Werk wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und u.a. mit dem Prix de l’Amitié Franco-Arabe ausgezeichnet. Nach Jahren in Frankreich und den USA lebt Mahi Binebine seit 2002 wieder in Marrakesch. www.mahibinebine.com.
Die Übersetzerin
Christiane Kayser, geboren 1954 in Esch-sur-Alzette, Luxemburg, übersetzt aus dem Französischen, u. a. Tahar Ben Jelloun, Jean Vautrin, Tonino Benacquista, Boualem Sansal und Fouad Laroui. Sie lebt teils in Berlin und teils in einem Dorf südlich von Toulouse. Sie engagiert sich ausserdem seit vielen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit in verschiedenen Ländern Afrikas. Mitgründung des Pole Institute in Goma, D. R. Kongo, Begleitung der Afrikaarbeit des Zivilen Friedensdienstes beim Evangelischen Entwicklungsdienst (EED), später Brot für die Welt. Sie ist Mitherausgeberin des Mapinduzi Journal und der Reihe Building Peace / Construire la Paix.
Titel der französischen Originalausgabe:
Rue du Pardon
Copyright © 2019 by Editions Stock
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © der deutschen Übersetzung
2021 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Coverfoto: Gabriel Boisdron
eISBN 978 3 85787 987 6
www.lenos.ch
Für Abdellah, der zu früh von uns gegangen ist
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
1
Mit meiner Dreikäsehöhe balancierte ich auf einem wackligen Hocker vor dem Spiegel im Bad und erhaschte einen Blick auf den Anflug von Augenbrauen, den oberen Teil meiner Stirn und den Gummi, der meine widerspenstigen Locken bändigte. Ausserhalb meines Sichtfelds wucherte meine dichte Wildfangmähne, die meine Mutter verabscheute. Sobald ich mich ihr näherte, bewegte sich ihre Hand wie von einem Magneten angezogen zu der wilden Mähne, den Glutbüscheln, die sie vergeblich zu glätten versuchte. Was wie Zärtlichkeit wirkte, war in Wahrheit der tägliche Kampf meiner Erzeugerin gegen die natürliche Unordnung der Dinge. Doch die starrköpfige und eigensinnige Natur behauptete immer wieder ihr Recht. Sobald ich aus dem Haus trat, entledigte ich mich meines Stirnbands und wurde wieder zum kleinen, molligen Wuschelkopf aus der Rue du Pardon. Ich habe mich oft gefragt, warum meine Mutter sich so sehr an meinem Haar störte. Sah sie einen Fluch darin? Die Vorboten meiner künftigen Verdammnis? Vielleicht. Jedenfalls sah sie mich an wie eine Ausserirdische von einem unbekannten Planeten, die hier gestrandet ist. Sie konnte noch so viel unter ihren Vorfahren wie denen meines Vaters nachforschen, sie fand nicht den Hauch eines Ahnen, von dem ich einen solchen Wuschelkopf geerbt haben könnte, der noch dazu blond war!
Ich meinerseits fühlte mich ebenfalls nicht zu diesem Stamm zugehörig, in den ich hineingeboren worden war und bei dem ich eine schwierige und bedrückende Kindheit durchlebt hatte. Abgesehen vom gewalttätigen und heimtückischen Charakter meiner Eltern war ihre Welt stumpf, trist, phantasielos und tödlich langweilig. Der einzige heitere Tupfer in meiner Umgebung bestand in den mit Goldfaden auf einen Gebetsteppich gestickten Koransprüchen an der Wand des Wohnzimmers. Noch bevor ich lesen lernte, liebte ich es bereits, meine Pupillen durch die auf dem samtenen Hintergrund ineinander verschlungenen Arabesken zu verwirren. Der Rest wurde von der Farbe Grau bestimmt: Wände, Behänge, Gesichter, Mobiliar. Bis hin zum Fell der Katze. Ein verstaubtes Grau in allen Tönen der Depression. Passend zum Dekor herrschte bei uns von morgens bis abends düsteres Schweigen. Hätte Vater die Spatzen zum Schweigen bringen können, nichts hätte ihn davon abgehalten. Was Musikhören betraf, war nicht daran zu denken. Vater stellte das Radio nur zu den genauen Zeiten der Nachrichtensendungen an. Dann leierte eine tiefe Stimme monoton die Einzelheiten der glorreichen königlichen Taten herunter, wie immer gefolgt von einem Einheitsbrei aus Katastrophen, Kriegen und Schiffbrüchen.
Jedoch hatte ich mich – wie es Kinder so gut mit ihren Eltern können – an die Meinen angepasst, an die Dürftigkeit ihrer Empfindungen und an ihre Hässlichkeit. Durch eine geheimnisvolle Alchemie hatte ich eine Blase geschaffen, in die ich mich flüchtete, sobald die Umgebung toxisch wurde. Im Schutz meiner Blase liess ich mich vom Atem der Engel hinwegtragen. Es wird Sie überraschen, dass ein Schwarm als Schmetterlinge verkleideter Engel ein kleines Mädchen in seiner Luftblase hoch in den Himmel ziehen kann. Ich verstehe Ihr Erstaunen. Doch ich versichere Ihnen, genau wie ich Sie sehe, sah ich jene himmlischen Kreaturen auffliegen, beschwingt von den wunderbaren Geschichten, die mir Serghinia erzählte. Sie sagte, deren Mission auf Erden sei, den Weg für die Künstler zu bereiten.
Habe ich Ihnen eigentlich erklärt, dass ich eine Künstlerin bin?
Seit meiner frühesten Kindheit konnte ich die Sprache der Engel entziffern; deshalb verschaffte ich mir mit eigenen Mitteln Zutritt zum Reich der Träume und der Schmetterlinge. Ein bezauberndes und verzaubertes Reich aus Funken, Schauern, Lachgrübchen und allen Farben des Regenbogens. Inmitten der trockenen, strengen Starre meines Umfelds fand ich dort die Anmut der Rundung, den Tanz der Spirale, die zarte Eleganz, das Feingefühl und die Feinsinnigkeit der Wesen, die sich auf Zehenspitzen bewegen.
Eine Göttin regierte dieses Land: unsere Nachbarin Serghinia. Später werde ich Ihnen die fabelhafte Geschichte dieser Künstlerin erzählen, in deren Haus ich – wie ich heute ohne Angst bekennen kann – das Glück gefunden habe. Diese Frau war meine Familie, meine Freundin, meine Zuflucht.
Vor dem Spiegel im Bad von Serghinias gepflegter Wohnung konnte ich auf Zehenspitzen meine etwas abstehenden Ohrläppchen sehen, geschmückt mit massiven silbernen Ohrreifen, die mir meine Mutter verbot ausserhalb der Feiertage zu tragen. Das schonungslose Spiegelbild zeugte vom Ausmass der Katastrophe: ein mit schreiend rotem Lippenstift verschmiertes Gesichtchen, glänzend, kein Teil meiner sonst so weissen Haut ungeschminkt; Hurenrot, wie es meine Mutter genannt hätte, einer dieser zinnoberroten Töne, die mich auf Serghinias vollen Lippen so faszinierten. Das Wort »Hure« bekam einen besonderen Charakter in meinen jungfräulichen Ohren, wenn meine Mutter es aussprach. Hu-re. Das knallte wie die Eleganz einer befreiten Frau, das verlangte nach der Freiheit, öffentlich in einer hautengen seidenen Dschellaba mit dem Hintern zu wackeln, das hielt die brennende Fahne der Auflehnung hoch in den Himmel.
Doch ganz unten am Ende des Spiegels, wo die weissen Kacheln an der halboffenen Tür aufhören, sah ich – während ich die Augen wegen meiner sündigen Schminke weit aufriss – Serghinias strahlendes Gesicht. Unter theatralisch gerunzelten Augenbrauen grollten ihre leuchtenden Augen kaum, verziehen schon halb. Sie kam mit ausgebreiteten Armen auf mich zu, beunruhigt, da sie einen Sturz befürchtete.
»Mein Täubchen, dieser Hocker ist wacklig! Am Ende fällst du noch runter!«
Blitzschnell wurde mein schmächtiger Körper von ihrer fülligen Figur umarmt.
»Lass mich dir zeigen, wie man zu einer Prinzessin wird, Liebes. Lippenstift ist, wie der Name schon sagt, ausschliesslich dazu da, die Lippen zu färben. Nicht die Stirn oder deine von Natur aus rosigen Wangen und noch weniger deine jetzt blutig wirkenden Augenlider, mit denen du aussiehst wie eine direkt aus einer Horrorgeschichte eingeflogene Hexe. Du bist doch keine Hexe, nicht wahr, Liebling? Also gib dir Mühe wie mit Aïda und Sonia beim Ausmalen. Übermale unter keinen Umständen die Ränder. Verstanden?«
»Ja, Mamyta.«
»Gut. Wasch dein Gesicht mit viel Wasser ab, und bring es mir schnell, damit ich es verschlingen kann!«
Aïda und Sonia, die Zwillingstöchter von Serghinia, hatten sie Mamyta getauft. Ich nannte sie auch gerne so, aber mit Varianten: Mami, Mya, Maya, Mamyta. Jede Silbe dieses Spitznamens beinhaltete ihren Teil Zärtlichkeit. Es roch gut nach dem Moschus ihrer beruhigenden Brüste, ihren Lachsalven und den schallenden Küssen, die eine so schöne Spur auf unseren Wangen hinterliessen.
Hätte mich unglücklicherweise meine Mutter in diesem Zustand überrascht, vor dem Spiegel auf einem wackligen Hocker im Bad, die Gandura in die Hose gestopft, das Antlitz mit scharlachroter Sünde verschmiert, wäre es das Ende der Welt gewesen: eine ordentliche Tracht Prügel, durchsetzt mit endlosem Schreien und Jammern, und dann vor allem als Nachtisch das von mir am meisten gefürchtete Versprechen: »Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt!«
Ich mochte meinen Vater nicht. Ich mochte seine blutunterlaufenen Augen nicht, wenn der Zorn ihn übermannte. Es waren nicht so sehr die Schläge, die mir Angst machten, eher der Rest … Ich hasste sein dunkles Zimmer, seinen Atem, seinen kratzigen Bart, seine riesigen Hände … und den Rest. Den ganzen Rest.
2
Bei den Künstlern, die ihren Körper als Arbeitsinstrument nutzen, ist Schönheit nicht unbedingt erforderlich. Mamyta kann man kaum als Huri bezeichnen. Beim genaueren Betrachten ihrer Gesichtszüge kann man, ohne auf Widerspruch zu stossen, behaupten, dass unsereins ästhetisch gesehen unter dem nationalen Durchschnitt liegt. Ihre spiralförmigen Augen mit dick aufgetragener Wimperntusche, ihre kurze Stupsnase, ihr riesiger, mit fleischigen Lippen versehener Mund und ihre altmodischen Tattoos auf Stirn und Kinn gehören auf keinen Fall zu einer Odaliske. Weit entfernt. Jedoch bildet das alles zusammen in einem einzigen freudestrahlenden Antlitz ein sehr angenehmes harmonisches Ganzes. Wenn man ihre massiven Goldzähne dazunimmt, die bei jedem Lachen wie ein Feuerwerk blitzen, ihren hundert Kilo schweren, milchigen, in einen Satinkaftan gezwängten Leib, ihre raubkatzenhafte Art, bei der jeder Teil des Körpers selbständig, ungebunden, wie vom Rest losgelöst scheint, kann man auch behaupten, diese Kreatur mit einem Schönheitsmal auf der Wange habe zweifellos ein gewisses Etwas.
In Wirklichkeit gibt es zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Seiten von Mamyta: die der transparenten Hausfrau, die man morgens in einer der Querstrassen zur Rue du Pardon im Suk antreffen könnte, mit ihrem Einkaufskorb aus Palmblättern, oder die ganz einfach über die Grand-Place schlendert; dann gibt es die andere Seite, die der Diva im schillernden Kaftan, die einen abends auf einer Hochzeitsfeier erregt, bei einer Beschneidung oder bei einem dieser privaten Abende, die Männer auf der Terrasse eines Cafés in ihrer Melancholie flüchtig erwähnen.
Da ich meine Kindheit und einen Teil meiner Jugend bei Mamyta verbrachte, hatte ich das Privileg, am Wunder dieser Metamorphosen teilzuhaben. Zuerst als gewöhnliche Zuschauerin, staunend wie ein Kind vor einer bunten Trommel am Festtag, dann später in der ersten Reihe, als sie mir die Ehre erwies, mich in ihre Truppe aufzunehmen, um mich vor meiner Familie zu retten …
Meine Geschichte ist wirklich seltsam. Unwahrscheinlich und tragisch wie so oft die Geschichten aus unserer Gegend. Doch nur Geduld! Ich werde es Ihnen erzählen, wenn Sie mir Ihre Nachsicht schenken. Zeitweise wird meine Erzählung überraschende Wendungen nehmen. Sollten Sie sich darin verirren, wird ein Mondstrahl aus dem Nichts aufleuchten, um Ihnen den Weg hinaus zu zeigen … Doch ich zweifle sehr, dass Sie mein Labyrinth verlassen wollen. Die Freiheit meiner Vorstellungskraft wird Ihnen gefallen, wie auch meine Launen und einige unvorhersehbare Situationen, die, wie ich eingestehe, mich selbst überraschen. Sehen Sie darin weder Boshaftigkeit noch Eitelkeit, ich will einfach nur sagen, dass jene, die sich damals hineinwagten, niemals herausgefunden haben. Ein Geflecht aus empfindlichen Fasern hält sie gefangen … eine sanfte Spinnwebe, in der es so guttut, sich gegen alles und jeden zu wehren …
Ich habe Ihnen also von jenem magischen Moment erzählt, in dem sich Mamyta die Raupe in einen das Licht umschwirrenden Schmetterling verwandelt. Es war zur Zeit meiner ersten beruflichen Schritte. Ich war vierzehn, sah aber viel älter aus. Mamyta achtete darauf, mich selbst zu schminken; sie vergrösserte meine Augen mit einem Lidstrich bis hin zu den Ohren, betonte meine Wangen mit einer Schminke auf der Basis von Schildläusen, und als Krönung des Ganzen puderte sie meine Haarlocken mit einer Handvoll vergoldeter Sterne. Die kleine Aufmüpfige aus der Rue du Pardon verwandelte sich plötzlich in eine Prinzessin; eine begnadete Künstlerin, glänzend und feinsinnig, setzte sich von ihren Konkurrentinnen ab wie der Tag von der Nacht. Die Zwillinge, die vor mir in die Truppe aufgenommen worden waren, bedachten mich mit reissender Eifersucht, so unerträglich war ihnen die Zuneigung, die ihre Mutter mir entgegenbrachte.
Dabei sprühte Mamyta vor Zärtlichkeit. Ihre Liebe zu mir schränkte in keiner Weise ihre Liebe zu ihren Töchtern ein. Das bewiesen schon allein ihre unterstützenden Blicke für jede von uns während der Vorführung. Ich liebte es, sie lächeln zu sehen, wenn ich die Initiative ergriff und auf den runden Tisch sprang. Ich tanzte für sie. Für sie allein. Dann gab es nichts anderes zwischen meinem elektrisierten Körper und ihrem magnetischen Blick. Ich ahmte ihre Gesten nach, ihr unwiderstehliches Augenzwinkern, ihre Art, den Boden mit ihrem Haar aufzupeitschen, wenn der Teufel von ihrem Körper Besitz ergriff. Während die Tamburine und Zimbeln den Höhepunkt erreichten, verlängerte ich das Echo ihrer mitreissenden Lieder, ihrer fröhlichen Moritaten. Ich wäre so gern gewesen wie sie. Besser noch, ich wollte sie sein. Mich aus meiner sterblichen Hülle befreien, mich in jenes Lichtgewand kleiden, das sie auf der Bühne umfing.
Ein majestätischer Auftritt, bei dem alles einstudiert war, bemessen, gewichtet, bei dem jede Einzelheit Bedeutung hatte. Umringt von ihren Musikern und Tänzerinnen wie von einer Leibgarde, mit langsamen Schritten, herausgestrecktem Unterkörper, den Blick auf die Sterne gerichtet, erschien sie endlich vor einem ihr gewogenen, ungeduldigen Publikum, das es kaum erwarten konnte. Kaum erhob sie die Stimme, brandete kollektive Hysterie auf. Diese raue, sicher von altem Schmerz brüchige Stimme erschallte, durchflutete den Innenhof und über die gen Himmel gerichteten Lautsprecher das ganze Viertel. Aufrecht, beherrschend, mit offenen, verführerischen Armen wie Äste einer Zeder, die Spatzen zu einer liebestrunkenen Parade auffordern, stimmte sie Lieder an, in denen sich das Schlüpfrige und das Heilige miteinander verwoben, liess ihren Dämonen freien Lauf, um sich fast bewusstlos in die Menge zu stürzen. Dann riss die Brandung ihren Leib an sich, schlug den Weg der Schauer ein, erreichte den Unterleib, der sich aufrichtete, verschlang den Nabel und liess langsam nach wie eine ersterbende Welle. Das Wogen kam wieder auf, wurde ansteckend, erfasste die Anwesenden und riss sie in ein fieberndes Schlingern.
Die Ehemänner waren dabei, sie bedeckten die Tänzerinnen mit Geldscheinen, je mehr zusammenkam, desto schneller wurde der Rhythmus, passte sich den pochenden Herzen an und brachte das Blut zum Kochen. Die Ehefrauen waren keine Ehefrauen mehr. Sie sangen und lachten ausgelassen. Sie vibrierten wie wir, die Berufstänzerinnen, die sie nachahmten, um sinnlich zu wirken; doch sie waren linkisch, fast vulgär. Nicht die aufgesetzte Vulgarität, die wir nach Gutdünken einsetzen, nein, die wahre, suggestive und unverblümte Vulgarität, die vor sexuellem Frust aufschreit. Dann spielten wir, weiter und weiter, und liessen ihr unwiderstehliches Verlangen aufblühen, uns zu ähneln … unsere leichte, zügellose Moral öffentlich auszuleben …
Eines Abends, als sie nach ihrem Auftritt in den Kulissen stand, während die Musiker einheizten, und die entfesselten Zuschauer beobachtete, bemerkte Mamyta mir gegenüber: »Schau, mein Kind, schau diese tanzenden Frauen, sie sind so glücklich … Ich sehe weder Mütter noch Tanten, Schwestern oder Cousinen … Sie alle sind Liebhaberinnen … Siehst du, ich besitze die Macht, sie einen Augenblick lang aus ihrem kleinen Leben zu lösen und strahlende Dulzineen aus ihnen zu machen … auch wenn diese Schnepfen mich hinter meinem Rücken als Hure verunglimpfen!«