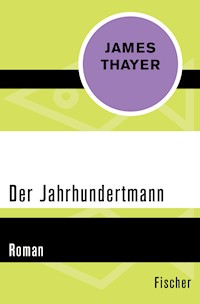
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Jahrhundertmann ist 108 Jahre alt – und sein Arzt ist schon lange tot. Er ist der Mann, der Roosevelt aus der Patsche half, der am Boxeraufstand in China teilnahm, der Sklave sudanesischer Derwische war, Leibwächter von Oscar Wilde und Enrico Caruso – und ein Liebling der Frauen. Woodrow Lowe, so sein Name, erzählt eine der phantastischsten und abenteuerlichsten Lebensgeschichten des zwanzigsten Jahrhunderts. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Leseprobe zu:
James Thayer
Der Jahrhundertmann
Roman
Aus dem Amerikanischen von Otto Bayer
FISCHER Digital
Erfahren Sie mehr unter: www.fischerverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.
© S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Inhalt
1 Zwei Geißeln
Ich begegnete den beiden großen Geißeln meines Lebens am selben Tag. Sie sollten mich, beginnend an einem Sommernachmittag des Jahres 1879, zusammen siebzig Jahre lang plagen, wenn man die Jahre getrennt zählt und dann addiert. Zum Glück plagten sie mich aber gleichzeitig und ließen so den letzten Teil meines Lebens unbehelligt. Diese Zeit brauchte ich, um mich zu erholen.
Die Lowes waren während der großen Hungersnot von County Kilkenny nach Boston gekommen. Mein Vater arbeitete im Tiefbau für den aufstrebenden irischen Bauunternehmer Timothy Hannon: hob Gräben aus, ebnete Straßen, füllte Sümpfe in der Back Bay auf, legte Fort Hill flach und schaufelte die Trasse für manch großen Boulevard der Stadt.
Meine Mutter, geborene Annie Tighe, diente bei einer Familie in Beacon Hill, wo sie für fünfundachtzig Wochenstunden ganze 3,75 Dollar nebst Kost und Logis bekam und sich krank arbeitete, bis sie zuletzt im St. Joseph landete, dem katholischen Heim für kranke und mittellose Dienstmädchen. Dort lernte sie eines Tages meinen Vater kennen, als sie am Zaun lehnte und er gerade vorbeikam.
Eine Woche später waren sie verheiratet, und mein Vater versprach ihr, dass sie nie mehr werde arbeiten müssen, was sie dann auch nicht tat, sofern man die hundert Wochenstunden nicht mitzählt, in denen sie unsere Sachen wusch, unser Essen kochte, die Fußböden fegte und meinem Vater die Haare aus Nase und Ohren schnitt.
Mutter war eine ehrliche, fromme Frau ohne jegliche Marotten, abgesehen von der Behaarung ihres Mannes. Soweit ich zurückdenken kann, setzte sie Papa jeden Abend, auch sonntags, auf einen dreibeinigen Melkschemel und zupfte zehn Minuten lang mit einer Pinzette an ihm herum, immer auf der Suche nach unbotmäßigen Härchen in Nase, Ohren und anderswo. Mein Erzeuger flehte und bettelte um die Erlaubnis, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, aber das kam überhaupt nicht in Frage.
Als ihr Ältester sollte ich natürlich Priester werden. Aber nachdem ich erst zehn Jahre alt war, hatte sie nicht mehr die Kraft, mich in einen Beichtstuhl zu zerren, womit meine religiöse Erziehung endete, und ich habe seitdem keine Kirche mehr von innen gesehen, höchstens zu der einen oder anderen Trauung, oder zur Aussegnung verstorbener Freunde und Verwandter, das heißt aller meiner Freunde und Verwandten. Das Schlimmste daran, über hundert Jahre alt zu werden, ist die Vielzahl der Begräbnisse, zu denen man gehen muss, und es waren reichlich viele, das kann ich Ihnen flüstern. Jetzt leisten mir vor allem die Toten Gesellschaft.
Als ich vierzehn wurde, fand ich, dass ich nun alles gelernt hatte, was sich zu lernen lohnte, und ging vom Dwight-Gymnasium in der Springfield Street ab, um bei meinem Vater zu arbeiten, was meine Mutter beinah unter die Erde gebracht hätte.
Mit Mamas Zunge hätte man Hecken schneiden können, und sie blieb nur am Leben, um Papa weiter die Leviten lesen zu können. Sie waren dreiundsechzig Jahre miteinander verheiratet, und nachdem Papa aus dieser Welt gegangen war, starb Mama zehn Tage später an Einsamkeit. Ich habe mich über die fortdauernde Liebe zwischen den beiden nie genug wundern können, denn man muss die dreiundsechzig Jahre Zank und Streit bedenken, die sie hinter sich hatten.
Hauptsächlich ging es bei diesen Streitereien um die Art seines Broterwerbs, nachdem mein Vater sich von Hacke und Schaufel verabschiedet hatte. Eines schönen Tages hatte nämlich ein Handlanger eine Ladung Ziegelsteine vom Baugerüst fallen lassen, und sie waren genau auf Papas Schatten gelandet, woraufhin er seine Idiotenkrücke – so pflegte er die Schaufel zu nennen – wegwarf, sich von seinem Bruder, der Leichenbestatter war, dreihundert Dollar borgte und Lonnie’s Haus der Entspannung an der Lenox Avenue kaufte. Das war in Roxbury, nicht weit von der früheren Bostoner Universität. Papa benannte das Haus der Entspannung in «Joe Lowe’s Museum und Sportpalast» um.
Ein weiterer Streitpunkt war die Angewohnheit meines Vaters, in kalten Winternächten das Schlafzimmerfenster im zweiten Stock zu öffnen und einen dampfenden Strahl ins Freie zu entsenden, statt über den Flur zu gehen und den eiskalten Abtritt zu benutzen. Meine Mutter hat es nie über sich gebracht, Mrs. Shaw in Wohnung 2A darüber aufzuklären, warum aus den Petunien in ihren Fensterkästen nie etwas Rechtes werden wollte. Aber ich schweife ab.
«Joe Lowe’s Museum und Sportpalast» war ein Saloon, ein Ort also, an dem ein Mann sein Pläsier finden konnte. Nun ist das Wort «Saloon» im Lauf der Jahre von alten Herren, deren Gedächtnis verschwommener ist als meines, ein bisschen verklärt worden, weshalb das Etablissement meines Vaters gewisser Erläuterungen bedarf. Das Boston von 1879 war eine Stadt der Straußenfedern, Pferdeäpfel, Schwingtüren, Korsetts, Puffärmel, Nippesvitrinen, Gaslaternen, Spitzbogenfenster, krummen Gassen, Cholera und Segeltuchschuhe, eine Stadt der Stehkrägen und des schlechten Geschmacks. Und den schlechten Geschmack konnte man vor allem in «Joe Lowe’s Museum und Sportpalast» befriedigen.
Die Ostwand nahm eine Bar ein, mit facettierten Spiegeln, kannelierten Nussbaumsäulen und kunstvoll geschnitzten Leisten darüber, aber dem Holzschnitzer mussten, als er sich eine Inschrift für den polierten Fries ausdenken sollte, die Ideen ausgegangen sein, denn dort stand, wenn auch in wunderschönen Old-English-Lettern, nichts weiter als: TRINKET, TRINKET, TRINKET.
Stühle oder Hocker gab es in dem Saloon keine, dafür ein Dutzend Spucknäpfe entlang der Bar. Zwar waren rundum an den Wänden flackernde Gaslampen installiert, aber es war immer düster in dem Raum, sogar mittags. Auf den Regalen hinter der Bar stand ein Whiskeyfässchen neben dem anderen. Der Strom der Iren nach Roxbury hatte so ab 1858 begonnen, als die Pferdebahn den Betrieb dorthin aufnahm, aber es gab in dem Viertel auch Deutsche und somit etliche von ihren Brauereien, sodass Papa nur allerbestes Bier ausschenkte. Kleine Jungen mussten «Kannengänge» machen – das heißt nachmittags in den Saloon kommen und für ihre Väter eine Kanne Bier holen. Es waren dieselben Blechkannen, in denen die Eisenbahnarbeiter, Kanalgräber und Kohlenschlepper morgens ihren Kaffee und das Mittagessen zur Arbeit mitnahmen. Manche Jungen verdienten sich mit «Kannengängen» für die Arbeiter regelrecht ihren Lebensunterhalt. Zwei emsige Bürschchen konnten bis zu einem Dutzend Kannen an einer Stange zwischen sich tragen.
Der Whiskey – den meine Mutter in Anspielung auf den original irischen Schwarzbrand potheen nannte, wenn sie gegen das Gewerbe meines Vaters wütete – war rau und scharf, des Kesselflickers Freude. «Kein Geschmack, das reine Feuer», pflegte mein Vater stolz zu erwidern. Es gab keine Mischgetränke, schon gar nicht solches Spülwasser wie shandygaff, das ein Gemisch aus Bier und Gingerale war und hauptsächlich von den Harvard-Studenten getrunken wurde, wenn sie in Häusern wie dem «Young’s Hotel» Billard spielten.
In «Joe Lowe’s Museum und Sportpalast» war Boxen angesagt. Die Wände waren tapeziert mit lithografierten Plakaten, auf denen die Größen der Faustkämpferzunft verewigt waren: Jack Slatt, der Schlächter von Norwich und Erfinder des «Karnickelschwingers» – ein anderes Wort für Nackenschlag; Monsieur Petit, der erste Franzose, der sich dem Boxsport verschrieb und mit seinen knapp zwei Metern Körpergröße und zwei Zentnern Lebendgewicht natürlich «der Riese» genannt wurde; und James Burke, «der Taube», der den bis dahin längsten Meisterschaftskampf bestritten hatte, neunundneunzig Runden mit einer Gesamtdauer von dreieinviertel Stunden, nach denen sein Gegner Simon Byrne umkippte und nie mehr aufstand. Das Meisterwerk an der Saloonwand war eine Reproduktion von Lord Byrons Wandschirm, auf dem Szenen aus Kämpfen um die englische Meisterschaft dargestellt waren: 1791 zwischen Tom Johnson und Big Ben Brain, 1788 zwischen Johnson und Daniel Mendoza, und viele andere.
Der Boxring befand sich im hinteren Teil der Kneipe. Damals hatte ein Boxring weder gepolsterte Pfosten noch stoffumwickelte Seile noch eine Matte auf dem Boden. Papas Boxring bestand aus vier Holzpfosten mit zwei groben Seilen dazwischen und sonst nichts. Wer umfiel, ging wortwörtlich auf die Bretter.
Ich will hier kurz einmal unterbrechen und sagen, dass Papa das Wort «Museum» nur in den Namen des Lokals aufgenommen hatte, um Mama zu beschwichtigen. Immerhin hat der berühmte Klugscheißer Horace Greeley einmal über das Boxen geschrieben: «Es ist die natürliche Schwerkraft seiner Gemeinheit, nach der es stinkt. Es ist in den Schnapsbuden zu Hause, den Bordellen und niederen Spielhöllen.» Die Vorurteile gegen das Preisboxen saßen tief in der ganzen Gesellschaft und in Mama noch tiefer. Sie hat den Saloon in all den Jahren seines Bestehens nicht ein einziges Mal betreten. Und da Papa nie in den Ruhestand gegangen ist, bestand «Joe Lowe’s Museum und Sportpalast» so lange wie er.
Den Museumsteil des Saloons stellte eine große, bei «Brendel’s» gebraucht gekaufte Vitrine dar. Sie stand an einer Wand, genau unter dem Porträt von Jack Slatt, und enthielt die kostbarsten Raritäten. Ich konnte stundenlang davor stehen und mir den Schrumpfkopf aus Niederländisch-Guyana ansehen, das auf ein Reiskorn gravierte Vaterunser (natürlich hinter einem Vergrößerungsglas), St. Eglactises mumifizierten Krummfinger, die zwei Hauer eines Keilers, ein zweiköpfiges Kätzchen im Einmachglas, sechs Barthaare von Robert E. Lee und die Daumenschrauben eines mittelalterlichen Folterers. Wen wundert es, dass ich keine Schule mehr brauchte.
In diesem Sommer sagte mein Vater: «Woodrow, du kannst dich im Museum um die Flüssigkeiten kümmern.» Ich hatte keine Ahnung, was es hieß, mich «um die Flüssigkeiten zu kümmern», ich hoffte nur, dass es dafür Trinkgeld gab.
Es gab keines. An jenem schicksalhaften Sommertag, an dem die beiden großen Geißeln meines Lebens mich fanden, kümmerte ich mich um die Flüssigkeiten.
«Fertig machen, Mr. Fitzpatrick», sagte ich, hinter dem Tresen stehend und eine Hand am Spund des Whiskeyfässchens. Ich war fünfzehn Jahre alt und sagte noch «Mister» zu den Leuten, sogar zu einem alten Krummbein wie Michael Fitzpatrick. O nein, ich habe nicht immer ausgesehen wie der hundertachtjährige, madenzerfressene Kadaver, der jetzt vor Ihnen sitzt. Damals hatte ich noch Haare, und zwar die blondesten in ganz Roxbury. Meine Nase war so gerade wie ein Lineal. Die Delle hier, die hab ich mir erst im Lauf der Jahre zugelegt. Mit dem Ohr war es dasselbe, das war nicht immer mit diesem Zeug verstopft. Und ich hatte auch diese lange Narbe an der Wange noch nicht. Meine Augen waren grün mit braunen und goldenen Flecken und strahlten vor Jugend und Unschuld. Von diesen Narben an der Stirn war noch keine einzige da. Früher hatte ich mal ein Lächeln im Gesicht wie ein Schauspieler, dazu einen Mund voll schöner, gerader Zähne. Ich war vielleicht nicht der hübscheste Bursche im Viertel, aber kein Spiegel musste gequält aufjaulen, wenn ich mich davor stellte.
Mit fünfzehn hatte ich schon meine volle Größe und Breite. Ich war einsdreiundachtzig groß und so stark und ausdauernd wie ein Bullterrier. Ich konnte aus dem Stand vom Boden auf den Tresen springen, runter und wieder rauf, achtmal hintereinander. Papa sagte, das hätte er noch nie erlebt und es würde mir bestimmt auch keiner mehr nachmachen, was im Übrigen das Netteste war, das er je zu mir gesagt hat.
Ich reichte Mr. Fitzpatrick den Gummischlauch. Er holte vierbis fünfmal tief Luft.
Ich schüttelte den Kopf. «Bitte zuerst den Fünfer.»
Er kramte mit einem verschlagenen Lächeln die Münze aus der Hosentasche, schob sie mir über den Tresen, füllte noch einmal seine Lungen und steckte sich den Schlauch in den Mund. Er hatte mit den fünf Cent das Recht erworben, so viel Whiskey durch den Schlauch in sich hineinzusaugen, wie er nur konnte, ohne dazwischen Luft zu holen. Ich hatte die Aufgabe, gut aufzupassen und jedem, der Luft schnappte, sofort den Hahn zuzudrehen. Wer gute Lungen hatte, konnte sich für fünf Cent ganz schön voll laufen lassen.
Ein bisschen blau im Gesicht, aber immer noch grinsend, wankte Mr. Fitzpatrick davon, um sich ein Plätzchen zum Umfallen zu suchen. Keuchend und prustend nahm nun Mr. McWherty seinen Platz am Schlauch ein. Der alte Herr hatte ein bisschen Asthma, weshalb ich ihm zwischen den Schlucken immer einen Atemzug gestattete. Obwohl es so heiß im Saloon war, hatte er jederzeit einen zerlumpten Mantel an. Der alte Mr. McWherty pflegte einmal im Jahr zu baden, ob er es nötig hatte oder nicht, und wenn man ihn an die Wand geworfen hätte, wäre er daran kleben geblieben, so dreckig war er.
Whiskey war also die eine Flüssigkeit, um die ich mich zu kümmern hatte. Die zweite war Tabaksaft. Zu meinen Aufgaben in «Joe Lowe’s Museum und Sportpalast» gehörte es nämlich auch, die Spucknäpfe zu leeren und den Fußboden zu fegen. Ich tat mich dabei nicht sonderlich hervor. Ein auf den Boden geworfener Zigarrenstummel konnte zwei Wochen später noch immer an derselben Stelle liegen. Und das Leeren der Spucknäpfe war auch nicht so lustig, wie es sich anhört. Ich ließ sie also immer randvoll werden, bevor ich sie zur Hintertür hinaustrug. Das weckte den Sportsgeist der Gäste. Sie schubsten mich und versuchten mir ein Bein zu stellen, damit mir die Sauerei über die Hände lief und aufs Hemd spritzte. So hatte ich immer einige braune Kleckse an mir, bevor ich zur Tür hinaus war und das Zeug auf die Gasse kippen konnte. Man sollte meinen, ich hätte aus diesen lustigen Streichen der Whiskeysäufer lernen können, die Spucknäpfe zu leeren, solange sie erst halb voll waren, um mir diese Ferkeleien zu ersparen, aber ich lernte es nie. Ich war eben etwas langsam von Begriff, wie Sie noch merken werden, denn es ist gewissermaßen das Leitmotiv meiner Lebensgeschichte.
Die dritte Flüssigkeit war Blut. Es war Samstagnachmittag, und schon trafen die Sportsfreunde ein. Man sah vor lauter Zigarren- und Zigarettenqualm die Wände des Saloons nicht mehr. Papa war unablässig an den Zapfhähnen und ließ die Biergläser über den Tresen schlittern. Als er Tom Kelly hereinkommen sah, übergab er die Zapfhähne und Fässer einem seiner Barmänner und eilte zum Ring. Ich ihm nach, denn ich wusste, dass dort bald meine Künste gefragt sein würden.
Tom Kelly war ein stadtbekannter Raufbold, der erst vor kurzem mit dem Boxen angefangen hatte. Er hatte ein schmales Gesicht, das kein großes Ziel bot, einen feuchten Mund und Rehaugen. Er schaute immer ein bisschen ängstlich drein, aber er hatte eine große Reichweite und war recht hart im Nehmen. Sein Haar war ganz kurz geschoren, das Kennzeichen des Preisboxers, denn nach den Londoner Regeln war es erlaubt, in die Haare zu grapschen.
Kelly zog seine Hose aus, unter der eine knielange schwarze Trikothose zum Vorschein kam, um die Taille fest gehalten von einer kastanienbraunen Schärpe. An den Füßen trug er lederne Schnürschuhe. Boxkämpfe nach Londoner Regeln wurden oft mit bloßen Fäusten ausgetragen, aber Papa bestand auf Zwei-Unzen-Handschuhen, um die Säuberungsarbeiten nach einem Kampf möglichst abzukürzen. Er wischte ungern Blut von der Wand. Arbeitshandschuhe waren meist dicker gepolstert als die Dinger, die ich Kelly jetzt reichte. Die Finger waren an den Knöcheln abgeschnitten, und Boxhandschuhe waren damals immer weiß.
Ich stieg durch die Seile und hob die Arme, um seine Faustschläge und Ellbogenstöße abzuwehren. Kelly wollte sich aufwärmen und schlug nur ganz leicht nach mir, ohne mir wehtun zu wollen.
Plötzlich johlten die Zecher auf, und ich wusste, dass John L. Sullivan den Saloon betreten hatte. Die Menge teilte sich, um ihn durchzulassen, und er stieg in den Ring, ein Todesgrinsen im Gesicht und einen Filzhut auf dem Kopf.
Kelly und ich drehten uns nach ihm um. Knochige Wülste wölbten sich über seinen Augen, die eigentlich dunkelbraun waren, aber jetzt im schräg von oben einfallenden Licht pechschwarz wirkten. Er hatte ein erstaunlich ebenmäßiges Gebiss, und ich glaube nicht, dass er im Lauf seiner langen Karriere auch nur einen Zahn eingebüßt hat. In späteren Jahren trug er einen stattlichen Schnurrbart, aber nie zu einem Kampf, denn da hätte er dem Gegner nur etwas zum Hineingreifen geboten. John L. hatte ein vorstehendes Kinn – das seine Gegner oft mit einem leichten Ziel verwechselten – und Henkelohren. Statt Haaren trug er auf dem Kopf nur kurze Borsten.
John L. war einen Meter achtundsiebzig groß und brachte sechsundachtzig Kilo auf die Waage. Er zog sein kariertes Hemd aus, dann die Hose, unter der eine weiße Trikothose mit grüner Hüftschärpe zum Vorschein kam. Auch er streifte ein Paar fingerlose Handschuhe über. Dann brachte er ein weißes Seidentaschentuch mit grünem Saum hervor – Grün und Weiß sollten die Farben seines Ruhms werden – und hängte es an einen Ringpfosten. Kelly hatte, während er verdrießlich seinen Gegner musterte, dieses Ritual ganz und gar vergessen und befestigte nun rasch auch seine Farben – Braun und Weiß – an einen der Pfosten. Sullivan zog fünfzig Dollar aus der Schärpe und übergab sie mir. Dann nahm ich auch Kellys fünfzig Dollar entgegen. Außer dem Einsatz der beiden Kämpfer gab es kein Preisgeld.
Nun hob ich also auch für Sullivan zum Aufwärmen die Arme. Ich spielte in diesem Ring oft seinen Sparringspartner, und da ich noch im zarten Jugendalter war, zog er seine Schläge nie richtig durch. Trotzdem war es ein Gefühl, als bekäme man einen Dachbalken an den Kopf. John L. (nie hieß er John oder Jack oder Sully) hatte die größten Hände, die ich je an einem Menschen gesehen habe. Zu Fäusten geballt, waren sie kaum kleiner als sein Kopf. Das war einer der größten Unterschiede zwischen John L. und mir und erklärt zumindest teilweise, warum seine Boxerkarriere in den Himmel jagte, während die meine geradewegs in die Senkgrube führte. John L. hatte Hände wie Keulen, die meinen waren feingliedrig und elegant und eher dafür geschaffen, den elfenbeinernen Knauf eines Spazierstocks zu umschließen. Ich sehe Sie meine Hände anglotzen und gebe zu, dass sie heute eher wie Baumwurzeln aussehen. Das kommt daher, dass ich mir sechsmal im Lauf meines Lebens die Finger und Hände gebrochen habe – oder jemand anders sie mir brach, natürlich gegen meinen Einspruch –, und üblicherweise immer dann, wenn ich es gerade recht weit zum nächsten Arzt hatte.
John L. verzichtete auf ein langes Aufwärmen und befahl mit seiner Bassstimme: «Raus mit dir, Woodrow.»
Ich verließ den Ring. Mein Vater hob eine Kuhglocke. Die Menge wurde still.
Der Kampf, von dem hier die Rede sein soll, war nur zwei Schläge lang; wenn ich also noch etwas über John L. und das Boxen erzählen will, dann sollte ich es lieber gleich tun. 1879 war John L. einundzwanzig Jahre alt. Schon damals war er ein in Boston wohlbekannter Preisboxer, aber seine eigentlich große Zeit lag noch vor ihm. Zehn Jahre später war er der berühmteste Mann Amerikas, höchstens nach dem Präsidenten und Thomas Edison. Man gab ihm Beinamen wie «K.-o.-König», «John L. der Große», «Stier von Boston», «Meister aller Meister» oder «Gladiator der Faust». In einem Schlager jener Tage hieß es: «Lass mich die Hand des Mannes schütteln, der John L. Sullivan die Hand drückte.» Zwar verlor er 1892 in New Orleans seinen Titel nach Queensbury-Regeln an James Corbett, aber als Meister der bloßen Faust trat er ungeschlagen ab.
Boxen war für uns, die Jugend von Roxbury, etwas sehr Wichtiges. Es gab damals noch keine erwähnenswerte Baseball-Liga (die National League war drei Jahre zuvor gegründet worden, spielte aber keine große Rolle), und Football war noch nicht mehr als eine Kuriosität. Die Zeitungen hatten noch nicht einmal Sportseiten. Außer Boxen gab es nichts.
Die meisten Boxer begannen als Kriminelle und endeten als Leichen. Yankee Sullivan wurde 1856 in San Francisco gelyncht. John Carmel starb 1873 verarmt und einsam in einem Eisenbahndepot der Green River Station von Wyoming. Joe Coburn saß für einen Mordversuch jahrelang im Gefängnis. Mike McCoole brachte einen anderen Boxer mit bloßen Fäusten um und musste sich für den Rest seines elenden Lebens irgendwo am Mississippi versteckt halten. Meine Mutter wusste das alles und hatte Angst um mich, denn ich träumte davon, ein Gelehrter der Faust zu werden.
John L. und sein Schlachtopfer traten an die Linie. Mein Vater schüttelte die Glocke. Kelly hob die Fäuste.
John L. holte einmal aus, und seine Faust schoss vor wie ein Rammbär. Der Schlag trieb Kelly die eigene Faust mit solcher Wucht an die Nase, dass diese brach. Er sank zu Boden.
Kelly besaß einiges Stehvermögen, das wir damals auch als «Mumm» bezeichneten. Nach einigen Sekunden bekam er die zitternden Beine wieder unter sich und kroch auf allen vieren in seine Ecke. Schemel waren im Ring nicht erlaubt, weshalb Seamus McWherty durch die Seile stieg und sich in der Ecke hinhockte, damit Kelly sich auf seine Knie setzen konnte. Derweil spazierte Sullivan lässig in seine Ecke und pulte sich mit dem Fingernagel einen Rest vom Mittagessen aus den Zähnen, den er auf den Boden schnippte. Wenn ich mich recht erinnere, war es ein Fädchen Sauerkraut.
[...]
Über James Thayer
James Thayer, geboren 1949, ist Rechtsanwalt und Romanautor.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Über dieses Buch
Der Jahrhundertmann ist 108 Jahre alt – und sein Arzt ist schon lange tot. Er ist der Mann, der Roosevelt aus der Patsche half, der am Boxeraufstand in China teilnahm, der Sklave sudanesischer Derwische war, Leibwächter von Oscar Wilde und Enrico Caruso – und ein Liebling der Frauen. Woodrow Lowe, so sein Name, erzählt eine der phantastischsten und abenteuerlichsten Lebensgeschichten des zwanzigsten Jahrhunderts.
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © 1997 by James Thayer
Published by Arrangement with James Thayer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Impressum der Reprint Vorlage
ISBN dieser E-Book-Ausgabe: 978-3-10-562262-9





























