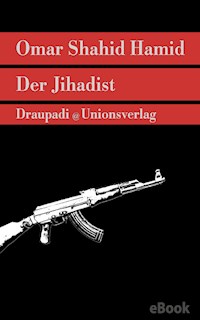
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Scheich Ahmed Uzair Sufi gehört zu den gefürchtetsten Männern Pakistans. Er ist ein führender Jihadi-Kämpfer, der an nichts außer an grenzenlose Gewalt glaubt. Zwei Jahrzehnte früher hatte niemand eine solche Entwicklung erwartet. Damals besuchte er mit Eddy und Sana, seinen besten Freunden, die Schule. Während Eddy und Sana zum Studium nach Amerika gingen, nahm Ahmeds Leben eine gefährliche und unerwartete Wendung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Scheich Ahmed Uzair Sufi gehört zu den gefürchtetsten Männern Pakistans. Er ist ein führender Jihadi-Kämpfer, der an nichts außer an grenzenlose Gewalt glaubt. Seine Schulfreunde Eddy und Sana hätten eine solche Entwicklung nie erwartet. Warum hat sein Leben diese Wendung genommen?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Omar Shahid Hamid (*1977) arbeitete bei der Sindh Police in Karachi, Pakistan, als Hauptkommissar. Als er auf die Todesliste der Taliban gesetzt wurde, beendete er seine Polizeiarbeit. 2013 verfasste er The Prisoner, inspiriert von der Entführung eines Wall Street Journal-Reporters.
Zur Webseite von Omar Shahid Hamid.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Omar Shahid Hamid
Der Jihadist
Roman
Aus dem Englischen von Rebecca Hirsch
E-Book-Ausgabe
Draupadi @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Draupadi-Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt durch Litprom e.V. - Literaturen der Welt.
Lektorat: Durdana Förster und Shobna Nijhawan
Originaltitel: The Spinner’s Tale
© by Omar Shahid Hamid 2015
© by Draupadi Verlag, Heidelberg 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Reinhard Sick
ISBN 978-3-293-31072-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 23:06h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER JIHADIST
Prolog — Die ViehzuchtanstaltEins — Gegenwart: 21. April 2011Zwei — 13. April 2011: Gefängnis HyderabadDrei — Gegenwart: 22. April 2011Hinaus in die WeltVier — Gegenwart: 3. Mai 2011Fünf — 23. Oktober 1994: Haileybury College, Ridgefield, New HampshireSechs — 31. Januar 1995: KarachiSieben — Gegenwart: 4. Mai 2011Acht — Januar 1996: Kaschmir und KarachiNeun — April 1996: Haileybury College, New HampshireZehn — Sommer 1996: Whitechapel, LondonElf — 22. Dezember 1996: Haileybury College, New HampshireZwölf — GegenwartDreizehn — Mai 1997: KosovoLänder im KriegVierzehn — November 1997: Camp Suleyman Farsi, Khost, AfghanistanFünfzehn — 21. August 1998: New York CitySechzehn — GegenwartSiebzehn — Juli 1999: New York CityAchtzehn — Dezember 1999: Indische Seite KaschmirsDer Krieg kommt nach HauseNeunzehn — 18. Dezember 2001: KarachiZwanzig — GegenwartEinundzwanzig — Februar 2002: KarachiZweiundzwanzig — GegenwartDreiundzwanzig — Oktober 2003: RawalpindiVierundzwanzig — GegenwartEpilog — Juni 2011: Irgendwo im Süden von PunjabAnhangNamenBerufsbezeichnungenUrdu-BegriffeCricket-BegriffeMehr über dieses Buch
Über Omar Shahid Hamid
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Omar Shahid Hamid
Zum Thema Religion
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für die Frauen in meinem Leben,
meine Mutter, die mir den Mut gab,
all das zu tun, was ich getan habe,
und meine Frau, die immer mein Fels in der Brandung war.
Und für meinen Freund Aslam, der mir jeden Tag fehlt.
Prolog
Die Viehzuchtanstalt
Eins
Gegenwart: 21. April 2011
Nachts kann die Wüste ein furchteinflößender Ort sein. Die Dunkelheit senkt sich unerwartet schnell über die kahle Landschaft. Die Kälte, die die Nacht mit sich bringt, dringt bis in die Knochen. Aber es ist die Stille, die einem am meisten zu schaffen macht. Selbst das kleinste Geräusch wird um das Zehnfache verstärkt, wenn es durch die leeren Weiten hallt. Das Heulen eines einsamen Schakals klingt bedrohlich. Die spärliche Vegetation wirft düstere Schatten, und der pfeifende Wind wirbelt tanzende Staubwolken auf, die im Mondlicht unwirklich scheinen. An einem Ort wie diesem spielt der Verstand den Sinnen Streiche. Mit jeder Gestalt, jedem Geräusch und jedem Schatten kommt auch die Angst.
Das galt besonders für die kleine Gruppe Polizisten, die sich in dieser besonders einsamen Ecke der Nara-Wüste gemeinsam um ein Lagerfeuer drängten. Ihr winziges Camp befand sich zwischen zwei einstöckigen Gebäuden mitten im Nirgendwo. Die nächsten Spuren der Zivilisation fand man zwei Kilometer entfernt hinter der indischen Grenze. Die Bauwerke selbst waren marode und besaßen schon lange keine Türen, Fenster oder anderen Vorrichtungen mehr. Nur bei einem einzigen Raum in dem größeren der beiden Gebäude waren Eisenstäbe am Fenster angebracht worden. Die Straße, die zu dem Feldlager führte, war kaum besser als ein Trampelpfad. Am Eingang des Geländes baumelte ein altes Schild von seinen Scharnieren herab und wies diesen Ort als Viehzuchtanstalt der Abteilung für Forstwirtschaft aus.
Die Sonne war erst vor einer Stunde untergegangen, aber die Wüste war bereits in Finsternis gehüllt. Die einzige Lichtquelle war das Feuer, an dem die Männer saßen. Es war Ramadan, der Fastenmonat, und die Polizisten hatten sich damit begnügen müssen, ihren langen Fastentag mit fadem Naan und aufgeweichten Pakoras zu brechen. Aber sie stärkten sich mit schwarzem Tee, den sie in einem Stahlkessel über offener Flamme gekocht hatten. Es war das erste Mal an diesem Tag, dass sie ihre Umgebung richtig wahrnahmen.
Den ganzen Morgen waren sie unaufhörlich damit beschäftigt gewesen, das Lager aufzustellen und dem nagenden Hunger zu widerstehen, den die erste Ramadanwoche unvermeidlich mit sich brachte.
Einer der Männer, der größte der Truppe, ein Polizist namens Peeral, schlürfte geräuschvoll seinen Tee aus der rissigen Porzellantasse. »Dieser Ort ist mir nicht geheuer. Ich habe Geschichten über ihn gehört … hier spukt es.«
Die anderen verstummten und sahen sich nervös nach Zeichen übernatürlicher Kräfte um. Beim plötzlichen Geräusch knarrenden Metalls schreckten alle auf, zwei verschütteten ihren Tee. Der Stämmigste in der Runde, ein kräftiger Mann namens Juman, war der Einzige, der sich bei dem Geräusch nicht gerührt hatte. Er lachte. »Ihr verdammten Idioten. Das war nur die Tür des Pick-ups. Ihr wisst doch, dass die immer knarrt, wir wollten sie doch schon seit einiger Zeit reparieren lassen. Ihr alle wisst das, und trotzdem lasst ihr euch von diesem Dorftrottel Angst einjagen. Verratet mir mal, welcher verdammte Geist eine Viehzuchtanstalt heimsuchen sollte!«
Die anderen lachten nervös. Peeral blickte finster drein. »Man darf sich nicht über sie lustig machen. Wir wollen doch nicht, dass ein Geist, der zufällig hier vorbei kommt, sich angegriffen fühlt.«
»Hör mal, Peeral, der einzige Geist, der hier vorbeikommen könnte, wäre der eines geilen Büffels, der gestorben ist, als er gerade eine Kuh bestieg. Kein Geist, der was auf sich hält, würde sich hier jemals blicken lassen.«
Nach Jumans Bemerkung lockerte sich die Stimmung und die Männer lachten nun viel gelassener miteinander. Nur Peeral blieb skeptisch.
»Okay, Juman, angenommen, das sei wirklich eine Viehzuchtanstalt. Das bedeutet noch lange nicht, dass hier nie Menschen waren. Was, wenn einer der Forscher hier gestorben ist und sein Geist immer noch umherwandert?«
»Und wie soll der Forscher bitte gestorben sein? Wurde er vom Blitz getroffen, als er es gerade einem Büffel besorgte? Klar, du hast sicher recht, hier läuft gerade irgendwo ein Geist herum, mit Büffelsperma an den Händen.«
Die Männer lachten wieder und ein anderer von ihnen ergriff das Wort. »Ich mache mir keine Sorgen wegen der Toten, sondern wegen der Lebenden. Arre baba, wisst ihr überhaupt, was wir hier machen? Wen sollen wir bewachen?«
»Einen lebendigen Geist.« Juman trank einen Schluck Tee, damit seine Worte ihre Wirkung entfalten konnten.
»Wer ist es?«
»Kennst du Scheich Uzair?«
»Ja, das ist der, der versucht hat, den Präsidenten umzubringen. Zweimal. Oh Gott, ist er es? Er kommt hierher?«
»Hat er nicht auch vor ein paar Jahren diese weiße Journalistin ermordet? Die, die schwanger war? Aber ich habe gehört, er wäre bei der Belagerung der Sher-Moschee gestorben?«
»Richtig, genau dieser Kerl. Er ist nicht gestorben, er wurde verhaftet. Aber seit der Belagerung ist seine Truppe die größte Jihadistengruppe im ganzen Land. Ihre Rekrutierungscamps sind überall. Letzten Monat kamen sie sogar in mein Dorf und rekrutierten zwei oder drei der Jungs aus dem Ort. Aber dieser Scheich war im Gefängnis in Hyderabad. Warum bringen sie ihn hier nach Nara?«
Juman zündete sich eine bereits zur Hälfte gerauchte beedi an. Der Tabak war stark und er spürte, wie er in seinen Blutkreislauf überging und ihn aus der Lethargie riss, in der er sich nach dem Fastenbrechen befand. »Ich habe gehört, dass im Gefängnis in Hyderabad etwas schiefgelaufen ist. Deswegen mussten sie ihn woanders hinbringen.«
»Aber warum bringen sie ihn ausgerechnet hierher? Das ist kein Gefängnis. Dieser Ort ist nur ein winziges Dreckloch mitten im Nirgendwo. Und warum wir? Wir sind keine Elite-Antiterror-Einheit. Wir sind nur ein Haufen Dorfpolizisten. Jetzt werden seine Jihadi-Freunde uns holen. Ich wusste, dass ich heute nicht hätte kommen sollen. Wäre ich daheim geblieben, würde ich jetzt gemütlich in meinen eigenen vier Wänden sitzen.« Peerals Jammern wurde immer heftiger.
»Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass sie ihn hierher bringen. Weil es so ein Dreckloch ist. Und das ist auch der Grund, warum wir ihn bewachen sollen. Welche Verbindung sollte er zu Bauerntölpeln wie uns schon haben? So hat es mir zumindest der Assistent des ASP Sahibs erklärt.«
»Wo ist der ASP Sahib überhaupt? Ich habe ihn seit dem Iftar nicht gesehen. Er hat sein Fasten mit ein paar Datteln gebrochen und einen ordentlichen Schluck Wasser getrunken, und dann war er verschwunden.«
»Du weißt, wie er ist. Er muss alles fünfhundertmal überprüfen. Er sieht wahrscheinlich noch mal nach dem Stacheldrahtzaun.«
»Aber warum mussten sie ausgerechnet uns aussuchen, yaar? Der ASP Sahib brummt uns immer die schlechtesten Aufträge auf, die man sich vorstellen kann.«
»Halt den Mund und hör auf zu heulen, Peeral. Denkst du, der ASP Sahib hatte in dieser Angelegenheit was zu sagen? Wenn es um Scheich Uzair geht, müssen die Anweisungen von ganz oben gekommen sein. Arre baba, er ist einer der meistgesuchten Männer der Welt. Ich habe gehört, dass die Amerikaner ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben, aber die Regierung will ihn vor Gericht stellen. Wie es scheint, setzen sie ihn beinahe auf eine Stufe mit Osama.«
»Was meinst du, wie viel werden die Amerikaner zahlen?«
»Genug, um dir in deinem Dorf ein Stück Land und so viele Kühe zu kaufen wie du willst.«
Von dort, wo er stand, am Rande des Camps, konnte ASP Omar Abassi beobachten, wie die Männer über Jumans unbeschwerte Bemerkung lachten. Er legte seine Hand auf den neuen Maschendrahtzaun und überprüfte, ob er stabil genug war und seine Stacheln ausreichend spitz. Er hatte sich dazu entschlossen, die Umzäunung des Camps noch einmal zu inspizieren, auch wenn er das im Laufe des Tages schon zweimal getan hatte. Aber Omar Abassi war bekannt für seine Gewissenhaftigkeit. Nun ja, manche nannten es gewissenhaft. Andere, die weniger freundlich waren, bezeichneten es als krankhaft ordnungsbedürftig.
Von letzterer Sorte hatte es leider schon immer viele in seinem Leben gegeben. Omar Abassi war noch nie gut darin gewesen, Freunde zu finden. Für Kameradschaft hatte er nie Zeit gehabt, da er sich immer ausschließlich und punktgenau auf die Arbeit fokussiert hatte, die vor ihm lag. Als Sohn eines bescheidenen Dorfschulleiters hatte er sein Leben lang von Stipendien profitiert und einige der prestigeträchtigsten Schulen des Landes besucht, war dabei aber immer ein Außenseiter geblieben. Seine Klassenkameraden, allesamt Sprösslinge reicher und mächtiger Familien, hatten nichts als Verachtung für ihn übrig gehabt. Sie mochten eine Schulbank mit ihm geteilt haben, aber für sie würde er trotzdem immer der Sohn des Dorfschulleiters bleiben, der in der starren Klassenordnung der ländlichen Provinz Sindh kaum besser war als ein Bauer. Sein Vater hatte davon geträumt, dass er ein Arzt werden würde, aber die Stipendien waren im zweiten Jahr seines Medizinstudiums versiegt. Abassi waren zwei Möglichkeiten geblieben: in ein mittelmäßiges Leben in Lakarna zurückzufallen, die Provinzstadt, in der sein Vater lebte, oder die einzige Tür aufzubrechen, die für ihn noch übrig war, und sein Glück bei den Aufnahmeprüfungen für den öffentlichen Dienst zu versuchen, die es ihm ermöglichen würden, aus seiner Lage zu fliehen.
Aber die soziale Unbeholfenheit, die ihn während seiner Universitätszeit gequält hatte, war ihm bis an die Polizeiakademie gefolgt. Seine Kollegen mochten vielleicht nicht allesamt Nachkommen des Landadels gewesen sein, aber sie waren alle sozial bessergestellt gewesen als er und hatten keine Gelegenheit ausgelassen, ihn daran zu erinnern, dass er ein unkultivierter Provinzdepp war, der nicht mal wusste, welche Gabel man beim Abendessen benutzte. Als ob fundiertes Wissen über Besteck alles war, das man brauchte, um ein guter Polizist zu sein. Mit seiner reservierten Art hatte er die Sache nicht gerade besser gemacht – er hatte immer alles zu ernst genommen und nie mit den anderen gescherzt. Während die anderen also ihre Karriere vorangetrieben hatten, indem sie endlos Kontakte mit Politikern und ranghohen Beamten geknüpft hatten, hatte er sich darauf konzentriert, der beste Auszubildende von allen zu sein: Er war niemals zu spät zum Exerzieren gekommen, hatte sich in akademischen Dingen hervorgetan und stets sichergestellt, dass seine Uniform makellos war. Dass man noch lange nicht die beste Stelle bekam, nur weil der Vorsitzende einem bei der Abschlussfeier eine Trophäe überreichte, hatte er nie verstanden. Alle seine Kollegen hatten dank der Kontakte, die sie gepflegt hatten, während er sich über seine Bücher gebeugt hatte, bequeme Stellen in großen Städten ergattert. Als schließlich Abassi an der Reihe gewesen war, war nur noch eine Stelle mitten in der Wildnis übrig geblieben.
Und Nara konnte man getrost als Wildnis bezeichnen. Man sagte, dass vor Omar noch nie ein eigens einberufener ASP hierher versetzt worden war. Die meisten Offiziere, die etwas auf sich hielten, mieden diesen Ort wie die Pest. Tatsächlich war der Posten einige Jahre lang unbesetzt gewesen, bis Omar als letzte Demütigung schließlich die schlimmste Abteilung im ganzen Land zugeteilt bekam. Er hatte außerdem den miesesten Boss erwischt. Der SP seines Distrikts war die lebendig gewordene Karikatur eines urbildlichen Polizisten. Er war klein, gedrungen und korpulent und hatte keinen ehrlichen Knochen in seinem Körper. Seine Uniform war immer schluderig, sein Bauch hing über seinen Dienstgürtel wie ein ausladender Fels, und er war aufrichtig stolz auf die Tatsache, dass ihm während seiner gesamten Karriere noch nie eine Gelegenheit durch die Lappen gegangen war, auf unehrliche Weise eine zusätzliche Rupie zu verdienen. Er war überzeugt davon, dass die Polizei des Distrikts ausschließlich dafür da war, ihm bei seiner persönlichen Bereicherung behilflich zu sein. Einen idealistischen jungen ASP unter seinen Fittichen zu haben, wurde ihm da leider zu einer Last, derer er sich rasch entledigte, indem er ihm diesen kleinen Fleck Wüste zugewiesen hatte.
Als Omar sich in dieser misslichen Lage wiederfand, reagierte er auf die einzige Art und Weise, die er kannte. Gewissenhaft und fleißig arbeitete er an jeder popeligen Aufgabe, die sein überheblicher Boss ihm auftrug. Er schuftete ununterbrochen, als wäre es das Wichtigste auf der ganzen Welt. Selbst an diesem Ort, wo man ihn abgeladen und vergessen hatte, versuchte er noch, den Anschein von Professionalität zu bewahren. Das war das Einzige, das ihm in den vergangenen vierzehn Monaten geholfen hatte, bei Verstand zu bleiben.
All das hatte sich vor zwei Tagen plötzlich geändert. Er hatte in dem Verschlag gesessen, der sein Büro darstellte, und alle möglichen Verrenkungen durchgeführt, um zu verhindern, dass der Schweiß, der bei einer Hitze von 43 Grad Celsius aus jeder Pore seines Körpers trat, auf das Papier tropfte, auf das er gerade mit Sorgfalt schrieb. Es war ein weiterer jener Berichte, von denen er wusste, dass sein Boss sie in eine Schublade stopfen würde, ohne sie jemals zu lesen. Seine zwei Assistenten waren über eine alte Klimaanlage gebeugt und versuchten, sie zum Laufen zu bringen. Aber das Gerät machte die Lage nur noch schlimmer, indem es heiße Luft ausspuckte und den Raum in einen Dampfkessel verwandelte. Plötzlich klingelte das einzige Telefon im Büro – was an sich schon ein Ereignis war, da die einzige Person, die anrief, für gewöhnlich Omars Boss war, und selbst der hatte sich seit drei Monaten nicht mehr die Mühe gemacht.
Aber es war nicht sein Boss. Stattdessen meldete sich ein Mann aus dem Innenministerium. Als die Stimme am Telefon ihm die Details seiner Aufgabe erklärte, dachte Omar zunächst, seine alten Klassenkameraden würden ihm einen ausgeklügelten Streich spielen, um Salz in die Wunde zu streuen. Er legte auf und dachte sich nichts dabei, bis eine Stunde später sein Boss auftauchte, aschfahl im Gesicht, und eine schriftliche Bestätigung der Anweisungen in der Hand hielt. Er blieb nur, um Omar die Bestätigung zu übergeben und ihm mitzuteilen, dass er für den kommenden Monat aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt war und dass Omar nun für die Zeit seiner Abwesenheit für den gesamten Distrikt verantwortlich sei und somit die alleinige Verantwortung für die ihm aufgetragene Aufgabe hatte. Als Omar nach genaueren Anweisungen fragte, antwortete sein Boss, dass er alle verfügbaren Mittel im Distrikt nach eigenem Gutdünken benutzen könne – solange Omar nur versprach, ihn unter keinen Umständen zu kontaktieren. Nachdem er sich nun also jeglicher Verantwortung für diese Sache entledigt hatte, düste der SP in seinem glänzend roten Jeep davon.
Die Anweisung des Ministeriums war auch nicht gerade hilfreich. Darin stand nur, dass er die Viehzuchtanstalt der Abteilung für Fortwirtschaft, die größte und am besten isolierte Anlage in diesem Gebiet, übernehmen und unverzüglich absichern solle, sodass Ahmed Uzair Sufi dort für einen nicht näher bestimmten Zeitraum untergebracht werden könne.
Scheich Ahmed Uzair Sufi. In den Papieren standen keine konkreten Hinweise auf ihn, aber natürlich wusste Omar wie jeder andere Mensch in diesem Land, der einen Fernseher besaß, wer Scheich Uzair war. Wer könnte die grauenvollen Bilder vergessen, auf denen der Scheich die Journalistin enthauptete. Die Fernsehsender hatten das Video, das die jihadistische Gruppe ins Internet gestellt hatte, monatelang immer wieder gesendet – ohne Rücksicht auf die Angemessenheit der Bilder. Omar schloss die Augen und rief sich die Szene wieder ins Gedächtnis. Die Frau, eine Ausländerin, war so offensichtlich schwanger, dass sich ihr runder Bauch sogar unter dem schmutzigen Gewand, in das man sie gesteckt hatte, noch abzeichnete. Die Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben, sie schwitzte, klammerte sich an eine Zeitung, auf der das Datum zu sehen war, ihr Blick flehend. Bis zum allerletzten Moment wusste sie nicht, ob man sie am Leben lassen würde oder nicht. Der Scheich stand hinter ihr, seine gewaltige Statur füllte das Bild vollständig aus. Er trug einen eleganten rotbraunen Turban, und seine stechenden dunklen Augen starrten direkt in die Kamera; er wirkte wie beseelt von einer olympischen Ruhe, während er wartete, bis sein Komplize die Beschwerden an den Staat verlesen hatte. Während der Redner seine Stimme zu einem immer leidenschaftlicheren Crescendo anschwellen ließ, in dem er die »wahren« Gläubigen dazu aufrief, dem Jihad gegen die Kreuzritter beizutreten, erhob der Scheich seine Axt hoch über den Kopf der Frau – und sobald die Verlesung beendet war, senkte er seine Klinge in einer einzigen ruhigen Bewegung auf ihren Nacken herab und trennte den Kopf sauber vom Körper ab. Selbst sein predigender Kollege schien über seinen Text zu stolpern, als das Blut auf seinen makellos weißen Shalwar Kameez spritzte, und vielleicht wurde er sich in diesem Moment des ungeheuerlichen Ausmaßes dessen bewusst, was sie getan hatten. Der Scheich aber stand unbeirrt da und zuckte nicht einmal mit der Wimper; die einzige erkennbare Gefühlsregung sah man in seinen Augen, diesen glühenden schwarzen Augen, in denen ein Feuer brannte, das direkt aus den Tiefen der Hölle zu kommen schien.
Omar erinnerte sich abgesehen davon noch an ein weiteres Bild des Scheichs aus dem Fernsehen, von dem Tag, an dem er festgenommen wurde. Die Polizei hatte ihn im Rahmen der größten Fahndung der Landesgeschichte geschnappt, die in einer Belagerung eines Madrasakomplexes in Karachi gipfelte. Als seine Komplizen von der Polizei aus dem Gebäude geschleift wurden, hing ihre Kleidung in Fetzen, ihre Gesichter und ihr Haar waren mit Dreck und getrocknetem Blut verschmiert, und der beißende Gestank des Tränengases – verrottete Zwiebeln und scharfes Ammoniak – hing über ihnen wie ein schwerer Vorhang. Es war ein völlig armseliger und resignierter Haufen von Individuen. Nur er wirkte ungeschlagen. Er war mit hocherhobenem Kopf aus dem Gebäude getreten und hatte direkt in die Fernsehkameras gestarrt, von denen er wusste, dass sie da sein würden. Er tat es mit voller Absicht, sodass sie die Grausamkeit einfangen konnten, die in sein Gesicht eingeätzt war, und diese schwarzen Augen, die glühten, ohne auch nur einen Hauch von Reue zu zeigen. Während Omar damals gemütlich in der Polizeiakademie vor dem Fernseher saß, hatte er sich gefragt, was mit einem Menschen geschehen sein musste, dass ein solcher Hass in seinem Blick lag.
Trotz des Mangels an offiziellen Informationen und des gewaltigen Ausmaßes dieser Aufgabe hatte Omar sich in gewohnt hartnäckiger Manier an die Arbeit gemacht. Er hatte in den vergangenen zwei Wochen Tag und Nacht gearbeitet, alle Ressourcen ausgeschöpft, die ihm zur Verfügung standen, und versucht, die baufälligen Hütten in etwas zu verwandeln, das an ein Hochsicherheitsgefängnis erinnerte. Im Nachhinein konnte er recht zufrieden mit sich sein, und er seufzte erleichtert. Das Gelände war mit doppeltem Stacheldraht eingezäunt worden. Auf den Dächern der Hütten hatten sie hastig Scheinwerfer von Polizei-Pick-ups angebracht. Omar hatte sogar das Elektrizitätswerk überzeugt, die Leitung, die zur Schule führte und lange brachgelegen hatte, wieder funktionsfähig zu machen. Es war nicht einfach gewesen. Anfangs hatte der Chefingenieur nicht einmal mit Omar sprechen wollen. Aber ein kurzer nächtlicher Besuch des örtlichen Polizeipostens bei ihm zu Hause hatte sein Verhalten radikal verändert. Über Nacht waren Leitungen gelegt und Verbindungen erneuert worden. Die Lichter funktionierten noch nicht, aber der Ingenieur hatte versprochen, dass er das bis zum nächsten Tag regeln würde. Omar war zuversichtlich, dass dieses Versprechen erfüllt werden würde. Handwerker waren herbeigeeilt und hatten einer der Baracken eine schnelle Rundumerneuerung verpasst, indem sie Eisenstäbe an den Fenstern angebracht und jeglichen Verschleiß am Gebäude repariert hatten. Omar hatte außerdem polizeiliche Kontrollstellen in einem Radius von einem Kilometer um die Schule aufgestellt.
Er schritt am Stacheldrahtzaun entlang und versuchte, im entfernten Schein des Lagerfeuers die Akte in seiner Hand zu lesen. Um die Lücken in den offiziellen Informationen über Scheich Uzair beziehungsweise den Grund für seine Ankunft zu schließen, hatte Omar versucht, ein Dossier zusammenzustellen. Zu diesem Zweck hatte er einen Freund in Hyderabad gebeten, alles auszudrucken, was im Internet über den Scheich zu finden war. Auf Wikipedia gab es einen besonders detaillierten Eintrag über ihn. Omar war überrascht gewesen zu erfahren, dass der Scheich eine der besten Schulen des Landes besucht hatte. Man nannte sie ganz einfach »Die Schule«, als wäre dieser Name für jeden selbsterklärend, und bezeichnete sie auch als das »Eton College des Ostens«. Omar wusste aus persönlicher Erfahrung, wie schwierig es war, dort angenommen zu werden. Einer seiner Cousins hatte gerade erst den Großteil des vergangenen Jahres damit verbracht, alle möglichen Verrenkungen auszuführen, um seinen Sohn dort anzumelden, und war trotzdem gescheitert. Es war nicht nur eine Frage des Geldes – sein Cousin war Banker und hatte davon genug –, sondern ging vielmehr darum, dass »Die Schule« eine äußerst leistungsorientierte Einrichtung war, die nach den »passenden Kandidaten« Ausschau hielt. Es war unbegreiflich, wie Scheich Uzair jemals als »passend« hatte erachtet werden können.
Der Eintrag auf Wikipedia enthielt ein paar Bilder von ihm: ein ikonisches Foto vom Tag seiner Festnahme und ein anderes Bild, das augenscheinlich aus seinen Schultagen stammte. Das Schulfoto zeigte einen jungen Mann in Schuluniform, die aus einem weißen Hemd, grauen Hosen und einer blau-rot gestreiften Krawatte bestand. Sein Gesicht hatte den leicht gelangweilten Ausdruck eines Teenagers, der vor der Kamera lässig wirken wollte. Er war ein magerer, athletisch aussehender Junge, braungebrannt wie es nur Sportler sein können. Um noch cooler zu wirken, hatte er seine Krawatte gelockert, sodass sie fast bis zu seinem Gürtel herunterhing. Einzig seine dunklen Augen verrieten, dass er die jüngere Version des Mannes war, der aus der verwüsteten madrasa herausgelaufen war. Im Bild war noch ein anderer Junge, der die im Cricket übliche weiße Sportkleidung trug und seinen Arm um den Scheich gelegt hatte. Dieser Junge war etwa genauso groß wie der Scheich, hatte aber einen deutlich dunkleren Teint. Er schien sich ebenfalls Mühe zu geben, cool auszusehen, wirkte aber um einiges weniger selbstbewusst als Scheich Uzair. Sein Gesicht war zur Hälfte von einer riesigen Sonnenbrille verdeckt, und seinen Kragen trug er aufgestellt. Mit dem roten Fleck, der auf seiner Hose prangte und andeutete, wo er den Cricketball poliert hatte, sah er aus wie ein professioneller fast bowler, der gerade seinen Wurf beendet hatte.
Wären da nicht die durchdringenden Augen des Jungen gewesen, hätte Omar vermutet, dass jemand einen fälschlichen Eintrag auf der Seite gemacht hatte. Der Rest des Artikels beschäftigte sich mit der allseits bekannten Karriere des Scheichs: wie er in Afghanistan ausgebildet worden war, wie er in Kaschmir Bekanntheit erlangt hatte, indem er westliche Touristen kidnappte, und natürlich mit seinen berühmtesten Schandtaten, nämlich dem Mord an der Journalistin und der Attacke auf den Präsidenten. Omar konnte sich den ersten Paragrafen des Eintrags in Verbindung mit dem Rest einfach nicht erklären. Wie hatte der Junge in diesem Bild, der die Schuluniform der angesehensten und anglisiertesten Bildungsanstalt des Landes trug und der überdies aussah, als wäre das Einzige, das ihn interessierte, Mädchen und Cricket, zum bart- und turbantragenden Mörder einer schwangeren Frau werden können?
Es gab keine Informationen darüber, warum er von Hyderabad verlegt worden war. Obwohl Scheich Uzair in Karachi verhaftet worden war, hatte er als Gefangener eine derart hohe Stellung, dass die Behörden beschlossen hatten, dass eine Inhaftierung in der Metropole sein fanatisches Gefolge quasi magnetisch anziehen würde. In den Geheimdiensten hatte es geheißen, dass seine Anhänger mehrere Selbstmordattentate geplant hatten, um die Regierung zu zwingen, ihn freizulassen. Das war der Grund dafür gewesen, warum er in Hyderabad eingesperrt worden war. Man hatte wohl gehofft, dass er schnell vergessen werden würde, sobald er in die hinterste Ecke gesteckt wurde, weit weg vom Scheinwerferlicht der Medien. Offensichtlich war das nicht eingetreten, dachte Omar, denn dann wäre es nicht nötig gewesen, ihn an einen noch kleineren und weitaus abgelegeneren Ort als Hyderabad abzuschieben.
In diesem Moment tauchte in der Ferne eine Kette von Scheinwerferlichtern auf. Ein Konvoi von Polizei-Pick-ups und Jeeps fuhr mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf sie zu. Je näher die Fahrzeuge kamen, desto lauter wurde das Heulen ihrer Sirenen. Omar lief auf das Eingangstor der Anlage zu und erreichte das Tor gerade, als die Autokolonne hindurchfuhr und eine Staubwolke in seine Richtung wirbelte, die seine Uniform mit einer Schmutzschicht bedeckte. Für einen Mann, der ziemlich stolz darauf war, dass seine Uniform normalerweise um acht Uhr abends genauso frisch und sauber war wie um acht Uhr morgens, war das ein beträchtliches Ärgernis. Als er die Autokolonne von Nahem sah, wurde seine Laune nur noch schlechter. Abgesehen von den Nummernschildern an den Fahrzeugen gab es nichts, anhand dessen man die Männer, die daraus ausstiegen, als Polizisten identifizieren konnte. Keiner der Männer trug eine Uniform, stattdessen waren sie in eine Vielfalt anderer Kleidungsstücke gehüllt – manche hatten einen Kampfanzug an, andere einen Shalwar Kameez, und wieder andere T-Shirt und Jeans. Aber alle waren bis an die Zähne bewaffnet. Sie trugen eine Mischung verschiedenster Waffen bei sich, einschließlich AK-47s, MP-5s, Glock-Pistolen und sogar einige Scharfschützengewehre.
Die zusammengewürfelte Truppe positionierte sich um das Fahrzeug herum, das in der Mitte der Autokolonne stand, ein Schützenpanzer mit winzigen Schlitzen als Fenster. Omar war noch schockierter, als er feststellte, dass keiner der Männer ihn beachtete, während sie die Lage sondierten. Kein Einziger von ihnen hatte ihn auch nur eines Blickes gewürdigt, geschweige denn sich die Mühe gemacht, ihn zu grüßen. Gerade wollte Omar zu ihnen laufen und verlangen, mit ihrem Befehlshaber zu sprechen, da tippte ihm jemand auf die Schulter. Er wirbelte herum, aufgebracht über diese Unverschämtheit, und stand plötzlich einem heiteren dicken Mann in einem Safarianzug gegenüber. Statt von Omars grimmigem Gesichtsausdruck eingeschüchtert zu sein, grinste der Mann nur noch breiter und grüßte halbherzig mit einer Mischung aus einem Salut und einem beiläufigen Winken.
»ASP Omar Abassi?« Der fette Mann sprach die Worte mit einer solchen Fröhlichkeit aus, dass man meinen konnte, er würde einen unglaublich lustigen Witz erzählen.
»Wer zum Teufel sind Sie?« Die Worte überschlugen sich in Omars Mund, so überrascht war er über ein derart hohes Maß an Unverfrorenheit.
»Oh, entschuldigen Sie vielmals. Inspektor Shahab. Ziemlich beeindruckend, was Sie in so kurzer Zeit aus diesem Gelände gemacht haben, ASP Abassi. Ein Cousin von mir hat hier früher mal gearbeitet. Einmal bin ich ihn besuchen gekommen. War eine richtige Müllhalde. In der Mauer war ein Loch, durch das die Büffel einfach durchlaufen konnten. Mein Trottel von Cousin musste ihnen ständig quer durch die Wüste hinterherrennen. Aber Sie haben wirklich was draus gemacht. Ja, ganz eindeutig.«
»Das Loch ist zugemauert worden. Was hat das alles mit mir zu tun?«
»Was? Oh, eigentlich nichts. Tut mir leid, ich schwafele immer zu viel.«
Inspektor Shahab nickte noch einmal anerkennend und bummelte gemächlich über das Gelände, als wäre es die normalste Sache der Welt. Erst nach gut fünf Minuten bemerkte er Omars wutentbrannten Blick und lächelte betreten.
»Oh, bitte entschuldigen Sie, ASP Sahib. Es hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, hier draußen im Freien zu sein. Ich komme nicht oft aus der Stadt raus, wissen Sie. Wenn sich eine solche Gelegenheit bietet, muss man sie genießen. Aber Sie werden mit Sicherheit darauf warten, Ihren Gast in Empfang zu nehmen.« Shahab sah sich noch mal auf dem Gelände um. »Sie, äh, haben doch sicherlich ein Zimmer oder eine Art Zelle für ihn vorbereitet, nehme ich an?«
»Natürlich habe ich das. Manche von uns nehmen die Verantwortung, die sie tragen, durchaus ernst, Inspektor.«
»Aber natürlich, natürlich. Entschuldigen Sie vielmals.« Er gab den Männern, die um den Schützenpanzer herumstanden, ein Zeichen, und diese öffneten daraufhin die hintere Tür des Wagens. Zum Vorschein kam ein uniformierter Offizier, der eine Kette in der Hand hielt, die an seinem Gürtel befestigt war. Am anderen Ende der Kette war ein Mann, der ein Paar altmodische Fußfesseln trug.
Im ersten Moment erkannte Omar die gefesselte Gestalt nicht, die aus dem Panzer stieg. Der Scheich Uzair im Fernsehen hatte größer gewirkt. Dieser Mann hingegen hatte eine gebückte Haltung. Er trug eine schlichte Gebetskappe auf dem Kopf, und der ehemals buschige schwarze Bart war ordentlich getrimmt worden. Er schien noch recht jung zu sein, nicht älter als Mitte Dreißig, schätzte Omar. Seine Augen waren hinter einer Sonnenbrille versteckt, die ihn irgendwie seriös, fast bürgerlich aussehen ließ. Gekleidet war er in einen einfachen weißen Shalwar Kurta, und an den Füßen trug er ein Paar Flipflops aus blauem Plastik. Als er langsam vom Boden aufblickte, schien er den jungen uniformierten ASP mit seinem Blick zu fixieren. Omar fiel auf, dass der Scheich den Rest der Umgebung völlig ignorierte und nur ihn allein mit leicht spöttischem Gesichtsausdruck musterte.
»Nun, ähm, ASP Sahib, nur noch ein paar Kleinigkeiten bevor wir Ihnen den Gefangenen aushändigen. Wenn Sie mir bitte folgen würden.« Shahab war nicht entgangen, mit welchem Interesse der Scheich Omar gemustert hatte, deshalb entfernte er sich ein wenig vom Rest der Gruppe und sprach mit gedämpfter Stimme, nun nicht mehr so scherzhaft wie zuvor. »Ich weiß nicht genau, wie viel unsere Vorgesetzten Ihnen über diese Angelegenheit erzählt haben, aber ich vermute mal, dass sie Sie nicht besonders gut aufgeklärt haben.«
»Tja, im Grunde haben sie überhaupt nichts erzählt. Ich weiß nicht einmal, warum er hierher gebracht wird oder was ich überhaupt mit ihm anstellen soll.«
»Ah ja, nun, das ist typisch für sie, nicht wahr? Der erste Teil ist leicht zu beantworten. Sie wissen natürlich, wer er ist. Nach seiner Verhaftung kam er ins Hochsicherheitsgefängnis in Hyderabad, weil man befürchtete, dass es zu viele seiner verrückten Fans anziehen würde, wenn er in Karachi im Gefängnis säße. Auf jeden Fall aber gibt es in Karachi eine Menge Jihadisten wie ihn, sodass er definitiv in schlechter Gesellschaft gewesen wäre. Hyderabad schien abgelegen zu sein, isoliert, ein Ort, an dem wir ihn abladen und die ganze Sache vergessen konnten. Leider war es nicht ganz so einfach. Wissen Sie, der Scheich ist ein ganz besonders charmanter Kerl. Er fing an, seinen Wachen zu predigen, wie unbedeutend die Annehmlichkeiten dieser Welt sind und dass es ihre wahre Berufung war, für Gott zu arbeiten. Innerhalb weniger Wochen hat er ihnen komplett das Gehirn gewaschen. Zuerst ließen sie ihre Bärte wachsen. Dann trugen sie auf einmal keine westliche Kleidung mehr und weigerten sich sogar, in Uniform zum Dienst zu erscheinen. Der Gefängnisaufseher übersah den Zusammenhang und dachte, sie wären vielleicht einfach nur sonderbar, deshalb erlaubte er ihnen, ihre knöchellangen Shalwars zu tragen. Aber das war nicht alles, wozu der Scheich sie brachte. Er ließ seinen Kameraden außerhalb des Gefängnisses Nachrichten übermitteln, indem er die dämlichen Wachen als Kuriere benutzte. Wir fanden das durch reinen Zufall heraus, als wir gerade einen seiner Anhänger verhafteten und einen Zettel in seinem Besitz fanden. Sie hatten Pläne geschmiedet, das Gefängnis in die Luft zu jagen und dem Scheich zu helfen, zu entkommen. Die Planung war schon bedenklich weit fortgeschritten gewesen. Das war der Moment, in dem die Alarmglocken zu läuten begannen, und die Regierung beschloss, ihn in die isolierteste Gegend abzuschieben, die ihnen einfiel.«
»Wer zur Hölle hat bitte an diesen gottverlassenen Ort gedacht?«
»Tja, da muss ich mich schuldig bekennen. Da kommt mein Cousin ins Spiel, wissen Sie. Ich erinnerte mich an diesen Ort, weil er dort mal gearbeitet hatte, und schlug ihn meinen Vorgesetzten vor. Konnte mir keinen besseren Ort für den Scheich vorstellen.«
»Sie sagten, der zweite Teil meiner Frage ist schwerer zu beantworten. Warum?«
»Nun ja, wie mans nimmt. Ich würde sagen, es ist nicht so schwer, sich zu überlegen, was man mit ihm machen soll. Tun Sie einfach, was Ihnen den Umständen angemessen erscheint. Ich würde mal sagen, wenn dieser Ort noch als Viehzuchtanstalt dienen würde, hätten Sie ihn die Kühe besamen lassen können.« Shahab lachte schallend über seinen eigenen Witz. »Spaß beiseite. Das Schwierige an der Sache ist, wie Sie mit ihm umgehen. Wissen Sie, nach der Geschichte in Hyderabad wurde uns klar, dass der Scheich extrem überzeugend sein kann. Darum wollen wir nicht, dass er sich zu sehr mit irgendjemandem hier verquatscht. Die Wächter waren nicht irgendwelche Grünschnäbel, die ganz neu in diesem Job waren. Das waren gestandene Männer mit fünfzehn oder zwanzig Jahren Erfahrung, die es gewohnt waren, hochgefährliche Gefangene zu bewachen. Aber er zog sie auf seine Seite, als wären es Kinder. Deshalb wollen wir nicht, dass er mit jemandem redet. Dafür müssen Sie sorgen.«
»Zum Teufel! Wie soll ich das bitte machen? Wer hat sich so einen bescheuerten Plan ausgedacht?«
Shahab lächelte einen Moment lang über Omars Wutausbruch und nickte bedächtig, wie ein Vater, der versucht, seinem fehlgehenden Kind etwas zu erklären. »Ich muss mich entschuldigen, ASP Sahib. Vielleicht habe ich nicht klar genug ausgedrückt, wie ernst die Lage ist. Wir haben große Mengen an Sprengstoff sichergestellt, die in die Jacke einer der festgenommenen Gefängniswärter eingenäht waren. Der Scheich hatte ihn dazu überredet, als Selbstmordattentäter das Gefängnis in die Luft zu jagen. Der Mann wäre bereit gewesen, sein eigenes Leben zu opfern, genauso wie das dutzender seiner Kollegen, die er seit Jahren kannte – nur um dem Scheich zur Freiheit zu verhelfen. Ein anderer Wächter hatte Listen mit den Adressen der Familien seiner Kollegen erstellt. Die wollte er an die Anhänger des Scheichs weitergeben, damit sie diese Leute als Geiseln nehmen konnten. Können Sie sich vorstellen, was für ein teuflisches Genie am Werk sein muss, um Männer zu solchen Schandtaten zu überreden? Also bitte bitte – nehmen Sie sich zu Herzen, was ich gesagt habe! Um keinen Preis dürfen Sie zulassen, dass Ihre Männer sich mit ihm verschwören. Es hilft wohl ein wenig, dass hier draußen die meisten Wachen nur Sindhi sprechen, und das versteht er nicht. Aber nichtsdestotrotz müssen Sie dafür sorgen. Und auch Sie selbst dürfen nicht mit ihm kommunizieren, es sei denn, Sie geben ihm einen Befehl. Ich kenne ihn, und ich habe genau gesehen, wie er gerade versucht hat, Sie einzuschätzen. Er wird versuchen, Sie um den Finger zu wickeln, freundlich zu sein, aber Sie dürfen nicht darauf eingehen. Was auch immer er sagt oder tut, denken Sie einfach daran: Das Einzige, das ihn interessiert, ist hier rauszukommen. Menschenleben haben für diesen Mann keinen Wert. Wenn Sie nun bitte meine Männer zu seiner Zelle führen würden – wir bringen ihn dort hin und dann gehört er ganz Ihnen.«
Die Geschichte hatte Omar tief beeindruckt. Seine Einstellung hatte sich deutlich verändert, auch wenn er das vor Shahab nicht zeigen würde. Bis jetzt hatte Omar seine Aufgabe gerne und selbstverständlich erledigt, weil er begeistert gewesen war, endlich einen wichtigen Auftrag zu erhalten, nachdem er vorher so lange ignoriert worden war. Natürlich war er nicht naiv genug gewesen zu glauben, dass eine solche Aufgabe ganz ohne Risiko sein könnte. Schließlich war aus genau diesem Grund sein Chef verschwunden und hatte die ganze Verantwortung ihm überlassen. Aber das war eben das erste Mal, dass jemand diese Gefahr so explizit ausgesprochen hatte. Er sparte es sich, Shahab nochmals zurechtzuweisen, und führte die Gruppe wortlos zu der alten Hütte, die für den Scheich vorbereitet worden war.
Scheich Uzair hatte das Gespräch zwischen Shahab und Omar recht desinteressiert verfolgt; die neue Umgebung schien ihm spannender gewesen zu sein. Shahabs Männer führten ihn zu seiner Zelle, doch ein paar Meter vor der Tür zögerte er und räusperte sich.
»Assalam Alaikum, Bruder.«
Omar hielt unwillkürlich inne. Er warf einen Seitenblick auf Shahab, der sich herumgedreht hatte und nun den Scheich anstarrte. Er gab seinen Leuten ein Zeichen, den Scheich wieder in Bewegung zu setzen. Der Scheich selbst trug ein entwaffnendes Lächeln im Gesicht, als wäre er sich nicht bewusst, welche Unruhe er stiftete.
»Bitte entschuldigen Sie, dass ich Englisch spreche, Bruder – aber aus den Abzeichen an Ihrer Schulter schließe ich, dass Sie ein ASP sein müssen. Ich dachte mir, Sie sprechen sicher Englisch. Ich habe die Sprache so lange nicht gesprochen, dass ich nicht widerstehen konnte. Ich frage mich, ob Sie wohl das Ergebnis des Cricketmatchs Pakistan gegen Indien kennen.«
Shahab brummte missbilligend. »Weiterlaufen. Keiner spricht hier Englisch.« Er sagte es auf Urdu. Einer seiner Männer stieß den Scheich ein wenig fester an, um ihn voranzutreiben.
Der Gestank in der alten Baracke haute sie fast um. Es war stockdunkel, sodass Omar sich seinen Weg ertasten musste, bis sein Kollege Peeral mit einer Taschenlampe hinter ihm auftauchte. Die Zelle an sich war eigentlich nur eine Ecke der Hütte, die gerade mal groß genug für ein vierbeiniges Tier war. Sie war an allen vier Seiten gesichert und verstärkt worden, und am Fenster, der einzigen Lichtquelle im Raum, hatte man neue Eisengitter angebracht. Man hatte ein schmales Feldbett mit einem einzigen Laken in die Zelle gestellt, was es noch schwerer machte, sich darin zu bewegen, wenn sich mehr als eine Person darin befand. Omar hatte sich die letzten zwei Tage darauf konzentriert, das Gebäude so sicher wie möglich zu machen. Die Sauberkeit hatte er dabei vollkommen vernachlässigt. Jetzt, da er in der dunklen Baracke stand, in der der Gestank nach Büffelurin überwältigend war und der Boden unter seinen Stiefeln aus einer schleimig-nassen Pampe aus Exkrementen, Heu und weiß Gott was bestand, bereute er das. Trotz all der Arbeit, die er in den letzten zwei Tagen hineingesteckt hatte, war dieser Ort für Menschen nicht bewohnbar. Nicht einmal für ein Monster wie Scheich Ahmed Uzair Sufi. Omar warf dem Scheich einen verstohlenen Blick zu. Er trug einen makellos weißen Shalwar Kameez, und auf seiner Stirn konnte man eine leichte Verfärbung erahnen – das Markenzeichen derer, die fünfmal am Tag beteten. Er mochte ein Scheusal sein, aber er war ohne Frage auch sehr religiös. Als Omar sich vorstellte, wie der Scheich seine Stirn auf den dreckigen Boden senkte, fühlte er sich schuldig.
»Es – äh – es ist nicht so sauber, wie es sein sollte, aber, hm, wir haben es gut gesichert. Mir wurde gesagt, das hätte Priorität. Ich werde am Morgen jemanden vorbeischicken, der hier sauber macht.«
»Oh, das ist schon in Ordnung, ASP Sahib. Diese Zelle ist vollkommen angemessen. Ich bin sicher, der Scheich hat kein Problem damit.«
Shahab schien sich über den schmutzigen Zustand der Zelle fast zu freuen. Der Scheich selbst hatte sich noch nicht geäußert. Er sah sich weiterhin im Raum um, starrte erst auf den Boden, dann auf das kleine Fenster unter der Decke. Seine Augen blieben an einem Plastikeimer hängen, der in der Ecke des Raumes stand.
»Wäre es möglich, etwas sauberes Wasser in diesen Eimer zu füllen? Ich bräuchte es für meinen Wudu.«
Peeral, der aufgrund des Zustands der Hütte genauso beschämt zu sein schien wie sein Boss, schnappte sich sofort den Eimer. Er murmelte halb auf Sindhi, halb auf Urdu, dass schließlich ein jeder das Recht auf sauberes Wasser für den Wudu, die rituelle Waschung vor dem Gebet, hatte.
Shahab nickte noch einmal, woraufhin seine Männer dem Scheich die Fußfesseln abnahmen. Dann verließ die Gruppe die Zelle, und der Scheich ließ sich auf der Bettkante nieder. Nachdem Peeral die Tür mit einem riesigen eisernen Vorhängeschloss gesichert hatte, warf Shahab noch einen letzten Blick durch den Türschlitz und lief, zufrieden mit seiner Arbeit, hinaus in die kühle Wüstenluft.
»Ah, wie erfrischend. Danke für Ihre Kooperation, ASP Sahib. Viel Glück mit ihm. Sie werden es brauchen. Hier ist meine Visitenkarte, falls Sie Hilfe brauchen oder Rat, wie Sie mit ihm umgehen sollen. Zögern Sie nicht, mich anzurufen, und bitte schauen Sie mal in meinem Büro vorbei, wenn Sie das nächste Mal in Karachi sind.«
»Moment mal. Karachi? Haben Sie ihn nicht aus Hyderabad hergebracht?«
»Oh doch. Er war in Hyderabad. Aber als im Gefängnis dort alles drunter und drüber ging, wurde es für das Beste gehalten, mich aus Karachi zu holen, damit ich ihn zu seiner nächsten Adresse bringe. Ich war schließlich derjenige, der ihn festgenommen hat, wissen Sie – deshalb kenne ich ihn auch am besten. So, jetzt müssen wir aber los. Ich habe meinem Cousin ein Abendessen versprochen, wenn ich jemals wieder an diesen Ort zurückkommen würde. Schätze mal, die Wette hat er gewonnen. Hatte ich erwähnt, dass er mal hier gearbeitet hat? Oh, aber natürlich, das hatte ich erzählt. Nehmen Sie mir das nicht übel – ich schweife gerne mal ab, wie Sie sicher bemerkt haben.«
»Wie lange muss ich ihn hierbehalten?«
»Oh – nicht mal das hat Ihnen jemand gesagt? Grundgütiger, da hat man Sie wirklich ins kalte Wasser geworfen, was? Ich weiß nichts davon, wie lange er hierbleiben wird. Unser Job beschränkt sich darauf, ihn von einem Ort an den nächsten zu schaffen. Aber ich vermute, nicht allzu lang. Denen ist schon klar, dass das hier keine dauerhafte Lösung ist. Ich schätze mal drei bis vier Wochen. Ach, übrigens, eins noch. Hätte ich fast vergessen.« Er kramte in seiner Brusttasche herum und holte einen zerknitterten Umschlag hervor. »Er hat versucht, den hier einem meiner Männer zu geben, als wir ihn hergebracht haben. Es ist Englisch, deshalb konnte es keiner meiner Männer lesen, und was mein eigenes Englisch angeht – nun ja, das übernimmt für gewöhnlich mein Sekretär. Da Sie jetzt für ihn verantwortlich sind, gehört das Ihnen.«
»Was ist das? Und was mache ich damit?«
»Es ist irgendein Brief. Sie können ihn gerne lesen. Sie sind schließlich der Englischexperte. Ich bin sicher, Ihnen fällt was ein. Ist mir schnuppe, was Sie damit machen, das überlasse ich ganz Ihnen. Einen guten Tag, ASP Sahib.«
Shahabs Männer saßen schon im Auto und ließen die Motoren aufheulen, als er in den Wagen stieg. Die Autokolonne machte eine rasche Kehrtwende und düste davon. Zurück blieb Omar, der auf den Umschlag in seiner Hand starrte. Das Papier fühlte sich an wie ein glühendheißer Ziegelstein. Er konnte Shahabs Nachlässigkeit nicht nachvollziehen – er hatte nicht einmal versucht, den Brief auf dem Weg hierher zu lesen oder gar zu verstehen. Wie konnte er ein so wichtiges Beweisstück einfach so ignorieren? Omar war auf seltsame Weise fasziniert von diesem Brief und fragte sich, welche geheimen Anweisungen es wohl sein könnten, die das terroristische Genie hier zu Papier gebracht hatte. Von dem, was auf diesem Zettel geschrieben stand, konnten die Leben hunderter Menschen abhängen. Zum möglicherweise ersten Mal in seiner Karriere konnte Omar erahnen, wie es war, mitten im Geschehen zu sein, ein Eingeweihter in die bestgehüteten Geheimnisse. Er mochte dieses Gefühl.
Aber seine Neugier und Aufregung wurden bald von Furcht abgelöst. Er verfluchte Shahab, weil ihm nun klar wurde, warum der Inspektor sich nicht die Mühe gemacht hatte, den Brief zu lesen. Wissen war Macht, aber es war auch ein zweischneidiges Schwert. Für Shahab war es am bequemsten gewesen, den Umschlag einfach an ihn weiterzugeben, denn mit diesem hatte er zugleich die Verantwortung dafür abgegeben, was mit dem Brief geschah. Was wenn der Brief, wie Omar vermutete, tatsächlich Pläne für einen Terroranschlag enthielt? Hier gab es niemandem, der ihm helfen konnte. Das war genau der Grund, warum sein Chef verschwunden war. Vor lauter Begeisterung, endlich etwas zu tun zu haben, hatte Omar nicht einen Gedanken daran verschwendet, wen er in einem solchen Fall kontaktieren konnte. Wenn morgen hundert Leute bei einem Bombenanschlag getötet würden und herauskäme, dass der Scheich dahintersteckte, dann würde Omars Boss einfach sagen, er hätte die Verantwortung ihm überlassen. Shahab würde pflichtbewusst antworten, dass der Brief ordnungsgemäß an den jungen ASP weitergereicht worden war. Es war von größter Wichtigkeit, dass er mit dem Brief genau das Richtige tat. Ein einziger Fehltritt und Omar Abassis Träume und Hoffnungen eines ganzen Lebens würden einfach so zerplatzen.
Er stand nun mitten auf dem Gelände und war wie gelähmt vor Angst. Schnell zwang er sich, sich wieder zusammenzureißen, und sah sich um. Er würde die Situation retten, indem er das tat, was er am besten konnte: sich systematisch auf alles vorbereiten, was möglicherweise passieren konnte. Er stopfte den Brief in die Tasche und begann voller Elan, Anweisungen zu geben und jedes kleinste Detail bezüglich der Sicherung des Geländes noch einmal zu überprüfen. Das beruhigte ihn ein wenig. Es war ihm vertraut. Welches Gift der Brief auch enthalten mochte – es hatte gefälligst zu warten, bis er bereit dafür war.
Die Männer hatten inzwischen zu Abend gegessen und ihre Gebete abgehalten, und die Nachtwachen bereiteten sich auf ihre Schicht vor. Omar hatte eine vierköpfige Spezialeinheit zusammengestellt, die den Gefangenen überwachen sollte, und zu dieser Gruppe gehörten Peeral and Juman. Er klärte sie auf Sindhi über die strengen Regeln auf, die es in Bezug auf die Kommunikation mit dem Gefangenen zu beachten galt.
»Aber Sir«, fragte Peeral, der besonders perplex wirkte, »was, wenn er mit uns redet?«
»Ich denke, ich habe deutlich genug gesagt, dass ihr ihm unter keinen Umständen antworten dürft. Habt ihr das verstanden?«
Juman und Peeral tauschten einen Blick, der deutlich machte, dass die Angelegenheit für sie alles andere als klar war. Nach kurzem Zögern ergriff Juman das Wort.
»Aber Sir, wie sollen wir ihn fragen, ob er Hunger hat? Es ist Ramadan, und wir wissen nicht, ob die Leute, die ihn hergebracht haben, ihm auf dem Weg hierher etwas zu essen gegeben haben. Ich wette, er fastet auch gerade, und wenn er noch nichts gegessen hat und wir ihm nichts geben, machen wir uns schuldig. Aber wenn wir ihn danach fragen, widersetzen wir uns Ihren Anweisungen, die uns hochheilig sind, wie Sie wissen.«
Omar schüttelte frustriert den Kopf. »Bereitet das Essen einfach zu und stellt es in seine Zelle. Wenn er Hunger hat, wird er schon essen. Verstanden?«
Offensichtlich waren die Männer mit der ausgesprochen logischen Antwort ihres Chefs zufrieden, und die Gruppe löste sich auf. Omar ging noch einmal durch das Camp und lief dann zu dem Zelt, das seine Leute in einer Ecke des Geländes für ihn aufgebaut hatten. Das Zelt wurde von einer Petroleumlampe erhellt, und an der Seite befand sich ein einfaches Feldbett. Die Lampe stand auf einem kleinen Klapptisch, auf den sein Bediensteter außerdem einen Teller mit kalten Linsen und Fladenbrot gestellt hatte. Omar fiel ein, dass er während des iftar nach Sonnenuntergang nichts gegessen hatte außer einer Dattel, also zog er seinen Dienstgürtel aus, setzte sich auf das Bett und begann damit, Stücke des Fladenbrots in das dal zu tunken. Mit einem Mal holte ihn die Erschöpfung des anstrengenden Tages ein, und er fühlte sich benommen. Die Müdigkeit legte sich schwer auf seine Augenlider. Omar war dankbar für die Thermoskanne mit Tee, die sein Bediensteter ihm zusammen mit dem Essen dagelassen hatte. Er goss sich eine Tasse davon ein und tastete nach seiner Brusttasche, um zu sehen, ob der Brief noch da war. Natürlich war er noch da. Wie dumm von ihm. Wo sollte er auch sonst sein, dachte er, während er den heißen Tee schlürfte. Er zögerte es noch ein paar Minuten länger hinaus, doch ihm war klar, dass er es nicht mehr aufschieben konnte.
Der Umschlag war bereits geöffnet worden. Es stand nichts darauf geschrieben außer einer Postfachnummer in einer abgelegenen Stadt an der Grenze zu Kaschmir. Der Brief an sich war auf altes Zeitungspapier geschrieben worden. Omar musste erst einige Sekunden lang auf das Papier starren, bevor er die englischen Wörter entziffern konnte. Sie waren mit einem Kugelschreiber, dem schon fast die Farbe ausgegangen war, über das gedruckte Urdu geschrieben worden. Zunächst schienen die Worte für ihn keinen Sinn zu ergeben. Genaugenommen waren seine Englischkenntnisse etwas eingerostet, seit er hier draußen festsaß. Man benötigte die Sprache hier nicht gerade oft. Deshalb dauerte es einen Moment, bis er die Worte verstand. Doch dann fing er an zu lesen.
Zwei
13. April 2011: Gefängnis Hyderabad
Lieber Eddy,
ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Unser letzter Briefwechsel hat ganz eindeutig nicht gut geendet. Das war meine Schuld, und ich habe versucht, dir danach noch mal zu schreiben und mich zu entschuldigen, aber das war an dem Tag, an dem ich verhaftet wurde, sodass mein Brief dich nie hätte erreichen können.
Zurzeit kann ich kaum schlafen. Ich denke oft an sie. Nein, nicht an Sana. An die andere, die Journalistin. Ich sehe sie vor meinem inneren Auge, so wie sie war, als ich das erste Mal mit ihr sprach: großspurig und von sich selbst überzeugt. Schon in dem Moment, in dem sie in mein Büro kam, war mir klar, wie schlau sie war. Die Adresse hatte sie von irgendeinem zweitklassigen Hintermann, der ihr ein Interview mit »einem von den Jihadisten« versprochen hatte. War ’ne Masche. Du erinnerst dich sicher daran, wie damals die Journalisten aus dem Westen über das Land herfielen wie eine Heuschreckenplage. Alle wollten sie im Krieg gegen den Terror, was auch immer das heißen sollte, an vorderster Front mit dabei sein. Viele Betrüger machten sich einen Spaß daraus, gaben die Imame ihrer örtlichen Moscheen als Jihadistenanführer aus und knöpften den dämlichen Weißen für das Privileg, sie interviewen zu dürfen, 1000 Dollar ab.
Aber sie war nicht dumm. Sie wusste genau, mit wem sie es zu tun hatte, als sie im Büro vorbeikam. Heftig diskutierte sie mit meinen Leuten, die bemüht waren sie abzuschütteln. Sie versuchte sie dazu zu überreden, mich interviewen zu dürfen, und wusste nicht, dass ich die ganze Zeit im Raum nebenan war und sie durch eine Trennwand beobachtete und ihren Tod plante. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, sie zu töten. Wie sie da im Vorzimmer saß, diesen schrecklichen Tee trank und versuchte, sittsam auszusehen in ihrem Shalwar Kameez – und es trotzdem nicht verbergen konnte, dass sie so offensichtlich schwanger war. Die Gelegenheit war einfach zu gut, um sie verstreichen zu lassen.
Ich kann nicht aufhören an sie zu denken. Es ist heiß an diesem Apriltag in Hyderabad, aber ich kann nicht aufhören zu zittern. Meldet sich mein schlechtes Gewissen? Nach allem was ich getan habe? Ein bisschen spät dafür, findest du nicht? Oder ist es Angst? Vielleicht ist das der Grund, warum ich dir schreibe. Wenn einen die eigene Sterblichkeit einholt, wendet man sich an das, was einem im Leben am vertrautesten war.
Ich muss gestehen, dass die Behörden von meinen »außerplanmäßigen Aktivitäten« gehört haben. Sagen wirs mal so – dass ihre Familien bedroht wurden, haben sie nicht gerade gut aufgenommen. Ich habe keinen Schimmer, warum die Leute sowas immer so persönlich nehmen müssen. Ich habe jedenfalls gehört, dass sie mich aus diesem Grund verlegen werden, aber nicht in ein anderes Gefängnis. Das ist der Punkt, der mir Sorgen macht. In Gefängnissen gibt es Regeln, bestimmte Richtlinien, die die Gefangenen befolgen müssen. Meine Aufseher haben kein Verständnis für meine kleinen Spielchen. Ich fürchte, sie könnten eine etwas endgültigere Lösung für mich parat haben.
Ich würde nicht sagen, dass ich Angst vor dem Sterben habe. Schließlich hat ein Mann, der dem Tod so oft entronnen ist wie ich, keinen Grund, ihn zu fürchten. Wovor es mir graut, ist, alleine zu sterben. Ich habe viele Jahre damit verbracht, Mauern um mich herum aufzubauen – so viele Mauern, dass ich nicht einmal selbst weiß, wie man sie alle durchbrechen könnte. Aus meiner Familie sind Fremde geworden. Ich frage mich, ob überhaupt irgendjemand um mich trauern wird, wenn ich sterbe. Natürlich wird mein Vater darüber wachen, dass meine Beerdigung rechtmäßig abgehalten wird, und meine Familie wird drei Tage lang trauern, so wie es erwartet wird. Man wird deghs kochen und es unter den Armen verteilen. Verwandte werden kommen, um ihr Beileid zu bekunden und zu essen. Und meine Anhänger werden für meine Seele beten, mich als Märtyrer bezeichnen und in der ganzen Stadt Plakate von mir aufhängen. Wenn sie sehr motiviert sind, zünden sie vielleicht sogar ein paar Busse an.
Aber ich frage mich, ob mich jemand wirklich vermissen wird. Die Plakate werden irgendwann abgerissen oder von neuen überklebt. Die Verwandten werden zum nächsten Anlass weiterziehen, sei es ein fröhlicher oder ein trauriger. Mein Vater wird vermutlich sogar froh sein, mich los zu sein. Auch meine Frau wird wohl erleichtert aufatmen und sich vielleicht darauf freuen, beim nächsten Mal einen verlässlicheren, fürsorglicheren Mann zu heiraten. Was meinen Sohn angeht, so kennt er mich nur von Fotos. Er ist noch klein, er wird mich vergessen. Wie viele Leute erinnern sich wohl noch an die Journalistin, so viele Jahre nach ihrem Tod?





























