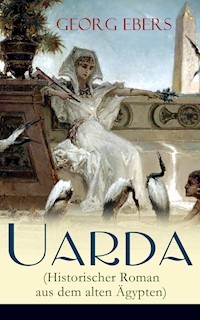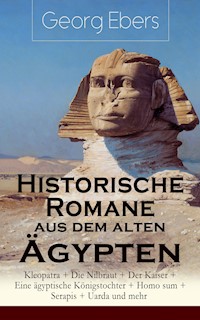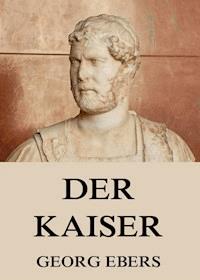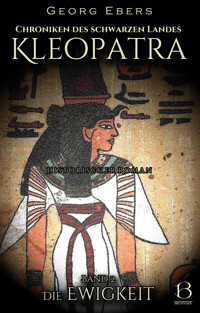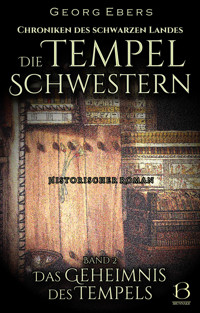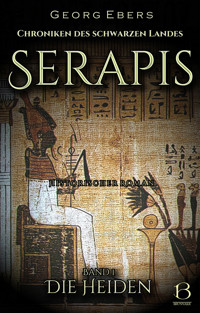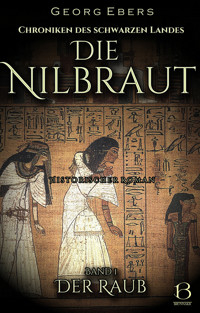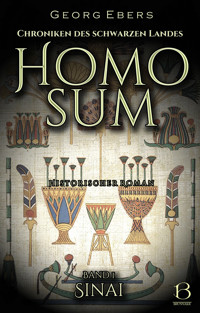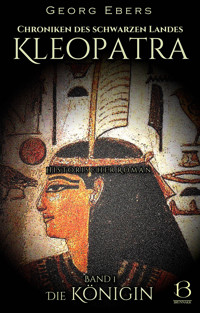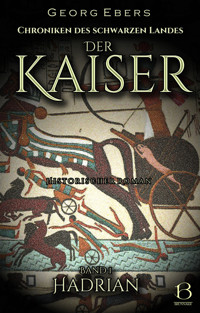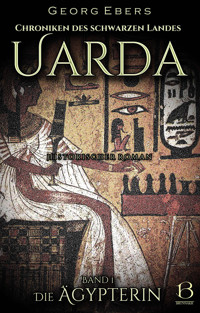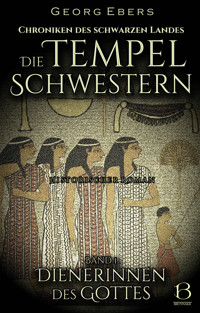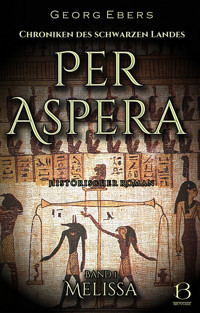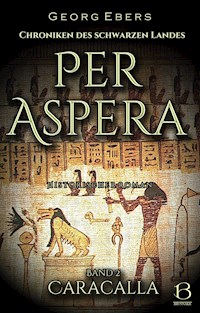Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Das alte Ägypten Der bekannte Historiker und Autor Georg Ebers beschreibt mit ausgeprägten Scharfsinn und Wissen und mit nicht weniger poetischer Freiheit ein prächtiges Bild des alten Ägypten zu Zeiten des römischen Kaisers Hadrian. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Ebers
Der Kaiser
Georg Ebers
Der Kaiser
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 3. Auflage, ISBN 978-3-954188-38-3
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Sechsundvierzigstes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Widmung
Seinem teueren, in glücklichen und trüben, in ernsten und heiteren Stunden gleich bewährten Freunde und Kollegen Otto Stobbe, dem Germanisten, widmet dieses Buch in unwandelbarer Liebe und Treue der Verfasser.
Vorwort
Vor vierzehn Jahren plante ich nach einer Reihe von Vorlesungen, welche ich über die Römerzeit in Ägypten gehalten hatte, die Geschichte, welche ich in diesem Buche erzähle. Aber wissenschaftliche Arbeit drängte die Lust am poetischen Schaffen zurück, und als diese die Flügel wiederum kräftiger zu regen begann, fühlte ich mich von anderen Stoffen lebendiger angeregt. So kam es denn, daß ich die Zeit Hadrians später zum Hintergrunde einer Dichtung wählte, als selbst die jüngere Epoche der anachoretischen Bewegung.
Mit der Beendigung dieses Romans hat mein alter Wunsch, die wichtigsten Abschnitte der Geschichte des ehrwürdigen Volkes, dem ich seit beinahe einem Vierteljahrhundert mein Leben weihe, dichterisch zusammenzufassen, seine Erfüllung gefunden. Die Glanztage der Pharaonenzeit habe ich in der »Uarda«, den Heimfall Ägyptens an die junge Weltmacht der Perser in der »Königstochter«, die hellenische Epoche unter den Lagiden in den »Schwestern«, die Römerzeit und das Aufkeimen des jungen Christentums in dem »Kaiser« und die anachoretische Bewegung in den Ägypten benachbarten Wüsten und Felsenlandschaften in »Homo sum« zur Darstellung zu bringen versucht. So wird denn »Der Kaiser« der letzte Roman sein, dem ich das alte Ägypten zum Schauplatz anweise.
Diese Reihe von Dichtungen hat meine Leser nicht nur mit der Kulturgeschichte Ägyptens bekannt machen, sondern ihnen auch die Erkenntnis von einigen besonders mächtigen Ideen, welche das Altertum bewegt haben, erleichtern sollen.
Wieweit es mir gelungen ist, die dargestellten Epochen zu farbigen, der Wirklichkeit nahekommenden Gemälden zusammenzufassen, wage ich nicht zu beurteilen. Denn wenn sich schon gegenwärtige Dinge in verschiedenen Köpfen verschieden spiegeln, so muß dies doch weit bestimmter bei längst vergangenen und halb vergessenen der Fall sein.
Wie oft war ich genötigt, wenn bei der Wiederbelebung einer fernen Vergangenheit die Mittel der Wissenschaft versagten, von der Einbildungskraft Rat und Hilfe zu fordern und mich des Wortes zu erinnern, daß der Dichter ein rückwärts schauender Prophet sein soll. Ruhig durfte ich der Phantasie gestatten, die Flügel zu entfalten, denn ich blieb Herr über sie und kannte die Grenzen, bis zu denen ich ihr erlauben durfte, sich aufzuschwingen. Ich hielt es für mein Recht, viel frei Erfundenes zu zeigen, aber nichts, das nicht in der darzustellenden Zeit möglich gewesen wäre. Die Rücksicht auf diese Möglichkeit hat überall der Phantasie Schranken gesetzt; wo die vorhandenen Quellen gestatteten, völlig treu und wahr zu sein, bin ich es stets gewesen, und die vorzüglichsten unter meinen Fachgenossen in Deutschland, England, Frankreich und Holland haben dies mehr als einmal bezeugt. Aber ich brauche wohl kaum hervorzuheben, daß die dichterische Wahrheit eine andere ist als die historische, denn diese soll möglichst unberührt bleiben von der Subjektivität ihres Verkünders, jene kann nur durch das Medium der Phantasie des Künstlers zur Wirkung gelangen.
Wie meine beiden letzten Romane, so lasse ich auch den »Kaiser« ohne Anmerkungen. Ich tue es in dem frohen Bewußtsein, durch gelehrte und andere Arbeiten einiges Recht auf das Vertrauen der Leser gewonnen zu haben. Nichts hat mich mehr zu immer neuem poetischem Schaffen ermutigt als der Umstand, daß durch diese Dichtungen meiner Wissenschaft mehrere Jünger zugeführt worden sind, deren Namen jetzt unter den Ägyptologen mit Achtung genannt werden.
Jeder mit der Zeit Hadrians Vertraute wird auch bei kleineren Zügen erkennen, welchem Autor, welcher Inschrift, welchem Denkmal sie entnommen worden sind; dem größeren Kreise meiner Leser will ich den Genuß an der Dichtung nicht trüben. Es würde mich beglücken, wenn dieser Roman den Namen eines echten Kunstwerkes verdiente, und die Betrachtung eines solchen soll vor allen Dingen erfreuen und erheben. Wer dabei Bereicherung seines Wissens empfängt, darf doch nicht merken, daß er belehrt wird.
Kenner der Geschichte Alexandrias unter den Römern werden sich wundern, daß ich Therapeuten am mareotischen See unberücksichtigt lasse. Ich hatte ihnen ursprünglich ein eigenes Kapitel zugedacht, Lucäs neueste Untersuchungen bestimmten mich aber, es ungeschrieben zu lassen.
Jahre des Studiums habe ich den Anfängen des Christentums, namentlich in Ägypten, gewidmet, und es gereicht mir zum besonderen Genuß, auch anderen zu vergegenwärtigen, wie sich zur Zeit Hadrians die reine, von menschlichen Zutaten noch wenig getrübte Lehre des Heilandes der Herzen bemächtigte und bemächtigen mußte. Neben dem triumphierenden Glauben zeige ich die edle Blüte des Wesens, die Kunst, welche in späteren Jahrhunderten vom Christentum, um sich mit ihren schönen Formen zu schmücken, herangezogen wurde. Die aus der Zeit meiner Erzählung stammenden Antinousstatuen und Büsten beweisen, daß es der welkenden Pflanze beschieden war, unter Hadrian neue Blätter zu treiben.
Die romantischen Züge, die ich dem Charakter meines die Welt durchwandernden Helden beilege, der Berge bestieg, um sich am Glanz der aufgehenden Sonne zu freuen, sind ihm tatsächlich eigen gewesen. Eine der schwierigsten Aufgaben, welche ich mir jemals gestellt habe, war die, aus den an inneren Widersprüchen so reichen Nachrichten über Hadrian ein Menschenbild zu gestalten, an dessen Wahrheit ich selbst zu glauben vermochte; aber wie gern bin ich an ihre Lösung gegangen! Es gab bei der Anlage dieser Dichtung viel zu bedenken, aber sie selbst ist ganz aus dem Herzen ihres Verfassers gegossen. Möge sie auch den Weg in die Herzen der Leser finden.
Leipzig, den 2. November 1880.
Georg Ebers
Erstes Kapitel
Die Morgendämmerung war geschwunden, die Sonne des ersten Dezembers im Jahre 129 nach der Geburt des Heilands aufgegangen, aber sie wurde von milchweißen Dünsten verhüllt, die dem Meere entstiegen. Es war kalt.
Der Kasius, ein Berg von mittlerer Höhe, steht auf einer Landzunge der Küste zwischen dem südlichen Palästina und Ägypten und wird an seiner Nordseite vom Meere bespült, das heute nicht wie an anderen Tagen in leuchtendem Ultramarin schimmert. In finsterem Schwarzblau bewegen sich langsam seine ferneren Wogen, die näheren aber sind völlig anders gefärbt und schließen sich in trübem, grünlichem Grau an ihre dem Horizont benachbarten Schwestern wie staubiger Rasen an dunkle Lavaflächen.
Der Nordostwind, der sich nach dem Aufgang der Sonne erhoben hatte, begann lebhafter zu wehen, milchweißer Schaum zeigte sich auf den Häuptern der Wellen, diese aber schlugen heute nicht wild und kräftig den Fuß des Berges, sondern wälzten sich mit unabsehbar langen gekrümmten Rücken träge zu ihnen heran, als bestünden sie aus schwerem geschmolzenen Blei. Dennoch spritzten leichte und helle Tropfen auf, wenn sie eine Schwungfeder der Möwen berührte, die unruhig und als triebe die Angst sie hierhin und dorthin, scharenweis mit schrillem Gekreisch über dem Wasser schwebten.
Drei Männer wanderten langsam auf dem von der Spitze des Berges in die Ebene führenden Wege zu Tale, aber nur der älteste von ihnen, der den beiden anderen voranschritt, achtete auf den Himmel, das Meer, die Möwen und die wüste, unter ihm ruhende Fläche. Jetzt blieb er stehen, und sobald er den Fuß hemmte, taten die beiden anderen das gleiche. Die Landschaft unter ihm schien seine Blicke zu fesseln und rechtfertigte die Befremdung, mit der er das in einer leichten Neigung gesenkte bärtige Haupt schüttelte. Ein schmaler Wüstenstreifen streckte sich, zwei Wasser voneinander scheidend, soweit das Auge reichte, nach Abend hin vor ihm aus. Auf diesem natürlichen Damme zog eine Karawane dahin. Der weiche Fuß der Kamele fiel lautlos auf den Weg, den sie zogen. Ihre in weiße Mäntel gehüllten Reiter schienen zu schlafen und ihre Treiber zu träumen. Die grauen Adler am Saume der Straße rührten sich nicht bei ihrem Nahen.
Links von der Landnehrung, auf welcher der von Syrien nach Ägypten führende Weg sich hinzog, lag das glanzlose, mit grauem Gewölk verschwimmende Meer, links, mitten in der Wüste, ein seltsames, landschaftliches Etwas, dessen Ende nach Osten und Westen hin das Auge nicht zu erreichen vermochte und das hier einem Schneefelde, dort einem stehenden Wasser und an anderen Stellen einem Binsendickicht gleichsah.
Der älteste Wanderer schaute stets nach dem Himmel und in die Ferne, der zweite, ein Sklave, der Decken und Mäntel auf der breiten Schulter trug, verwandte keinen Blick von seinem Gebieter, und der dritte, ein freier Jüngling, blickte müde und träumerisch auf den Weg nieder.
Eine breite, auf ein stattliches Tempelgebäude zuführende Straße kreuzte den von der Spitze des Berges an die Küste führenden Pfad, und der bärtige Wanderer betrat sie. Aber er folgte ihr nur wenige Schritte, dann blieb er stehen, warf unwillig das Haupt zur Seite, murmelte einige unverständliche Worte in den Bart, wandte sich um, kehrte mit beschleunigtem Schritte zu dem schmalen Wege zurück und ging talabwärts.
Sein jugendlicher Begleiter folgte ihm, ohne das Haupt zu erheben und seine Träumerei zu unterbrechen, als sei er sein Schatten; der Sklave jedoch erhob den kurz geschorenen blonden Kopf, und ein überlegenes Lächeln flog ihm um den Mund, als er am linken Saume der Straße die Leiche eines gefallenen schwarzen Böckleins und neben ihr ein altes Hirtenweib erblickte, das ihr faltiges Antlitz beim Nahen der Männer ängstlich mit dem blauschwarzen Schleier bedeckt hatte. »Also darum«, murmelte der Sklave vor sich hin und nickte, die Luft mit dem spitzen Munde küssend, dem schwarzköpfigen Mädchen zu, das zu Füßen der Greisin kauerte. Aber die also Gegrüßte bemerkte nicht diese stumme Werbung; denn ihre Augen folgten wie gebannt den Wanderern und besonders dem jungen Manne. Sobald die drei sich weit genug entfernt hatten, um ihre Stimme nicht mehr zu hören, fragte das Mädchen zusammenschauernd, als sei ein Wüstengeist ihr begegnet, mit gedämpfter Stimme: »Großmutter, wer war das?«
Die Alte lüftete den Schleier, legte der Enkelin die Hand auf die Lippen und flüsterte ängstlich: »Er ist es.«
»Der Kaiser?«
Die Antwort der Alten bestand in einem bedeutungsvollen Nicken; das Mädchen aber drängte sich mit leidenschaftlicher Neugier an die Großmutter, streckte den braunen Kopf weit vor, um besser zu sehen, und fragte leise: »Der junge?«
»Närrin! Der Voranschreitende, der Graubart.«
»Der? Ich wollte, der junge wäre der Kaiser.«
Roms Imperator Hadrian war es in der Tat, der dort schweigend seinen Begleitern voranzog, und es war, als belebe sein Kommen die Einöde; denn sobald er sich dem Schilf nahte, flogen mit pfeifendem Schrei Kibitze in die Höhe und hinter einem Dünenhügel am Saume der breiteren Straße, die Hadrian gemieden, traten zwei Männer in priesterlichen Kleidern hervor. Sie gehörten beide zum Tempel des klassischen Baal, einem kleinen Bauwerk von festem Gestein, das dem Meere zugekehrt war und das gestern der Kaiser besuchte.
»Ob er den Weg verfehlte?«, fragte der eine Priester den anderen in phönizischer Sprache.
»Schwerlich«, lautete die Antwort. »Mastor erzählte, er finde jeden Weg, den er einmal gegangen, auch im Dunkeln wieder.«
»Und doch sieht er mehr in die Wolken als auf den Boden.«
»Aber er versprach uns doch gestern …«
»Bestimmtes hat er nicht zugesagt«, unterbrach ihn der andere.
»Doch; beim Abschied rief er, ich habe es deutlich gehört: Vielleicht komm’ ich wieder und befrage euer Orakel.«
»Vielleicht.«
»Ich glaube, er hat ›wahrscheinlich‹ gesagt.«
»Wer weiß, welch ein Zeichen, das er da oben gesehen, ihn forttreibt. Er geht auf das Lager am Meere zu.«
»Aber in unserem Festsaal steht doch die Mahlzeit für ihn bereit.«
»Für den deckt sich überall die Tafel. Komm! Ein abscheulicher Morgen; mich friert.«
»Warte noch etwas. – Sieh nur.«
»Was?«
»Er trägt nicht einmal einen Hut auf den grauen Locken.«
»Auf Reisen sah ihn noch keiner mit bedecktem Haupte.«
»Und sein grauer Mantel sieht gar nicht kaiserlich aus.«
»Beim Gastmahl trägt er immer den Purpur.«
»Weißt du, an wen mich sein Gang und sein Aussehen erinnern?«
»Nun?«
»An unseren verstorbenen Oberpriester Abibaal; der schritt auch so mächtig und sinnend einher und trug den Bart wie der Kaiser.«
»Ja, ja, und das grübelnde, sinnende Auge.«
»Er sah auch oft in die Höhe. Selbst die breite Stirn haben beide gemein – aber Abibaals Nase war mehr gebogen und sein Haupt weniger kraus gelockt.«
»Unseres Meisters Mund war würdevoll ernst, während die Lippen Hadrians bei allem, was er sagte und hörte, sich spitzten und zuckten, als wollte er spotten.«
»Sieh nur, jetzt wendet er sich zu seinem Liebling – Antonius mein’ ich, heißt der schmucke Geselle.«
»Antinous, nicht Antonius. In Bithynien, sagen sie, habe er ihn aufgelesen.«
»Schön ist er.«
»Schön ohnegleichen. Welcher Wuchs, welches Antlitz! Aber ich wollte doch nicht, daß er mein Sohn wäre.«
»Des Kaisers Liebling?«
»Eben darum. Er sieht jetzt schon aus, als hätte er alles genossen und könnte über nichts mehr Freude empfinden.«
Auf einer kleinen Fläche hart am Ufer des Meeres, die von bröckligen Klippen vor dem Ostwinde geschützt war, standen mehrere Zelte. Zwischen ihnen brannten Feuer, um die sich römische Soldaten und kaiserliche Diener geschart hatten. Halbnackte Knaben, Kinder der in dieser Wüste hausenden Fischer und Kameltreiber, liefen geschäftig hin und her, um die Flammen mit dürren Schilfstengeln und welkem Wüstengestrüpp zu speisen; aber so hoch die Lohe auch aufschlug, schwebte der Rauch doch nicht himmelan, sondern trieb sich, von kurzen Windstößen hin und her gejagt, wie eine auseinandergesprengte Schafherde in kleinen Wolken über den Boden hin. Es war, als fürchte er sich, in die graue, unfreundliche und feuchte Luft aufzusteigen.
Das größte unter den Zelten, vor dem vier römische Soldaten zu zwei und zwei Wache haltend auf und nieder schritten, war nach dem Meere hin weit geöffnet. Die Sklaven, die durch sein breites Tor ins Freie traten, mußten die Bretter, die sie auf den geschorenen Köpfen trugen und auf denen silberne und goldene Schüsseln, Teller, Weinkrüge und Becher mit den Resten einer Mahlzeit standen, mit beiden Händen festhalten, damit der Wind sie nicht zu Boden wehe. Das Innere des Zeltes war völlig schmucklos.
Auf einem Polster an seiner rechten, vom Sturm bewegten Wand lag der Kaiser. Seine blutlosen Lippen waren fest aufeinander gepreßt, die Arme über der Brust gekreuzt und die Augen halb geschlossen. Aber er schlief nicht; denn manchmal öffnete sich sein Mund und zog sich hin und her, als hätte er den Geschmack einer Speise zu prüfen. Bisweilen schlug er auch die langen, mit kleinen Falten und bläulichen Adern ganz überzogenen Lider der Augen auf, wandte sie in die Höhe oder ließ den Blick zur Seite und niederwärts nach der Mitte des Zeltes hin rollen.
Dort lag auf dem mit blauem Tuche verbrämten Felle eines gewaltigen Bären Hadrians Liebling Antinous. Sein schönes Haupt ruhte auf dem künstlich erhaltenen Kopfe des von seinem Gebieter erlegten Tieres, sein rechtes Bein spielte, gestützt von dem in die Höhe gezogenen linken, frei in der Luft und seine Hände beschäftigten sich mit dem Molosserhunde des Kaisers, der seinen klugen Kopf an die hochgewölbte nackte Brust des Jünglings geschmiegt hatte und oft zu seinem weichen Munde hinanstrebte, um ihm seine Zärtlichkeit zu beweisen. Aber Antinous wehrte ihn von sich ab, preßte scherzend die Schnauze des Tieres mit den Händen zusammen oder umwickelte sein Haupt mit dem Ende des weißen Palliums, das ihm von den Schultern gesunken war.
Dem Hunde schien dies Spiel zu behagen; als der Jüngling aber einmal das Tuch fester um seinen Kopf geschlungen hatte und er sich vergeblich bemühte, sich von der Hülle zu befreien, die ihm den Atem beengte, heulte er laut auf, und dieser Klageton veranlaßte den Kaiser, die Lage zu verändern und dem auf dem Bärenfell Ruhenden einen mißbilligenden Blick zuzuwerfen, nur einen Blick, kein Wort des Tadels. Bald veränderte sich auch der Ausdruck in Hadrians Auge, das sich mit so liebevoller Aufmerksamkeit an die Gestalt des Jünglings heftete, als sei sie ein edles, niemals genug zu bewunderndes Kunstwerk. Und wahrlich, die Himmlischen hatten dieses Menschenkindes Leib zu einem solchen gestaltet! Wundervoll weich und doch kräftig war jeder Muskel an diesem Halse, dieser Brust, diesen Armen und Beinen! Ebenmäßiger als das seine konnte kein Menschenantlitz geschnitten sein.
Antinous bemerkte, daß der Gebieter seine Aufmerksamkeit auf das Spiel mit dem Hunde richtete, ließ den Molosser los und wandte das große, aber wenig belebte Auge dem Kaiser zu.
»Was treibst du da?«, fragte Hadrian freundlich.
»Nichts«, lautete die Antwort.
»Niemand tut nichts. Wer es dennoch dahin gebracht zu haben meint, der denkt doch wenigstens, daß er unbeschäftigt sei, und denken ist viel.«
»Ich kann gar nicht denken.«
»Jedermann kann’s, und tatest du es jetzt eben nicht, dann hast du gespielt.«
»Ja, mit dem Hunde.«
Bei dieser Antwort ließ Antinous die Füße zu Boden sinken, wehrte das Tier ab und legte beide Hände unter das lockige Haupt.
»Du bist müde?«, fragte der Kaiser.
»Ja?«
»Wir haben beide den gleichen Teil der Nacht durchwacht, und ich, der um so viel Ältere, fühle mich munter.«
»Du sagtest erst gestern, die alten Soldaten taugten am besten zum Nachtdienst.«
Der Kaiser nickte und versetzte dabei:
»In deinen Jahren lebt man, solange man wacht, dreimal so schnell wie in meinen, darum braucht man wohl auch doppelt so langen Schlaf. Du hast das Recht, müde zu sein. Freilich erst drei Stunden nach Mitternacht erstiegen wir den Berg, und wie häufig endet ein Gastmahl weit später.«
»Es war kalt und unfreundlich da oben!«
»Erst nach dem Aufgang der Sonne.«
»Vorher bemerktest du’s nicht; denn du hattest bis dahin mit den Sternen zu tun.«
»Und du nur mit dir selbst, das ist richtig.«
»Ich dachte auch an deine Gesundheit, als sich vor der Ausfahrt des Helios die kalte Luft erhob.«
»Ich mußte sein Erscheinen erwarten.«
»Erkennst du auch an der Art und Weise des Sonnenaufgangs zukünftige Dinge?«
Hadrian schaute den also Fragenden befremdet an, schüttelte verneinend das Haupt, blickte zur Decke des Zeltes hinauf und sagte nach einer längeren Pause in kurzen, von mancher Gedankenpause unterbrochenen Sätzen:
»Der Tag ist lauter Gegenwart, und aus dem Dunkeln erwächst Zukünftiges; aus der Ackerscholle ersteht das Korn, aus der finsteren Wolke fließt der Regen, aus dem Mutterschoße kommen neue Geschlechter, im Schlaf erneut sich die Frische der Glieder. Was aus dem dunklen Tode hervorgeht, wer weiß es?«
Nachdem der Kaiser dann längere Zeit geschwiegen hatte, fragte der Jüngling: »Aber wenn dich der Sonnenaufgang nichts Zukünftiges lehrt, warum unterbrichst du dann so oft die nächtliche Ruhe und besteigst die Berge, um ihn zu sehen?«
»Warum? warum?«, gab Hadrian langsam zurück, strich nachdenklich den ergrauenden Bart und fuhr wie im Selbstgespräche fort:
»Dem Verstande fehlt auf diese Frage die Antwort, dem Munde das Wort, und stünde es mir zur Verfügung, wer begriffe mich wohl von dem Gesindel? Mit Bildern kommt man bei solchen Fragen am weitesten. Wer am Leben teilhat, ist ein Schauspieler auf der Bühne der Welt. Wer groß sein will auf dem Theater, der besteigt den Kothurn, und ist ein Berg nicht die höchste Unterlage, die der Mensch seiner Sohle zu geben vermag? Der Kasius dort ist ein Hügel, aber ich habe auf gewaltigeren Gipfeln gestanden und unter mir wie Jupiter auf seinem Olymp die Wolken geschaut.«
»Du brauchst keine Berge zu ersteigen, um dich als Gott zu fühlen«, rief Antinous. »Der Göttliche wirst du genannt – du befiehlst, und die Welt muß gehorchen. Mit dem Berge unter sich ist man allerdings dem Himmel näher als in der Ebene, aber …«
»Nun?«
»Ich getraue mich nicht herauszusagen, was mir da einfiel.«
»Sprich nur.«
»Da war ein kleines Mädchen. Wenn ich das auf die Schulter nahm, so streckte es gern den Arm hoch in die Höhe und sagte: ›Ich bin so groß!‹ Es dachte dann, es sei höher als ich, und war doch nur die kleine Panthea.«
»Aber in ihrer Vorstellung war sie die große, und das gibt den Ausschlag; denn für jeden ist jedes Ding nur das, wofür er es hält. – Gewiß, sie nennen mich göttlich, aber ich fühle doch täglich hundertmal die Beschränktheit der menschlichen Kraft und Natur, über die ich nirgends hinaus kann. Auf der Spitze eines Berges empfind’ ich sie nicht. Da will es mir scheinen, als wäre ich groß; denn nichts auf Erden überragt meinen Scheitel in der Nähe und Ferne. Und wenn dort vor meinen Blicken die Nacht verschwindet, das Glanzlicht der jungen Sonne die Welt neu für mich gebiert, indem sie alles noch jüngst vom Dunkel Verschlungene meiner Vorstellung zurückgibt, dann heben mir tiefere Atemzüge die Brust, und die Lunge füllt sich gern mit der reineren und leichteren Luft der Höhe. Dort oben allein und in einsamer Stille berührt mich keine Mahnung an das Treiben da unten, fühle ich mich eins mit der großen vor mir ausgebreiteten Natur. Es kommen und gehen die Wogen des Meeres, es neigen und heben sich die Kronen der Bäume des Waldes, Nebel und Dünste und Wolken wallen auf und verteilen sich hierhin und dorthin, und ich fühle mich da oben so ganz verschmolzen mit dem Geschaffenen, das mich umgibt, daß es mir oftmals scheinen will, als sei es mein Atem, der es bewegt. Wie die Kraniche und Schwalben, so zieht es auch mich in die Weite, und wo wäre es dem Auge wohl eher gestattet, das unerreichbare Ziel wenigstens ahnend zu erspähen, als auf dem Gipfel eines Berges? Die unbegrenzte Ferne, die die Seele sucht, scheint hier eine mit dem Sinnen erfaßbare Form zu gewinnen, und der Blick berührt ihre Schranken. Erweitert, nicht erhoben nur fühlt sich da das ganze Wesen, und die Sehnsucht, die ich, sobald ich das Gewühl des Lebens teile und die Sorge für den Staat meine Kräfte aufrufen, fühle, sie schwindet … Aber das verstehst du nicht, Knabe – das alles sind Dinge, die ich mit keinem anderen Sterblichen teile.«
»Nur mir verschmähst du nicht sie zu zeigen«, rief Antinous, der sich dem Kaiser voll zugewandt und mit weit geöffneten Augen keines seiner Worte verloren hatte.
»Dir?«, fragte Hadrian, und ein Lächeln, das nicht frei war von Spott, flog ihm um die Lippen. »Vor dir hab’ ich so wenig ein Geheimnis wie vor dem Amor des Praxiteles in meinem Arbeitszimmer zu Rom.«
Aus des Jünglings Herzen stieg das Blut in die Wangen und färbte sie mit flammendem Purpur.
Der Kaiser bemerkte es und fügte begütigend hinzu:
»Du bist mir mehr als das Kunstwerk. Der Marmor kann nicht erröten. In der Zeit des Atheners regierte die Schönheit das Leben, du aber beweist mir, daß es den Göttern gefällt, sie auch in unserer heutigen Welt zu verkörpern. Dein Anblick versöhnt mich mit den Disharmonien des Daseins. Es tut mir wohl, aber wie sollt’ ich von dir verlangen, daß du mich verstehst? Deine Stirne ward nicht zum Grübeln geschaffen. Oder hättest du eines von meinen Worten verstanden?«
Antinous stützte den Oberkörper auf die Linke, und die Rechte erhebend rief er ein entschiedenes »Ja«.
»Welches?«, fragte der Kaiser.
»Ich kenne die Sehnsucht.«
»Wonach?«
»Nach vielen Dingen.«
»Nenne mir eines.«
»Genuß, dem keine Ernüchterung folgt; ich kenne keinen.«
»Diesen Wunsch teilst du mit der ganzen römischen Jugend; sie pflegt sich nur den Nachsatz zu sparen. Weiter!«
»Ich darf nicht.«
»Wer verbietet dir, offen mit mir zu reden?«
»Du tatest es selbst.«
»Ich?«
»Ja, du; denn du untersagtest mir, dir von meiner Heimat, meiner Mutter, den Meinen zu sprechen.«
Des Kaisers Stirn faltete sich, und gebieterisch fiel er ihm ins Wort:
»Ich bin dein Vater, und mir soll deine ganze Seele gehören.«
»Sie ist dein eigen«, entgegnete der Jüngling, ließ sich auf das Bärenfell zurückfallen und zog das Pallium fest um seine Schultern; denn ein Windstoß blies kalt durch das sich öffnende Tor des Zeltes, durch das Phlegon, der Geheimschreiber des Kaisers, dem Gebieter entgegentrat. Ihm folgte ein Sklave mit mehreren versiegelten Rollen unter dem Arme.
»Ist es dir genehm, Cäsar, daß wir die eingelaufenen Schriften und Briefe erledigen?«, fragte der Beamte, dessen schön geordnete Haare der Seewind zerzaust hatte.
»Ja; dann aber wollen wir aufzeichnen, was ich in dieser Nacht am Himmel beobachten konnte. Hast du die Tafeln zur Hand?«
»Ich ließ sie in dem zur Arbeit aufgeschlagenen Zelte ausbreiten, Cäsar.«
»Der Sturm ist heftig geworden?«
»Er scheint zugleich von Osten und Norden zu wehen. Die See geht sehr hoch. Die Kaiserin wird eine schlimme Überfahrt haben.«
»Wann brach sie auf?«
»Gegen Mitternacht wurden die Anker gelichtet. Das Schiff, mit dem sie aus Alexandria geholt ward, ist ein schönes Fahrzeug, aber es rollt in unangenehmer Weise von der einen Seite zur anderen.«
Hadrian lachte bei diesen Worten mit schneidiger Schärfe auf und rief:
»Das wird ihr das Herz und den Magen von oberst zu unterst kehren. Ich wünschte, ich könnte dabei sein! Aber nein – bei allen Göttern nein, ich wollte es nicht! Heute vergißt sie sicher sich zu schminken. Und wer baut ihr die Haare auf, wenn auch ihre Frauen das Schicksal ereilt? Wir bleiben heute hier; denn treffe ich sie bald nach ihrer Ankunft in Alexandria, so ist sie lauter Galle und Essig.«
Hadrian erhob sich bei diesen Worten vom Lager und trat, indem er Antinous mit der Hand grüßte, dem Geheimschreiber voran ins Freie.
Dem Gespräche des Günstlings mit dem Gebieter hatte als Dritter vom Hintergrunde des Zeltes aus der Jazygier Mastor beigewohnt. Er war Sklave und wurde darum so wenig beachtet wie der molossische Hund, der Hadrian gefolgt war, oder das Polster, auf dem der Kaiser gelegen.
Der hübsche, gut gewachsene Mann drehte eine Zeitlang die Enden seines langen rötlichen Schnurrbartes, strich sich mit der Hand über den runden, kurz geschorenen Schädel, zog den offenen Chiton über die in besonders hellem Weiß schimmernde Brust zusammen und verwandte dabei keinen Blick von Antinous, der sich umgekehrt hatte und das Antlitz samt den Händen, die es bedeckten, in das Fell am Hinterhaupte des Bären drückte.
Mastor hatte ihm etwas zu sagen, aber er wagte es nicht, ihn anzurufen, denn der Günstling war unberechenbar in seinem Verhalten gegen ihn. Manchmal hörte er ihm gerne zu und sprach mit ihm wie mit einem Freunde, manchmal wies er ihn härter zurück als ein strenger Emporkömmling den untersten Diener. Endlich faßte der Sklave sich ein Herz und rief den Jüngling an; denn es schien ihm leichter, Scheltworte hinzunehmen, als einen schon in Worte umgesetzten, warm empfundenen Gedanken, so klein er auch sein mochte, in sich zu verschließen.
Antinous hob das Haupt ein wenig über die Hände empor und fragte:
»Was willst du?«
»Ich wollte dir nur sagen«, entgegnete der Jazygier, »daß ich weiß, wer das kleine Mädchen war, das du dir manchmal auf die Schultern setztest. Nicht wahr, es ist dein Schwesterchen gewesen, von dem du mir neulich erzähltest?«
Der also Angeredete nickte mit dem Kopfe, vergrub ihn wiederum in die Hände, und seine Schultern flogen so lebhaft auf und nieder, daß es aussah, als ob er weine.
Da schwieg Mastor einige Minuten. Dann trat er Antinous näher und sagte:
»Du weißt, ich habe einen Sohn und ein Töchterchen zu Hause, und ich höre gern von kleinen Mädchen erzählen. Wir sind beide allein, und wenn dir’s die Seele erleichtert …«
»Laß nur, ich habe dir schon zehnmal von meiner Mutter und der kleinen Panthea erzählt«, entgegnete Antinous, indem er sich gefaßt zu erscheinen bemühte.
»So tue es heute getrost zum elften Male«, bat der Sklave. »Ich kann im Lager und in der Küche über die Meinen so viel sprechen, wie ich nur will. Aber du? Wie hieß gleich das Hündchen, dem die kleine Panthea die rote Kappe nähte?«
»Kalliste nannten wir’s«, rief Antinous und wischte die Augen mit dem Rücken der Hand. »Mein Vater wollte es nicht dulden, wir aber gewannen die Mutter. Ich war ihr Liebling, und wenn ich sie umfaßte und mit beiden Augen bittend zu ihr aufsah, so sagte sie ›Ja‹ zu allem, um was ich sie bat.«
Ein froher Glanz leuchtete aus dem müden Auge des Jünglings, er hatte an eine Reihe von Freuden gedacht, auf die keine Ernüchterung gefolgt war.
Zweites Kapitel
Einer der von den ptolemäischen Fürsten in Alexandria erbauten Königspaläste lag auf der Landzunge Lochias, die sich wie ein nach Norden weisender Finger in das blaue Meer hinausstreckte. Sie bildete die östliche Grenze des großen Hafens. Es fehlte ihm niemals an zahlreichen Fahrzeugen jeder Art, heute aber war er besonders reich besetzt und die mit geglätteten Steinplatten gepflasterte Kaistraße, die aus dem vom Meer bespülten Palastviertel der Stadt, dem sogenannten Bruchium, zu der Landzunge führte, war so überfüllt von neugierigen Bürgern zu Fuß und zu Wagen, daß diese, bevor sie den Privathafen der kaiserlichen Schiffe erreicht hatten, die Fahrt unterbrechen mußten.
Es gab aber auch Ungewöhnliches an dem Landungsplatze zu sehen; denn da lagen, von hohen Molen geschützt, die prächtigen Dreiruderer, Galeeren, Lang- und Lastschiffe, die die Gattin des Hadrian und das Gefolge des Herrscherpaares nach Alexandria gebracht hatten. Ein mächtiges Fahrzeug mit einem sehr hohen Kajütenhause auf dem Hinterdeck und dem Kopf einer Wölfin am baumhohen, kühn geschwungenen Schnabel erregte die größte Aufmerksamkeit. Es war ganz aus Zedernholz gearbeitet, reich mit Bronze und Elfenbeinzierat geschmückt und hieß »Sabina«. Ein junger Bürger wies mit dem Finger auf diesen am Stern des Schiffes mit goldenen Lettern angebrachten Namen, stieß seine Begleiter an und sagte lachend:
»Sabina hat den Kopf einer Wölfin.«
»Ein Pfauenkopf würde besser passen. Sahst du sie gestern ins Cäsareum fahren?«, entgegnete der andere.
»Leider«, rief der erstere, schwieg aber sogleich, als er dicht hinter sich einen römischen Liktor bemerkte, der ein schön zusammengeschnürtes Bündel von Ulmenruten, die Faszes, auf der linken Schulter trug und mit dem Stöcklein in der rechten Hand, unterstützt von seinen Genossen, die Menge zu zerteilen und Platz für den Wagen seines Gebieters, des kaiserlichen Präfekten Titianus, zu schaffen suchte, der ihm in langsamem Schritte folgte.
Der hohe Beamte hatte die losen Worte der Bürger vernommen und sagte, indem er sich an den neben ihm stehenden Mann wandte und das Ende der Toga mit einem raschen Wurfe in neue Falten brachte:
»Wunderliches Volk! Ich kann ihm nicht gram sein, aber ich ritte lieber auf einem Messer als auf einer alexandrinischen Zunge von hier nach Kanopus.«
»Hörtest du, was der Dicke vorhin über Verus sagte?«
»Der Liktor wollte ihn fassen, aber mit Strenge kommt man bei ihnen zu gar nichts. Müßten sie für jedes giftige Wort nur einen Sesterz zahlen, ich sage dir, Pontius, die Stadt würde verarmen und unser Schatz bald voller sein als der des alten Gyges von Sardes.«
»Laß sie reich bleiben«, rief der andere, der Oberbaumeister der Stadt, ein Mann von einigen dreißig Jahren mit hochgewölbten, tatkräftig dreinschauenden Augen, und fuhr, indem er die Rolle, die er in der Hand hielt, kräftig zusammenfaßte, mit tiefer Baßstimme fort: »Sie verstehen zu arbeiten und Schweiß ist salzig. Beim Schaffen fördern, in der Ruhe beißen sie einander wie übermütige Rosse an der gleichen Stange. Der Wolf ist ein stattliches Tier, aber brich ihm die Zähne aus, so wird er zum garstigen Hunde.«
»Mir aus der Seele gesprochen«, rief der Präfekt. »Aber da sind wir. Ewige Götter, so schlimm hab’ ich mir das Ding doch nicht gedacht. Von weitem sah es immer noch stattlich genug aus!«
Titianus und der Baumeister stiegen vom Wagen. Jener befahl einem Liktor, den Vorsteher des Palastes zu rufen, und besichtigte dann mit dem Begleiter zuerst die in den Palast führende Pforte. Sie bot mit den doppelten Säulen, die den hohen Giebel trugen, einen majestätischen Anblick, aber sie bot einen keineswegs freundlichen Anblick; denn der Stuck war an vielen Stellen von den Wänden gefallen, die Kapitäle der marmornen Säulen waren kläglich verstümmelt, und die hohen, mit Metall beschlagenen Türflügel hingen schief in den Angeln.
Pontius maß jeden Teil der Pforte scharf prüfenden Blickes und trat dann mit dem Präfekten in den ersten Hof des Palastes, in dem zur Zeit der ptolemäischen Fürsten die Zelte der Gesandten, Schreiber und diensttuenden Beamten der Könige gestanden hatten.
Dort stellte sich den beiden ein unvermutetes Hindernis entgegen, denn von dem Häuschen aus, in dem der Torhüter wohnte, waren mehrere Stricke quer über den gepflasterten Raum gespannt, auf dem Gras grünte und hohe Disteln blühten.
An den Seilen hing feuchte Wäsche von jeder Größe und Form.
»Ein hübsches Quartier für den Kaiser«, seufzte Titianus, die Achseln zuckend, und wehrte dem Liktor, der die Faszes erhoben hatte, um die Stricke zu Boden zu schlagen.
»Ist nicht so schlimm, wie es aussieht«, sagte der Baumeister entschieden. »Torhüter! He, Torhüter! Wo steckt nur der Nichtstuer?«
Während er rief und der Liktor in das Innere des Palastes eilte, schritt Pontius auf das Häuschen des Wächters zu und blieb, nachdem er sich in gebückter Stellung einen Weg durch die feuchten Tücher gebahnt hatte, stehen. Ungeduld und Verdruß hatten sich, seitdem er die Schwelle des Tores überschritten, auf seinen Zügen gespiegelt, jetzt aber begann sein kräftiger Mund zu lächeln und mit halblauter Stimme rief er dem Präfekten zu:
»Titiane, gib dir die Mühe!«
Dem alternden Würdenträger, dessen hohe Gestalt die des Baumeisters um eines vollen Hauptes Länge überragte, wurde es nicht eben leicht, mit gekrümmtem Rücken unter den Seilen dahinzuschreiten. Aber er tat es mit guter Laune, und indem er sorglich vermied, die Wäsche herunterzureißen, rief er Pontius zu: »Ich beginne die Kinderhemden zu achten. Unter ihnen kommt man doch mit ungebrochenem Rückgrat hindurch. – Ach, ach! Das ist köstlich!«
Dieser Ruf galt dem Anblick, zu dem der Baumeister den Präfekten geladen und der allerdings eigentümlich genug war.
Die Vorderseite des Torhüterhäuschens war ganz mit Efeu umwachsen, der auch das Fenster und die Tür der Wächterwohnung mit vollen Ranken einrahmte. Zwischen dem grünen Laubwerke hingen zahlreiche Käfige mit Staren, Amseln und kleineren Singvögeln. Die breite Pforte des Häuschens stand weit geöffnet und gestattete, ein ziemlich geräumiges, heiter bemaltes Zimmer ganz zu überblicken. Im Hintergründe dieses Gemaches sah man das Tonmodell eines Apollo von vortrefflicher Arbeit. Über und neben ihm hingen an der Wand Lauten und Leiern von verschiedener Größe und Form.
In der Mitte des Zimmers und dicht neben der geöffneten Tür war ein Tisch zu sehen, auf dem ein großer Vogelbauer mit mehreren Nestern voll junger Stieglitze und mit grünem Kraut zwischen den rundlichen Stäbchen, ein großer Weinkrug und ein mit fein geschnitztem Bildwerk geschmückter elfenbeinerner Becher stand. Neben dem Trinkgeschirre ruhte auf der steinernen Platte der Tafel der Arm einer ältlichen Frau, die in ihrem Lehnsessel eingeschlafen war. Trotz des kleinen grauen Schnurrbarts an der Oberlippe und des kräftigen Rots auf der Stirn und den Wangen sah sie freundlich und gut aus. Es mußte ihr auch etwas sehr Angenehmes träumen; denn die Stellung ihres Mundes und der Augen, von denen das eine halb offen, das andere fest verschlossen war, gaben ihr das Ansehen, als ob sie sich freute.
In ihrem Schoße schlief eine graue Katze und neben ihr, als meide die Zwietracht dies heitere Gemach, das keineswegs der Geruch der Armut, sondern ein angenehmer, eigentümlicher Duft erfüllte, ein kleiner, zottiger Hund, der das schneeige Weiß seines Felles sicherlich besonders sorgsamer Pflege verdankte. Zwei andere, dem ersteren ähnliche Hündlein lagen lang ausgestreckt auf dem Estrich zu Füßen der Alten und schienen nicht weniger fest als diese zu schlafen.
Der Baumeister wies, sobald der Präfekt ihn erreicht hatte, mit dem Finger in dies Stilleben hinein und flüsterte:
»Hätten wir hier einen Maler, das gäbe ein prächtiges Bildchen.«
»Unvergleichlich!«, gab Titianus zurück. »Nur scheint mir das tiefe Inkarnat auf dem Antlitz der Alten mit Hinblick auf die Größe des neben ihr stehenden Weinkruges ein wenig bedenklich.«
»Aber sahst du jemals ein friedvoller, freundlicher gestimmtes Bildnis?«
»So hat Baucis geschlafen, wenn Philemon sich einmal einen Ausgang erlaubte. Oder war dieser anhängliche Gatte immer zu Hause?«
»Wahrscheinlich. Aber nun ist’s vorbei mit dem Frieden.«
Die Nähe der Freunde hatte das eine Hündchen erweckt. Es schlug an, und sogleich erhoben sich seine Gefährten und bellten mit ihm um die Wette. Auch der Liebling der Alten sprang ihr vom Schöße. Seine Herrin und die Katze ließen sich indessen von diesem Lärm nicht stören und schliefen weiter.
»Eine Wächterin wie sie sein soll«, lachte der Architekt.
»Und diese Phalanx von Hunden, welche den Palast eines Kaisers bewacht«, fügte Titianus hinzu, »läßt sich leicht mit einem Schlage erlegen. Gib acht, jetzt erwacht die würdige Matrone.«
Die Alte war in der Tat von dem Gebell der Hunde gestört worden, hatte sich ein wenig aufgerichtet, die Hände erhoben und sich dann, indem sie einen kurzen Satz halb sang, halb sprach, wieder in den Lehnstuhl zurückgeworfen.
»Das ist köstlich«, rief der Präfekt. »Nur immer munter, hat sie aus dem Schlafe gerufen. Wie sich dies seltsame Menschenkind wohl ausnehmen mag, wenn es wach ist?«
»Mir wär’ es leid, die Alte aus ihrem Neste zu treiben«, sagte der Baumeister, indem er die Rolle entfaltete.
»Du rührst mir nicht an das Häuschen«, rief der Präfekt mit lebendigem Eifer. »Ich kenne Hadrian. Er liebt so eigentümliche Dinge und Menschen, und ich wette, daß er mit der Alten in seiner Weise anbinden wird. Da kommt wohl endlich der Verwalter dieses Palastes.«
Der Präfekt irrte sich nicht; denn die raschen Schritte, deren Nahen er vernommen hatte, gingen von dem Erwarteten aus.
Schon aus einiger Entfernung hörte man das Keuchen des sich beeilenden Mannes, der auf dem weiteren Gange, bevor Titianus es hindern konnte, die über den Hof gespannten Stricke mitsamt der an ihnen hängenden Wäsche zu Boden riß.
Nachdem der Vorhang gefallen war, der ihn von dem Vertreter des Kaisers und seinem Begleiter trennte, verneigte er sich so tief wie vor jenem, wie dies die große Fülle seines Leibes gestattete. Aber der schnelle Lauf, die Gewalttat, die er begangen, und seine Überraschung über das Erscheinen des mächtigsten Mannes am Nil in dem seiner Obhut anvertrauten Gebäude beraubten ihn so ganz des ohnehin nicht ausgiebigen Atems, daß er selbst den herkömmlichen Gruß nicht zu stammeln vermochte.
Titianus ließ ihm auch wenig Zeit; denn, nachdem er dem Bedauern über das schlimme Schicksal der am Boden liegenden Wäsche Ausdruck gegeben und dem Beamten den Namen und Beruf seines Freundes Pontius genannt hatte, eröffnete er ihm in knappen Worten, daß der Kaiser wünsche, in dem von ihm gehüteten Palaste zu wohnen, daß er, Titianus, Kenntnis von seiner schlechten Erhaltung besitze und gekommen sei, um mit dem Architekten und ihm zu beraten, was in wenigen Tagen geschehen könnte, um das vernachlässigte Schloß für Hadrian bewohnbar zu machen und wenigstens die ins Auge fallenden Schäden auszubessern. Er, der Verwalter, möge ihn nun von einem Raum in den anderen führen.
»Sogleich – sofort«, entgegnete der in vielen Jahren der Ruhe zu seinem schweren Körpergewicht gelangte Grieche. »Ich eile und hole die Schlüssel!«
Während er sich keuchend entfernte, lockerte er mit schnellen Bewegungen der kurzen, runden Finger die rechte Seite des immer noch vollen Haares auf.
Pontius schaute ihm nach und sagte:
»Ruf ihn zurück, Titianus. Er wurde beim Brennen seiner Locken gestört. Nur die eine Seite war fertig, als der Liktor ihn abrief. Ich biete meinen Kopf zum Pfande, daß er auch die andere kräuseln läßt, bevor er zurückkehrt. Ich kenne meine Griechen!«
»Laß ihn!«, entgegnete Titianus. »Schätzest du ihn richtig, so wird er doch erst ohne Nebengedanken auf unsere Fragen eingehen, wenn auch die andere Hälfte des Haares gelockt ist. Ich weiß gleichfalls meine Hellenen zu nehmen.«
»Besser als ich, wie ich sehe«, versetzte der Architekt im Tone fester Überzeugung. »Ein Staatsmann arbeitet eben mit Menschen, wie wir mit leblosen Massen. Sahst du, wie der Dicke erbleichte, als du von den wenigen Tagen sprachst, nach deren Ablauf der Kaiser hier den Einzug zu halten gedenkt? Es muß schön in dem alten Dinge dort aussehen! Jede Stunde ist kostbar, und wir haben hier schon zu lange gesäumt.«
Der Präfekt nickte dem Baumeister beistimmend zu und folgte ihm in die inneren Räume des Schlosses.
Wie groß, wie harmonisch war die Anlage dieses ungeheuren Baues, durch den der nunmehr rings von schönen Locken geschmückte Palastvorsteher Keraunus die Römer führte!
Der Palast stand auf einem künstlichen Hügel inmitten der Landzunge Lochias, und von manchem Fenster und manchem Altane aus ließen sich die Straßen und Plätze, die Häuser, Tempel und öffentlichen Bauten der Weltstadt und ihr von Schiffen wimmelnder Hafen schön überblicken. Reich, mannigfaltig und vielfarbig war die Aussicht von der Lochias nach Westen und Süden; wer aber von dem Altan des Ptolemäerpalastes nach Morgen und Mitternacht schaute, vor dem eröffnete sich der niemals ermüdende Blick über die nur vom Himmelsgewölbe begrenzte unendliche See.
Als Hadrian vom Kasischen Berge aus seinem Präfekten Titianus durch einen eilenden Boten befohlen hatte, gerade dies Bauwerk zu seinem Empfang einrichten zu lassen, wußte er wohl, was seine Lage ihm bieten konnte; – das vernachlässigte Innere des seit dem Sturze Kleopatras unbewohnten Schlosses genügend herzustellen, war die Sache seiner Beamten.
Acht, vielleicht neun Tage ließ er ihnen Zeit, wenig mehr als eine Woche! Und wie fanden Titianus und Pontius, dem beim Sehen und Zeichnen, Untersuchen und Schreiben der helle Schweiß von der Stirn rann, diese verkommene, ausgeplünderte Stätte des höchsten Glanzes!
Die Säulen und Treppen in den Innenräumen waren erträglich erhalten, aber in die offenen Decken der Fest- und Versammlungssäle hatte es hineingeregnet, die herrlichen Mosaikfußböden waren hier auseinandergewichen, dort sproß mitten in einem Saal, einer Halle oder einem Säulenhofe eine kleine Wiese; denn schon Oktavianus Augustus, Tiberius, Vespasian, Titus und eine ganze Reihe von Präfekten hatten die schönsten musivischen Bilder aus dem berühmten Ptolemäerpalast auf der Lochias sorgfältig ausbrechen und nach Rom oder in die Provinz bringen lassen, um dort ihre Stadthäuser oder Villen mit ihnen zu zieren.
Ebenso war es gerade den schönsten Bildsäulen ergangen, mit denen vor einigen hundert Jahren die kunstsinnigen Lagiden diesen Palast, neben dem sie freilich noch andere größere im Bruchium besaßen, geschmückt hatten.
Mitten in einer weiten Marmorhalle stand ein mit dem vortrefflichen Aquädukt der Stadt zusammenhängender, herrlich gearbeiteter Springbrunnen. Der Zugwind strömte in diesen Saal ein und peitschte das Wasser in stürmischen Tagen über seinen ganzen, des musivischen Schmuckes beraubten Boden, der nun, wohin auch der Fuß trat, mit einem dünnen, dunkelgrünen, schlüpfrig feuchten Überzug von moosigen Pflanzengeweben bedeckt war.
In dieser Halle war es, wo der Palastvorsteher Keraunus sich keuchend an eine Wand lehnte und, die Stirn trocknend, mehr schnaufte als sagte: »Angelangt – am Ende!«
Diese Worte hörten sich an, als meine er sein eigenes Ende, nicht das des Palastes, und es klang wie ein gegen ihn gerichteter Hohn, als der Baumeister Pontius ungesäumt mit der ihm eigenen Entschiedenheit entgegnete:
»Gut, so können wir die Untersuchung von hier aus sogleich von neuem beginnen.«
Keraunus widersprach nicht, als er aber der vielen wiederum zu ersteigenden Treppen gedachte, sah er aus, als habe man ihm das Todesurteil gesprochen.
»Ist es nötig, daß ich auch bei deiner weiteren Arbeit, die doch wohl das einzelne ins Auge faßt, bei dir bleibe?«, fragte der Präfekt den Baumeister.
»Nein«, entgegnete dieser, »vorausgesetzt freilich, daß du dich bequemst, gleich jetzt in meinen Plan zu schauen, dich im ganzen von dem, was ich vorhabe, zu unterrichten und mir Vollmacht zu erteilen, in jedem einzelnen Falle über Menschen und Mittel frei zu verfügen.«
»Zugestanden«, entgegnete Titianus. – »Ich weiß, daß Pontius keinen Mann und keinen Sesterz mehr oder weniger in Anspruch nehmen wird, als der Zweck es gebietet.«
Der Baumeister verneigte sich schweigend, Titianus aber fuhr fort:
»Vor allen Dingen: glaubst du in acht Tagen und neun Nächten mit deiner Aufgabe zu Ende zu kommen?«
»Zur Not – vielleicht. – Stünden mir nur vier Tage mehr zur Verfügung, wahrscheinlich.«
»Es würde also gelten, Hadrians Ankunft um viermal vierundzwanzig Stunden zu verzögern.«
»Sende ihm anregende Leute, etwa den Astronomen Ptolemäus und den Sophisten Favorinus, der ihn hier erwartet, nach Pelusium entgegen. Sie bringen es fertig, ihn dort aufzuhalten.«
»Kein übler Gedanke! Wir wollen sehen. Aber wer kann mit den Stimmungen der Kaiserin rechnen? Denke in jedem Falle, du hättest nur über acht Tage zu gebieten.«
»Gut.«
»Wo hoffst du Hadrian unterbringen zu können?«
»Brauchbar im eigentlichen Sinne sind nur kleine Teile des alten Gebäudes.«
»Davon mußte ich mich leider selbst überzeugen«, erwiderte der Präfekt mit Nachdruck und fuhr, indem er sich an den Vorsteher wandte, nicht streng verweisend, doch im Ton des Bedauerns fort:
»Mir will es scheinen, Keraunus, als wäre es deine Pflicht gewesen, mich schon früher über den Verfall dieses Bauwerks in Kenntnis zu setzen.«
»Ich klagte bereits«, entgegnete der Angeredete, »aber ich erhielt auf meine Eingabe zur Antwort, es stünden keine Mittel zur Verfügung.«
»Ich weiß nichts von dieser Sache«, rief Titianus. »Wann sandtest du dein Gesuch auf die Präfektur?«
»Unter deinem Vorgänger Haterius Nepos geschah es.«
»So –« entgegnete der Präfekt gedehnt. »Damals! Ich an deiner Stelle hätte meine Eingabe in jedem Jahre und unbedingt beim Amtsantritt des neuen Präfekten wiederholt. Aber wir haben jetzt keine Zeit, über Versäumtes zu klagen. Während der Anwesenheit des Kaisers sende ich vielleicht einen meiner Beamten zu deiner Unterstützung hierher.«
Dabei wandte Titianus dem Verwalter kurz den Rücken und fragte den Baumeister:
»Nun, mein Pontius, welchen Teil des Palastes hast du ins Auge gefaßt?«
»Die inneren Säle und Zimmer sind noch am besten erhalten.«
»Aber an sie dürfen wir am wenigsten denken!«, rief Titianus. »Der Kaiser ist im Lager mit allem zufrieden, doch wo es freie Luft gibt und einen Blick in die Ferne, da muß er sie haben.«
»So wählen wir die westliche Zimmerreihe. Halte den Plan, mein stattlicher Freund.«
Der Verwalter tat, wie ihm geheißen. Der Baumeister ergriff den Stift, strich mit ihm kräftig durch die Luft über die linke Seite des Risses und sagte:
»Dies ist die Abendfront des Palastes, die man vom Hafen aus überblickt. Von Süden her kommt man zuerst in das hohe Peristyl, das als Warteraum benützt werden mag. Es wird von Zimmern für die Sklaven und Leibwächter umgeben. Die folgenden kleineren Säle neben dem Hauptgange weisen wir den Beamten und Schreibern an, in dieser geräumigen hypäthralen1 Halle – die mit den Musen – erteilt Hadrian Audienzen und es können sich in ihr die Gäste versammeln, denen er in diesem breiten Peristyl an seiner Tafel zu speisen gestattet. Die kleineren, gut erhaltenen Zimmer zur Seite des langen Ganges hier, der in die Wohnung des Verwalters führt, sollen den Pagen, Sekretären und anderen persönlichen Dienern des Cäsar gehören. Der lange, mit edlem Porphyr und grünem Marmor getäfelte und mit dem schönen Bronzefries geschmückte Raum wird Hadrian, denke ich, als Arbeitsgemach und Ruhezimmer gefallen.«
»Vortrefflich!«, rief Titianus. »Ich möchte deinen Plan der Kaiserin zeigen.«
»Dann würde ich statt acht Tage ebensoviel Wochen gebrauchen«, entgegnete Pontius gelassen.
»Du hast recht«, lachte der Präfekt und fragte dann: »Aber sage, Keraunus, warum fehlen gerade in den besten Zimmern die Türen?«
»Sie bestanden aus kostbarem Thyiaholze und man begehrte sie in Rom zu haben.«
»Ich bin dort wohl einer oder der anderen begegnet«, murmelte der Präfekt. »Deine Schreiner müssen sich tummeln, Pontius.«
»Sage lieber, die Teppichhändler können sich freuen. Wo es angeht, verschließen wir mit schweren Vorhängen die Pforten.«
»Was wird aus dieser feuchten Wohnung für Frösche, die, wenn ich nicht irre, an den Speisesaal stoßen muß?«
»Ein mit Blattpflanzen angefüllter Garten.«
»Das läßt sich hören. Aber die zerbrochenen Bildsäulen da drin?«
»Die schlimmsten schaffen wir fort.«
»Steht Apoll mit den neun Musen nicht in dem von dir zum Audienzsaal bestimmten Raume?«
»Ja.«
»Sie sind, denk’ ich, erträglich erhalten?«
»So so.«
»Die Urania fehlt gänzlich«, bemerkte der Palastvorsteher, indem er immer noch den Plan vor sich hin hielt.
»Wo kam sie hin?«, fragte Titianus nicht ohne Erregung.
»Deinem Vorgänger, dem Präfekten Haterius Nepos, gefiel sie besonders, und er nahm sie mit sich nach Rom«, lautete die Antwort.
»Warum auch gerade Urania?«, rief Titianus verdrießlich. »Sie darf im Audienzsaal des himmelskundigen Kaisers nicht fehlen. Was ist da zu tun?«
»Es wird schwer sein, eine andere fertige Urania in der Größe ihrer Schwestern zu finden, und zum Suchen fehlt es an Zeit; so muß denn eine neue hergestellt werden.«
»In acht Tagen?«
»Und ebenso vielen Nächten!«
»Aber ich bitte dich; bevor der Marmor …«
»Wer denkt an den? Papias macht uns eine aus Stroh und Tüchern und Gips – ich kenne den Zauber – und damit die anderen nicht zu sehr von der neugeborenen Schwester abstechen, werden sie sämtlich weiß übertüncht.«
»Vortrefflich; aber warum wählst du einen Papias, da wir doch einen Harmodius haben?«
»Harmodius nimmt es ernst mit der Kunst, und bevor er fertig ist mit seinen Entwürfen, kommt schon der Kaiser. Papias arbeitet mit dreißig Gehilfen, was man auch bei ihm bestellt, wenn es nur Geld bringt. Seine letzten Sachen freilich, besonders die schöne Hygieia für den Juden Dositheos und die im Cäsareum aufgestellte Büste Plutarchs machten mich stutzig; denn sie sind voller Anmut und Kraft. Aber wer mag unterscheiden, was ihm gehört, was seinen Schülern? Genug, er weiß, wie man’s macht, und gibt es was Rechtes zu verdienen, so haut er dir in fünf Tagen eine ganze Seeschlacht aus Marmor.«
»So gib Papias den Auftrag. Aber die armen, verstümmelten Fußböden; was tust du mit ihnen?«
»Gips und Farbe müssen sie heilen«, entgegnete Pontius. »Wo das nicht glücken will, legen wir nach der Sitte des Morgenlandes Teppiche über den Estrich. Gnädige Nacht, wie dunkel es wird! Gib den Plan, Keraunus, und sorge für Fackeln und Lampen; denn der heutige Tag und seine Nachfolger werden vierundzwanzig voll gemessene Stunden haben. Ich bitte dich um ein halbes Dutzend zuverlässiger Sklaven, Titiane. Sie müssen als Boten benutzbar sein. Was stehst du da, Mann? Licht hab’ ich gesagt! Ein halbes Leben hattest du Zeit, dich auszuruhen, und dir blühen nach dem Abschied des Kaisers ebensoviel Jahre zu dem gleichen köstlichen Zwecke …«
Der Verwalter hatte sich bei diesen Worten schweigend entfernt, der Baumeister schenkte ihm aber nicht das Ende des Satzes und rief ihm nach:
»Wenn du bis dahin nicht in deinem Fette erstickt bist. – Ob wohl Nilschlamm oder Blut in den Adern dieses Ungetüms rollt?«
»Kann mir gleich sein«, entgegnete der Präfekt, »wenn in den deinen das immer prächtiger glühende Feuer nur bis zum Ende des Werkes aushält. Hüte dich vor übergroßer Ermüdung am Anfang, und mute deiner Kraft nicht das Unmögliche zu; denn Rom und die Welt erwarten noch Großes von dir. Völlig beruhigt schreib’ ich nun dem Kaiser, daß auf der Lochias alles für ihn bereit sein wird, und zum Abschied rufe ich dir zu: Verzagen ist Torheit – wenn Pontius nur da und Pontius mit seinem Beistand zur Hand ist.«
nicht überdachten <<<
Drittes Kapitel
Der Präfekt befahl den neben seinem Wagen auf ihn wartenden Liktoren, in sein Haus zu eilen und mehrere zuverlässige, in Alexandria heimische Sklaven, die er einzeln namhaft machte, dem Baumeister Pontius zuzuführen und außerdem für den Architekten ein gutes Ruhebett mit Polstern und Decken, sowie eine Mahlzeit und edlen Wein in den alten Palast auf der Lochias zu schicken. Dann bestieg er den Wagen und fuhr durch das Bruchium dem Meere entlang zu dem das Cäsareum genannten Prachtbau.
Er kam nur langsam vorwärts; denn je mehr er sich seinem Ziele näherte, je dichter wurde die Menge der neugierigen Bürger, die Kopf an Kopf das weitläufige Gebäude umstanden.
Schon von fern leuchtete dem Präfekten helles Licht entgegen. Es stieg aus großen Pechpfannen gen Himmel, die man auf den Türmen zu beiden Seiten des hohen, dem Meere zugewandten Tores des Cäsareums aufgestellt hatte.
Zur Linken und Rechten dieser Pforte erhob sich je ein stattlicher Obelisk. An beiden entzündete man noch die Lampen, die gestern an ihren vier Seiten und auf ihrer Spitze befestigt worden waren. Zu Ehren Sabinas, dachte der Präfekt. Was dieser Pontius ausführt, hat Hand und Fuß, und es gibt kein überflüssigeres Geschäft, als seine Anordnungen zu überwachen.
Ganz erfüllt von dieser Erwägung unterließ er es auch, sich dem erleuchteten Tore zu nähern, das in den von Oktavian gegründeten Tempel Julius Cäsars führte; vielmehr befahl er dem Rosselenker, an der den Gärten des Ptolemäerpalastes im Bruchium zugewandten und im ägyptischen Stil errichteten Pforte zu halten, die in das kaiserliche Schloß führte. Dies hatten die Alexandriner zu Ehren des Tiberius erbaut. Unter den späteren Kaisern war es mancherlei Erweiterungen und Ausschmückungen unterworfen worden. Ein heiliger Hain trennte es von dem Tempel des Cäsar, mit dem es durch einen bedeckten Säulengang verbunden war.
Vor dem Haupttore hielten mehrere bespannte Wagen und wartete eine ganze Schar von weißen und schwarzen Sklaven neben den Sänften der Herren. Liktoren drängten hier die schaulustige Menge zurück, Offiziere lehnten dort an den Säulen, und die römische Schloßwache sammelte sich soeben mit Waffengerassel und beim Klang einer Trompete hinter dem Tore, um ihre Ablösung zu erwarten.
Ehrfurchtsvoll wich alles vor dem Wagen des Präfekten zurück, und als Titianus durch die erleuchteten Säulengänge des Cäsareums schritt und an den zahlreichen hier aufgestellten Meisterwerken der Bildhauerkunst, den Gemäldereihen und den Sälen vorbeikam, in denen sich die Büchersammlung dieses Palastes befand, dachte er an die Mühe und Sorgfalt, die er, von Pontius unterstützt, monatelang aufgewandt hatte, um diesen seit dem Aufbruch des Titus nach Judäa unbenutzt gebliebenen Palast zu einem dem Hadrian zusagenden Quartiere umzugestalten.
Die Kaiserin bewohnte nun die für ihren Gemahl bestimmten, mit den auserlesensten Kunstwerken geschmückten Gemächer, und Titianus sagte sich mit Bedauern, daß es, nachdem Sabina einmal von ihrem Vorhandensein Kenntnis genommen, unmöglich sein würde, sie in den Palast auf der Lochias überzuführen.
Vor dem schönen Saale, den er dem Kaiser zugedacht hatte, damit er in ihm seine Besucher empfange, traf er den Kämmerer Sabinas, der es übernahm, ihn sogleich bei der Herrin einzuführen.
Die im Sommer geöffnete Decke der Halle, in der der Präfekt die Kaiserin finden sollte, war nun, um den Regen des alexandrinischen Winters abzuwehren und weil Sabina gewöhnlich selbst in der wärmeren Jahreszeit über Kälte zu klagen pflegte, durch einen frei schwebenden kupfernen Schirm, neben dem die Luft eine weite Öffnung fand, in zweckmäßiger Weise beschützt.
Als Titianus diesen Raum betrat, wehten ihm angenehme Wärme und seine Düfte entgegen. Diese wurde durch sehr eigentümliche, inmitten der Halle stehende große Ofen erzeugt. Der eine stellte die Schmiede Vulkans dar. Hell glühende Holzkohlen lagen vor dem Blasebalge, den ein Automat in kurzen, regelmäßigen Zwischenräumen bewegte. Der Gott und seine Genossen umgaben, aus Erz gearbeitet, mit Zangen und Hämmern das wärmende Feuer. Der andere Ofen bestand aus einem großen silbernen Vogelneste, in dem gleichfalls Holzkohlen brannten. Aber ihrer Glut schwebte die aus Erz gegossene, einem Adler gleichende gefiederte Gestalt des Phönixvogels himmelan. Außerdem erhellten zahlreiche Lampen den reich mit edel geformten Sitzen, Ruhebetten und Tischen, Blumenvasen und Bildsäulen ausgestatteten Raum, der freilich zu groß erschien für die Zahl der in ihm versammelten Menschen.
Für kleine Zusammenkünfte hatten der Präfekt und Pontius früher ein ganz anderes Zimmer ins Auge gefaßt und seiner Bestimmung gemäß ausgestattet, die Kaiserin aber die Halle dem weniger geräumigen Zimmer vorgezogen. Mißbehagen, ja eine ihn befremdende Befangenheit erfüllte den hochgeborenen, ergrauten Staatsmann, als er die hier weilenden, zu kleinen Gruppen vereinten Menschen mit den Blicken zusammensuchen mußte und hier gedämpfte Worte, dort unverständliches Murmeln oder verhaltenes Kichern, nirgends aber eine frisch von den Lippen strömende Rede vernahm.
Einen Augenblick wollte es ihm vorkommen, als sei er in das Gemach der flüsternden Verleumdung getreten, und doch war ihm bekannt, warum hier niemand wagte, frei herauszureden.
Laute Worte taten der Kaiserin wehe, eine helle Stimme war ihr ein Greuel, und doch verfügten wenige Menschen über so weit vernehmbare und kräftige Brusttöne, wie ihr eigener Gemahl, der sich keinem Menschen, auch nicht seiner Gattin gegenüber, Zwang auferlegte.
Sabina saß auf einem großen, mehr einem Bette als einem Stuhle gleichenden Ruhesitze. Ihre Beine waren tief in dem zottigen Felle eines Auerstieres vergraben, und die herniederhängenden Füße rings mit seidenen Federkissen umgeben.
Ihr Kopf war steil in die Höhe gerichtet. Man begriff kaum, wie der dünne Hals ihn und die Perlenschnüre und Edelsteinketten, die durch das hohe Gebäu ihrer blondroten, in langen Zylindern dicht aneinander gereihten Locken geflochten waren, zu tragen vermochte. Das hagere Gesicht der Kaiserin erschien besonders klein unter der Menge des natürlichen und künstlichen Schmuckes, der ihr Stirn und Scheitel bedeckte. Schön konnte es selbst in der Jugend nicht gewesen sein, aber es war regelmäßig geschnitten, und der Präfekt sagte sich, als er in Sabinas von winzigen Fältchen zerrissene, weiß und rot gemalte Züge schaute, daß der Künstler, dem vor einigen Jahren der Auftrag zuerteilt worden war, sie als Venus victrix1 zu bilden, immerhin in der Lage gewesen war, der Göttin eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem kaiserlichen Modell zu erteilen. Wären nur die völlig wimperlosen Augen dieser Matrone trotz der dunklen Pinselstriche an ihren Rändern nicht gar so winzig klein erschienen, hätten die Sehnen an ihrem Halse sich nur nicht aus dem Fleische, das sie zu bedecken verschmähte, in so augenfälliger Weise hervorgedrängt.
Titianus ergriff, sich tief verneigend, Sabinas mit Ringen überladene Rechte; sie aber entzog schnell und als ob sie fürchte, daß es Schaden leiden könnte, dies sorgsam gepflegte, aber für keinen nützlichen Zweck verwendbare Spielzeug dem Freunde und Verwandten ihres Gemahls und verbarg Hand und Arm unter dem Obergewande. Die herzliche Begrüßung des Präfekten erwiderte sie mit aller ihr zu Gebote stehenden Wärme.
Sie sah Titianus, den sie zu Rom in früherer Zeit täglich in ihrem Hause zu sehen gewohnt gewesen war, in Alexandria zum erstenmal; denn gestern war sie, erschöpft von den Leiden der Seefahrt, in einer verschlossenen Sänfte in das Cäsareum getragen worden; heute morgen aber hatte sie seinen Besuch abweisen müssen, weil sie von den Ärzten, Badefrauen und Haarkünstlern völlig in Anspruch genommen worden war.
»Wie hältst du es aus in diesem Lande?«, fragte sie mit leiser, schmelzloser Stimme, aus der man stets herauszuhören meinte, daß das Reden ein schweres, lästiges, fruchtloses Geschäft sei. »Am Mittag brennt die Sonne, und des Abends wird es so kalt, so unerträglich kalt.«
Bei diesen Worten zog sie das Obergewand noch fester zusammen, Titianus aber wies auf die Öfen inmitten der Halle und sagte:
»Ich dachte, wir hätten dem ohnehin matten Bogen des ägyptischen Winters die Sehne zerschnitten.«
»Immer noch jung, immer noch bilderreich, immer noch ein Dichter«, entgegnete die Kaiserin matt. »Vor zwei Stunden habe ich auch deine Gattin begrüßt. Ihr scheint Afrika weniger gut zu bekommen; ich erschrak, die schöne Matrone Julia so wiederzufinden. Sie sieht nicht gut aus.«
»Die Jahre sind die Feinde der Schönheit.«
»Häufig; aber die echte Schönheit widerstand ihrem Angriff doch häufig.«
»Du selbst bist der lebende Beweis für diese Behauptung.«
»Das heißt, daß ich alt werde.«
»Nein, daß du schön zu bleiben verstehst.«
»Dichter!«, murmelte die Kaiserin und ihre schmale Unterlippe verzog sich.
»Die Staatsgeschäfte sind der Muse nicht hold.«
»Aber wer die Dinge schöner sieht, als sie sind, oder sie doch mit glänzenderen Namen benennt, als sie es verdienen, den nenn’ ich einen Poeten, einen Schwärmer, einen Schmeichler – wie es so kommt.«
»Die Bescheidenheit weist auch wohlverdiente Bewunderung abweisend zurück.«
»Wozu dies törichte Wortgeplänkel«, seufzte Sabina und warf sich tief in den Stuhl zurück. »Du bist bei den Silbenstechern hier im Museum in die Schule gegangen, ich nicht. Da drüben sitzt der Sophist Favorinus. Er beweist vielleicht dem Astronomen Ptolemäus, daß die Sterne nichts sind als Blutflecken in unserem Auge, die wir am Himmel zu sehen vermeinen. Florus der Historiker zeichnet diese wichtige Unterredung auf, der Dichter Pankrates besingt den großen Gedanken des Philosophen, und welche Aufgabe bei diesem wichtigen Anlaß dem Grammatiker dort zufällt, das weißt du besser als ich. Wie heißt der Mann?«
»Apollonius.«
»Hadrian gab ihm den Beinamen des Dunkeln. Je schwerer man die Reden dieser Herren versteht, desto höher werden sie geschätzt.«
»Nach dem, was in der Tiefe ruht, muß man tauchen; was auf der Oberfläche schwimmt, führt jede Welle fort, und die Kinder spielen damit. Apollonius ist ein großer Gelehrter.«
»So sollte ihn mein Gatte bei seinen Schülern und Büchern lassen. Er gebot mir, diese Leute zur Tafel zu laden. Den Florus und Pankrates ließ’ ich mir gefallen – aber die anderen.«
»Von Favorinus und Ptolemäus könnt’ ich dich leicht befreien. Schicke sie dem Kaiser entgegen.«