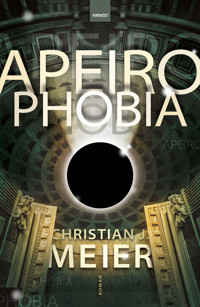Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Polarise
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wenn es um die freie Wahl geht: Wie leicht lässt du dich manipulieren?
Deutschland in naher Zukunft. Sophie König steht kurz vor ihrem Ziel: die Psyche von Menschen in deren Datenspuren zu erkennen. Um ihren Traum zu verwirklichen, schließt die KI-Forscherin einen Pakt mit dem zwielichtigen Andy Neville, der früher Wähler digital manipuliert hat.
Zur gleichen Zeit macht der charismatische Jungpolitiker Boris Riemann eine steile Karriere. In seinem Ringen um Wählerstimmen attackiert er die etablierte "Präventionspolitik" von Bundeskanzler Frederik Mager.
Bald verbinden sich die Erfolge von Sophie und Riemann auf tödliche Weise...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTIAN J. MEIER
DERKANDIDAT
SIE ZIELEN AUF DEIN INNERSTES
© 2022 Polarise
Ein Imprint der dpunkt.verlag GmbH
Wieblinger Weg 17
69123 Heidelberg
www.polarise.de
1. Auflage 2022
Autor: Christian J. Meier
Lektorat: Martin Wohlrab
Copy-Editing: Irina Sehling
Satz: Veronika Schnabel
Herstellung: Stefanie Weidner, Frank Heidt
Illustration Cover: Weberson Santiago
ISBN:
Print 978-3-947619-61-0
PDF978-3-947619-62-7
ePub978-3-947619-63-4
mobi978-3-947619-64-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über www.dnb.de abrufbar.
Christian J. Meier folgte nach Physikstudium und Promotion seinem Traum und wurde freier Journalist und Autor. Der 53-Jährige schreibt Artikel über Forschung, Technik und Digitalisierung für verschiedene Medien, z. B. Neue Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung oder Riffreporter.
Über einige seiner Lieblingsthemen wie Quantenphysik und künstliche Intelligenz hat er bislang drei allgemein verständliche Sachbücher und den Tech-Thriller »K.I. – Wer das Schicksal programmiert« verfasst. Mehrere seiner Kurzgeschichten wurden veröffentlicht, etwa bei c’t oder »Exodus«.
Im Spiegel stand, hoch wie ich,ein riesiger schöner Wolf, stand still,blitzte scheu aus unruhigen Augen.
Aus »Der Steppenwolf«von Hermann Hesse
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
DANKSAGUNG
1
1992
Es war nur ein Korridor im California Hospital Medical Center in Los Angeles. Doch er attackierte Ferdinand Walther: Seine Enge presste, sein Neonlicht stach, sein Krankenhausgeruch würgte ihn. Der Gang trieb Ferdinand in das hinein, was die Kleingeister ergeben Schicksal nannten.
Ferdinand beneidete diesen Sänger aus der griechischen Sagenwelt. Allein mit seiner Begabung hatte Orpheus sogar die strengen Herrscher der Unterwelt weichgeklopft. So ungeheuerlich schön hatte er gesungen, dass sie seine verstorbene Geliebte freigaben.
Ferdinand erreichte die Tür zu Maries Krankenzimmer. Wie ferngesteuert bewegte sich seine Hand an die Klinke. Für einen Moment konnte er sie zurückhalten. Die Finger zitterten. Seine Füße mochten ihn vom Zimmer des Chefarztes hierhergetragen haben. Sein Körper mochte diese oder jene Bewegung ausführen. Doch er selbst fühlte sich seit dem Unfall zu einer Puppe erstarrt.
Er beobachtete sich, wie er eintrat.
Einem dünnschaligen Ei gleich, lugte Maries Gesicht aus der weißen Bettwäsche hervor, behütet von einer elektronischen Glucke aus Monitoren, Kabeln und Schläuchen, die pulste und piepte.
Er trat an ihr Bett. Seine Lebensgefährtin sah ihn aus trüben Augen an.
Ängstlich, die dünne Schale zu zerbrechen, legte er seine Hand auf ihre Wange. Er erschrak über die Kühle ihrer Haut.
Marie antwortete mit einem schwachen Lächeln. »Die Ärzte wissen nicht weiter«, quälte sich ihre Stimme durch den schnell gehenden Atem. Alles war ihr verlorengegangen: der kratzbürstige Charme, die zielorientierte Kraft, die liebenswürdige Besessenheit. Marie löste sich vor seinen Augen auf. Er konnte ihre Haut spüren, sie selbst aber nicht mehr halten. Wie vorhin, als der Chefarzt ihm seine Kapitulation gestanden hatte, fühlte er sich aller Mittel beraubt.
Gemeinsam mit Marie würde seine Zukunft untergehen. Sie war seine verwandte Seele. Mit ihr hatte er dahin gehen wollen, wo noch nie ein Mensch gewesen war.
Genau deshalb hatten sie Kalifornien doch besucht! Um von Jungs wie Max zu erfahren, wie man mit digitaler Technik die Grenzen verschob. Sie waren aus dem fernen Deutschland angereist, um ihrer Zukunft eine Richtung zu geben. Und jetzt?
Die Ironie der Situation stachelte seinen Trotz an. »Nein, Marie!«, stieß er aus und nahm seine Hand von ihrer Wange. »Das ist zu früh. Wir sind doch noch so jung!«
Maries rechter Mundwinkel hob sich leicht – nur ein Hauch des spöttischen Lächelns, mit dem sie seine ambitionierten Ideen immer kommentiert hatte.
»Mich friert«, flüsterte sie.
Ferdinand griff unter die Decke und fand ihre Hand. Sie drückte mit ihrem Daumen schwach gegen seinen Handrücken.
Maries Berührungen waren immer seine einzige Vergewisserung gewesen. Nur einmal hatte er sich ohne ihre Hilfe selbst so intensiv gespürt: als er erkannte, dass er von seinem engstirnigen Erzeuger alles bekommen konnte, wenn er es nur geschickt genug anstellte.
»Akzeptiere es und hilf mir«, sagte sie überraschend kraftvoll.
Er suchte nach den richtigen Worten. »Es fällt mir unglaublich schwer, es hinzunehmen«, murmelte er und dachte daran, was vor einer Woche passiert war.
Euphorisiert hatten sie das schäbige Wohnheim nahe dem Campus der University of Southern California verlassen, jener Uni, an der Max promovierte. Stundenlang hatten sie sich mit ihm unterhalten, seine Ideen aufgesogen und weitergesponnen. Nun, in der hellen Sonne des University Parks, sprudelte aus ihnen heraus, wie sie nach ihrer Rückkehr Deutschland erschüttern wollten – dieses von Bürokraten erstickte Land. Ein letztes Mal lachte Marie in seiner Erinnerung ihr kehliges Lachen. Sie legte den Kopf in den Nacken. »Ach, hier ist der Himmel einfach höher!«, rief sie, die Arme ausgebreitet, und drehte sich. Das Adrenalin pulsierte auch in seinem Körper, er betrachtete Maries Freudentanz und lief ihr grinsend nach. Immer schneller wirbelte sie herum, tanzte schließlich auf die Nebenstraße.
Sie sah das Auto nicht kommen. Er bemerkte es zu spät, seine Stimme versagte. Der Wagen erwischte sie ungebremst.
Seitdem suchte Ferdinand vergeblich nach einer Erklärung für das ganze Geschehen. Wie sehr Maries Unfall dem ihres Bruders glich, erschreckte ihn bis jetzt.
»Die Ärzte sind Kleingeister!«, preschte er vor.
»Sie haben getan, was sie konnten«, widersprach Marie. »Sie können nicht zaubern.«
»Natürlich nicht«, gab er nach. Doch etwas in ihm wollte, dass Marie zuversichtlich blieb. Dass sie sich auch jetzt treu blieb. Dass sie bis zum letzten Atemzug voll und ganz zu ihm gehörte. »Zauberei braucht es nicht«, meinte er. »Sie ist lächerlich verglichen mit dem, was technisch geht. Sieh dir das Internet an! Menschen aus der ganzen Welt werden sich vernetzen. Raum und Zeit werden aufhören zu existieren! Die Grenzen, vor denen wir heute noch stehen, werden sich auflösen.«
Schon halb erloschen musterten ihn ihre Augen, die Mundwinkel kräuselten sich amüsiert.
»Du wolltest mit mir die Welt verändern«, sagte er.
Für einen Moment flackerte der alte Glanz in ihren Augen auf, für ihn das einzige wirklich lebendige Feuer. Sie hob den Kopf an. »Das kannst du immer noch«, sagte sie. »Tu es mir zuliebe.« Ihr Kopf fiel zurück auf das Kissen.
Etwas veränderte sich in Ferdinand. Blut floss in den Puppenkörper, zu dem sein Leib erstarrt war. Er spürte, wie die Puppenglieder wieder zu seinen eigenen wurden.
»Das werde ich«, sagte er. »Für dich und sonst niemanden werde ich die Welt verändern!«
Er drückte ihre Hand nun fester. Sie erwiderte es mit einer Kraft, die ihn erneut erstaunte. Für einen Moment spürte er die alte Vertrautheit. Doch schon nach Sekunden lockerte sie den Druck. Erschöpft ließ sie den Kopf zur Seite fallen und schloss die Augen.
Ferdinand wachte die Nacht an ihrem Bett.
Im Morgengrauen gab ihr Körper seinen Kampf auf. Alle Spannung wich aus ihr.
Als das mechanische Piepen der Glucke in ein andauerndes Pfeifen wechselte, sank Ferdinands Kopf auf das Bett. Er weinte.
Obwohl Marie tot war, spürte sich Ferdinand. Intensiv. Denn klarer als je zuvor erkannte er seine Lebensaufgabe.
Eine Woche später, Maries Körper ruhte in kalifornischer Erde, stieg Ferdinand in ein Flugzeug nach Deutschland.
2
Berlin, März 2041
Durch ihr Bürofenster ließ Sophie König den Blick über die Skyline gleiten: vom Fernsehturm und den Wohnhochhäusern am Alexanderplatz nach Westen bis zum Expertenbaum, der die Kuppel des Reichstags weit überragte. Das Holzhochhaus strahlte etwas von seinem Stolz auch auf sie. Vom Stolz ihrer Zunft: der Wissenschaft. Ein greller Blitz leuchtete plötzlich in der Mitte des Gebäudes auf, ein weiterer an seiner Spitze. Flammen schlugen von beiden Stellen weit in die Höhe. Sophie schnappte nach Luft und riss sich das Augmented-Reality-Visier vom Kopf.
Das Feuer war weg, der Expertenbaum unversehrt. Das Meer aus Dachgärten ließ die Stadt wie ein Idyll aussehen. Das AR-Visier hatte den Brand als erweiterte Realität auf Sophies Netzhaut projiziert.
Das musste einer dieser fiesen KI-Agenten gewesen sein, die von wissenschaftsfeindlichen Aktivisten neuerdings ins Euronet geschleust wurden. Der Digitalschild war noch nicht perfekt auf diese intelligente Software adaptiert, so fand sie immer wieder ihren Weg bis in die AR-Visiere, wo sie Anschläge oder Attentate vorgaukelte.
Sophie atmete durch und setzte das AR-Visier wieder auf. Es klopfte dreimal, die Bürotür schwang auf und Pete spazierte herein. Ihr Datenspezialist hob die rechte Hand, lächelte breit und schnippte mit den Fingern. Harfenklang. Funken sprühend tanzten zwei Tickets vor Petes Hand.
»Rate mal, was ich hier habe!«
Sophie hob die Augenbrauen, seufzte und schielte in die Ecke des Schreibtischs, wohin ihr AR-Visier die Uhr projizierte.
»Pete, ich halte gleich Vorlesung.«
Er lachte auf.
»Immer noch die graue Professorin von der Humboldt-Universität! Sophie, du bist inzwischen eine Koryphäe in der datengetriebenen Psychologie. Studenten aus aller Welt schalten sich in deine Vorlesung. Du kannst, nein, du musst sie warten lassen.«
»Du kennst mich schlecht, wenn du glaubst, ich würde deshalb meine Pünktlichkeit aufgeben.«
Er hielt ihr die Tickets entgegen. »Die sind fürs Thetis. Eine Retro-Veranstaltung. Science-Fiction. Genauer gesagt Star Trek. Du stehst doch auf Mister Spock!«
Sophie blies die Backen auf. »Ich mag Lieutenant Commander Data. Thetis, sagst du? Du meinst doch nicht dieses Kino?«
Pete nickte.
Sophie lachte trocken. »Du willst mich in eine Veranstaltung locken, in der alle gleichzeitig auf dieselbe Leinwand starren? Du kennst mich wirklich schlecht, Pete.«
»Oh my God!«, rief er ihr zu. »Typisch Europäer! Ihr verbringt zu viel Zeit hinter euren AR-Visieren. Jeder lebt in seiner eigenen Blase! Ihr geht kaum unter Leute. Daran sind eure Regierungen schuld. Diese Präven… ahm …«
»Präventionspolitik?« Sophie ging zur Bürotür.
»Ja, genau! Das macht euch ängstlich und unsozial!«
»Fast die ganze Welt macht Präventionspolitik«, stellte sie richtig. »Ihr drüben doch auch!«
»Ja, aber wir ordnen nicht alles den Naturgesetzen unter!«
Vor dem Hinausgehen drehte Sophie sich um. Pete machte keine Anstalten, das Büro zu verlassen. »Noch was, Pete?«
»Ahm, ja, noch etwas. Unser Datenerheber… Ach, dieses deutsche Monster von Wort!«
»Du meinst den Datenerhebungsantrag?«
»Ja, genau. Die Datenschutzbehörde hat ihn weitergeleitet. An die … äh, warte …« Er legte zwei Finger an die Schläfen. »… an die algorithmische Antragsverarbeitung.«
Petes Brust hob sich und er lächelte wie nach einem erzielten Tor.
Sophie presste die Finger der rechten Hand zur Faust, bis sich die Nägel in die Haut bohrten. Sie hatte gehofft, dass ein Mensch, der ihre Arbeit kannte, den Antrag schnell durchwinken würde. Algorithmische Entscheidungen mochten zwar anfechtbar sein, doch die Verfahren dauerten Monate. Und eine Ablehnung würde faktisch das Ende des Projekts »Carin« bedeuten.
»Danke für die Info«, presste sie heraus und wandte sich zum Gehen. »Halt mich auf dem Laufenden, Pete«, rief sie, während sie schon den Gang in Richtung Hörsaal entlangmarschierte. Sie durchquerte das Foyer und betrat den Korridor zum Hintereingang des Hörsaals. Die fensterlose Dunkelheit lastete auf ihr wie nasser Sand. Wann reparierten sie endlich die Lampen! Sie ließ das Visier die Konturen des Korridors anzeigen und beschleunigte den Schritt.
Die Helligkeit im Auditorium ließ sie aufatmen. Doch gleich folgte der nächste Schreck. Nicht nur, weil der Hörsaal bis zur obersten Bankreihe gesteckt voll war. Nein, sondern auch, weil darüber noch viel mehr Gesichter erschienen. Die eingeblendeten Reihen wirkten wie die Westkurve eines WM-Stadions beim Finale. Sophie fühlte sich wie eine Fußballerin, die tausende Augenpaare erwartungsvoll anstarrten.
Es geht nicht um dich, versuchte sie ihren wieder anziehenden Puls zu beruhigen. Die datengetriebene Psychologie boomt und du bist eine der weltweit führenden Expertinnen auf dem Gebiet. Bleib ganz ruhig!
So viel Publikum wie heute hatte sie allerdings noch nie gehabt. Schuld daran war sicher ihr jüngster Auftritt in einer weltweit erfolgreichen Doku über die Frage, wie sich die Seele eines Menschen in seinen Daten widerspiegele. Diese Formulierung war ihr natürlich viel zu effekthascherisch. Sie hatte aber widerwillig mitgemacht, denn Popularität erleichterte in aller Regel den Zugang zu Fördergeldern und vor allem Daten.
»Guten Morgen allerseits«, rief Sophie. Wenn man einmal redete, floss der Rest wie von selbst, ermutigte sie sich. Sie kniff die Augen zusammen, führte den Zeigefinger über einzelne Köpfe und ließ ihn dabei leicht hüpfen, als zähle sie. Nach ein paar Sekunden winkte sie ab. »Wie viele Persönlichkeiten mögen hier wohl versammelt sein?«
»Es sind viertausenddreihundertzwölf Nutzende anwesend«, ertönte eine Stimme, kaum dass Sophie zu Ende gesprochen hatte. Manche drückten den Wortmeldungsbutton äußerst rasch.
»Danke!«, rief Sophie lächelnd in die ungefähre Richtung. »Dann ist die Antwort leicht. Na, wie viele Persönlichkeiten?«
»Viertausenddreihundertzwölf!«, sagte eine andere Stimme.
»Genau! Natürlich hat jeder Mensch seine ganz eigene Persönlichkeit! Einzigartig und unverwechselbar. Also, warum sind Sie alle hier?«
Wieder blickte sie über die Menge. Ihre Aufregung legte sich. Sie fand, dass sie es gut meisterte. Mit einer teilvirtuellen Masse umzugehen, fiel ihr leichter, als mit zwei oder drei Leuten am Esstisch.
»Weil wir lernen wollen, wie man die Persönlichkeit aus Datenspuren herausliest!«, antwortete eine Stimme.
Sophie wiegte den Kopf. »Sie glauben, dass das geht? Kann ich die Persönlichkeit eines Menschen erkennen, den ich nie im Leben gesehen habe?«
»Ja!«
»Natürlich!«
»Und ob!«
»Okay, okay«, fuhr Sophie fort. »Dann muss ich Ihnen ja wohl nur noch erklären, wie das geht.«
»Wir sind ganz Ohr!«
Sophie trat ein paar Schritte zurück und flüsterte einen Befehl. Eine Kugel, halbtransparent und größer als sie selbst, schwebte vor ihr knapp über dem Boden.
»Na, wie viele Punkte hat die Oberfläche dieser Kugel?«
»Eine Million?«
Sie schüttelte den Kopf und lächelte zaghaft.
»Unendlich viele«, riet ein Student.
Sophie schnippte mit den Fingern und deutete ungefähr in die Ecke des Sprechers.
»Richtig!«
Ihr Blick glitt durch die Kugel über die Reihen. »Und dennoch«, sagte sie, »reichen zwei Zahlen, um jeden Punkt auf der Kugeloberfläche eindeutig zu beschreiben: der Längen- und der Breitengrad.«
Sie tippte die Spitzen von Daumen und Zeigefinger erneut aneinander. Ein Netz aus waagrechten und senkrechten Linien zog sich über die Kugel, sodass diese aussah wie ein Modell der Erde.
»Man könnte auch sagen, die Kugeloberfläche hat zwei Dimensionen. Wie viele Dimensionen, denken Sie, hat die Persönlichkeit?«
»Eine Million?« Die Antwort kam von derselben Stimme wie zuvor.
Sophie hob etwas genervt die Augenbrauen.
»Achthundert?«
»Ich verstehe. Sie denken, etwas so Komplexes wie eine Persönlichkeit braucht viele Dimensionen? Vielleicht wird es Sie überraschen, aber schon fünf Dimensionen reichen für eine ziemlich gute Beschreibung einer Person. Persönlichkeitspsychologen nennen sie die Big Five.«
Wieder tippte Sophie die Finger aneinander. Im Raum schwebten nun fünf Wörter:
Aufgeschlossenheit
Perfektionismus
Geselligkeit
Rücksichtnahme
Verletzlichkeit
»Das«, erklärte Sophie, »sind die Koordinaten der Persönlichkeit. Oder sagen wir, es ist ein gängiges Koordinatensystem in der Persönlichkeitspsychologie. Jeder Mensch nimmt einen Punkt in diesem Raster ein.«
»Professorin König!«, meldete sich eine physisch anwesende Studentin in der ersten Reihe. »Stimmt es, dass Sie eine künstliche Intelligenz entwickelt haben, die ein eigenes Modell erstellt hat?«
Die Frau lächelte, doch Sophie konnte nicht entscheiden, ob freundlich oder aggressiv. Wie so oft wünschte sie sich, menschliche Mimik besser lesen zu können.
»Ja, das stimmt«, antwortete sie auf die Frage. »Die KI heißt ›Carin‹. Die Abkürzung steht für Context Aware Reaction Inference Network.«
»Es heißt«, fuhr die Frau fort, »Carin habe das Persönlichkeitsmodell selbständig durch Auswertung von Daten aus Aktivitäten von tausenden Menschen entwickelt.«
Mit der Frage hatte Sophie gerechnet. Doch sie wollte nicht viel über Carin sprechen. Sie wiegte den Kopf und drehte die Handfläche hin und her.
»So ungefähr«, bestätigte sie. Gespannte Stille. Die Meute wartete auf weitere Happen. »Sie werden sich fragen, was neu daran ist«, gab Sophie nach. Wie für die Filmdoku würde sie auch jetzt wortreich möglichst wenig preisgeben. »Carin erzeugt ihr Modell ganz selbständig, ohne menschliche Anleitung. Sie blickt quasi unvoreingenommen auf die Menschen. Carins Modell hat mehr Dimensionen als fünf, bildet also Facetten der Persönlichkeit detaillierter ab. Sie liefert ein hochaufgelöstes Bild statt nur eines grobpixeligen. Wir Forscher müssen erst herausfinden, wie viele Dimensionen einen Menschen gut genug beschreiben.«
»Gut genug wofür?«, fragte eine neue, männliche Stimme.
Sie zuckte betont lässig mit den Achseln.
»An unserem Institut machen wir Grundlagenforschung. Aber natürlich lässt sich schon an Anwendungen denken. Mit Carins Hilfe könnten Psychologen neue Präventionsformen entwickeln. Sie könnten effektivere Methoden zur Vorbeugung von Angststörungen, Depressionen oder Psychosen finden. Carin wäre eine Art Spiegel der Persönlichkeit, um an sich zu arbeiten. Ein automatisierter Coach. Jugendliche könnte sie von Orientierungslosigkeit befreien, Berufstätige vor dem Burnout bewahren. Wer das Richtige aus seinem Leben macht, hat weniger Stress. Carin würde einen weiteren Beitrag zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Übergewicht leisten.«
Sophie hoffte, die Standardmarketingfloskeln würden die Fragenden beruhigen, und setzte an, die Vorlesung wie geplant weiterzuführen, doch der, der die Frage nach Carins Zweck gestellt hatte, ließ noch nicht locker.
»Lässt sich Carin nicht auch missbrauchen?«, wollte er wissen. »Etwa um Wähler individuell zu manipulieren? Wenn man weiß, wie jemand tickt, kann man ihm maßgeschneiderte Wahlwerbung senden. Solche Dark Posts gab es in den Zehnerjahren zuhauf. Bei der Wahl Donald Trumps im Jahr 2016 waren sie möglicherweise das Zünglein an der Waage.«
»Diese Dark Posts sind in der EU verboten!«, entgegnete sie scharf. »Mir ist kein einziger Fall bekannt, bei dem sie hier zur Anwendung gekommen wären. Soweit ich mich an den damaligen Wahlkampf erinnere, arbeiteten Dark Posts mit falschen Behauptungen oder beleidigten die Kandidatin der Demokraten. Solches Zeug käme heute gar nicht mehr zum Adressaten. Selbst in den wilden Kanälen filtern Algorithmen Fake News und Hassbotschaften aus. In den Kanälen mit staatlichem Faktentreue-Zertifikat bleibt die Sprache von vornherein zivilisiert.«
»Aber könnte Carin nicht genau das aushebeln?«, fragte eine virtuelle Teilnehmerin. »Könnte sie die Wähler nicht viel psychologischer manipulieren, ganz ohne unzivilisierte Sprache und platte Lügen?«
In Sophie wallte Wut auf. Dieses eher abseitige Thema kam doch jetzt nur wegen der Bundestagswahl auf, die in einigen Monaten stattfinden sollte! Sie war Forscherin, was gingen sie aktuelle politische Themen an? Sophie presste die Lippen zusammen, zwang sich zu einem Lächeln und schüttelte möglichst sachte den Kopf.
»Carin selbst kann natürlich niemanden manipulieren«, erklärte sie ruhig. »Sie ist eine Maschine. Es kommt darauf an, wer sie wie nutzt. Rein theoretisch könnten böswillige Menschen sie für Wahlmanipulation missbrauchen. Doch in der Praxis hätten sie keine Chance. Denn sie müssten Carin mit personenbezogenen Daten der Wähler füttern. Zu solchen Daten kriegen diese hypothetischen Wahlbetrüger natürlich keinen Zugang! Wir sind in der EU! Mehr noch: Eine so umfassende Datensammlung von EU-Bürgern existiert gar nicht!«
»Was ist mit dem Tiefen Text?«, rief jemand. Durch das Auditorium ging ein Raunen.
Jetzt wurde es Sophie zu bunt. »Also, bevor wir uns hier über Verschwörungsmythen auslassen, machen wir mit dem Stoff weiter!«
Der Rest der Vorlesung verlief reibungslos, die Zwischenfragen blieben rein fachlich.
Als Sophie nach der Vorlesung das Foyer durchquerte, drückte unvermittelt ihr rechter Schuh. Trotzig marschierte sie weiter. Das war das dritte Mal. Der Obsoleszenz-Algorithmus wollte sie damit zum Neukauf stupsen. Sie bedauerte, dass sie sich keine analogen Schuhe leisten konnte. Die Krankheit ihres Vaters kostete viel Geld. Und die Mieten in Berlin waren ein Akt der Barbarei. Da sie keine krisenrelevante Forschung betrieb, war ihr Gehalt dürftig. Also musste sie sparen. Der rechte Schuh ließ wieder locker.
Sie machte sich Mut. Bald würde sie mehr personenbezogene Daten für das Training von Carin bekommen. Da ihr die Patente ihrer KI allein gehörten, würde dann endlich die Kasse klingeln. Vaters Krankheit wäre zumindest kein finanzielles Problem mehr und ihre Schuhe würden fortan analog sein. Doch Geld war es nicht, wonach sie eigentlich gierte. Ihr ganz persönlicher Traum würde sich erfüllen. Endlich.
3
Alexandra Calla erblickte einen Platz in der ersten Reihe, eilte hin und ließ sich auf den Stuhl fallen. Sie schob ihr AR-Visier hoch, schließlich war dieses Theaterfestival in einer alten Fabrikhalle am Gleisdreieck vollreal. Sie wollte sehen, ob die Augen des Schauspielers wirklich glänzten, und die Schweißperlen auf seiner Stirn zählen. Sie wollte die Funken spüren, die er angeblich versprühte. Kurz: Sie wollte seine Aura sehen. Die Rezensionen waren überschwänglich. Konnte es sein, dass ein Niemand namens Boris Riemann tatsächlich der Eine war, den sie seit Jahren suchte?
Sie war skeptisch nach allem, was sie über ihn schon wusste. Doch entscheidend war der Augenschein. Alexandra zog ein Stoffsäckchen aus der Umhängetasche und roch daran. Zimt erhöhte die Konzentration. Erst zum zweiten Akt war sie aufgetaucht, da dieser gleich mit einer Rede des fiktiven Politikers namens John Gerwin begann – gespielt von Riemann.
Das Licht erlosch. Ein Spot war auf ein leeres Rednerpult gerichtet. Aus dem Dunkel polterten Schritte heran. Ein Mann trat mit breiter Brust in den Lichtkegel, ließ aber das Pult links liegen. Der Spot folgte ihm zum Bühnenrand, wo Gerwin, alias Riemann, sich aufbaute. Breitbeinig beanspruchte er die Bühne für sich. Der Anzug schimmerte seiden und saß perfekt. Das Lächeln des Mannes wirkte offen. Riemann ließ den Blick über das Publikum streifen. Als er auf Alexandra traf, fühlte sie sich von Riemanns Aura umhüllt. Sofort war ihr klar: Auf dieser Bühne stand eine Ausnahmeerscheinung.
Die Stimme! Alexandra wollte die Stimme hören!
Soviel sie über das Stück wusste, startete Gerwin darin als unbekannter US-amerikanischer Provinzpolitiker in die Vorwahlen und stieg schnell zum Präsidentschaftskandidaten auf. Sofort fühlte sie sich mitten in den Wahlkampf versetzt.
»Hallo Freunde!«, rief er.
Alexandra spürte ein Kribbeln an den Wangen. Die Luftmoleküle verstärkten Riemanns Stimme wie mikroskopische Resonanzkörper. Nur einmal hatte sie sich ähnlich tief ausgefüllt gefühlt: vor Jahrzehnten bei einem Konzert von Tangerine Dream. Mit nur zwei Worten hatte er seine physische Präsenz auf den ganzen Saal ausgedehnt. Bis in Alexandra hinein. Wie sein Blick, so gab auch Riemanns Stimme ihr das Gefühl, persönlich gemeint zu sein. Diese Stimme spendete Trost und Zuversicht.
Mit einem Griff an die Augen überzeugte Alexandra sich, dass das Visier wirklich oben war. Unglaublich, wie stark Riemann leuchtete. Die Aura dieses Menschen überwältigte sie – und auch die anderen Zuschauer, wie sie erkannte, als sie sich umsah. Wie in Trance starrten alle auf die Bühne. Dieser Mann absorbierte sein Publikum.
Sie war sich sicher: Auch als Politiker wäre er einmalig. Einer, der nicht führt, sondern inspiriert. Der nicht überzeugt, sondern strahlt. Der keine Probleme löst, sondern heilt. Er wäre das Herz des sozialen Organismus.
Nach all den Jahren war Alexandras Suche beendet.
Noch vor dem Ende des Stücks stand sie auf und huschte aus der alten Fabrikhalle. Sie umrundete das Gebäude, bis sie auf ein rostiges Tor stieß, das ein aufgeklebter Zettel als Bühneneingang auswies. Wenig später tröpfelten die Schauspieler heraus, allein oder in Grüppchen. In der Mitte einer Gruppe, fast einen Kopf größer als die anderen, entdeckte sie ihn.
»Herr Riemann«, rief sie.
Er blieb stehen und wandte ihr sein Gesicht zu, während die anderen weitergingen. Das dunkelblonde Haar war außer Form und glänzte weniger als im Bühnenlicht. Das Gesicht wirkte blasser. Doch die fast ideale Trapezform von Wangen und Kinnpartie sowie die kraftvollen Jochbeine wirkten nach wie vor sehr attraktiv. In seinem Blick lag Neugier, aber auch Irritation, die Alexandras Mischung aus fortgeschrittenem Alter und erotischer Wucht bei Männern immer noch auslöste.
Die anderen gingen schnatternd weiter.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Riemann.
»Herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich beeindruckenden Verkörperung des John Gerwin!«, lobte ihn Alexandra. »Genauso habe ich ihn mir beim Lesen von Joshua Brides Stück vorgestellt!«
Spontan lächelte Riemann. Die wenigsten Besucher dürften den Autor des Stückes kennen. Die Analog-Theaterszene produzierte erklärtermaßen am Mainstream vorbei.
»Vielen Dank, gern geschehen!«
»Mein Name ist Alexandra Calla. Herr Riemann, ich könnte Sie mir auf einer größeren Bühne vorstellen. Auf einer viel größeren. Hätten Sie Zeit für einen Kaffee?«
Riemann sah sie amüsiert an, als zweifle er daran, dass der Vorschlag ernst gemeint war. Doch sein zuckender Mundwinkel verriet Gefallen.
»Sicher, warum nicht?«
Die junge Frau, die den Whisky vor Riemann auf den Tisch stellte, ließ den Blick auf ihm verweilen, während sie auch den Schafgarbentee vor Alexandra abstellte, wobei ein wenig von der Flüssigkeit überschwappte. Als sie wegging, blickte Riemann ihr interessiert nach.
»Wahrscheinlich wird sie Ihnen ihre ID mit der Rechnung übertragen«, scherzte Alexandra.
»Gut möglich«, antwortete Riemann. Bedächtig nahm er einen Schluck vom Whisky. Alexandra erkannte in seiner Neigung zu Frauen und Alkohol klare Zeichen für astrale Kraft. Diese müsste sie in die richtige Bahn lenken. Mit ihren eigenen Verführungskünsten würde sie sich zurückhalten müssen. Ihre Macht über Männer könnte seine Aura trüben.
Riemann schluckte und genoss den Abgang. Dann badete Alexandra in seinem warmen, belebenden Blick. Wieder war sie sich sicher, einen Volltreffer gelandet zu haben. Die meisten Leute misstrauten dem Charisma, da sie glaubten, es speise sich aus einem finsteren Machtinstinkt. Sie hingegen fand, dass die wichtigste Zutat etwas völlig anderes war: voll auf das Gegenüber einzugehen, es in den Fokus zu nehmen und genau zu wissen, mit wem man spricht. Es war vor allem eins: eine echte Verbindung mit den Menschen. Etwas, das mit der Digitalisierung verlorengegangen war. Noch war sie skeptisch, dass sich dieses Manko der Technologie beheben ließe, wie die Nerds behaupteten, noch dazu mit einer neuen, unerprobten Technologie.
»Warum spielen Sie vor achtzig Leuten in einer muffigen Fabrikhalle?«, fragte sie Riemann. »Bei Ihrem Talent.«
Riemann hob die Augenbrauen und stellte das Glas ab.
»Na ja, vollreales Theater ist nicht gerade massentauglich. Außerdem bin ich nur Hobbyschauspieler. Der kleine Rahmen hat auch etwas Schönes: Ich kann spüren, ob das Publikum glücklich ist!«
»Womit verdienen Sie Ihr Geld?«
Natürlich kannte sie die Antwort. Doch sie wollte sehen, wie er reagierte. Alexandra hob die Tasse an die Lippen. Riemann neigte den Kopf zum Tisch, über seine Augen legte sich ein Schatten. Sein markanter Nasenrücken stach hervor, was ihn wirken ließ wie einen Adler vor dem Zustoßen. Alexandra begrüßte auch diese finstere Facette. Sie war wichtig.
»Ich bin Pharmazeut«, sagte er.
Sie spielte die Überraschte, indem sie den letzten Schluck Tee in die Tasse zurückblies und Riemann anstarrte. Dass er etwas Technisches machte, war einer der Gründe für ihre anfängliche Skepsis gewesen, die immer noch nachhallte. Aber sie sah es so: Der Mann war ein roher Diamant. Ihre Aufgabe bestand darin, den Edelstein zu schleifen.
»Sie sind was?«, fragte sie.
Riemann rollte die Augen zur Decke und sog Luft ein. »Nun ja, Sie wissen, wie das oft so ist. Die Familientradition.«
»Sicher, Herr Riemann. Doch Ihr Schicksal ist es, bewundert zu werden. Von Millionen.«
Sein Mundwinkel verzog sich zu einem halben Lächeln. »So?«
»Welches ist die größte Bühne, auf der Sie sich einmal sehen?«, forderte sie ihn heraus.
Riemann senkte lachend den Blick und schüttelte den Kopf. Er ist zu bescheiden, dachte sie. Etwas hemmt ihn.
»Ich meine es ernst«, bekräftigte sie. »Welche Bühne? Sagen Sie!«
Ihr Gegenüber hob den Kopf und verengte die Augen.
»Wer sind Sie eigentlich?«
»Das erfahren Sie bald. Sagen Sie: Welche Bühne?«
»Nun, ich weiß nicht. Das Berliner Ensemble? Das Thalia? Die Burg?«
Riemann hob das Glas zum Mund und kippte den Rest des Whiskys hinunter. Alexandra lächelte dünn. »Das sind Schülertheater verglichen mit der Bühne, auf der ich Sie sehe.«
Riemann stellte das Glas ab und starrte Alexandra an. Aus seinen Augen sprang ihr Neugier entgegen, Lust auf Neues und – was sie am meisten freute – Gier. Die Gier auf das große Publikum.
4
Nach einem verspäteten Mittagessen durchquerte Sophie mit strammem Schritt das Foyer. Gut ein Dutzend Leute schwirrten aus einem der sternförmig einmündenden Gänge. Sie redeten kaum miteinander und wirkten betreten. Eine der Wissenschaftlerinnen in der Gruppe nickte ihr im Vorbeigehen zu.
»Hey, Wen!«, rief Sophie ihr hinterher. »Was ist denn los?«
Im Weitergehen wandte die junge Frau ihren Kopf zu Sophie. »Verdacht auf das Omega2-Virus. Wir gehen in häusliche Quarantäne.«
Sophies Brust schnürte sich zusammen. Ein kalter Schweißfilm legte sich über ihren Nacken und kroch den Rücken hinab. »Omega2?«
Wie wohl fast jeder Mensch erinnerte sie sich bei diesem Wort an wochenlange Ausgangssperren. Da war sie plötzlich wieder: die Angst vor Ansteckung – das ständige Gefühl, aus jeder Ecke könnte ein Wolf springen.
»Habt ihr die Impfung nicht aufgefrischt?«, rief sie Wen nach. Doch die eilte gerade durch die Drehtür ins Freie.
Mit hochgezogenen Schultern steuerte Sophie auf den Gang zu, der in ihr Institut führte. Die Wände des Foyers warfen das Geräusch ihrer Schritte zurück. Mit jedem Echo schien das Wort »Omega2« auf sie einzuhämmern.
»Was ist denn mit dir los?«
Sie riss den Kopf hoch und sah in Petes Gesicht, das deutlich eine Emotion zeigte. Erschrockenheit, vermutete Sophie.
»Bist du einem Körperfresser begegnet?«
Ihr Versuch eines Lächelns missriet. »Das trifft es ganz gut. Drüben in der Neurokognition haben sie einen Omega2-Verdacht.«
»Ach was!« Er winkte ab. »Mach dir doch nicht gleich ins Hemd, Sophie!«
Petes Faible für deutsche Redewendungen, gepaart mit seinem breiten texanischen Akzent, heiterte sie ein wenig auf.
»Der Epidemieschild wird zwei Wochen auf Level 3 geschaltet«, sagte er, »bis es null Fälle gibt. Und gut ist.«
»Ja, aber es ist so nah! Ich würde um mindestens sechs Biojahre altern, wenn ich mich infizierte.«
»Ach was! Höchstens ein paar Hansel werden sich anstecken. Das war doch immer so. Seit zwölf Jahren zieht euer Kanzler die Präventionspolitik knallhart durch, viel konsequenter als irgendwo sonst auf der Welt und in allen Bereichen: Klima, Gesundheit, Migration.«
»Das stimmt«, gab sie zu. »Und ich hoffe, dass Frederik Mager exakt so weiterregiert, auch nach der Wahl. Du findest das vielleicht albern. Aber ich mag Dinge, die funktionieren und die keine bösen Überraschungen produzieren.«
»Und warum sollte sich das ändern?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, dass es unter der Oberfläche brodelt. Vorhin hat ein KI-Agent den Expertenbaum virtuell in Brand gesetzt! Man hört immer lautere Stimmen, die das Vorsorgeprinzip hinterfragen.«
»Na ja, das kann ich verstehen. Kanzler Mager sagt: Im Zweifel geht der Schutz der Bevölkerung vor, solange nicht bewiesen ist, dass er überflüssig ist. Was, wenn man diesen Beweis gar nicht erbringen kann?«
»Siehst du, jetzt fängst du auch schon an. Aber wir fahren doch sehr gut damit! Es gibt wenige Klimatote, selbst für EU-Verhältnisse, keine Seuchen, keinen Terror. Nur das EU-Migrationskontingent ist in diesem Jahr um ein paar Prozent gestiegen, wegen dieser Fluten in Asien.«
»Ach, Sophie, reg dich nicht künstlich auf! Dein Mager wird Kanzler bleiben, weil die Deutschen so sind wie du: Ihr wollt Stabilität. Oder glaubst du vielleicht, morgen kommt eine charismatische, gutaussehende Politikerin, die euch zu einem Experiment verführt? Ich bitte dich!«
Sie lachte. »Das wird wohl bis zur Bundestagswahl nicht mehr passieren!«
»Das wird nie passieren!« Pete zwinkerte und ging weiter.
Sophie schüttelte sich, um das Bild zu vertreiben, das ihr Pete in den Kopf gesetzt hatte: eine strahlende Wahlsiegerin neben einem geknickten Frederik Mager.
»Andra?«, fragte sie, während sie weiterging.
»Ja, Sophie?«, ertönte die Stimme ihrer virtuellen Assistentin.
»Mobilitäts-App öffnen«, befahl sie.
»Bereit.«
»Den amtlichen Epidemieschild aktivieren.«
»Okay.«
Eine grüne Null erschien am Rand ihres Blickfelds. Bei Level 0 folgten zwar weder Belohnung noch Bußgeld, da man ja alles durfte, die Funktionen des Epidemieschilds standen aber bereit. Sophie stellte die Mobilitätspriorisierung von möglichst kurzer Strecke auf minimale Ansteckungsgefahr. Die App würde damit nach wenig frequentierten Verbindungen suchen. Die zusätzlichen Kilometer würden ihr zwar angerechnet, solange Level 0 herrschte, doch die Gesundheit ging jetzt vor. Kilometermäßig lag sie diesen Monat ohnehin gut im Soll.
Offensichtlich war es Pete nicht gelungen, sie zu beruhigen.
Womöglich war ja passiert, was der Infektionsrat seit Längerem befürchtete. Womöglich war Omega2 in einem tierischen Zwischenwirt mutiert und eine neue Pandemie drohte. Auch wenn Sophie das überlebte: Eine Alterung um mehrere Biojahre konnte sie sich laut dem letzten Epigenom-Check kaum leisten. Ihre finanziellen Verhältnisse erlaubten keinen schlechteren Präventionsindex.
Ein Teil von ihr begrüßte indessen eine neue Krise: Jede akute Situation aktivierte Regeln, deren brave Einhaltung mit finanziellen Boni belohnt wurde. Geld, das sie bitter nötig hatte.
Aber vielleicht war es auch der virtuell brennende Expertenbaum von vorhin, der ihr Angst machte. Sie fürchtete, dass sich die Kräfte des Irrationalen durchsetzten.
5
Die Zehn zitterte im Zielfernrohr. Ken schloss die Augen. Der Abzug sog die Wärme seines Fingers auf, verschmolz mit ihm. Ken ließ den Atem fließen und öffnete ein Auge. Nur noch ein winziger Rest von Zittern. Das Ziel deckte sich jetzt perfekt mit der Mitte des Fadenkreuzes. Nach einem weiteren Atemzyklus schoss er.
Er ließ sich von der verdichteten Kraft des Knalls überrollen. Wie ein Ballon blähte sich sein Universum auf. Er öffnete das zweite Auge und sah die Edelstahlwände des Schießstands, die anderen Gewehrscheiben. Seine hatte ein Loch, exakt in der Mitte! Für einen Moment genoss er den Erfolg.
Dann ging sein Universum zurück in den Normalzustand – keine Mitte, kein Ziel, nur grandiose Sinnlosigkeit. Bloß ein Zufall, gestand er sich ein. Er hatte den Natural Point of Aim, an dem der Einfluss der Körperbewegung praktisch ausgeschaltet war, noch nicht erreicht, schon gar nicht automatisch.
»Wow, Ken!«, hörte er eine Stimme von links, direkt neben sich.
Es war die Stimme.
»Voll in die Zehn!«
Ken drehte sich zu Janus. Er sah die regelmäßigen roten Bartstoppeln, die großen braunroten Augen. Der Moment schmeckte süß.
»Na, noch in die neue Shisha-Bar vorne am Eck?«, fragte Janus.
Blitzartig schmeckte alles bitter. Ausgerechnet die Shisha-Bar! Es wirkte alles so – arrangiert. Als würde irgendein Teufel ihn mit perfiden Manövern durch ein endloses Labyrinth zwingen, von einer Sackgasse in die nächste, immer knapp am Ausgang vorbei.
»Wie wär’s mit der Eckkneipe an der Karl-Marx?«, versuchte es Ken.
Janus verzog den Mund.
»Sorry. Ist mir zu prollig.«
Wie gesagt, ein hinterhältiger Plan. Unscheinbare, aber exakt platzierte Stolpersteine.
»Na ja, bin sowieso ziemlich erledigt«, log Ken. »Ich gehe lieber nach Hause.« Er deutete auf die durchlöcherte Zehn. »Besser wird’s heute nicht mehr.«
Das Leuchten in Janus’ Augen trübte sich etwas. Er zuckte mit den Schultern.
»Wie du willst, Süßer. Dann suche ich mir eben einen anderen Begleiter«, sagte er und ging. Die breiten Schultern tanzten unter seinem Flanellhemd davon. Ken biss sich auf die Unterlippe und riss den Blick los. Zackig zerlegte er das Gewehr und packte es in den Waffenkoffer. Während er sich das Bracelet um den Unterarm wickelte, rief er die Mobilitäts-App auf und ließ sie eine Verbindung zu sich nach Hause suchen. Das Armband zeigte einen freien Individualwagen an, schräg gegenüber dem Schützenheim. Das passte: Indi-Kilometer wurden zwar doppelt gezählt, aber er wollte jetzt keine Leute sehen. Er klappte das AR-Visier herunter und brach auf.
Draußen hielt er sich den Kragen zu, um sich vor der eisigen Brise zu schützen. Und das im März. Hieß es nicht, Berlin habe inzwischen ein Klima wie früher Toulouse? Jetzt sagten sie auch noch einen »Flutsommer« voraus. Doch das war ihm egal. Er würde den Sommer sowieso im Schützenheim verbringen.
Das Visier zeigte ihm den Indi. Ken steuerte darauf zu und stieg ein. Der Fahrersitz schmiegte sich um Kens Gesäß und Oberschenkel. Er drückte den Startknopf, gab sachte Gas und kurbelte aus der Parklücke.
»Fenster runter«, befahl er beim Passieren der Shisha-Bar, während er etwas vom Gaspedal ging. Das Fenster fuhr herunter. Ken lehnte sich auf dem Ellbogen hinaus und spuckte in Richtung des Lokals. Dann bog er in die Karl-Marx-Straße ein. Sein virtueller Assistent Rudi empfahl ihm einen Umweg über die Sonnenallee, weil auf dem kürzeren Weg ein Stau prognostiziert sei. Die Zusatz-Kilometer würden nicht gezählt. Ken folgte der Empfehlung.
Der grüne Schleier über der Straße wechselte ins Rot. An der nächsten Kreuzung würde er warten müssen, es sei denn, er gab weniger Gas. Das tat er, bis der Schleier wieder ins Grün wechselte.
»Ken«, meldete sich Rudi, »eine Anfrage, die in dein Filterprofil passt. Soll ich sie durchstellen?«
»Von mir aus.«
»Hi Ken, hier ist Tik, die KI von Personal Services.«
Ken atmete schwer aus. »Du musst nicht mit dem Hinweis nerven, dass du eine Kack-KI bist!«
»Tut mir leid, wenn ich dich verärgert habe, Ken«, sagte Tik. »Aber du weißt, dass die Algorithmen-VO diesen Hinweis vorschreibt.«
»Jaja, ist ja gut«, murrte er. »Also?«
»Ken, es wird immer schwerer, einen Job zu finden. Die Automatisierung. Man hat das Gefühl, sie legen einem extra noch Stolpersteine in den Weg, nicht wahr?«
Kens Atem setzte einen Moment aus. Trotz eines neuen roten Teppichs beschleunigte er und überfuhr die Kreuzung. Am oberen Rand seines Sichtfeldes zählte das Bußgeld hoch. Er ging vom Gas.
»Wir räumen diese Hindernisse aus dem Weg«, fuhr Tik fort. »Ich hätte da auch schon was für dich.«
»Moment, Moment! Sagtest du ›Stolpersteine‹?«
Tik machte eine kurze Pause.
»Ja, Stolpersteine. Eine Metapher für Hindernisse.«
Das Spalier der Straßenbeleuchtung verengte sich zu einem Tunnel. Die Kabine des Wagens bedrängte Ken.
»Woher hast du diese Metapher?«, schrie er.
Wieder setzte Tik kurz aus.
»Ich möchte dich nicht verärgern, Ken. Tut mir leid.«
»Ich habe dich etwas gefragt!«
Neue Pause.
»Viele unserer Kunden haben Schwierigkeiten, einen adäquaten Job zu finden. Um die Kommunikation mit euch Menschen natürlicher zu gestalten, verwenden wir Algorithmen Redensarten, Jargon oder Metaphern. ›Stolpersteine‹ ist in diesem Kontext naheliegend.«
»Hm«, quittierte er. »Also, was für einen Scheißjob hast du für mich?«
»UrbanAgro sucht Mitarbeiter, die neue Fassadengärten in den Wohntürmen am Alex anlegen.«
Ken hob die Augenbrauen. Alle Achtung, Tik, dachte er. Voll auf sein altes Steckenpferd Gärtnerei, das er mal zum Beruf hatte machen wollen. Bevor es anfing mit den Stolpersteinen. Und nicht mehr aufhörte, bis zu diesem Tag. Die KI zeigte sich zur Abwechslung mal lernfähig. Sonst bot sie ihm stets irgendwelche technischen Bullshit-Klick-Jobs an, die er einfach nur hasste.
»Hm, ja, das klingt gut, du Scheiß-KI«, provozierte er die Software.
»Siehst du«, antwortete Tik.
Nicht mal ordentlich beleidigen kann man dich, dachte Ken.
»Ich vermittle gerne ein Gespräch mit dem Anbieter«, bot Tik an.
An der Hasenheide bog Ken in die Jahnstraße ein. Das Visier wies ihn zu einem freien Ladeplatz für den Indi. Er stellte ihn ab, wartete, bis der Wagen sich mit der Ladebuchse verbunden hatte, stieg aus und ging auf eine steingraue Mietskaserne zu.
Im vierten Stock hielt er das Bracelet an das Schloss der Wohnungstür. Die klickte und sprang auf. »Spiel ›Wir leben‹ von Heinrich K.«, befahl er, als er seine Wohnungstür hinter sich zuzog. Harte, dumpfe Beats und ein rauer, aggressiver Gesang füllten den Flur.
In der Küche schlug sich Ken Eier in die Pfanne, als es klingelte. Die Musik pausierte. Er stapfte zur Wohnungstür, öffnete sie auf Sperrkettenlänge und stoppte den Impuls, sie sofort wieder zu schließen.
»Guten Abend«, rief der Besucher überschwänglich. »Ich bin Mourad. Heute erst eingezogen.«
Kens linke Hand presste den Türgriff, als wolle er ihn zerquetschen.
»Und?«, stieß er aus.
Die Augen seines Gegenübers verdunkelten sich etwas, doch das Lächeln blieb.
»Auf gute Nachbarschaft!«, meinte er.
Kens Lippen spannten sich, ein Mundwinkel begann zu zucken.
»Sicher«, gab er zurück und knallte die Tür zu.
Wenig später, er saß am Küchentischchen und wollte gerade in den Strammen Max beißen, klingelte es erneut. Er warf das Brot auf den Teller und polterte murrend zur Tür. Über die Sperrkette wollte er schon ein »Hau ab!« bellen. Doch nicht Mourad blickte ihm entgegen, sondern ein ledriges Gesicht mit eingefallenen Wangen: Flechtner, sein direkter Nachbar.
»Das ist der Anfang«, flüsterte dieser giftig.
Ken ekelte sich vor den weißen Speichelbläschen, die sich beim Sprechen um Flechtners Mundwinkel bildeten.
»Wie bitte?«
»Na, dieser Mourad, oder wie auch immer der heißt.«
»Der Anfang wovon?«
»Bis gestern war unser Haus sauber«, erzürnte sich der Nachbar. »Jetzt sickern sie ein. Wie überall.«
Ken beschloss, ihn etwas zu kitzeln. Aber vorsichtig. »Einsickern? Was meinen Sie?«
»Es läuft ganz perfide«, giftete Flechtner. Beim Sprechen blubberten immer neue weiße Bläschen um die äußere Lippenpartie.
»Erst macht man uns weis, dass das gute, freundliche Menschen sind«, redete er weiter. »Dann findet man bei jedem von uns den Schwachpunkt. Da bohrt man rein. Vorsichtig, unmerklich. Und dann, aus heiterem Himmel, ohne dir dessen bewusst zu sein, machst du den Platz frei für einen von denen. Frau Boheim aus dem Erdgeschoss meinte auf einmal, ins Heim ziehen zu müssen. Sie ist gerade mal 72! Und raten Sie mal, wer da jetzt einzieht!«
Ken zuckte mit den Schultern.
Flechtner sah ihn entgeistert an. »Na, dieser Mourad!«
Ken setzte eine Miene plötzlicher Einsicht auf. »Und wer ist ›man‹?«, fragte er.
»Wie bitte?«
»Sie sagten, ›man‹ finde bei jedem den Schwachpunkt. Wer ist ›man‹?«
»Wissen Sie denn gar nichts? Diejenigen, die im Tiefen Text lesen.«
Tiefer Text. Davon hatte er schon gehört, sich aber noch nicht damit auseinandergesetzt. »Aha. Und in diesem … Tiefen Text steht, wie man einen herumkriegt?«
»Klar«, stieß Flechtner aus und studierte Ken aus zugekniffenen Augen, als sei der begriffsstutzig. »Da steht alles über Sie drin! Alles, bis zu dem Furz, den Sie morgens in die smarte Matratze lassen.«
Ken erschrak, war es aber gewohnt, seine Emotionen zu verbergen. Sie versprachen doch stets hoch und heilig, dass das Euronet wasserdicht sei, was die Privatsphäre anging! Der »europäische Weg«: Sicherheit ohne Überwachung.
Andererseits waren da die Stolpersteine.
»Warum beschweren Sie sich nicht beim Bundeskanzler?«, entgegnete er. »Der hat das doch eingefädelt mit dieser präventiven Migrationspolitik.«
Flechtner verzog einen seiner sabbernden Mundwinkel und spuckte einen Lacher aus. An Kens Wange spritzte ein Tropfen. Er verbarg den Würgereiz.
»Mager? Machen Sie Witze? Wir dachten, schlimmer als unter Merkel kann’s nicht werden. Mager lässt vielleicht keine Selfies mit sich machen, aber er ist noch viel übler: Er steckt doch selbst hinter dieser hinterhältigen Ersetzungsstrategie. Das lässt sich alles recherchieren, Herr Fröbe! Überzeugen Sie sich! Machen Sie sich schlau, bevor Sie selbst an der Reihe sind!«
Flechtner wandte sich ab und ging zur gegenüberliegenden Wohnungstür. Dort drehte er den Kopf zu Ken. »Sobald Sie Bescheid wissen, können Sie sich bei mir melden.«
»Sicher«, antwortete Ken und schloss die Tür.
Der hat sie doch nicht alle, dachte er, als er in die Küche zurückging, wo es nach kaltem Fett roch. Trotzdem spürte er den Drang, mehr zu erfahren.
Die Stolpersteine.
Hatten sie vielleicht mit diesem ominösen Tiefen Text zu tun?
Ken ging ins Wohnzimmer und ließ sich aufs Sofa fallen. Exakt abgestimmte Weichheit fing ihn auf. Er winkelte ein Bein an, schob das Visier herunter und recherchierte.
6
Sophie verließ das Institutsgebäude. Andra empfahl ihr einen Umweg über den Alex mit zweimaligem Umsteigen. Das dauere zwölf Minuten länger, die Auslastung der Züge sei aber um 48 Prozent geringer. Ankunftszeit 18:39 Uhr. Das hieß, sie würde sich um neun Minuten verspäten. Dunja kannte Sophies enge Taktung und hatte sich auf ihre Pünktlichkeit eingestellt. Doch Sophie konnte sich nicht entschließen, die Empfehlung des Schildes zu missachten. Also würde sie ihre Freundin warten lassen. Sophie schlug den Weg zur Straßenbahnhaltestelle ein. Das Visier legte einen roten Schimmer über den Gehweg. Um die Bahn nicht zu verpassen, beschleunigte Sophie. Der rote Teppich verschwand.
»Text an Dunja«, formten ihre Lippen lautlos.
»Bereit«, quittierte Andra. Sophie freute sich, dass der Lippenleser funktionierte, erst heute früh hatte sie ihn installiert.
»Komme neun Minuten später, sorry«, diktierte sie, wiederum lautlos.
Sekunden später reihten sich Buchstaben am unteren Blickfeldrand aneinander. Dunjas Antwort:
»Ach, sieh an! Sophie verspätet sich auch mal. Wir sind gleich da. Andy ist schon sehr neugierig auf dich. Smarter Brite. Er wird dir gefallen, ganz sicher!«
Sophie seufzte. Dunja würde es nie aufgeben, sie verkuppeln zu wollen. Immer lachte sie nur, wenn Sophie ihr die Sachlage erklärte: dass Liebe nur ein Dopaminrausch war und Sophie Süchte konsequent mied, um sich auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. Besonders auf ihr großes Ziel, wie sie in Gedanken stets hinzufügte.
Kurz vor der Haltestelle lachten Männer hinter Sophie. Ihr Nacken versteifte sich. Sie schaltete noch einen Gang hoch. Verwaschene Wortfetzen drangen aus dem Surren des Verkehrs. Der Fußgängerüberweg färbte sich rot. Sophie stoppte. Körper huschten an ihr vorbei, einer streifte ihren Arm. Eine Gruppe junger Männer überquerte die Straße. Blaue Jeans, durchtrainierte Oberkörper in eng anliegenden T-Shirts. Ein leuchtend oranges Bild auf einem der breiten Rücken: Flammenzungen formten einen Schmetterling. Drüben, am Bahnsteig, blieben sie stehen. Die Straßenbahn glitt heran. Der Größte in der Gruppe schob sein Visier hoch und fokussierte sie. Es sah nach der üblichen männlichen Gier aus, mit genug Aggression darin, damit Sophie sie wahrnehmen konnte. Es gelang ihr nicht, derlei ganz zu verhindern. Ihre attraktive Figur konnte sie mit maskuliner Kleidung verstecken. Mit ihren ebenmäßigen, eleganten Gesichtszügen ging das nicht. Früher hatte sie das Visier auf einseitig intransparent geschaltet. Das mochten die Leute aber nicht, drum ließ sie es meist. Es blieb ihr nur, ihr hübsches Gesicht nicht auch noch mit Schminke zu betonen. Manchen Männern gefiel aber anscheinend gerade ihre vornehme Blässe. Eine Welle von Indis, Rädern und Lieferwagen schwappte vorbei. Als eines der Gefährte den Blickkontakt unterbrach, drehte sich Sophie weg.
Die Straßenbahn! Sie musste sie kriegen! Sie sauste zum nächsten Fußgängerüberweg, der zum anderen Ende des Bahnsteigs führte. Dort unterdrückte sie den Impuls, die freie Fahrbahn zu überqueren, da der Fußweg noch rot schimmerte. Erst als er sich in Grün umfärbte, rannte sie los. Die Türen der Straßenbahn schlossen sich bereits. Sophie schlüpfte gerade noch hinein.
Drinnen hielt sie das Handgelenk mit dem Bracelet an den Check-in-Scanner, bis das Armband freundlich piepste. Die Bahn fuhr los. Sophie wankte an freien Sitzen vorbei und stellte sich in die Mitte eines der grünen Kreise. Das brachte bei Level 0 zwar keinen Bonus, doch sicher war sicher. Sophie blickte zu einem blauen Punkt an der Wand. Das Visier reagierte und öffnete den zertifizierten Newskanal der Verkehrsgesellschaft.
Sophie sah eine Flutwelle durch ein malerisches Flusstal brechen. In der nächsten Einstellung ragten Dächer aus einem Meer schlammig-brauner Brühe. Ein Schauer lief ihr über die Haut. »Evidenzbasiertes Szenario«, blinkte am Rand ihres Sichtfeldes. Sophie seufzte. Die Modelle prognostizierten einen Flutsommer mit extremen Niederschlägen im Odenwald, im Erzgebirge und in Brandenburg.
Oje, Brandenburg! Da lag Berlin ja mittendrin! Sie hörte Pete schon spotten: Na, Frau Professor, hast du wieder Extremwetterangst?
Der Klimamitigationsrat empfehle eine Erhöhung der Mikrosteuer für präventive Flutmaßnahmen um 0,031 Prozent, sagte die Nachrichtenstimme. Sophie blies die Backen auf. Sie dachte an die Kosten für die Reha ihres Vaters.
Als Nächstes kam ein Lotto-Werbespot. Bunte Buchstaben tanzten:
IRRER JACKPOT!!!!
GEWINNE
Zahlen lösten die Buchstaben ab. Eine Fanfare ertönte.
40.500
Und wieder Buchstaben:
KILOMETER!!!!
EINMAL RUND UM DIE WELT!!!
Das Nachrichtenprogramm ging weiter. Im nächsten Szenario brachen riesige Eisbrocken von Gletschern ab und platschten ins Meer. »Die grönländischen Gletscher schmelzen nach einer mehrjährigen Verlangsamung wieder schneller ab«, berichtete die Sprecherin. Ein Forscher mit grauem Wuschelkopf mahnte, die Erderhitzung dürfe auf keinen Fall über drei Grad Celsius steigen, sonst schmelze der grönländische Eisschild mit großer Sicherheit komplett ab und der Meeresspiegel steige um sieben Meter an. In diesem September würde erstmals seit Menschengedenken eine eisfreie Arktis erwartet. »Damit Deutschland konform mit dem Drei-Grad-Korridor bleibt«, erklärte die Sprecherin, »muss die Klimanotbremse weiter angezogen werden.« Laut Expertenrat für Emissionsmanagement müssten die Treibhausgasemissionen binnen fünf Jahren auf null sinken. Das Mobilitätslimit der Bürger werde pauschal um 12,5 Prozent gekürzt. Der Malus bei Überschreiten des Limits werde auf sechs Euro pro Kilometer erhöht, der Bonus bei Unterschreiten immerhin auf einen Euro pro Kilometer. Das sah Sophie positiv: Sie würde mit gesparten Kilometern ihr Konto auffüllen können.
»Is’ doch alles Fake!«, meckerte eine Frauenstimme. »Früher sagte man Klimawandel. Heute nennen sie es Klimaeskalation. Völlig übertrieben! Für den letzten Winter hatten ihre Modelle Extremkälte angezeigt. Dann kam das übliche Schmuddelwetter! Aber irgendeine Ausrede fällt ihnen immer ein. Der Jetstream lief halt anders als erwartet oder bla, bla, bla!«
»Sie erzählen Geschichten, um uns zu melken«, kommentierte ein Mann trocken.
»Ach, ihr habt doch keinen Schimmer«, protestierte eine jüngere Stimme. »Wenn wir in den Zwanzigern schon aus Kohle und Erdgas ausgestiegen wären, hätten wir jetzt längst einen klimaneutralen Energiemix und müssten nicht mit Kilometern geizen. Wir wussten das die ganze Zeit. Wir sind selber schuld! Denkt doch endlich an die nächste Generation! Die wollen auch noch Freiheit!«
»Klimaneutral! Nächste Generation!«, stieß der Vorredner aggressiv aus. »Was ist mit uns? Sie wollen mit fadenscheinigen Argumenten die Welt von morgen schützen. Aber wenn tatsächlich mal ein Hitzesommer kommt, dann versagen die Klimageräte in den öffentlichen Kühlsälen. Wie war das denn vor vier Jahren, hä? Fünfzigtausend Hitzetote! Sie haben keinen Plan und schützen niemanden. Gut sind sie nur darin, unser Geld zu verbrennen!«
»Ich geh dieses Jahr nicht mehr wählen«, antwortete die Frauenstimme. »Sagen doch eh nur noch die Expertenräte, wo’s langgeht! Der Bundestag nickt nur noch ab!«
»Wundert’s dich? Da hocken ja auch immer mehr Wissenschaftler drin.«
»Physiker, Chemiker, Biologen. Versammelte Genialität – und immer schön einer Meinung.«
»Mager ist doch selbst einer von diesen Technokraten!«, tönte die erste Männerstimme. »Schmidt, Kohl, Schröder: Das waren Kanzler!«
»Es ist alles eine Scheißlüge«, ätzte eine weitere Stimme, die wie ein Reibeisen klang. »Sie retten die Welt, während wir mit Dumpinglöhnen abgespeist werden und uns von den Boni ernähren müssen. Ich kotze! Diktator Mager soll sich seine Prävention doch in den Arsch stecken!«
In Sophie wallte eine fast vergessene Wut auf. Nicht wegen der Berliner Schnoddrigkeit, die sie mochte. Aber sie hasste diese brutale Twitter-Tonalität, wie es sie Anfang der Zwanziger gegeben hatte. Ging das jetzt wieder los?
Doch schnell brachte Sophie das wilde Gefühl unter Kontrolle. Sie schaute woandershin, sodass das Newsprogramm verschwand. »Andra, bitte spiel Fiona Topol«, formten ihre Lippen. Sie brauchte jetzt klare, strukturierte, beruhigende Musik. Sophie liebte den Berliner Neuronal-Pop genau dafür. Deswegen hatte sie als ihr soziales Netzwerk auch LocalCulture gewählt. Da gab es Flatrates für die lokale Kunstszene. Fiona Topol war ihr persönlicher Favorit: ein unheimlich produktiver Cyborg, eine KI, die 24/7 komponierte und von Fiona, einer Frau, bewertet, korrigiert und variiert wurde.
Als die Musik startete, schaltete Sophie das Visier auf intransparent, ging ins Euronet und rief die Website von Wega auf. Sie stellte sich einen Lebensmittelkorb zusammen. Leider gab es keinen Kakao – Ernteausfälle in den tropischen Anbaugebieten. Kaffee gab es – teuer zwar, aber ohne ging es nun mal nicht. Kakao und Kaffee betrachtete sie als Neuro-Enhancement, nicht als Droge. Sie sendete die Bestellung ab.
Nach zweimaligem Umsteigen erreichte sie den U-Bahnhof Eberswalder Straße. Das Restaurant lag ganz nah in einem Hinterhof. Neben der Eingangstür stach ihr ein Graffiti ins Auge, in einem Grün, das sie an die Borg aus Star Trek erinnerte:
LÖSCHT DEN TIEFEN TEXT!
Sophie riss den Blick davon los und schielte auf das Hygienezertifikat unterhalb der Speisekarte. Klasse A. Ihre neu entflammte Omega2-Angst beruhigte sich etwas.
Sie öffnete die Tür, trat ein und fühlte sich wie in eine andere Welt versetzt. Im warmen, weichen Licht saßen Paare oder kleine Gruppen an locker verteilten Tischen vor Weingläsern und spärlich gefüllten Tellern. Gedämpftes Reden mischte sich mit perlender Pianomusik. Der helle Parkettboden, die cremefarbenen Wände und die in hellen Blautönen gehaltenen Landschaftsaquarelle rundeten die angenehme Atmosphäre ab. Dunja wusste, was sie Sophie zumuten konnte.
Als diese über die Tische blickte, entdeckte sie ein schmales Gesicht, das sie unter einem brünetten Pony anstrahlte – Dunja. Sophie grüßte sie mit einem Winken und lächelte zurück. Dann sah sie zu dem Mann neben ihrer Freundin und erschrak. Nicht, weil er mit dem hellen Teint, dem fein geschnittenen Gesicht und dem dichten, pechschwarzen Haar einem Vampir ähnelte. Sondern wegen der Art, wie er sie ansah. Zwar tat sich Sophie mit Mimik schwer, doch hier war der Fall klar: Er blickte sie an, als würden sie sich seit Jahren kennen. Sie befahl dem Visier lautlos, alle virtuellen Ergänzungen kurz auszublenden. Doch nach dem Bestätigungston saß der Mann noch da.
Irgendwie kam ihr das Gesicht bekannt vor. Sie hatte es schon einmal neben einem Artikel über eine Firma gesehen, fiel ihr ein. Aber persönlich hatte sie diesen Mann ganz sicher noch nie getroffen.
Sie wich dem vertraulichen Blick aus, indem sie seine Kleidung inspizierte. Gehobenes Business-Outfit. Recht konventionell.
Wie kam Dunja auf die Idee, dass dieser Andy ihr gefallen könnte? Ihre Freundin wusste allerdings auch, dass Sophie auf das Aussehen eines Mannes wenig gab. Wenn sie einen Menschen liebgewann, dann wegen seines oder ihres Geistes.
Sie überwand ihren Schrecken und bahnte sich den Weg zum Tisch.
»Hallo«, grüßte Sophie und nickte Dunja lächelnd zu. Zögernd blickte sie zu Dunjas Begleiter. Der stand auf und bot ihr die Faust, die Art der Begrüßung, wie sie nur in einer akuten epidemiologischen Phase üblich war, die im Moment nicht vorlag. Sie stutzte. Nicht, weil sie es übertrieben fand. Sondern weil es ihr tatsächlich lieber war.
»Hi, ich bin Andy Neville«, stellte er sich mit britischer Färbung vor. Beim Lächeln zeigte sich ein weißes, regelmäßiges Gebiss. Die Stimme war tiefer und kräftiger, als es seine schlanke Statur erwarten ließ. Sophie lächelte verhalten. »Hallo«, begrüßte sie ihn knapp und stieß leicht gegen seine Faust. Ein förmliches »Freut mich« brachte sie nicht über die Lippen.
»Schön, Sie kennenzulernen«, sagte er, rückte die Krawatte zurecht und setzte sich. Auch Sophie nahm Platz.
»Andy ist ein Freund von mir«, erklärte Dunja, »ein Star seiner Branche, meine Liebe.« Mit gesenkter, bedeutungsschwerer Stimme fügte sie hinzu: »Geschäftsführer von Berlin Smart Communications.«
Jetzt fiel Sophie wieder ein, worum es in dem Artikel mit Nevilles Bild grob gegangen war. Der war eine Weile her. Sie hätte jetzt gerne Andra gebeten, den Artikel anzuzeigen. Doch die Lippenbewegung wäre aufgefallen. Zum Glück hatte sie ein gutes Gedächtnis. Das lieferte einige Details. Der Text hatte Nevilles zwielichtige Vergangenheit beleuchtet, das Wort »Wahlbeeinflussung« war vorgekommen. Ein Schleier legte sich über das Wesen, das ihr schräg gegenüber saß. Auf Dunjas Lob hin hob Neville beschwichtigend eine Hand, die aussah wie die eines Skeletts mit einem übergezogenen Handschuh. Sophie vermied es mühsam, darauf zu starren.