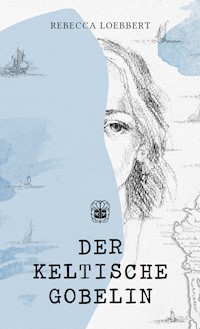
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In der Pension im Hafen von Calais, wo Mary mit ihren Eltern und ihrer Schwester Urlaub macht, soll schon Maria Stuart mit ihren Hofdamen übernachtet haben, bevor sie nach Schottland zurückkehrte. Ein uralter Wandteppich zieht Marys Blicke an. Er scheint zu leuchten, sie hört Stimmen, schiebt den Gobelin zur Seite - und plötzlich findet sie sich unter den Hofdamen der schottischen Königin. Nicht nur das: Mary Seton, eine der Damen, scheint ihren Platz im Jahr 2016 eingenommen zu haben. Warum? Hat sie eine Aufgabe hier? Und wird sie jemals heimkehren können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der keltische Gobelin
DER KELTISCHE GOBELINWidmungTeil 1 Zwischen zwei WeltenProlog12345678Teil 2 Die Frau auf dem Gobelin9101112131415Teil 3 Im unvergänglichen Licht der Sterne161718192021DazwischenEpilogHistorische Korrektheit und BegebenheitenDramatis PersonaeNachwortLast Days at FotheringhamDanksagungLiteraturverzeichnisImpressumDER KELTISCHE GOBELIN
_________________________________________
REBECCA LOEBBERT
_____________________________________________
To be kind to all,
to like many
and love a few,
to be needed and
wanted by those we love,
is certainly the nearest
we can come to happiness.
Mary, Queen of Scots
Widmung
Für Opa Willi, der mir die wunderbare Vielfalt der Sprache und der Welt zeigte.
Der mir zeigte, dass die kleinsten Dinge ein Wunder sein können
und dass wir uns an ihnen erfreuen sollten, auch,
wenn der Rest der Welt sie gar nicht wahrnimmt.
Und für Schottland.
Für all die Menschen, die ich auf meinen Reisen dort kennengelernt habe.
Für eine Königin, deren Leben so anders verlief, als es hätte sein können.
Für eine Hofdame, die zu oft im Schatten bleibt.
Und all die tapferen Ritter, die für Unabhängigkeit und ihren Glauben gekämpft haben.
Teil 1 Zwischen zwei Welten
1561/2016
The stars forever unchanging
They guide us on paths unseen
And you were written in my story
Destined to collide with me
They say you stole me in moonlight
But love, I was already yours
For we were written in the starlight
As the wolf belongs to the moon
Like the rain meets the river
Like the trees meet the sky
We were born to be together
You and I
Like the fish need the water
Like the birds need the sky
We were made to need each other
You and I
(Karliene)
Prolog
Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser.
Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind.
Johann Wolfgang von Goethe
Calais, Frankreich 15. August 2016
Es war ein furchtbar schwüler Morgen. Ich erwachte von den Sonnenstrahlen, die durch das Fenster fielen und mich an der Nasenspitze kitzelten. Verschlafen schlug ich die Augen auf und blickte auf meinen Wecker. Sechs Uhr. Stöhnend ließ ich mich wieder in die Kissen fallen. Bis meine Eltern und meine Schwester aufstanden, würde es noch ein paar Stunden dauern. Sie waren Langschläfer und störten sich nicht an den hohen Temperaturen. Im Gegenteil – sie genossen sie. Zu Hause war es ihnen stets zu kühl. Ich hingegen hatte nicht das geringste Problem damit, dass es in England oft regnete und kühl blieb.
Ich wälzte mich hin und her, in der Hoffnung, noch einmal einzuschlafen, doch ich schaffte es nicht. Schließlich gab ich es auf. Seufzend streckte ich die Füße über die Bettkante, trat zu dem geöffneten Fenster und spähte hinaus auf den Hafen von Calais. Unsere Pension war in der Tudor-Zeit erbaut worden und unsere Wirtin hatte uns schwärmerisch erzählt, dass die vier Marys, die Jugendfreundinnen und später Hofdamen von Königin Mary Stuart von Schottland, ihre letzte Nacht in Frankreich in diesem Gebäude verbracht hatten, ehe sie mit ihrer Königin nach Schottland zurückkehrten. Ich stellte mir vor, wie sie vor über vierhundertfünfzig Jahren an genau dieser Stelle gestanden hatten, um das Treiben im Hafen zu beobachten.
Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Es klang wie ein Pfeifen. Bestimmt war es bloß der Wind, der durch die Mauern zog. Merkwürdig, denn ich stand am Fenster und spürte nichts. Auch die Äste der Bäume standen still, als steckte nicht ein Hauch Leben in ihnen. Das Pfeifen hielt an. Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber es war, als hörte ich Stimmen darin. Ein Lachen, ein Stöhnen, ein Schluchzen und ein Wispern. Und dann passierte etwas Seltsames. Es war, als wäre ich von einer unsichtbaren Macht gebannt. Ich drehte mich um, schritt auf die Tür zu. Langsam drückte ich die Klinke hinunter. Der Flur war verlassen. Aus dem Zimmer gegenüber drang das leise Schnarchen meiner Schwester. Ich setzte einen Fuß vor den anderen, ohne zu wissen warum, und folgte den jetzt deutlich zu hörenden Stimmen. Vor einem uralten Wandteppich machte ich schließlich halt. Das Lachen war jetzt so laut, als stünde die Person direkt vor mir, ebenso wie das Schluchzen, das Stöhnen und das Wispern. Aber da war niemand. Wie von einer unsichtbaren Hand gelenkt ergriff ich den schweren Stoff des Gobelins und schob ihn zur Seite. Dahinter kam eine Reihe Bruchsteine zum Vorschein, als sei dieses Stück Wand bei sämtlichen Renovierungsarbeiten vergessen worden. Ich fuhr mit den Fingern darüber. Eine dicke Schicht Staub lag darauf. Darunter vermeinte ich ein Muster zu erkennen. Vorsichtig wischte ich mit den Fingern darüber. Mir offenbarten sich zahlreiche ineinander verschlungene Linien. Ein keltischer Knoten, dachte ich. Er war mit größter Sorgfalt in den Stein geritzt worden. Jetzt erst bemerkte ich die Stille. Die Stimmen waren verschwunden. Vielleicht hatte ich mir nur alles eingebildet. Lag es an der Wärme, die ich nicht vertrug? Ich wollte mich gerade umdrehen und den Wandteppich wieder vor den Stein schieben, da begannen die Muster auf einmal zu leuchten. Die feinen Linien erstrahlten in einem leuchtenden Rot. Langsam bewegte sich meine Hand darauf zu. Ich legte die Fingerspitzen auf die obersten Ränder. Dann lag meine ganze Hand auf dem Ornament. Mit einem Mal hörte ich wieder eine Stimme, nur eine einzige dieses Mal.
„Mary!“ Woher kannte sie meinen Namen?
„Mary!“ Die Stimme klang vertraut, obgleich ich nicht wusste, wo ich sie schon einmal gehört hatte. Alles um mich herum begann zu verschwimmen.
„Mary!“
Ohne mein Zutun erklang plötzlich meine eigene Stimme, fremd und weit entfernt, aber ich wusste, dass es meine war.
„Mary!“
Und dann tauchte für den Bruchteil einer Sekunde ein Bild vor mir auf. Es war ein Gesicht, mein Gesicht. Aber das Mädchen war nicht ich. Das Mädchen, das mir gegenüberstand, trug ein altmodisches Kleid. Wie man es in der Zeit der Tudors getragen hatte.
„Mary!“ Diesmal schrien wir gleichzeitig. Und dann fiel ich in eine tiefe, schwarze Leere.
Calais, Frankreich 15. August 1561
Ich blickte hinaus in den Hafen. Bald würde ich ein Schiff besteigen, um mit meiner Königin nach Schottland zurückzukehren. Unten erwarteten mich meine Freundinnen. Ich wusste, dass es Zeit wurde aufzubrechen. Unsere unbeschwerte Zeit am französischen Hof war Vergangenheit. Ich hatte keine Ahnung, was in Schottland auf uns zukommen würde, aber ich wusste, dass in dem Land Unruhen herrschten. Der protestantische Aufrührer John Knox hatte eine gewaltige Schar Anhänger um sich geschart, die alle nicht gerade auf die Rückkehr ihrer katholischen Königin erpicht waren.
„Mary!“, ertönte eine Stimme von unten. „Mary Seton! Das Schiff wartet auf uns!“
Ich seufzte. Ich wollte nicht fort. Ich wollte für immer hier stehenbleiben, die Möwen beobachten, die über den Schiffen kreisten, frei und leicht, und die sanfte Brise genießen, die mir um die Nase wehte. Noch einmal wurde ich gerufen. Unverkennbar die aufgeregte Stimme Mary Livingstons, die es kaum erwarten konnte, in unsere Heimat zurückzukehren, die wir im Alter von fünf Jahren verlassen hatten. Damals waren wir nach Frankreich gekommen, um Mary Stuart, unsere Königin, vor König Henry von England zu beschützen, der sie mit seinem Sohn hatte verheiraten wollen. Mary Livingston, Mary Beaton, Mary Fleming und ich waren in unserer Kindheit ihre Gespielinnen gewesen. Am Hof in Frankreich wuchsen wir zusammen auf, wurden ihre Hofdamen. Wir waren dabei, als sie den Dauphin von Frankreich, François, heiratete, und auch, als er ein Jahr später starb. Wir waren auch dabei, als sie kurz nach ihrem tragischen Verlust die Nachricht erreichte, dass nun auch ihre Mutter Marie de Guise verschieden war. Schließlich blieb Mary kaum etwas anderes übrig als nach Schottland zurückzukehren, um ein neues Leben zu beginnen: als Königin. Obwohl Mary schon gekrönt wurde, als sie gerade einmal eine Woche alt war, war Schottland ihr fremd. Mir erging es nicht anders, hatten wir doch unsere ganze Kindheit am französischen Hof verbracht.
Ich seufzte noch einmal. Dann drehte ich mich um und trat auf den Flur hinaus. Plötzlich hörte ich ein Pfeifen vom anderen Ende des Ganges. Ich blieb stehen. Nein, ich bildete es mir nicht ein. Das Geräusch war da. Jetzt vernahm ich es klar und deutlich. Stimmen mischten sich hinein. Manche flüsterten, andere weinten, wieder andere lachten. Ich hörte ein verzweifeltes Schreien und ein verzücktes Stöhnen. Langsam setzten sich meine Füße in Bewegung, schritten auf die lauter werdenden Stimmen zu. Schließlich kam ich vor einem Gobelin zum Stehen. Er zeigte eine Frau mit langem weißem Gewand, die rechte Hand offen ausgestreckt. In der linken hielt sie ein geöffnetes Amulett, das jedoch kein Abbild enthielt, sondern ein Herz, das von einer Distel durchbohrt wurde. Der Teppich war fein gearbeitet und musste sehr kostbar sein. Ich ließ meinen Blick an der Frau hinaufgleiten. Jede Falte ihres Kleides war sorgsam gearbeitet. Ich blickte in das blasse Gesicht – und erstarrte. Die schmalen Lippen, die schiefe Nase, die grünen Augen umrahmt von einer Flut goldenen Haars – all das kam mir bekannt vor. Es war ein Gesicht, das ich nur zu gut kannte. Ein Gesicht, das mich stets musterte, wenn ich an einem Spiegel vorbeikam.
Es war mein Gesicht.
Ich wollte zurückweichen, doch es war, als wären meine Füße festgefroren. Die Stimmen, die nun unerträglich laut klangen, summten in meinem Kopf. Ohne, dass ich es wollte, bewegte sich meine Hand. Wie in Trance schob ich den Stoff des Gobelins zur Seite. Darunter kamen Muster zum Vorschein, sorgfältig in den Stein geritzt. Als meine Finger sich ihnen näherten, begannen sie rot aufzuleuchten.
Dann tauchte vor mir ein Gesicht auf. Es war das Gesicht der Frau auf dem Teppich. Mein Gesicht. Gleichzeitig das Gesicht eines Mädchens, das ich nicht kannte, dessen Schicksal jedoch mit meinem verwoben war wie die Fäden des Gobelins.
Die Stimmen verstummten schlagartig. Stattdessen hörte ich meine eigene Stimme wie aus weiter Ferne.
„Mary!“
Das Mädchen mir gegenüber hatte Angst, genau wie ich. Keine von uns wusste, was hier geschah. Beide waren wir machtlos, mussten mitansehen, wie alles um uns herum verschwamm und nur noch wir beide blieben, gefangen in einer schwarzen Leere.
„Mary!“, rief ich noch einmal. Dieses Mal antwortete sie.
„Mary!“
Unsere Rufe vermischten sich, unsere Stimmen wurden eins.
„Mary!“
Und dann war da nichts mehr.
1
Den Weg des Windes kannst du nicht ergründen.
Aus dem Orient
Calais, Frankreich 15. August 1561
Das erste, was ich sah, waren die groben Holzbalken an der Decke. Mein Blick wanderte daran entlang, über die Wand und den alten Wandteppich. In meinem Kopf hämmerte es. Ich musste gestürzt sein. Alles, an das ich mich erinnerte, war, dass ich mein Zimmer verlassen und vor dem Gobelin mit der Frau in Weiß stehengeblieben war. Warum ich das getan hatte, wollte mir nicht mehr einfallen.
„Mary!“ Ich hörte, wie sich eilige Schritte näherten. Dann vernahm ich erneut die herrische Stimme. „Mary Seton! Nun komm endlich!“
Seton? Mein Kopf brummte ob des harten Aufschlags, aber ich war mir dennoch ziemlich sicher, dass mein Nachname Montgomery war, und nicht Seton. Also konnte ich wohl kaum gemeint sein. Komisch nur, dachte ich, wir waren doch die einzigen Gäste der Pension, wie uns der Wirt gestern mitgeteilt hatte. Die Schritte wurden lauter, dann sah ich vor meiner Nase einen spitzenbesetzten Rocksaum.
„Was um alles in der Welt tust du da?“ Mühsam schaffte ich es, mich aufzusetzen und ließ den Blick an der Frau hinauf gleiten. Sie sah aus, als wäre sie einem Gemälde entsprungen. Das Kleid war aus grüner Seide, mit weißer Spitze am Saum, so wie an den Ärmeln und am Kragen. Oben schmiegte sich das mit Stickereien verzierte Mieder eng an den Körper, während der Stoff nach unten hin in einen weiten Rock überging. Die dunklen Haare der Frau waren kunstvoll hochgesteckt. Ihr Gesicht war weiß gepudert, ihre grünen Augen funkelten. Sie sah aus, als käme sie geradewegs vom Set eines Historienfilms.
„Jetzt komm schon. Das Schiff ist bereit!“ Sie zog mich auf die Füße, sodass ich der Frau auf dem Wandteppich genau in die Augen sah. Schlagartig fiel mir alles wieder ein. Die Stimmen, die Ornamente, die Frau, die mir bis aufs Haar glich. Dann blickte ich an mir herunter. Meine Shorts war verschwunden, ebenso wie das abgetragene Top. Stattdessen trug ich ein Kleid, das dem der Frau in Grün glich. Es war mit kunstvollen blauen Ranken bestickt, die sich über das cremefarbene Mieder wanden. Die weiten Röcke bauschten sich um meine Beine.
„Worauf wartest du?“ Die Frau ergriff meine Hand und zog mich mit sich, eine schmale Treppe hinunter, die unter unserem Gewicht laut ächzte. An deren Fuß standen zwei weitere Frauen in ähnlichen Kleidern und warteten.
„Da bist du ja endlich!“, meinte die eine. „Was hast du da oben bloß so lange gemacht?“ Ich verstand nichts von dem, was sie sagten.
„Sie lag auf dem Boden vor dem alten Gobelin“, berichtete die Frau in Grün.
„Was hast du da bloß getrieben?“ Die drei Gesichter musterten mich mit einer Mischung aus Verständnislosigkeit und Sorge. Ich antwortete nicht. Wie sollte ich auch? Wer waren diese Frauen? Wo waren meine Eltern, meine Schwester? Und warum sah das Haus aus wie in den Tagen, in denen es gerade erst erbaut worden war?
„Wie auch immer, wir müssen los“, entschied die, die ein Kleid in Rosè-Tönen trug. Die, die mich gefunden hatte, zog mich mit sich. Unfähig mich zu wehren, stolperte ich hinter ihr her; hinaus aus der Pension in den Hafen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass sich auch hier alles verändert hatte. Keine Autos, keine Fähren lagen im Hafen, stattdessen fuhren Kutschen an mir vorbei. Menschen eilten die Promenade entlang, deren Kleider allesamt nicht ins 21. Jahrhundert passten. Ein aufgeregter Mann kam mit fuchtelnden Armen auf uns zu geeilt.
„Mademoiselles! Mademoiselles! Die Königin erwartet Euch schon!“ Er redete so schnell und mit so starkem italienischem Akzent, dass ich Mühe hatte, ihn zu verstehen.
„Es tut uns leid, dass wir so spät sind“, entschuldigte sich die in Rosè. Der kleine Mann mit dem auffallend langen Schnurrbart fuchtelte noch immer wild mit den Armen. „Jetzt sind Sie ja da!“
Die Frau mit dem grünen Kleid nickte. „Oui, Monsieur Riccio, jetzt sind wir ja da.“ Sie lächelte amüsiert.
Der kleine Mann marschierte nun eiligen Schrittes auf die Galeone zu, die vor Anker lag. Die drei Damen folgten ihm und ich mit ihnen, als sie mich mit an Bord nahmen. Vielleicht träumte ich all das nur. Vielleicht hatte ich einen Hitzeschock erlitten. So warm war es überhaupt nicht, Mary. Das ist ganz und gar unmöglich ... Genauso unmöglich, wie in der Zeit zu reisen.
An Bord herrschte wildes Treiben. Männer schleppten Kisten und Fässer, unterhielten sich angeregt und fluchten gelegentlich. Ich folgte den anderen durch die Menge zum Bug des Schiffes, wo eine schlanke Frau mit dem Rücken zu uns stand, die ungefähr meine Größe hatte. Als sie uns hörte, drehte sie sich um. Die Kinnlade klappte mir herunter. Ihr Kleid war mit goldenen Fäden durchwirkt. Ihre blonden Haare waren als Kranz um den Kopf geschlungen und mitten drin prangte eine goldene Krone. Sie war wunderschön.
„Mary!“, riefen meine Begleiterinnen freudig. Mary lächelte, obgleich in ihren Augen Trauer stand, und dann umarmte sie die anderen. Schließlich fiel ihr Blick auf mich.
„Komm her, Mary“, forderte sie mich auf. Ich wusste nicht recht, was ich nun tun sollte, also gehorchte ich. Sie schloss mich in die Umarmung mit ein, in der ich wie ein Stein verharrte.
„Euer Majestät!“ Ich fuhr herum. Vor mir stand ein hochgewachsener Mann mittleren Alters. „Verzeiht die Störung, aber das solltet Ihr Euch ansehen.“
Wir folgten dem Mann zur Steuerbordseite des Schiffes. Es war ein nebeliger Tag, kühl und trüb. Ganz anders, als das Wetter heute Morgen gewesen war, als ich aufgewacht bin. Ich musste phantasieren!
Schließlich blieb der Mann stehen und deutete nach unten ins Wasser. Auf den ersten Blick sah ich nichts außer dunklen Fluten. Doch als ich genauer hinsah, erkannte ich Holzplanken, die auf den Wellen trieben. Und dann schrie Mary – die Königin – auf. Zwischen dem Holz schwammen drei leblose Körper. Entsetzen packte mich. Wie aus weiter Ferne hörte ich, wie jemand erklärte, dass es sich um ein Fischerboot handelte, das im Hafen zerschellt war. Dann wusste ich plötzlich, was zu tun war. Ich kletterte auf die Reling, bereit, hinunter zu springen, um die Fischer zu retten. Da wurde ich von hinten gepackt und unsanft zurückgezerrt.
„Was tut Ihr da?“, fuhr mich der Mann an. Reservierter und versucht höflicher fügte er hinzu: „Mylady.“
„Ich muss ihnen helfen“, stammelte ich resigniert.
„Ihr könnt nichts mehr tun! Sie sind tot.“
„Aber, aber nein. Ich muss doch...“
„Mademoiselle Seton, fühlt Ihr Euch nicht gut?“ Das war die Stimme von dem kleinen Mann mit Schnurrbart, der uns im Hafen entgegengeeilt war. Ich fühlte eine Hand auf der Stirn. Dann vernahm ich eine Frauenstimme.
„Sie ist damals auf der Hinreise nach Frankreich furchtbar seekrank geworden. Ich werde mit ihr unter Deck gehen.“
Eine zarte Hand führte mich durch die Masse schwitzender Männer, deren raue Stimmen mir plötzlich unerträglich laut erschienen. Das letzte, was ich hörte, war die Stimme von Königin Mary, die schluchzend meinte: „Welch trauriges Vorzeichen für diese Reise.“
Dann wurde die Welt schwarz.
Als ich erwachte, spürte ich eine kratzige Matratze unter mir. Zumindest glaubte ich, dass es eine solche war. Flatternd öffneten sich meine Lider.
„Wie fühlst du dich?“ Ein fremdes Gesicht schob sich in mein Blickfeld.
„Was ist passiert?“, murmelte ich.
„Da war das Fischerboot, das im Hafen zerschellt ist. Du wolltest ins Wasser springen und die Insassen retten, warst völlig hysterisch. Als ich dich mit unter Deck nehmen wollte, bist du ohnmächtig geworden.“ Ich blinzelte. Träumte ich etwa noch immer? Ich versuchte mich aufzurichten, und die Frau stützte meinen Rücken. Sie kam mir vage bekannt vor.
„Wer bist du?“ Die Frau blinzelte verblüfft.
„Mary Fleming.“ Ihre Stimme klang leicht besorgt.
„Und – und die anderen, die da waren? Die Frauen in Grün und Rosè und Gold?“ „Mary Livingston trägt heute Grün. Rosè ist die Farbe von Mary Beaton – es war schon immer ihre Lieblingsfarbe. Und Gold trägt natürlich unsere Königin.“
Ich verstand kein Wort. Mary Fleming. Beaton. Livingston. Die Namen sagten mir etwas. Ich hatte sie schon einmal gehört. Aber wo? Und was meinte sie mit „unsere Königin“? Da war eine vage Erinnerung. Richtig, die Frau hatte eine Krone getragen.
Zögernd fragte ich: „Welche Königin?“
Für einen Moment wirkte sie geschockt, fasste sich aber schnell wieder. „Mary Stuart natürlich, unsere Königin und Freundin, seit ich denken kann.“
Auf einmal wusste ich, wo ich die übrigen Namen schon einmal gehört hatte. Sie standen in goldenen Lettern auf einem Schild vor einem Restaurant, in welchem wir auf einer Reise durch Schottland vor drei Jahren Halt gemacht hatten. Es war benannt nach den vier Marys, den Hofdamen der Mary Stuart, Königin von Schottland im 16. Jahrhundert.
Nein, das konnte nicht sein! Die vier Marys waren seit mehreren Jahrhunderten tot, ebenso wie ihre Königin.
„Mary?“, hörte ich die Stimme der Frau – Mary Fleming – erneut an meinem Ohr. „Mary, du siehst furchtbar aus! Ich weiß, dass du Seereisen nicht magst. Vielleicht ist es besser, du legst dich wieder hin.“
Ich kam ihrem Vorschlag nach, ließ mich zurücksinken und schloss die Augen. Auch wenn mein Verstand mir sagte, dass dies völlig unmöglich war, begann sich ein Winkel meines Bewusstseins sich mit der vollkommen irrwitzigen Idee abzufinden, dass ich nicht träumte, sondern mich wirklich auf einem Schiff des 16. Jahrhunderts befand, an Bord die Königin von Schottland, und dass man mich aus einem mir nicht zu erschließenden Grund für eine ihrer Hofdamen hielt. Irgendwann nickte ich über meinen Grübeleien ein.
Ich erwachte, weil ich unsanft von meiner Lagerstadt geschleudert wurde. Der Boden vibrierte. Ich griff reflexartig nach etwas zum Festhalten, um nicht quer durch den Raum zu fliegen, und erwischte einen Holzstoß, der furchtbar splitterte. Das Schiff musste den Hafen bereits verlassen und nun eine enge Kurve genommen haben. Als es sich wieder ausgependelt hatte und ich nurmehr das sanfte Schaukeln der Wellen spürte, zog ich mich an dem rauen Holz auf die Beine. Ich blickte mich um, doch im Dunkeln konnte ich nur Schemen ausmachen. Da ich nicht den Drang verspürte, wieder auf das unbequeme Lager zurückzukehren, tastete ich mich durch die Dunkelheit voran, bis ich Sprossen unter den Fingern spürte. Vorsichtig setzte ich einen Fuß darauf, testete, ob sie mich halten würden und hangelte mich Schritt für Schritt hinauf, bis mir schließlich frische Nachtluft ins Gesicht schlug. Ich spürte die Brise, die über das Deck wehte, erfrischend kühl auf meiner Haut. Am Himmel funkelten unzählige Sterne und die Mondsichel beschien die leise rauschenden Wellen, die vom Bug durchschnitten wurden. Ich atmete tief ein und füllte meine Lungen mit dem Duft der Freiheit. Froh, der Enge meiner Kabine entkommen zu sein, schritt ich zur Reling, umfasste sie mit beiden Händen und betrachtete die tanzenden Lichtpunkte unter mir.
„Können Sie auch nicht schlafen, Mademoiselle Seton?“ Ich zuckte unwillkürlich zusammen, als mich eine tiefe Stimme hinter mir aus den Gedanken riss. Ich drehte mich um und erblickte den kleinen Italiener. Freundlich lächelte er mir zu.
„Fühlt Ihr euch besser?“ Seine Stimme war freundlich und warm. Ich versuchte mich zu erinnern, wie die Dame in Grün – Mary Livingston, berichtigte ich mich – ihn genannt hatte, doch es wollte mir nicht mehr einfallen. Höflich erwiderte ich sein Lächeln. „In der Tat geht es mir schon um ein Vielfaches besser, vielen Dank!“
Er nickte. „Macht es Euch etwas aus, wenn ich Euch etwas Gesellschaft leiste?“ Ich schüttelte den Kopf und versicherte ihm, dass das Gegenteil der Fall wäre, dass ich mich über etwas nette Gesellschaft freuen würde. Eine Weile standen wir schweigend nebeneinander, blickten hinaus in das unendliche Dunkel der Nacht und hingen unseren Gedanken nach. Ich dachte über alles nach, was ich über das Leben im 16. Jahrhundert wusste und was ich in Geschichtsbüchern über Mary Stuart gehört hatte. Erfreulicherweise erinnerte ich mich an mehr, als ich zunächst angenommen hatte. Meine Mutter war begeisterte Historikerin und obgleich ich ihren leidenschaftlichen Vorträgen, die sie uns manchmal hielt, wenn sie wieder besonders begeistert von etwas gewesen war, selten aufmerksam zugehört hatte, war in meinem Unterbewusstsein doch etwas hängen geblieben.
Mary Stuart, geboren am 8. Dezember 1542, wurde im Alter von nur einer Woche Königin von Schottland, da ihr Vater James V. kurz nach ihrer Geburt gestorben war. Zunächst wollte Henry VIII. von England sie mit seinem Sohn Edward verheiraten, was die Mutter der Baby-Königin jedoch nicht zuließ. Auf Grund der daraus entstandenen Gefahr, die Henrys Truppen nun bildeten, und religiöser Unruhen im Land, schickte Marie De Guise ihre Tochter im Alter von fünf Jahren an den französischen Hof, um dort erzogen zu werden, begleitet von den vier Marys, die eines Tages die Damen der Königin werden sollten. Zehn Jahre später heiratete die junge Königin Mary dann François, den Dauphin, und war somit nun zu gleichen Teilen Königin von Schottland und Frankreich. François erlag jedoch ein Jahr darauf den Folgen einer Ohreninfektion. Als die trauernde Witwe nicht lange danach auch noch von dem Tod ihrer Mutter, die bis zu jenem Zeitpunkt in Schottland regiert hatte, erfuhr, verließ sie Frankreich, um in ihrem eigenen Land ihren königlichen Pflichten nachzukommen. Und genau da kam ich ins Spiel. In diesen Abschnitt ihres Lebens war ich geradewegs hineingestolpert. Weiter musste ich für den Moment noch nicht denken.
Zufrieden mit dem, was ich aus meinem Gedächtnis hervorgekramt hatte, musste ich nur noch eine Frage endgültig klären: Wie hatte es passieren können, dass ich so unvermittelt in einer anderen Zeit und dem Körper einer anderen Frau gelandet war? Ich war mir mittlerweile sicher, dass ich nicht träumte, dafür war ich schon zu lange hier, und dafür war alles viel zu real. Damit meine ich nicht die Realität, die man in einem wirklichkeitsnahen Traum empfindet, sondern die nicht zu leugnende Realität des Windes in meinem Haar, auf meiner Haut, die starken Gerüche der frischen Nachtluft und des beißenden Gestankes im Hafen.
Ich erschauderte, als ich mich an die auf den Wellen treibenden Holzplanken des Fischerbootes erinnerte, an die leblosen Körper, die hin und wieder untertauchten, ehe das Meer sie wieder freigab.
Eine beruhigende Hand drückte die meine und holte mich in die Wirklichkeit zurück. Zum ersten Mal betrachtete ich mein Gegenüber genauer. Er war gut eineinhalb Köpfe kleiner als ich, der lange Schnurrbart, der mir von Anfang an aufgefallen war, war ebenso schwarz wie das Haupthaar, das, heute Morgen noch sorgsam zurück gestrichen, ihm nun ins Gesicht fiel und zwischen deren Strähnen mich aufgeweckte dunkle Augen musterten.
„Ein wenig frische Luft kann wahre Wunder bewirken, nicht wahr, Mademoiselle?“, durchbrach er die Stille.
„Wahrlich. Und man bekommt einen klaren Kopf.“
Der Griff um meine Hand verfestigte sich. „Lastet etwa ein Kummer auf Eurem Herzen, Mademoiselle?“ Er klang halb erstaunt, halb mitleidig. „Was kann denn einer Dame Ihrer Majestät auf den hübschen, schmalen Schultern lasten?“
Ich seufzte und spürte unwillkürlich, wie sich eine einzelne Träne aus meinem Augenwinkel löste, meine Wange hinabrann und hinuntertropfte. Schnell hatte ich mich wieder im Griff. „Es ist nichts“, versicherte ich nachdrücklich. Ich wich seinem Blick aus, wusste jedoch, dass er mir nicht glaubte. Ich war keine besonders gute Lügnerin. Schließlich fügte ich hinzu: „Es ist nur so, dass ich mich nicht gerne ohne festen Boden unter den Füßen weiß.“ Jetzt lächelte er wieder. Aufmunternd tätschelte er mir den Handrücken. „Oh, das verstehe ich selbstverständlich. Um ehrlich zu sein, ist auch mir zu Lande wohler. Aber die modernen Schiffe sind sicher gebaut und die Seekarten sehr genau. Es kann uns nichts passieren.“
Die modernen Schiffe. Es war als Aufmunterung gedacht gewesen, rief in mir aber den Gedanken an moderne Schiffe aus meiner Zeit wach, die mit Navigationsgeräten ausgerüstet waren und sich nicht auf Skizzen verlassen mussten. Hatte ich vorher meine Unverträglichkeit gegenüber Seereisen nur als Vorwand benutzt, mein seltsames Verhalten zu erklären, überkam mich nun doch leise Sorge. Um mir nichts anmerken zu lassen, wandte ich den Blick erneut den Wogen unter mir zu, auf denen kleine Schaumkronen tanzten.
„Wie ist eigentlich Euer Name, Mademoiselle? Verzeiht die Frage, aber ich gehöre erst seit kurzem zum Gefolge der Königin, und obgleich man mir Euren Namen sicherlich genannt hat, muss ich zu meiner Schande feststellen, dass er mir entfallen ist.“
„Oh, selbstverständlich. Mein Name ist Mary-“ Ich brach ab, entsann mich der Person, die hier alle in mir zu sehen schienen, und beendete meinen Satz mit „Mary Seton.“ Ich knickste ungelenk, wie ich es aus den Historienschinken aus dem Fernsehen kannte. Der Mann deutete nun seinerseits eine Verbeugung an. „Es freut mich sehr!“ Er machte jedoch keine Anstalten mir seinen Namen zu nennen, und als ich ihn danach fragen wollte, fuhr er bereits fort. „Verzeiht mir, Mademoiselle Seton, aber ich sollte in meine Kabine zurückkehren. Ich habe noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen, ehe die Sonne aufgeht.“ Er stieß sich von der Reling ab, ging ein paar Schritte, ehe er stehen blieb, um sich noch einmal umzudrehen. „David steht Euch stets zu Diensten!“
Dann setzte er seinen Weg fort, und ich blieb alleine zurück. David. Ich durchforstete mein Gehirn auf der Suche nach jemandem, der zu diesem Namen gehörte. Zuerst fiel mir mein Freund aus Kindertagen ein. In der Grundschule hatten wir uns regelmäßig getroffen. Mal spielten wir Fußball, was seine größte Freude war, ein anderes Mal musste er mit mir und meinen Barbiepuppen einen Friseursalon eröffnen. Meine Mundwinkel hoben sich bei der Erinnerung an unbeschwerte Zeiten, die nun einem anderen Leben anzugehören schienen. Dann verdrängte ich den Gedanken an ihn und dachte an Moms Vorträge während unserer sechswöchigen Schottlandrundreise. David. David. Da war etwas. Und dann fiel mir wieder ein, wie Mary Livingston ihn im Hafen genannt hatte. Monsieur Riccio. David Riccio.
Und dann machte es klick. David Riccio stieß kurz vor ihrer Abfahrt aus Frankreich zum Gefolge der Königin. Ein begabter italienischer Musiker, der später zum Sekretär Mary Stuarts wurde. Er war zwar weder von Adel, noch von nennenswertem Reichtum, doch sein schlauer Rat wurde von der Königin sehr geschätzt.
Froh, vielleicht einen Freund gefunden zu haben, reckte ich meine Nase in den Wind. Ich verharrte dort, bis das erste Rot am Himmel zu erahnen war. Dann machte ich mich auf den Weg zurück zu meinem Lager. Ich legte mich hin, schloss zufrieden die Augen; als ich langsam einzudämmern begann, hörte ich die Stimme meiner Mutter im Ohr, die aus irgendeinem Schlossführer vorlas: „David Riccio, Sekretär Mary Stuarts, wurde an dieser Stelle vor den Augen Ihrer Majestät und deren Damen brutal ermordet.“
Ich konnte nicht lange geschlafen haben, denn als ich erneut meinen Kopf aus der Luke steckte, war die Sonne noch nicht vollends aufgegangen. Dennoch hörte ich einige Stimmen von der anderen Seite des Schiffes, ebenso ein Schluchzen. Ich kletterte hinaus ins Freie und sah mich um. Die aufgehende Sonne bahnte sich ihren Weg den Horizont hinauf, dort, wo ich vor einigen Stunden noch mit David gestanden hatte. Über mir zogen Möwen kreischend ihre Runden, umflogen die Masten, an denen zwei Fahnen flatterten; eine zeigte die Flagge Frankreichs, die andere trug den schottischen Saltire. Vor mir erstreckte sich nichts als die tiefblauen Fluten der Nordsee, und einen Moment verharrte ich reglos. Dann trat ich auf die Stufen zu, die zum oberen Deck führten, von wo die Stimmen kamen. Am Heck des Schiffes hatte sich eine Anzahl Leute versammelt. Ich machte die drei Frauen aus, die gestern mit mir von dem Gasthaus aus zum Schiff gegangen waren – die drei Marys –, ebenso wie einen rothaarigen Mann in den Zwanzigern und einen Dunkelhaarigen, der mir den Rücken zugewandt hatte. Dann vernahm ich die warme Stimme Riccios, die beruhigende Worte murmelte. Die Marys verwehrten mir allerdings den Blick auf ihn. Auch die Frau, deren Schluchzen deutlich hörbar war, konnte ich nicht erkennen. Als Mary Fleming mich entdeckte, hellte sich ihr tristes Gesicht für einen kurzen Moment auf, ehe wieder ein Schatten darauf fiel.
„Mary. Es geht dir besser“, stellte sie fest. Nun wandten auch die anderen ihre Köpfe zu mir um und ich nickte reflexartig zur Bestätigung. Ich stellte mich zwischen den Rothaarigen und Mary Fleming. Mary Stuart, Königin der Schotten, klammerte sich an die Reling. Tränen rannen ihr über das Gesicht, welches sie nun wieder dem Horizont zuwandte. Wir waren weniger weit gekommen, als ich zunächst gedacht hatte; in der Ferne konnte man noch immer die Küste Frankreichs ausmachen, die sich dunkel von dem Blau über und unter uns abhob.
David hatte seiner Königin tröstend eine Hand auf den Rücken gelegt. Mary Beaton beugte sich zu mir vor. „Sie hat die vergangene Nacht hier oben an Deck verbracht. Man hat ihr ein notdürftiges Bett bereitet, aber sie wollte den letzten Anblick Frankreichs um nichts in der Welt verpassen.“ Da erst sah ich die Decken, die zu unseren Füßen lagen. Ich senkte den Blick, unsicher, was ich erwidern sollte. Ich verstand nur allzu gut, was sie gerade mitmachte. Auch mir war zum Weinen zumute. Ich war aus meinem unbeschwerten, zumal etwas langweiligen, aber friedlich verlaufenden Teenager-Leben gerissen worden. Meine Eltern machten sich mit Sicherheit große Sorgen, wenn sie mein Verschwinden entdeckten – was sie mittlerweile zweifelsohne getan haben mussten – und ich befand mich in einem vergangenen Jahrhundert, das vor Gefahren nur so wimmelte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich zurückkommen sollte, zumal ich mit jeder Minute mehr Wasser zwischen mich und das Wirtshaus brachte, wo alles begonnen hatte. Wie gerne hätte ich mich neben die Königin gestellt und mit ihr gemeinsam den Verlust der geliebten Heimat beweint. Doch ich riss mich zusammen, schluckte die Tränen hinunter und verknotete meine Hände, um das Zittern zu verbergen.
„Monsieur Hepburn!“ Ein schmächtiger Junge in abgetragenen Kleidern war hinter den Mann zu meiner Rechten getreten. „Monsieur, der Kapitän wünscht Euch zu sprechen.“ Der Angesprochene brummte etwas, dann folgte er dem Jungen.
Das Schluchzen der jungen Königin hatte sich nunmehr in einen haltlosen Ausbruch von Tränen verwandelt. Die letzten Umrisse der französischen Küstenlinie verblassten zu Schatten, und während Mary Stuart unaufhaltsam die Worte „Adieu Frankreich, Adieu geliebtes Frank-reich“ murmelte, wurde sie schließlich vom Horizont verschluckt.
„Adieu Frankreich. Ich werde dich wohl nie wiedersehen.“ Eine Welle des Mitleids erfasste mich, wusste ich doch sehr genau, dass sie Frankreich in der Tat nie wiedersehen würde. Wie gerne hätte ich ihr das Gegenteil versichert. Dennoch hoffte ich inständig, dass wenigstens ich bald die Möglichkeit bekommen würde, zurückzukehren.
Wir standen eine gefühlte Ewigkeit dort. Die Marys und David versuchten die Königin zu beruhigen, indem sie sanft auf sie einredeten und ihr behutsam über den Rücken strichen. Ich wusste nicht recht, was ich anderes tun sollte, also tat ich es ihnen gleich. Auch der dunkelhaarige, hagere Mann, der mir zunächst den Rücken zugedreht hatte, versuchte die Königin mit einigen Versen aufzuheitern, jedoch ohne Erfolg. Sein Name war Pierre de Bourdeille, Singneur de Brantôme, und ich erfuhr, dass er ein bekannter französischer Dichter war.
Ein Page führte uns unter Deck, wo wir ein üppiges Mahl auf goldenen Tellern für uns vorfanden. Der Kelch vor mir war gefüllt mit gutem rotem Wein. Der Duft nach Braten stieg mir in die Nase, und ich machte mich freudig über das Essen her. Es war mehr als vierundzwanzig Stunden her, dass ich zuletzt etwas zu mir genommen hatte, und mein Magen war dankbar dafür, endlich etwas zu tun zu haben. Anschließend zog Mary Stuart sich in ihre Kabine zurück, um einen Brief an ihren Onkel, den Kardinal von Lothringen in Frankreich, zu verfassen. Da auch die anderen Marys für sich sein wollten, schlenderte ich über das Deck in der Hoffnung, irgendwo David zu entdecken. Gedankenverloren setzte ich einen Fuß vor den anderen. Zu spät sah ich den Mann, der mit dem Rücken zu mir stand, und rannte geradewegs in ihn hinein. Erschrocken schrie ich auf, taumelte zurück und wäre gestürzt, hätte er mich nicht im letzten Moment aufgefangen. Er schlang mir einen Arm um die Taille und einen Moment hing ich ganz in seinem Griff, schaute in sein überraschtes Gesicht, ehe er mich auf die Füße stellte.
„Geht es Euch gut, Mylady?“
Ich nickte. „Ja, ich denke schon. Vielen Dank!“
Mein Blick war in den seinen vertieft. Seine Augen waren von einem unergründlichen Blau, wie der Ozean um uns herum. Sein langes, pechschwarzes Haar wurde ihm vom Wind ins Gesicht geweht und umspielte seine kantigen Züge. Ein ebenso dunkler Dreitagebart umrahmte die fein geschwungenen Lippen und an seiner Seite hing ein Schwert. Er mochte vielleicht fünf Jahre älter sein als ich.
„Wer seid Ihr?“, wagte ich zu fragen und kam mir gleichzeitig unglaublich dumm dabei vor. Dann zuckte ich zusammen. Was, wenn es jemand war, der Mary Seton nah stand, oder den sie zumindest kennen musste? Ich machte mich darauf gefasst, zu einer Erklärung anzuheben, dass mir die Schiffsreise nicht bekomme, doch der junge Mann neigte demutsvoll den Oberkörper, wie es sich einer edlen Dame gegenüber geziemte.
„Cailean Graham, Ritter im Dienste James Hepburns, des Earl of Bothwell – zu Euren Diensten!“ Seine Stimme war rau, aber warm und freundlich und mit einem melodischen schottischen Akzent. Als mir bewusst wurde, dass ich ihn anstarrte, raffte ich schnell meine Röcke und knickste artig, wenngleich ein wenig ungelenk. „Mary Seton.“
Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. „Ihr seid Hofdame Ihrer Majestät, habe ich Recht? Ich sah Euch heute Morgen bei ihr.“
„Das stimmt.“ Ich überlegte einen Moment, dann fügte ich hinzu: „Sie vermisst Frankreich schon jetzt sehr.“
Er nickte verständnisvoll. „Aye, das kann ich mir vorstellen. Sie –“
Er wurde von jähem Geschrei unterbrochen, das plötzlich auf dem Hauptdeck ertönte. „Halt still, hab ich gesagt!“, donnerte eine wütende Männerstimme. Caileans Hand fuhr an den Knauf seines Schwertes. „Entschuldigt, Mylady.“ Mit diesen Worten stürmte er zur Treppe, die zum Ausgangspunkt des Lärms führte, und verschwand aus meinem Blickfeld. Einen Moment stand ich wie versteinert da. Als ein spitzer Schrei die Luft zerriss, erwachte ich aus meiner Starre. Ich raffte die Röcke und rannte die Stufen hinauf, hinter Cailean her. Erneut hörte ich einen Schrei, der sich mit wüsten Drohungen mischte. „Du kleine Ratte, du! Jetzt zeig ich es dir!“
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um einen Blick über die Männer werfen zu können, die mir die Sicht versperrten. Ich entdeckte den Rothaarigen, den ich heute Morgen bei der Königin gesehen hatte. Er stand über einen schmächtigen Jungen gebeugt, der die knochigen Hände schützend erhoben hatte. Halb kniete er, halb saß er in der Hocke und starrte aus angsterfüllten Augen zu dem grimmigen Mann auf. „Bitte, Monsieur, ich werde es bestimmt nicht wieder tun!“, stammelte er, doch der andere unterbrach ihn barsch. „Nein, das wirst du ganz sicher nicht. Wenn ich mit dir fertig bin, dann wirst du deine kleine diebische Hand nicht einmal mehr heben können!“ Er wandte sich an einen Mann zu seiner Rechten. „Holt mir eine Peitsche und bindet ihn an den Mast!“ Der Junge schrie und flehte, doch er war bereits von zwei Männern gepackt worden, die ihn in Richtung des Hauptmastes schleiften.
„Nein!“, entfuhr es mir, doch meine Stimme ging im Lärm der Menge unter. „Nein!“ Hektisch blickte ich mich um. Jemand musste doch helfen. Was auch immer der Junge gestohlen haben mochte, es konnte eine derartige Bestrafung unmöglich rechtfertigen. Ich stürmte den Männern hinterher, quetschte mich durch die Meute Schaulustiger, die sich versammelt hatte; offensichtlich war eine Auspeitschung eine willkommene Abwechslung für Matrosen und Krieger. Ich spähte immer wieder zwischen ihnen hindurch, sah, wie dem Unglücklichen das schmutzige Hemd vom Leib gerissen wurde und grobe Hände die schmächtigen Arme in die Luft zerrten.
Wieder hörte ich mich rufen. „Nein, das könnt ihr nicht tun!“
Da legte sich mir plötzlich eine warme Hand auf die Schulter. Als ich mich umdrehte begegnete mein Blick dem von Cailean. „Bitte! Tut etwas!“ Ich wusste nicht, warum ich so flehentlich klang, da mir eine innere Stimme sagte, dass er wahrscheinlich ebenso wenig ausrichten konnte wie ich selbst. Er nickte jedoch, wandte sich ab und schritt eilig davon. Ich konnte nicht darüber nachdenken, was er vorhatte; womöglich hielt er mich auch einfach für komplett verrückt und wollte nicht mit mir gesehen werden, für den Fall, dass ich selbst einmal wegen irgendeiner Dummheit am Mast enden sollte.
Das Gegröle war verstummt. Das Flehen des Gebundenen hatte aufgehört, nur noch ein leises Wimmern war zu vernehmen. Der rothaarige Mann, der noch immer grimmig dreinblickte, hatte sich neben dem Mast positioniert, dahinter bildeten die Zuschauer einen Halbkreis. Ein hutzeliger Kauz reichte ihm einen Stab, an dessen oberem Ende schmale Lederriemen angeknotet waren. „Mylord Bothwell!“ Als sein Herr die Peitsche entgegennahm, verneigte er sich und trat dann eilig zurück. Bothwell strich mit einer Hand über die Peitsche, beobachtete versonnen, wie das Leder über seine Finger glitt, ehe er sich seinem Opfer zuwandte. Langsam erhob er die Peitsche. Ich schloss die Augen, machte mich auf den Schmerzensschrei gefasst, auf das Klatschen von Leder auf nackte Haut.
„Genug!“, erklang eine müde, aber resolute Stimme. Die Menge wandte einheitlich den Kopf in Richtung der Frau, die gesprochen hatte. Eine vereinzelte Strähne ihres Haares fiel ihr in die Stirn und sie strich sie achtlos beiseite. „Monsieur Hepburn, was ist hier los?“
Der Angesprochene senkte demütig das Haupt, dann sagte er: „Majestät! Der hier“– Er deutete mit dem Kopf auf den angebundenen Jungen – „hat von dem Braten und dem Brot für Eure Majestät und Eure Damen gestohlen. In die Küche hat er sich geschlichen. Unter den Augen des Kochs hat seine diebische Hand sich an Eurer Majestät Speisen vergriffen.“
Die Königin schritt auf ihn zu; die Menge teilte sich vor ihr wie das Rote Meer vor Moses. Vor dem Mast blieb sie stehen.
„Sieh mich an, Junge!“ Trotz der Bestimmtheit, mit der sie es sagte, klang sie nicht, als sei sie erpicht darauf, einer Bestrafung beizuwohnen. Der Angesprochene versuchte seinen Kopf in eine Position zu bringen, in der er seiner Königin in die Augen sehen konnte.
„Ist es wahr?“ Er nickte. „Du hast gestohlen, obgleich du wusstest, was für eine Strafe dich erwarten würde. Hältst du meine Leute für blind und taub?“
Er schüttelte den Kopf. „Nein, Euer Majestät, natürlich nicht.“
„Und dennoch hast du es getan.“ Mary Stuarts Blick wanderte zurück zu Bothwell. „Was glaubt Ihr, weshalb er es wohl getan hat?“
Dem Schotten war sein Missfallen ob der Unterbrechung seiner Bestrafung ins Gesicht geschrieben. „Weil er ein Dieb ist, Eure Majestät. Er hält uns für einfältig und dumm.“
Ich hatte so gespannt das Geschehen verfolgt, dass ich nicht bemerkt hatte, wie jemand neben mich getreten war. Als sein Atem meinen Hals streifte, zuckte ich unwillkürlich zusammen. „Sie ist eine großherzige Königin und verurteilt Grausamkeit. Macht Euch also keine Sorgen mehr.“ Ich drehte mich nicht um, aus Angst, etwas von dem Geschehen zu verpassen. Stattdessen wisperte ich nur: „Danke, Cailean.“ Ich hatte nicht darüber nachgedacht, dass man in diesen Kreisen einen nahezu Fremden nicht mit dem Vornamen anredete, dass auch er mich mit Mylady ansprach. Aber er widersprach nicht und fragte auch nicht nach.
Mary Stuart musste den Kopf in den Nacken legen, um Bothwell in die Augen sehen zu können. „Das glaube ich nicht. Seht Euch den Jungen doch an. Er ist noch ein Kind und völlig abgemagert. Er hatte Hunger, das ist alles. Ihr kennt das Gefühl nicht, dass einem etwas fehlt, ohne das man nicht leben kann. Glaubt mir, ich würde mehr riskieren als eine Auspeitschung, wenn ich doch nur meinen geliebten François zurückbekommen könnte! Nein, an solch einem traurigen Tag des Abschieds wollen wir nicht Zeugen von Grausamkeit werden. Ich will nicht mitansehen, wie jemand leidet. Bindet ihn los!“
Sie beobachtete, wie sich ein Mann aus der Reihe löste und unter ihren wachsamen Blicken die Stricke löste. Kaum war der Junge frei, fiel er vor der Königin auf die Knie. „Ich danke Euch, Majestät! Ihr seid wahrhaftig voller Güte!“
Sie hielt ihm die zarte Hand hin, die er zitternd ergriff und einen Kuss darauf hauchte. „Vergiss es nicht. Und nun geh zurück an die Arbeit.“
Er erhob sich eilig und lief davon. Mary Stuart unterdessen richtete sich an die missmutige Menge. Obgleich niemand es wagte zu protestieren, sah man ihnen die Enttäuschung an. Ich hatte nie verstanden, wie sich Menschen am Leid anderer weiden konnten. Ich fragte mich stets, was in den Köpfen der Gaffer bei Verkehrsunfällen vorging, oder in denen der Zuschauer eines Stierkampfes.
„Geht zurück an die Arbeit!“, befahl die Königin. Die Versammlung löste sich auf. Der Earl of Bothwell sagte etwas zu ihr, was ich im nun einsetzenden Lärm jedoch nicht mehr verstand. Sie schüttelte lediglich den Kopf, wandte sich ab und ließ ihn stehen. Ich drehte mich um, um Cailean zu danken, doch er war verschwunden. Ich ließ die Augen über das Deck wandern, doch seinen dunklen Schopf konnte ich nirgends entdecken. Ein wenig enttäuscht machte ich kehrt und verzog mich in meine Kabine. Dort angekommen merkte ich, wie die Müdigkeit mich ob der Ereignisse des Tages einholte, und ich fiel in einen unruhigen Schlaf. Ich träumte von wüsten Männern, die jubelnd um einen an einen Pfahl gefesselten Jungen herumstanden. Als der Vollzieher der Strafe die blutige Peitsche hob und dem Unglücksseeligen den Rücken zerfetzte, mischte sich sein markerschütternder Schrei mit dem begeisterten Johlen des Publikums. Erst als ich die rauen Hände spürte, die nun mich an den Pfahl banden, erkannte ich, dass ich es gewesen war, die geschrien hatte, nicht der Gebundene. Ich versuchte meine Hände loszureißen, doch die Stricke hielten dem Druck meiner sich windenden Handgelenke stand. Unerbittlich hob der Mann die Peitsche und die Menge grölte vor Entzücken, als sie auf mich herniedersauste.
Schwer atmend erwachte ich. Augenblicklich fuhr meine Hand nach hinten, doch ich spürte nur den leichten Stoff des Kleides, in dem ich eingeschlafen war. Kein Blut, kein brennender Schmerz. Erleichtert ließ ich mich zurücksinken. Es war gerade noch einmal gut gegangen. Der Junge war dank Cailean einer Strafe entgangen. Ich war eine Lady der Königin – mehr noch, ich gehörte zu ihren vier Marys. Niemand würde es wagen, mir etwas anzutun. Meine Stellung bot mir Schutz. Würde es wirklich niemand wagen? Schrillte eine Stimme in meinem Kopf. Was, wenn mein Verhalten und meine emanzipierten Ansichten Misstrauen erregten? Zweifelsohne würden sie mir früher oder später Probleme einbringen. Ich musste mich verhalten, als gehörte ich ins sechzehnte Jahrhundert. Nicht einmal die Königin würde mir helfen können. Sie hatte ein gutes Herz, soweit ich ihr bisher begegnet war; was das betraf, hatten die Geschichtsbücher nicht gelogen. Aber wenn mein Betragen auch ihr verdächtig wurde? Denk daran, was später kommt, wenn Mary nicht mehr Königin, sondern Gefangene ist!, meldete sich eine weitere Stimme. Ich wusste, dass sie nur wenige Jahre in Schottland regierte. Dann geriet sie in englische Gefangenschaft. Der Protestantenführer John Knox sowie ihr Halbbruder und Vertrauter James, Earl of Moray, intrigierten gegen Mary Stuart, und schließlich nahm Königin Elizabeth von England, Marys Cousine, sie in Gewahrsam. Wenn sie in Gefangenschaft geraten wird, verbesserte ich mich. Knox und Moray intrigieren jetzt, in diesem Moment. Und ich bin hier. Mitten drin in dem Netz aus Intrigen, Verrat und Gewalt.
Ich musste so schnell wie möglich zurück nach Hause – zurück in meine Zeit. Aber wie würde ich es schaffen, dorthin zu gelangen? Würde ich einfach erneut den Stein berühren müssen, dessen rotes Licht das letzte war, an das ich mich erinnerte, bevor ich in Tudorkleidung wieder zu mir kam? Konnte ich überhaupt zurück, oder war es ein einmaliger Zeitsprung, der nicht rückgängig zu machen war? Was war mit diesem Mädchen, das mein Gesicht hatte, das nach mir gerufen hatte, und dessen Namen auch ich mich erinnerte gerufen zu haben? Wer war sie? Was hatte sie mit mir zu tun?
Und über allem stand die Frage: Wie kam ich schnellstmöglich zurück nach Frankreich?
Mein Kopf schwirrte ob der tausend Fragen, deren Antworten nur der Himmel kannte. Ich erhob mich vom Lager und stieg die schmale Leiter hinauf. War ich im matten Licht des Nachmittags hinunter gestiegen, so begrüßte mich nun eine zaghafte, aber doch klar erkennbar durch die Wolken brechende Mittagssonne. Ich blinzelte, bis sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnten. Wie lange hatte ich geschlafen?
„Mary!“ Freudestrahlend kamen Mary Beaton und Mary Fleming auf mich zugeeilt. „Wir dachten schon, du wachst nie wieder auf!“, meinte Beaton. „Bist du etwa wieder seekrank geworden? Ist es sehr schlimm?“, unterbrach Fleming.
„Mir geht es soweit gut, ich bin nur erschöpft“, erklärte ich.
Sie nickten eifrig. „Monsieur Graham hat uns erzählt, was geschehen ist. Ich weiß, dass du nie etwas für blutige Bestrafungen übrig hattest. Dennoch, ich dachte, du hättest dich allmählich daran gewöhnt und von deiner Scheu verloren“, sinnierte Fleming.
„Nun, es ist so ...“, begann ich. Es war schon mal hilfreich zu wissen, dass die echte Mary Seton offenbar auch nicht viel für Auspeitschungen und derlei übrig hatte. Hätte sie ihre helle Freude am Stöhnen und Ächzen der Gefangenen gehabt, so wäre mein Verhalten schwerer zu erklären gewesen. „Es ist so, dass mir die Seereise schon sehr zusetzt. Womöglich konnte ich einfach nicht ertragen, mitansehen zu müssen, wie jemand anders leidet.“ Wieder nickten beide verständnisvoll. „Weshalb seid ihr eigentlich so fröhlich?“, wechselte ich das Thema.
„Wir haben gerade mit dem Kapitän gesprochen. Er meinte, wir haben guten Wind und können mit etwas Glück schon in zwei Tagen in Schottland sein!“, rief Beaton freudestrahlend aus.
„Keine engen Kabinen, kein schwankender Untergrund und wieder etwas Richtiges zu essen!“, schwärmte Fleming.
Schottland. Nach Hause. So weit entfernt von dem Gobelin, dem roten Stein. So weit entfernt von meiner Familie.
„Aber du freust dich ja gar nicht!“ Fleming stieß mich an. Ich zwang mich zu einem Lächeln. „Doch, sicher freue ich mich!“ Beaton ergriff meine Hand, und ehe ich mich versah stolperte ich hinter ihnen her. Sie führten mich auf das Oberdeck, vorbei an dem Mast, an den gestern der Junge gekettet gewesen war, zu einer langen Holztafel, die zwar sparsam, aber dafür mit allerlei Köstlichkeiten gedeckt war. Am Kopfende saß Mary Stuart, neben ihr Mary Livingston. Obgleich noch immer ein trauriger Zug auf dem Gesicht der Königin lag, war es doch das erste Mal, dass ihre Mundwinkel nach oben gezogen waren und ihre Augen ehrlich zu lächeln schienen. Auch David Riccio und Segnieur de Brantôme waren zugegen. Ich nahm rechts von der Königin Platz. Mary Fleming schob sich neben mich auf die überraschend bequem gepolsterte Bank. Erst als sie mir eine Menge köstlich duftender Speisen auf den Teller lud, merkte ich, wie hungrig ich war. Ich griff nach dem Besteck und ließ mir ein Stück eines Fisches, den ich nicht näher benennen konnte, auf der Zunge zergehen. Brantôme unterhielt uns mit Versen und Livingston mit zahlreichen Geschichten über die französischen Edelmänner, die sie in Schottland zweifelsohne vermissen würde; dort gäbe es nur raue Kerle, die keine Manieren aufweisen konnten. Mit einem Mal kam mir ein neuer Gedanke. Was, wenn Mary Seton verheiratet war und ein Mann mich am Hafen erwarten würde, der anschließend mit mir nach Hause wollte, womöglich ins Bett. Ich hatte nie einen Freund gehabt, und alleine die Vorstellung, mit einem fremden Mann ... Ich verbannte die Überlegung aus meinem Kopf. Darüber konnte ich mir noch früh genug den Kopf zerbrechen, wenn es denn wirklich so war.
Wir beendeten das Mahl, und die anderen Marys nahmen mich mit zu einer Gruppe Stühle, die an der Reling aufgestellt waren. Mir wurden Nadel und Faden gereicht, sowie ein weißes Tuch. Einen Moment lang musterte ich das mir Dargebotene verwirrt. Dann sah ich, wie die anderen alle eine bereits angefangene Stickarbeit zur Hand nahmen. Im Sticken war ich nie gut gewesen. Meine Mutter hatte einmal versucht, es mir beizubringen, aber über meine ungelenken Stiche bloß den Kopf geschüttelt. Schließlich hatte sie es aufgegeben. Ich suchte verzweifelt nach einer Ausrede, weshalb ich nicht sticken konnte, doch kein plausibler Grund wollte mir einfallen. Ich seufzte. Ich musste mich wohl oder übel zusammennehmen und es versuchen. Auf der Suche nach Inspirationen ließ ich den Blick umherwandern, bis er schließlich an zwei Möwen hängen blieb, die um den Ausguck kreisten. Dieses Motiv erschien mir als nicht allzu schwierig, und so stach ich die Nadel durch das makellos weiße Leinen. Ich schwieg, lauschte weiteren Geschichten von Mary Livingston, außerdem Flemings und Beatons Schwärmereien von Schottland. Nur die Königin blieb so still wie ich.
Am späten Nachmittag wanderte ich gedankenverloren über das Deck. Die anderen Marys waren gemeinsam mit der Königin in ihre Kabinen gegangen, ich jedoch hatte mich damit entschuldigt, dass die frische Luft gut gegen die Übelkeit wäre. In Wahrheit konnte ich es einfach nicht ertragen, eingeengt mit meinen Fragen und Sorgen in einem stickigen Raum zu hocken.
Ich beobachtete, wie sich die Segel im Wind blähten. Die Sonne war verschwunden, stattdessen waren wir von einem endlosen Grau umgeben. Links und rechts erkannte ich die Schiffe, die uns als Eskorte dienten. Ich blieb stehen. Es nütze nichts, mich auf diese Weise abzulenken. Meine Gedanken schweiften immer wieder zurück zu der Frage: Wie komme ich nach Hause? Und vor allem: Warum bin ich hier?
Ich konnte einfach keine plausible Antwort auf diese Fragen finden. Nichts ergab einen Sinn.
„Herr im Himmel!“, stöhnte ich und klatschte meine Hände auf die Reling. „Geht es Ihnen nicht gut, Mademoiselle?“, vernahm ich eine leise Stimme neben mir. Ich fuhr herum. Vor mir stand der Junge, den Cailean gestern vor der Auspeitschung bewahrt hatte. Jetzt, wo er vor mir stand, erkannte ich, dass er größer war, als ich zunächst vermutet hatte. Er überragte mich um gut einen Kopf und die schwere körperliche Arbeit war ihm trotz seiner mageren Gestalt deutlich anzusehen.
„Nein, mir geht es gut“, winkte ich ab. Und als ich seinem skeptischen Blick begegnete, bekräftigte ich: „Wirklich!“
Er schien nicht sonderlich überzeugt, wurde sich dann aber wohl der Höflichkeitsformen und dem Unterschied zwischen seinem und meinem Stand bewusst, denn er senkte den Kopf. „Verzeiht, Mademoiselle. Ich wollte nicht aufdringlich sein.“
„Aber nein, ich habe es nicht als aufdringlich empfunden. Im Gegenteil. Ich danke dir, dass du dich um mein Wohl sorgst.“
Sein Kopf ruckte nach oben. „Tatsächlich?“ Ich nickte. Mir entgingen die roten Flecken an seinem Hals ebenso wenig wie die gezackte Narbe, die sich über seine Hand zog und unter dem Ärmel seines Hemdes verschwand. Ich wusste nicht, welche Position er genau inne hatte, aber dass er schon des Öfteren Misshandlungen ausgesetzt gewesen war, lag auf der Hand. Jetzt jedoch strahlten seine Augen. „Seid Ihr nicht Mademoiselle Seton?“
Wieder nickte ich. „Die bin ich. Und du bist ...?“
Er verneigte sich. „Louis Dubois, zu Euren Diensten.“ Als er sich wieder aufgerichtet hatte fuhr er fort: „Mademoiselle, Monsieur Graham hat mir berichtet, dass ich es Euch zu verdanken habe, gestern meiner ... äh ... Strafe entgangen zu sein. Ich möchte Euch meinen untertänigsten Dank aussprechen. Sollte ich Euch jemals einen Dienst erweisen können, so lasst es mich bitte wissen.“
Ich schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Zwischen meinen Problemen, meinen Fragen und Sorgen und dass ich beinahe Zeugin einer blutigen Bestrafung geworden war, hatte ich Lichtblicke gehabt. David Riccio und Cailean, die vielleicht so etwas wie Freunde werden könnten. Mary Fleming, Mary Livingston und Mary Beaton – obgleich ich auch noch nicht so viel über sie wusste, als dass ich sie meine Freundinnen nannte (was ich mir in der Rolle der Mary Seton natürlich nicht anmerken lassen durfte) – waren mir bisher stets herzlich begegnet. Die Königin selbst hing zumeist ihren Gedanken nach, trauerte um den Verlust des Gatten, der Mutter und des Landes, das ihr so viel mehr Heimat war als Schottland. Dennoch war ich mir sicher, auch in ihr einen aufrichtigen, freundlichen Menschen gefunden zu haben. Und nun stand dieser Junge vor mir, der mit leuchtenden Augen zu mir aufsah – das heißt, genau genommen blickte er auf mich herab, aber seinem Gesicht nach hätte ich auch ein Riese sein können – und bot mir seine Dienste an. Er konnte kaum älter sein als ich, eher jünger, und schien bereits erwachsener als die gleichaltrigen Jungen in meiner Zeit. Womöglich lag es an dem rauen Leben, das er führte, vielleicht wurde man in einer Zeit voll Krieg und Seuchen auch gezwungenermaßen schneller erwachsen.
„Hab vielen Dank. Gewiss wirst du mir eines Tages helfen können, Louis.“ Er strahlte über das ganze Gesicht.
„Louis!“, erklang da eine Stimme im Befehlston und dann tauchte der Earl of Bothwell hinter uns auf. „Louis, höre sofort auf, Mademoiselle Seton zu belästigen! Zurück an die Arbeit, du fauler –“
Ich fiel ihm ins Wort: „Mylord Hepburn. Verzeiht, wenn ich Louis von der Arbeit abgehalten habe. Mir war unwohl, und da bat ich ihn, mich einen Moment zu stützen.“ Ich hoffte nur, dass er uns nicht schon länger beobachtet und somit nicht gesehen hatte, dass ich sehr wohl alleine aufrecht stehen konnte. Um meine Aussage zu untermalen, stützte ich mich an der Reling ab. Offenbar war mein Auftritt überzeugend genug, denn Bothwell räumte sogleich ein: „Oh, aber selbstverständlich, Mylady. Ich wollte Euch auf keinen Fall zu nahetreten. Soll ich vielleicht nach Euren Freundinnen schicken...“ Ich winkte ab. „Schon gut, Monsieur. Es geht schon wieder. Wenn Ihr Louis noch einen kurzen Moment entbehren könntet, damit er mich auf das untere Deck geleiten kann, wäre ich Euch sehr dankbar.“
Für einen Augenblick hatte es den Anschein, als wolle er protestieren, und ich fürchtete schon, er würde mich selbst begleiten. Der Earl of Bothwell war die Person, die ich bisher am unsympathischsten fand. Er hatte Louis auspeitschen wollen, und wann immer ich ihn bei den Matrosen oder Bediensteten sah, zeigte er deutlich, welche Macht er besaß. Ich meinte mich erinnern zu können, dass er noch eine wichtige Rolle im Leben der Mary Stuart spielen würde, leider wollte mir nicht mehr einfallen, was es genau gewesen war.
Wider meine Befürchtung nickte er nun jedoch. „Selbstverständlich.“ Und an Louis gewandt: „Achte auf die Mademoiselle! Und wenn sie dich nicht mehr braucht, gehst du gefälligst zurück an die Arbeit! Der Boden wischt sich nicht von allein!“ Der Junge nickte, und nach einer angedeuteten Verbeugung in meine Richtung und einem „Mylady“ schritt Bothwell schweren Schrittes davon. Als er außer Sicht war, schaute ich zu Louis zurück, der mich ungläubig anstarrte. „Was ist los?“, wollte ich wissen.
„Ich ... Wieso ... Weshalb habt Ihr das getan?“, brachte er heraus. Ich griff nach seiner Hand. Aus irgendeinem Grund wollte ich dem Jungen helfen, ihn beschützen und ihm zeigen, dass es jemanden gab, dem sein Wohl am Herzen lag.
„Weil ich nicht wollte, dass du Ärger bekommst. Wenn ich mich recht erinnere, war er es, der gestern...“ Ich brach ab und schaute ihm in die Augen. „Weißt du, Louis, wenn es eines gibt, das ich nicht ertragen kann, so ist es Ungerechtigkeit.“ Eine Weile schauten wir uns bloß an. Ich spürte, wie seine Hand zitterte, und drückte sie ermutigend. „Wenn noch einmal etwas sein sollte, dann kannst du jederzeit zu mir kommen.“ Ich wusste nicht, ob dieser Satz angemessen war, weder für diese Zeit, noch für denjenigen, an der er sich richtete – das letzte Mal, dass ich so etwas zu jemandem gesagt hatte, hatte ich mit meiner kleinen Cousine gesprochen, die sich Sorgen um ihren ersten Tag in der Schule gemacht hatte – doch es war mir egal. Louis antwortete nicht sofort. Auf seinem Gesicht hatte sich eine nachdenkliche Falte gebildet. Schließlich wiederholte er schlicht: „Ich danke Euch!“ Ich lächelte ihn noch einmal bekräftigend an, dann meinte ich: „Vielleicht solltest du zurück an die Arbeit gehen.“
„Selbstverständlich, Mademoiselle. Habt vielen Dank!“ Und mit diesen Worten ging er davon.
Da ich fürchtete, Bothwell könnte heimlich kontrollieren, ob ich auch wirklich am Unterdeck angekommen war, stieg ich die hölzerne Treppe hinunter. Unten angekommen, konnte ich jedoch niemanden entdecken. Erleichtert atmete ich aus und wusste auf einmal mehr nicht genau, was ich tun sollte. Also genoss ich die kühle Seeluft und ging erst in meine Kabine, als sich der am Abend einsetzende Nieselregen in einen stärkeren Guss verwandelte.
Auch am nächsten Morgen wollte der Himmel seine Schleusen noch nicht schließen. Es regnete unablässig, mal stärker, mal nur leicht. Die zwei Schiffe starke Eskorte, die nicht von unser Seite wich, war in dem Nebel, der sich über alles gelegt hatte, nur noch zu erahnen. Niemand redete mehr als nötig, die Matrosen gingen grimmig ihrer Arbeit nach und die anderen Marys saßen in ihren Kabinen und nähten, stickten oder schrieben Briefe.
Erst als sich der Nebel gegen Mittag ein wenig lichtete und man die englische Küste zu unserer Rechten erahnen konnte, kam wieder Leben in die Passagiere. Bald hatten wir unser Ziel erreicht. Doch das Hochgefühl wehrte nicht lange.
„Schiff in Sicht!“, brüllte der Mann im Ausguck herunter. Alle, die sich an Deck befanden, stürmten augenblicklich in Richtung Bug. Ich hielt mir eine Hand über die Augen und spähte in das tiefe Grau. Zuerst sah ich nichts als eine Nebelwand, doch bei genauerem Hinsehen erkannte ich klar die Konturen eines Schiffes.
Einen kurzen Moment lang war alles still; nicht einmal ein Atemzug war zu hören. Dann brach das Chaos aus. Alle rannten wild hin und her, schrien sich Befehle auf Englisch und Französisch zu. Das Schiff war nähergekommen. Oben am Mast wehte eine Fahne – die Fahne Englands.
Ich stand da, wusste nicht, was ich tun sollte. Ich kramte in meinem Gehirn nach Informationen. War die königliche Flotte mit den Schiffen der Maria Stuart zusammengetroffen? Zweifelsohne war sie das, beantwortete ich mir meine Frage im nächsten Augenblick. Aber was noch nicht klar war – war bei dem Zusammentreffen etwas vorgefallen? Der Königin selbst konnte nichts geschehen sein, kam sie doch unbeschadet in Schottland an. Aber was war mit den anderen?
Plötzlich wurde ich unsanft angerempelt. Ich taumelte, versuchte das Gleichgewicht zu halten, schaffte es jedoch nicht und prompt landete ich auf dem Hinterteil. Ich keuchte und stützte mich am Boden ab, da streckte sich mir eine große Hand entgegen. Ich blickte an ihr hoch, folgte einem Hemdsärmel hinauf, bis ich schließlich in zwei tiefblaue Augen blickte.
„Mylady. Kann ich Euch behilflich sein?“ Dankbar lächelnd ergriff ich Caileans Hand. Er zog mich mühelos auf die Füße. Prüfend musterte er mich. „Geht es Euch gut? Oder wurdet Ihr verletzt?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, mir fehlt nichts. Habt vielen Dank!“ Er nickte. Ich überlegte kurz, dann fragte ich: „Was für Schiffe sind es? Kriegsschiffe?“ Cailean runzelte nachdenklich die Stirn. „Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass die Königin ein Gesuch an Elizabeth von England geschickt hat, in dem sie um sicheres Geleit bittet. Es kam aber keine Antwort aus England. Die Königin hat sich noch mit einem gewissen Throckmorton getroffen, aber ich weiß nicht, zu welchen Ergebnissen man bei den Gesprächen kam.“
Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz. Ich erinnerte mich an eine Geschichtsstunde in der achten Klasse.
„Aber Königin Elizabeth hat geantwortet und ihr sicheres Geleit gewährt. Die Nachricht traf nur zu spät in Frankreich ein!“, rief ich aus. Cailean starrte mich aus großen Augen an. Am liebsten hätte ich die Worte zurückgenommen. Ich hätte mich ohrfeigen können. Hektisch sah ich mich um, aber außer Cailean schien mich keiner gehört oder zumindest nicht verstanden zu haben.
„Woher ... wisst Ihr das?“, brachte Cailean schließlich stammelnd hervor. Ich wich seinem Blick aus und starrte stattdessen zu Boden. „Weil ich, ähm ...“ Verdammt. Was sollte ich nun sagen? „Also, es ist so, dass ich ... Ich weiß es, weil ...“ Ich schielte zu ihm hinauf. Verständnislos blickte er auf mich herab. Die Verwirrung stand ihm ins Gesicht geschrieben.
„Ich kann es nicht sagen“, flüsterte ich schließlich. Rasch fügte ich hinzu: „Es tut mir leid, Cailean. Ehrlich.“ Ich wappnete mich gegen unangenehme Fragen, auf die ich keine Antwort geben konnte, weil man es mir nicht glauben, mich für eine Hexe halten würde, oder einfach, weil ich die Antwort selbst nicht kannte. Doch Cailean fragte nichts dergleichen. Er ging auch nicht geradewegs zu Bothwell oder dem Kapitän, um ihnen zu berichten, dass ich etwas wusste, was ich gar nicht wissen durfte. Wahrscheinlich hielt er mich für eine Lügnerin oder Spionin, wobei mir nicht klar war, was ich schlimmer fände.
Unruhig trat ich von einem Fuß auf den anderen, biss mir auf die Unterlippe und starrte auf meine ineinander verschränkten Hände, deren Knöchel zum Zusammenpressen weiß hervortraten. Letztlich konnte ich das Schweigen nicht mehr ertragen. „Herr Gott, du musst mich für eine furchtbare Lügnerin halten! Oder Schlimmeres!“, entfuhr es mir.
Völlig unerwartet griff er nach meinen Händen, löste sie und hielt sie fest. „Schaut mich an“, bat er ruhig. Und ich tat es. Noch immer war sein Gesicht ein einziges Fragezeichen. Seine Stimme zitterte jedoch nicht im Geringsten, als er weitersprach. „Ich halte Euch nicht für eine Lügnerin ... Mary.“ Es war das erste Mal, dass er mich mit dem Vornamen ansprach. Mein Name klang fremd aus seinem Mund, melodischer und – einfach wunderschön. Ich riss mich zusammen. Nein, ich musste mich jetzt auf das konzentrieren, was er als nächstes sagte. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. „Was würde es Euch bringen, mich anzulügen? Ich würde es ohnehin schnell erfahren.“ Er deutete hinter mich, und als ich mich umsah, erkannte ich, dass das englische Schiff nahezu auf einer Höhe mit uns war. Einige Meter von uns entfernt stand der Kapitän mit einer weißen Fahne in der Hand und winkte hinüber.
Cailean fuhr fort: „Ich glaube auch nicht, dass Ihr für irgendjemanden spioniert oder intrigiert. Ich kenne Euch nicht sonderlich lange, aber wie Ihr Euch für Louis eingesetzt habt, hat mir gezeigt, welch gütiges Herz Ihr habt. Nein, das passt nicht zu Euch.“ Erneut hielt er kurz inne; er schien sich seine Worte genau zu überlegen. „Ich habe keine Ahnung, woher Ihr es wisst, Mylady Mary, aber ich glaube Euch. Wenngleich ich auch nicht verstehe, weshalb Ihr es mir nicht sagen wollt – oder könnt. Aber seid versichert, dass ich nicht schlechter von Euch denke.“ Zum Zeichen, dass er es ernst meinte, ließ er meine Hände los und legte sich die Rechte auf die Brust. Eine Geste, die ich bislang nur aus historischen Filmen kannte. Filme über die Zeit, in der ich jetzt bin. Alles, was für mich Vergangenheit war, ist nun real. Die Ritter ebenso wie die Pest und Schlachten zwischen Lords und Königen. Ich stecke mitten in diesen Filmen. Nur, dass das Happy End nicht gewiss ist!
Ich war sprachlos. Mir war klar, dass er von mir eine Antwort erwartete, aber kein Wort wollte den Weg auf meine Zunge finden. Schließlich entging ich der misslichen Lage, weil hinter mir ein lauter Ruf erklang. „Wir sind friedlich gesinnt! Wir bringen die Königin von Schottland zurück in ihr Land. Lasst uns passieren!“ Ich fuhr herum. Um den Kapitän hatte sich nun eine Traube von Menschen gebildet. Ganz vorne stand der Earl of Bothwell. Er war es, der gesprochen hatte. Des Weiteren entdeckte ich Mary Stuart, in ein goldenes Gewand gehüllt stand sie hocherhobenen Hauptes neben ihm. Riccio und Brantôme waren ebenfalls anwesend. Nur von den anderen drei Marys fehlte jede Spur. Dies wunderte mich, waren sie doch sonst nie weiter als einen Steinwurf von der Königin entfernt.
Endlich erklang eine abgehackte Antwort auf Englisch. „Wir segeln unter der Flagge Ihrer Majestät Königin Elizabeth der Ersten. Ich möchte mit Eurem Kapitän sprechen.“ Dieser schob sich nun an Bothwell vorbei und stellte sich an die Spitze der Menge. „Der bin ich“, rief er hinüber.
„Ihr reist im Dienst der Cousine meiner Königin?“, fragte der Engländer.
„So ist es“, bestätigte unser Kapitän.
„Wenn das so ist, dann habt Ihr nichts zu befürchten. Alles, was wir tun, ist, dafür zu sorgen, dass unsere Gewässer frei von Piraten und anderen Gesetzlosen sind.“
Ich merkte erst jetzt, dass ich die Luft angehalten hatte. Vorsichtig drehte ich mich zu Cailean herum, der mir knapp zunickte, sich jedoch gleich wieder auf das Geschehen an der Spitze des Bugs konzentrierte.
„Ihr lasst uns also passieren?“





























