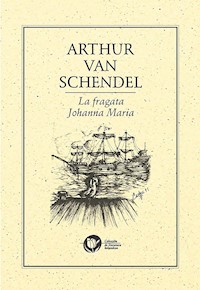Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein gesellschaftskritisches Märchen. Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der kleine Johannes
Frederik van Eeden
Inhalt:
Frederik van Eeden – Biografie und Bibliografie
Der kleine Johannes
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Der kleine Johannes, F. van Eeden
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849638016
www.jazzybee-verlag.de
Frederik van Eeden – Biografie und Bibliografie
Niederländ. Dichter, geb. 3. April 1860 in Haarlem, studierte Medizin (Psychotherapie), lebte als Arzt in Amsterdam und Bussum bei Amsterdam und gründete 1898 bei Bussum eine landwirtschaftliche und industrielle Siedelungsgenossenschaft (Kolonie Walden), der er vorsteht. Er begann noch als Student mit dramatischen Arbeiten (»Het Sonnet«, 1883; »De Student Thuis«, »Frans Hals«), gründete 1885 mit Willem Kloos und Albert Verwey den »Nieuwen Gids«, das Organ der jungholländischen Dichterschule, in dem 1886 sein populärstes Werk erschien: »De kleine Johannes« (6. Aufl. 1900; deutsch, Halle 1892). Fernere Werke von ihm sind das sogen. Lied vom Schmerze: »Ellen« (1891, 4. Aufl. 1900), »Johannes Viator« (1892, eine Fortsetzung des »Kleinen Johannes«), die Rechtstragödie »De Broeders« (1894), die Terzinendichtung »Het Lied van Schijnen Wezen« (1895, 2. Aufl. 1901), das Drama »Lioba« (1897), der Roman »Van de koele meren des doods« (1900) und der Gedichtband »De passieloose Lelie« (1901). Neuerdings ist E. als erfolgreicher Sozialpolitiker auf dem Gebiete der innern Kolonisation hervorgetreten. E. ist seiner Bedeutung nach der erste unter den Vertretern der Moderne in Holland, ein überaus feinfühliger Dichter, in seinem Wesen Mystiker, durchdrungen von reinster Menschenliebe. Eine »Bloemlezing uit v. Eedens werken« erschien 1899. Vgl. Otto Hauser, Fr. v. E. in »Westermanns Monatsheften« 1902 und desselben »Niederländische Lyrik von 1875–1900« (Leipz. 1901).
Der kleine Johannes
Erstes Buch
Ich will euch etwas von dem kleinen Johannes erzählen. Meine Geschichte erinnert zwar sehr an ein Märchen, aber dennoch ist alles in Wirklichkeit so geschehen. Sobald ihr das nicht mehr glaubt, sollt ihr nicht weiter lesen, denn ich schreibe dann nicht für euch. Auch dürft ihr nie zu dem kleinen Johannes darüber sprechen, wenn ihr ihm jemals begegnen solltet, denn das würde ihm Kummer bereiten und ich würde es bereuen, euch dies alles erzählt zu haben.
Johannes wohnte in einem alten Hause, das von einem großen Garten umgeben war. Es war schwer sich dort zurecht zu finden, denn in dem Hause waren viel dunkle Gänge, Treppen, Stübchen und geräumige Bodenkammern, und im Garten gab es allenthalben Spalierwände und Treibhäuser. Für Johannes bedeutete dieser Garten eine ganze Welt. Er konnte weite Streifzüge darin unternehmen, und allem, was er entdeckte, gab er einen Namen. Für das Haus hatte er lauter Namen aus dem Tierreich gefunden: da war der Raupenspeicher, weil er dort eine Raupenzucht trieb; und das Hühnerstübchen, weil er dort einmal ein Huhn gefunden hatte. Das war zwar nicht von selber dahin gekommen, sondern die Mutter des kleinen Johannes hatte es dort zum Brüten hingesetzt. Für den Garten wählte er lauter Namen aus dem Pflanzenreich, und beachtete dabei vornehmlich die Erzeugnisse, die für ihn von Bedeutung waren. So unterschied er einen Himbeerberg, einen Birnenwald und ein Erdbeertal. Ganz hinten war ein kleines Fleckchen, welches er das Paradies nannte, und dort war es natürlich besonders schön. Da war ein großes Wasser, ein Teich, auf dem weiße Lilien trieben und an dessen Ufern das Schilf flüsternd lange Gespräche mit dem Winde führte. Jenseits lagen die Dünen. Das Paradies selber bestand aus einem kleinen Rasen am diesseitigen Ufer, der von Buschholz umringt war; üppig schoß der Waldkerbel daraus empor. Dort lag Johannes oft im dichten Grase und spähte durch das wogende Schilf nach den Dünenspitzen jenseits des Wassers. An warmen Sommerabenden war er dort immer und konnte stundenlang so daliegen und schauen und schauen, ohne daß ihm jemals die Zeit lang wurde. Er dachte an die Tiefe des stillen klaren Wassers, das da vor ihm sich ausbreitete – wie traulich es dort sein mußte zwischen den Wasserpflanzen in dem seltsamen Dämmerlicht, und dann wieder an die fernen wunderbar gefärbten Wolken, die langsam über die Dünen dahinzogen – und was dahinter wohl sein mochte, und ob es köstlich sein würde dorthin fliegen zu können. Wenn die Sonne eben untergegangen war, türmten sich die Wolken dort so hoch übereinander, daß sie den Eingang zu einer Grotte zu formen schienen, und in der Tiefe jener Grotte erglänzte der Schein eines mattroten Lichtes. Das war es, wonach Johannes sich sehnte. O, könnte ich doch da hineinfliegen! dachte er dann bei sich. Was dort hinten wohl sein mag? Ob ich wohl je, jemals dahin werde gelangen können? ...
Doch so oft er sich das wünschte, fiel die Grotte in fahle dunkle Wölkchen zusammen, ohne daß er sich ihr zu nähern vermochte. Dann ward es kalt und feucht am Ufer des Teiches und er mußte sein dunkles Stübchen in dem alten Hause wieder aufsuchen.
Er wohnte dort nicht ganz allein; er hatte einen Vater, der gut für ihn sorgte, einen Hund, der Presto und einen Kater, der Simon hieß. Natürlich liebte er seinen Vater am meisten, aber Presto und Simon achtete er durchaus nicht so viel geringer, wie das ein Erwachsener tun würde. Ja, er vertraute Presto sogar mehr Geheimnisse an als seinem Vater, und Simon gegenüber empfand er eine ehrfurchtsvolle Scheu. Nun, und das war auch kein Wunder. Simon war ein großer Kater mit glänzend schwarzem Fell und einem dicken Schwanz. Man konnte es ihm ansehen, daß er von seiner eigenen Erhabenheit und Weisheit vollkommen überzeugt war. Er blieb stets vornehm und würdevoll, sogar dann, wenn er sich einmal dazu herabließ, einen Augenblick mit einem rollenden Korken zu spielen oder hinter einem Baum einen vergessenen Heringstopf zu verzehren.
Angesichts der tollen Ausgelassenheit Prestos kniff er verächtlich die grünen Augen zu und dachte: "Nun ja, die Hunde wissen es eben nicht besser."
Könnt ihr es jetzt verstehen, daß Johannes Respekt vor ihm hatte? – Mit dem kleinen braunen Presto ging er viel vertraulicher um. Der war kein schönes oder vornehmes, dafür aber ein ganz besonders gutmütiges und kluges Hündchen, das sich niemals weiter als um zwei Schritte von Johannes entfernte und den Mitteilungen seines Herrn geduldig lauschte. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, wie sehr Johannes an Presto hing. Trotzdem aber war in seinem Herzen auch noch sehr viel Raum für andere. Findet ihr es merkwürdig, daß sein dunkles Schlafkämmerlein mit den kleinen Fensterscheiben darinnen auch einen großen Platz einnahm? Er liebte die Tapete mit den großen Blumengebilden, in denen er lauter Gesichter sah und deren Formen er so oft schon aufmerksam studiert hatte, wenn er krank war oder wenn er des Morgens wachend im Bett lag. Ganz besonders liebte er das eine kleine Gemälde, das dort hing und auf dem steife Spaziergänger abgebildet waren, die in einem noch steiferen Garten an spiegelglatten Teichen entlang wanderten, aus denen himmelhohe Fontänen aufspritzten und darinnen kokette Schwäne schwammen; – die große Wanduhr indessen liebte er am meisten. Er zog sie stets sorgfältig auf und hielt es für eine Pflicht der Höflichkeit, daß er sie ansah, während sie schlug. Das ging natürlich nur, so lange Johannes nicht schlief. War die Uhr durch irgend ein Versehen stehen geblieben, dann fühlte sich Johannes sehr schuldig und bat sie tausendmal um Verzeihung. Ihr würdet am Ende gar lachen, wenn ihr die Gespräche belauschen könntet, die er mit seinem Zimmer führte. Aber, gebt einmal acht, wie oft ihr mit euch selber sprecht! Das erscheint euch nicht im mindesten lächerlich. Überdies war Johannes davon überzeugt, daß seine Zuhörer ihn vollkommen begriffen; eine Antwort brauchte er nicht. Indessen wartete er doch wohl hin und wieder ganz heimlich auf eine Antwort von der Uhr oder von der Tapete.
Schulkameraden hatte Johannes wohl, aber Freunde konnte man sie eigentlich nicht nennen. Er spielte mit ihnen und zettelte in der Schule Verschwörungen mit ihnen an, und im Freien bildete er Räuberbanden mit ihnen, aber so recht zu Hause fühlte er sich erst, wenn er mit Presto allein war. Dann verlangte es ihn nimmer nach andern Knaben und er fühlte sich vollkommen frei und geborgen.
Sein Vater war ein weiser ernster Mann, der Johannes des öfteren mitnahm auf lange Streifzüge durch die Wälder und die Dünen; dann sprachen sie nur wenig und Johannes ging um etwa zehn Schritt hinter seinem Vater her und grüßte die Blumen, denen er auf seinem Wege begegnete und die alten Bäume, die immer und immer auf demselben Fleck stehen bleiben mußten, und freundlich strich er ihnen mit seiner kleinen Knabenhand über die rauhe Rinde. Und rauschend dankten ihm alsdann die gutmütigen Riesen.
Manchmal schrieb sein Vater während des Gehens Buchstaben in den Sand, einen nach dem andern, und Johannes buchstabierte dann die Worte, die sich formten, und hin und wieder machte der Vater auch wohl einen Augenblick Halt und lehrte Johannes den Namen einer Pflanze oder eines Tieres.
Und Johannes fragte auch oftmals, denn er sah und hörte viel Rätselhaftes. Dumme Fragen stellte er häufig: er fragte, warum die Welt so sei wie sie sei und warum die Tiere und Pflanzen sterben müßten, und ob Wunder geschehen konnten. Der Vater des kleinen Johannes war ein weiser Mann; er sagte nicht alles was er wußte, und das war gut für Johannes.
Des Abends vor dem Schlafengehen sprach Johannes stets ein langes Gebet. Das hatte ihn die Kinderfrau so gelehrt. Er betete für seinen Vater und für Presto. Simon habe es nicht nötig, meinte er. Er betete auch sehr lange für sich selber und den Schluß bildete meistens der Wunsch, es möge doch einmal ein Wunder geschehen. Und nachdem er das Amen gesprochen, blickte er gespannt in dem halbdunklen Stübchen umher, auf die Figuren der Tapete, die in dem matten Dämmerlicht noch seltsamer erschienen als sonst, auf die Türklinke und auf die Uhr, an der nun das Wunder sich vollziehen würde. Allein die Uhr tickte unaufhaltsam ihre nämliche Weise und die Türklinke rührte sich nicht. Es war völlig dunkel und Johannes fiel in Schlaf, ohne daß das Wunder gekommen.
Einmal aber würde es dennoch geschehen, das wußte er.
Am Ufer des Teiches war es warm und totenstill. Die Sonne, rot und abgemattet von der Arbeit des Tages, schien sich einen Augenblick am fernen Dünenrand auszuruhen, bevor sie unterging. Beinahe vollkommen spiegelte das glatte Wasser ihr leuchtendes Angesicht wieder. Die weit über den Teich herabhängenden Blätter der Buche nützten die Stille, um sich einmal so recht andächtig im Spiegel zu beschauen. Der einsame Reiher, der zwischen den breiten Blättern der Wasserlilie auf einem Bein stand, vergaß, daß er ausgegangen war um Frösche zu fangen, und starrte in Gedanken versunken vor sich hin.
Da kam Johannes auf den kleinen Rasenplatz, um die Wolkengrotte zu sehen. Plumps! plumps! – sprangen die Frösche vom Ufer fort. Der Spiegel warf Falten, das Sonnenbild zerfiel in breite Streifen und die Buchenblätter raschelten verstört, denn mit ihrem Anschauen waren sie noch lange nicht zu Ende.
An den nackten Wurzeln der Buche festgebunden lag ein altes kleines Boot. Man hatte Johannes streng verboten es zu besteigen. O, wie war an diesem Abend die Versuchung groß! Schon formten sich die Wolken zu einer ungeheuren Pforte, hinter der die Sonne zur Ruhe gehen würde. Leuchtende Reihen kleiner Wölkchen scharten sich ringsumher wie eine goldgepanzerte Leibwache. Auch die Wasserfläche leuchtete und durch das Schilf am Ufer schossen rote Funken, Pfeilen gleich.
Langsam löste Johannes das Tau des Bootes von den Wurzeln der Buche. O, dort zu treiben, mitten in jener Pracht! Presto war bereits in das Boot gesprungen, und bevor sein Herr es noch selber wollte, teilte sich das Schilf langsam, ganz langsam, und beide trieben sie davon in die Richtung der Abendsonne.
Johannes lag auf dem Vordersteven und starrte in die Tiefe der Lichtgrotte. – Flügel! dachte er – jetzt Flügel zu haben! und dann dorthin!
Die Sonne war verschwunden. Die Wolken glühten noch immer. Im Osten war der Himmel dunkelblau. Dort standen Weiden in einer Reihe längs des Ufers. Regungslos streckten sie ihre hellen schmalen Blättchen in die stille Luft. Von dem dunklen Hintergrunde hoben sie sich ab wie prächtige mattgrüne Spitzenarbeit.
Still! was war das? Wie ein Säuseln zog es über den Wasserspiegel – wie ein leichter Windstoß, der in das Wasser eine schmale Furche gräbt. Es kam von den Dünen, von der Wolkengrotte herüber.
Als Johannes sich umschaute, saß auf dem Rande des Bootes eine große blaue Wasserlibelle. Solch eine große hatte er nimmer gesehen. Sie saß still, aber ihre Flügel zitterten unaufhaltsam in weitem Kreis. Es schien Johannes, als bildeten die Spitzen ihrer Flügel einen leuchtenden Ring.
"Das muß ein Feuerfalter sein", dachte er, "die sind sehr selten."
Allein der Kreis ward größer und immer größer und die Flügel zitterten so rasch, daß Johannes sie nur noch wie in einem Nebel sah. Und allmählich sah er aus jenem Nebel zwei dunkle Augen hervorleuchten und eine lichte schlanke Gestalt in einem zartblauen Kleidchen saß dort, wo die Libelle gesessen. Auf dem Blondhaar lag ein Kranz aus weißen Winden und die Schultern trugen Flügel aus Gaze, die, einer Seifenblase gleich, in tausenderlei Farben schillerten. Ein Wonneschauer durchzuckte Johannes. Das war ein Wunder!
"Willst du mein Freund sein?" flüsterte er.
Das war allerdings eine absonderliche Art und Weise einen Fremden anzureden – aber hier ging eben alles ein wenig ungewöhnlich zu. Und ihm war es, als müsse er dieses seltsame blaue Wesen schon lange kennen.
"Ja, Johannes", hörte er dann sagen, und die Stimme klang wie das Rauschen der Halme im Abendwind oder wie Regen, der auf die Blätter im Walde langsam herniedertropft.
"Wie soll ich dich nennen?" fragte Johannes.
"Ich bin in dem Kelch einer Winde geboren. Nenne mich Windekind!"
Und Windekind lachte und schaute Johannes so vertraulich in die Augen, daß es ihm wunderbar selig zu Mute ward.
"Heute ist mein Geburtstag," sagte Windekind. "Ich bin hier in der Gegend geboren, aus den ersten Strahlen des Mondes und den letzten der Sonne. Zwar sagt man, daß die Sonne weiblich sei, aber das ist nicht wahr. Denn sie ist mein Vater."
Johannes nahm sich vor, am folgenden Tage in der Schule von dem Sonne zu sprechen.
"Und sieh! Dort kommt das runde weiße Gesicht meiner Mutter schon zum Vorschein. Guten Tag, Mutter! O, o, wie gütig und bekümmert sie wieder aussieht!"
Er wies nach dem östlichen Horizont. Groß und leuchtend stieg dort der Mond am grauen Himmel auf, hinter dem Spitzenwerk der Weiden, das sich von der hellen Scheibe dunkel abhob. Seine Mutter machte wahrlich ein sehr betrübtes Gesicht.
"Aber Mutter, Mutter, das tut nichts. Ihm kann ich ja vertrauen."
Lustig ließ das liebliche Wesen seine Gazeflügel erzittern und gab Johannes mit der Irisblume, die es in der Hand hielt, einen leichten Schlag auf die Wange.
"Ihr ist es nicht recht, daß ich zu dir gekommen bin. Du bist der erste. Aber dir vertraue ich, Johannes. Du darfst nie, niemals einem Menschen meinen Namen nennen oder über mich sprechen. Gelobst du mir das?"
"Ja, Windekind," sagte Johannes. Es war ihm alles noch so fremd. Er fühlte sich unaussprechlich glücklich, aber ihm bangte, ob er sein Glück nicht wieder verlieren würde. Träumte er? – Neben ihm auf der Bank lag Presto, friedlich schlafend. Der warme Atem seines Hündchens beruhigte ihn. Die Mücken tanzten über dem Wasser, in der schwülen Luft, genau so wie immer. Um ihn her war alles so klar und so deutlich. Es mußte Wahrheit sein. Und immerfort fühlte er, wie Windekinds vertraulicher Blick auf ihm ruhte. Da erklang wiederum die süß raunende Stimme:
"Ich habe dich hier schon oft gesehen, Johannes. Weißt du wo ich war? – Oft saß ich auf des Teiches sandigem Grunde zwischen den dichten Wasserpflanzen und blickte zu dir hinauf, wenn du dich über das Wasser neigtest, um zu trinken oder um die Wasserkäfer und Salamander dir anzuschauen. Mich aber sahest du nie. Oftmals auch blickte ich aus dem dichten Schilf zu dir hinüber. Dort bin ich sehr häufig. Wenn es warm ist, schlafe ich da auch meistens in dem leeren Nest einer Rohrdrossel. Ja, das ist schön weich."
Windekind wiegte sich vergnügt auf dem Rande des Bootes und schlug mit seiner Blume nach den Mücken.
"Jetzt komme ich, dir ein wenig Gesellschaft zu leisten. Dein Leben ist sonst gar so eintönig. Wir wollen gute Freunde sein und ich werde dir mancherlei erzählen. Viel bessere Dinge als die, welche dir die Schulmeister weismachen. Die verstehen ja gar nichts. Und wenn du mir nicht glaubst, so werde ich dich das alles selber sehen und hören lassen. Ich werde dich mitnehmen."
"O Windekind, lieber Windekind, kannst du mich dorthin mitnehmen?" rief Johannes und wies in die Richtung, wo soeben noch das purpurne Licht der untergehenden Sonne durch die goldene Wolkenpforte gestrahlt hatte. Schon begann das wunderherrliche Gebilde in grauem Nebel zu zerfließen. Dennoch aber drang der mattrote Glanz noch aus tiefsten Tiefen zum Vorschein.
Windekind starrte in das Licht, das über sein seines Gesichtchen und sein Blondhaar einen goldenen Schimmer wob und schüttelte langsam den Kopf.
"Jetzt nicht, Johannes, jetzt nicht! Du mußt nicht gleich zu viel verlangen. Ich selber bin noch niemals bei Vater gewesen."
"Ich bin immer bei meinem Vater", sagte Johannes.
"Nein, das ist dein Vater nicht. Wir sind Brüder. Mein Vater ist auch der deine. Aber die Erde ist deine Mutter und daher sind wir beide sehr verschieden. Auch bist du in einem Hause geboren bei Menschen, ich hingegen in dem Kelch einer Winde. Das Letztere ist sicherlich besser. Aber wir werden uns dennoch gut verstehen."
Dabei sprang Windekind behende auf die Seite des Bootes, das sich nicht regte unter der Last, und küßte Johannes! Ihm war, als wandle sich alles um ihn her.
Was für ein seltsames Empfinden kam da über Johannes! Ihm war, als wandle sich alles um ihn her.
Er sähe jetzt alles viel besser und viel richtiger, meinte er. Er sah, wie der Mond jetzt viel freundlicher dreinschaute – und er sah auch, daß die Wasserlilien Gesichter hatten, mit denen sie ihn verwundert und forschend anstarrten.
Er begriff nun plötzlich, warum die Mücken so lustig auf und nieder tanzten, immer umeinander her, auf und nieder, auf und nieder, bis sie mit ihren langen Beinen das Wasser berührten. Er hatte schon manchmal darüber nachgedacht, aber jetzt begriff er es ganz von selbst.
Er hörte auch, was das Schilf raunte und wie die Bäume am Ufer leise klagten, weil die Sonne untergegangen.
"O, Windekind, ich danke dir, das ist köstlich. Ja, wir beide werden uns sicherlich gut verstehen."
"Gib mir deine Hand," sagte Windekind und breitete die vielfarbigen Flügel aus. Dann zog er Johannes in dem Boot mit sich fort über das Wasser und durch die großen Blätter der Seeblumen, die im Mondenlicht schimmerten.
Hier und dort saß ein Frosch auf einem Blatte. Jetzt aber sprang er nicht ins Wasser, wenn Johannes kam. Er machte nur eine leichte Verbeugung und sagte: "Quack!" Johannes verneigte sich gleichfalls sehr höflich – denn er wollte vor allen Dingen nicht hochmütig erscheinen.
Nun kamen sie an das Schilfrohr – das war breit und das ganze Boot verschwand darin, ohne daß sie das Ufer erreichten. Johannes aber klammerte sich fest an seinen Begleiter, und so kletterten sie an Land zwischen hohen Halmen hindurch.
Johannes meinte zwar, daß er kleiner und leichter geworden sei, aber das war am Ende nur Einbildung. Dennoch entsann er sich nicht, daß er jemals an einem Schilfrohr hatte emporklettern können.
"Paß jetzt gut auf", sagte Windekind, "dann wirst du was hübsches sehen."
Sie wandelten zwischen dem hohen Grase unter dunklem Buschholz, das hier und dort einen schmalen leuchtenden Streif des Mondenlichtes durchschimmern ließ.
"Hast du des Abends in den Dünen die Grillen schon einmal gehört, Johannes? Es ist gerade, als gäben sie ein Konzert, nicht wahr? Und niemals kann man hören, woher der Laut kommt. Nun, zu ihrem Vergnügen singen sie allerdings niemals, aber der Lärm kommt aus der Grillenschule, wo Hunderte von kleinen Grillen ihre Lektionen auswendig lernen. Jetzt aber sei ganz still, denn wir sind beinahe da."
Srrr! srrr!
Das Buschholz begann sich zu lichten, und als Windekind mit seiner Blume die Halme auseinanderschob, sah Johannes eine hellbeleuchtete offene Stelle und die kleinen Grillen, die eben dabei waren, zwischen dem dünnen schmächtigen Dünengras ihre Aufgaben auswendig zu lernen.
Srrr! srrr!
Eine große dicke Grille erteilte den Unterricht und überhörte. Die Schüler sprangen einer nach dem andern auf die behäbige Grille zu, immer einen Sprung vorwärts und dann in einem Sprung wieder an ihren Platz zurück. Wer verkehrt sprang, mußte auf einem Krötenpilz am Pranger stehen.
"Hör jetzt gut zu, Johannes, dann kannst du vielleicht auch etwas lernen", sagte Windekind.
Johannes verstand recht gut, was die kleinen Grillen antworteten. Aber das alles lautete ganz anders, als was ihm sein Lehrer in der Schule beibrachte. Zuerst kam die Geographie an die Reihe. Von den verschiedenen Weltteilen wußten sie nichts. Sie brauchten nur 26 Dünen und 2 Teiche zu kennen. Von allem übrigen könne niemand etwas wissen, sagte der Lehrer, und was davon erzählt würde, sei eitel Phantasie.
Darauf ging er zur Botanik über. Auf diesem Gebiet wußten sie alle sehr viel, und es wurden vielerlei Preise verteilt, ausgesucht junge und zarte Grashalme von verschiedener Länge. Über die Zoologie indessen wunderte sich Johannes am meisten. Die Tiere wurden in springende, fliegende und kriechende eingeteilt. Die Grillen konnten springen und fliegen und standen infolgedessen obenan. Dann folgten die Frösche. Vögel wurden mit allen Anzeichen des Abscheus als höchst gefährlich und schädlich bezeichnet. Endlich wurde auch der Mensch besprochen. Der sei ein großes unnützes und schädliches Tier, das sehr niedrig stände, da es weder fliegen noch springen könne, das aber zum Glück nur ziemlich selten hierher komme. Eine kleine Grille, die noch niemals einen Menschen gesehen hatte, bekam drei Schläge mit einem Röhrchen, weil sie den Menschen irrtümlich unter die unschädlichen Tiere zählte.
So etwas hatte Johannes noch nie gehört.
Da rief der Lehrer plötzlich: "Ruhe! Springübung!" Sofort hörten sämtliche Grillen mit dem Lernen ihrer Lektionen auf und begannen sehr geschickt und emsig "Bock, steh fest" zu spielen. Allen voran der dicke Lehrer.
Das war ein so lustiger Anblick, daß Johannes vor Freude in die Hände klatschte. Bei diesem Lärm stob die ganze Schule in weniger als einem Augenblick in die Dünen, und auf dem kleinen Rasenplatz ward es totenstill.
"Ja, das kommt davon, Johannes, du mußt dich auch nicht so plump benehmen. Man kann es doch wohl merken, daß du bei den Menschen geboren bist!"
"Es tut mir leid, ich werde mir alle Mühe geben. Aber es war auch so reizend!"
"Es wird noch viel reizender," sagte Windekind.
Sie schritten über den Rasen und bestiegen die Düne von der andern Seite. Uff, wie schwer es sich ging durch den dicken Sand! – aber als Johannes Windekind bei seinem leichten blauen Kleidchen faßte, flog er schnell und mühelos hinauf. Auf halbem Wege zum Gipfel war eine Kaninchenhöhle.
Das Kaninchen, das dort zu Hause war, streckte den Kopf und die Vorderpfoten aus dem Eingang heraus. Noch blühten die Dünenrosen, und ihr seiner zarter Duft gesellte sich dem des Thymian, der an den Dünenhängen wuchs.
Johannes hatte oftmals Kaninchen in ihre Höhle verschwinden sehen und dann stets bei sich gedacht: wie mag es dort drinnen wohl aussehen? Wie viele mögen dort wohl zusammen hocken? Und ob es nicht gar warm und dumpfig sein mag in ihrer engen Behausung?
So freute er sich denn ungemein, als er seinen Gefährten das Kaninchen fragen hörte, ob sie sich die Höhle einmal ansehen dürften.
"Was mich angeht, natürlich", sagte das Kaninchen. "Aber es trifft sich schlecht, da ich gerade heute Abend meine Höhle zur Veranstaltung eines Wohltätigkeitsfestes abgetreten habe und daher sozusagen nicht mehr Herr in meinem eigenen Haufe bin."
"So, so, ist denn ein Unglück geschehen?"
"Ach ja," antwortete das Kaninchen wehmütig, "uns hat ein schweres Mißgeschick betroffen, das wir wohl Jahre lang nicht überwinden werden. Etwa um tausend Sprünge von hier hat man eine Menschenwohnung gebaut, so groß! so groß! – Und jetzt wohnen Menschen darin, mit Hunden. Es sind schon mindestens sieben Mitglieder meiner Familie dabei umgekommen und noch dreimal so viel ihrer Höhlen beraubt. Und um das Geschlecht Maus und die Familie Maulwurf ist es noch schlimmer bestellt. Auch die Kröten haben schwer gelitten. – Nun haben wir zu Gunsten der Hinterbliebenen ein Fest veranstaltet. Jeder tut das Seine. Ich trete meine Höhle ab. Man muß für seine Mitgeschöpfe doch etwas übrig haben."
Das mitleidige Kaninchen seufzte und zog sich mit der rechten Vorderpfote das lange Ohr über den Kopf, um sich eine Träne aus dem Auge zu wischen. Ihm diente das als Taschentuch.
Da raschelte es in den Halmen und eine dicke schwerfällige Gestalt schleppte sich langsam bis zur Höhle hin.
"Sieh," rief Windekind, "da kommt Papa Kröte auch angewackelt. So, so, wagst du dich so spät noch auf den Pfad, Padde?"
Die Padde nahm von diesem Wortspiel keinerlei Notiz. Witze, die auf ihren Namen gemacht wurden, langweilten sie aufs äußerste. Bedächtig legte sie eine reife Kornähre, die fein säuberlich in ein dürres Blatt eingewickelt war, am Eingang nieder und stieg dann geschickt über den Rücken des Kaninchens in die Höhle hinab.
"Dürfen wir eintreten?" fragte Johannes, der sehr neugierig war. "Ich will auch etwas geben."
Er entsann sich, daß er noch einen Zwieback in der Tasche hatte. Einen kleinen runden Zwieback von Huntley & Palmers. Als er den zum Vorschein holte, bemerkte er erst recht, wie klein er geworden war. Denn er vermochte ihn kaum mit beiden Händen aufzuheben und begriff überhaupt nicht, wie er jemals in seiner Hosentasche Platz gefunden hatte.
"Das ist etwas sehr Kostbares und sehr Seltenes," sagte das Kaninchen, "ein fürstliches Geschenk!"
Ehrfurchtsvoll gab es den beiden den Eingang frei. In der Höhle war es dunkel und Johannes zog es vor, Windekind vorangehen zu lassen. Alsbald sahen sie, wie ein mattgrünes Lichtlein sich näherte. Es war ein Glühwürmchen, das sich bereitwillig erbot, ihnen voran zu leuchten.
"Der Abend verspricht sehr genußreich zu werden," sagte das Glühwürmchen, während es seinen Weg verfolgte. "Es sind schon viele Gäste da. Ihr seid Elfen, wie mir scheint, nicht wahr?" Dabei blickte das Glühwürmchen Johannes ein wenig mißtrauisch an.
"Du kannst uns als Elfen anmelden," antwortete Windekind.
"Wißt Ihr, daß Euer König dem Feste beiwohnt?" fuhr das Glühwürmchen fort.
"Ist Oberon hier? Was du nicht sagst! Das freut mich aber aufrichtig!" rief Windekind aus. "Ich kenne ihn persönlich."
"Ah?" sagte das Glühwürmchen, – "ich wußte nicht, daß ich die Ehre hatte" ... Und vor lauter Schrecken wäre sein Lichtlein beinahe erloschen. – "Ja, S. Maj. pflegt die frische Luft sonst vorzuziehen, aber sobald es einem wohltätigen Zweck gilt, ist er stets zu allem bereit. Das Fest wird gewiß sehr prunkvoll werden."
Und so war es auch in der Tat. Der große Saal in der Kaninchenhöhle war prächtig ausgeschmückt. Der Boden war festgestampft und mit duftendem Thymian bestreut. Quer vor dem Eingang hing eine Fledermaus an ihren Hinterbeinen. Diese rief die Namen der Gäste ab und diente gleichzeitig als Vorhang: das war eine Sparsamkeitsmaßregel. Die Wände waren mit dürren Blättern, Spinngeweben und kleinen hängenden Fledermäusen geschmackvoll dekoriert. Dazwischen und an der Decke entlang krochen unzählige Glühwürmchen, die eine entzückende bewegliche Beleuchtung bildeten. Am Ende des Saales war aus kleinen Stückchen morschen Holzes, die Licht ausstrahlten, ein Thron errichtet. Das war ein gar prächtiger Anblick!
Es hatten sich viele Gäste eingefunden. Johannes fühlte sich nicht recht heimisch in dieser fremden, seltsamen Menge und wich nicht von Windekinds Seite. Er sah lauter erstaunliche Dinge. Ein Maulwurf unterhielt sich aufs eifrigste mit einer Feldmaus über die schöne Beleuchtung und die Dekorationen. In einer Ecke saßen zwei dicke Kröten und klagten sich kopfschüttelnd ihre Not über das anhaltend trockne Wetter. Ein Frosch versuchte Arm in Arm mit einer Eidechse durch den Saal zu wandeln, was ihm indessen nicht recht gelingen wollte, da er nervös und verlegen war und jedesmal zu weit sprang, wodurch er die Wandverzierungen hin und wieder gründlich in Unordnung brachte.
Auf dem Thron saß Oberon, der Elfenkönig, umringt von seinem Elfengefolge, das ein wenig verächtlich auf die Umgebung herabblickte. Der König selber war nach Fürstenart außerordentlich leutselig und unterhielt sich freundlich mit verschiedenen Gästen. Er kam von einer Reise aus dem Orient und trug ein seltsames Gewand aus leuchtend-farbigen Blumenblättern. Solche Blumen wachsen hier nicht, dachte Johannes. Auf dem Kopf trug er einen kleinen tiefblauen Blumenkelch, der noch einen frischen Duft ausströmte, gleich als sei er soeben erst gepflückt. In der Hand hielt er als Szepter den Staubfäden einer Lotosblume.
Alle Anwesenden waren voll des stillen Lobes über seine Güte. Er hatte das Mondenlicht in den Dünen gerühmt und gesagt, daß die hiesigen Glühwürmchen fast ebenso schön seien wie die morgenländischen Feuerblumen. Auch hatte er mit sichtlicher Genugtuung die Wanddekorationen betrachtet, und ein Maulwurf wollte sogar beobachtet haben, daß er anerkennend mit dem Kopfe genickt.
"Geh mit mir," sagte Windekind zu Johannes, "ich werde dich vorstellen." Und sie bahnten sich einen Weg bis zu des Königs Thron.
Oberon breitete voller Freude die Arme aus, als er Windekind erkannte, und küßte ihn. – Darob entstand ein Geflüster unter den Gästen, und im Gefolge der Elfen konnte man manch neidischen Blick auffangen. Die beiden dicken Kröten in der Ecke murmelten etwas, das wie "Schmeichler" und "kriechen" und "nicht lange dauern" klang, und nickten einander vielsagend zu.
Windekind sprach lange in einer fremden Sprache mit Oberon und winkte darauf Johannes, daß er näher treten solle.
"Gib mir deine Hand, Johannes," sagte der König, "Windekinds Freunde sind die meinen. Ich werde dir beistehen, wo immer ich es vermag. Ich will dir ein Merkmal unseres Bundes geben."
Und dabei löste Oberon von seiner Halskette ein kleines goldenes Schlüsselein und reichte es Johannes, der es voller Ehrfurcht entgegennahm und es fest mit seiner Hand umschloß.
"Dies Schlüsselein kann dein Glück bedeuten," fuhr der König fort. "Es paßt zu einem kleinen goldenen Schrein, der kostbare Schätze enthält. Aber wer den Schrein besitzt, das kann ich dir nicht sagen, du mußt nur recht fleißig suchen. Wenn du mit mir und mit Windekind gut Freund bist und wenn du stets treu und standhaft bleibst, so wird es dir wohl glücken." Dabei nickte der Elfenkönig freundlich mit dem schönen Köpfchen, und Johannes dankte ihm überglücklich.
Da begannen drei Frösche, die auf einer kleinen Anhöhe aus feuchtem Moose saßen, die Einleitung zu einem langsamen Walzer zu singen, und es bildete sich ein Pärchen nach dem andern. Die nicht tanzten, wurden von einer grünen Eidechse, die das Amt eines Zeremonienmeisters bekleidete und geschäftig hin und her eilte, schleunigst beiseite geschoben – zum größten Ärger der beiden Kröten, die sich beklagten, daß sie nichts sehen könnten – und dann begann der Tanz.
Das war aber drollig! Ein jeder tanzte auf seine eigene Art und bildete sich natürlich ein, daß er es viel besser mache als alle anderen. Die Mäuse und die Frösche sprangen auf ihren Hinterbeinen in die Höhe, eine alte Ratte drehte sich so wild im Kreise herum, daß alle Tänzer vor ihr zur Seite wichen, und auch eine fette Baumschnecke wagte ein Tänzchen mit einem Maulwurf, gab es indessen alsbald wieder auf unter dem Vorwand, daß sie Seitenstechen davon bekäme. – In Wahrheit aber nur deshalb, weil sie sich auf die Kunst nicht allzu gut verstand.
Es vollzog sich indessen alles sehr ernst und feierlich. Man betrachtete das alles als eine Ehrensache und blickte gespannt zum König hinüber, ob auf seinem Antlitz nicht der Ausdruck des Wohlwollens zu entdecken wäre. Der König indessen fürchtete Unzufriedene zu machen und blickte starr vor sich hin. Die Elfen seines Gefolges stellten ihre Tanzkunst viel zu hoch, als daß sie sich in diesem Kreise daran beteiligt hätten.
Johannes war angesichts dieser feierlichen Würde lange ernst geblieben. Als er dann aber sah, wie eine kleine Kröte sich mit einer langen Eidechse im Kreise drehte, die das unglückliche Krötchen oft hoch über die Erde emporhob und es in der Luft einen Halbkreis beschreiben ließ, brach er endlich in ein schallendes Gelächter aus.
Das verursachte allgemeine Bestürzung. Die Musik verstummte. Der König blickte verstört um sich. Der Zeremonienmeister eilte so geschwind, wie er nur irgend konnte, auf den Lacher zu und ersuchte ihn dringend, sich ein wenig anständiger zu benehmen.
"Der Tanz ist eine ernsthafte Sache," sagte er, "und dabei gibt's nichts zu lachen. Es ist hier eine vornehme Gesellschaft, in der nicht etwa nur zum Spaß getanzt wird. Ein jeder tut, was er kann, und keiner will ausgelacht werden. Das ist eine Grobheit, übrigens wohnen wir hier einem Feste bei, das aus recht traurigen Gründen veranstaltet wurde. Hier sollte sich ein jeder anständig benehmen und nicht etwa so wie bei den Menschen."
Darob erschrak Johannes sehr. Allüberall sah er haßerfüllte Blicke. Seine Vertraulichkeit mit dem König hatte ihm manchen zum Feinde gemacht. Windekind zog ihn beiseite:
"Es ist wohl besser, wir gehen, Johannes," flüsterte er. "Du hast die Sache wieder einmal gründlich verdorben. Ja, ja, das kommt davon, wenn man bei den Menschen erzogen ist."
Geschwind schlüpften sie unter den Flügeln der Fledermauspförtnerin hindurch und gelangten in den dunklen Gang. Das höfliche Glühwürmchen erwartete sie bereits.
"Habt ihr euch gut unterhalten?" fragte es, "habt ihr König Oberon gesprochen?"
"O ja, es war ein sehr lustiges Fest," sagte Johannes. "Mußt du denn immer hier in dem dunklen Gang bleiben?"
"Das ist meine freie Wahl," sagte das Glühwürmchen in wehmütig-bittrem Ton. "Mir machen solche Nichtigkeiten keinen Spaß mehr."
"Ach was," sagte Windekind, "das meinst du ja gar nicht."
"Doch, es ist so wie ich sage. Früher – ja früher hat es eine Zeit gegeben, da auch ich Festlichkeiten besuchte und tanzte und mich mit solchen Spielereien abgab. Jetzt aber bin ich durch Kummer geläutert, jetzt..."
Und das Glühwürmchen war so gerührt, daß sein Lichtlein wiederum erlosch. Zum Glück waren sie dem Ausgang ganz nahe und das Kaninchen, das sie kommen hörte, trat ein wenig zur Seite, so daß das Mondenlicht voll hineinströmen konnte.
Sobald sie draußen bei dem Kaninchen angelangt waren, sagte Johannes:
"Erzähle uns doch mal deine Geschichte, Glühwürmchen."
"Ach," seufzte das Glühwürmchen, "die ist einfach und traurig und wird euch sicherlich nicht belustigen."
"Aber erzähle sie, erzähle sie trotzdem!" riefen alle.
"Nun: – euch allen ist es ja wohl bekannt, daß wir Glühwürmchen ganz außergewöhnliche Wesen sind. Ja, ich glaube sogar, niemand würde wagen, es in Abrede zu stellen, daß wir Glühwürmchen unter allem, was da lebt, am reichsten begabt sind."
"Warum denn? Davon weiß ich nichts," sagte das Kaninchen.
Und voller Verachtung fragte das Glühwürmchen: "kannst du denn etwa Licht ausstrahlen?"
"Nein, das allerdings nicht," mußte das Kaninchen eingestehen.
"Aber wir strahlen Licht aus. Alle! Und wir können es nach Willkür leuchten lassen und auslöschen. Licht ist die schönste Gabe der Natur und Licht verbreiten das Höchste, wozu ein lebendes Wesen es bringen kann. Sollte uns da wirklich jemand den Vorrang streitig machen wollen? Wir Männchen haben außerdem auch noch Flügel und können meilenweit fliegen."
"Das kann ich auch nicht," gestand das Kaninchen demütig ein.
"Und weil wir die göttliche Gabe des Lichtes besitzen," fuhr das Glühwürmchen fort, "schonen uns auch die übrigen Tiere. Kein Vogel wird uns jemals überfallen. Nur ein einziges Tier, das niedrigste von allen, sucht uns und nimmt uns mit sich. Das ist der Mensch, das scheußlichste Ungeheuer der Schöpfung."
Bei diesem Ausspruch blickte Johannes Windekind verständnislos an. Dieser aber bedeutete ihm lächelnd, daß er schweigen solle.
"Einst flog ich lustig umher wie ein Helles Irrlichtchen zwischen dunklem Gesträuch. Und auf einem einsamen feuchten Rasenplatz, am Rande eines Grabens, wohnte sie, deren Dasein mit meinem Glück unzertrennlich verknüpft war. Wunderbar leuchtete sie in mattem Smaragdglanz, wenn sie zwischen den Grashalmen umherkroch, und sie bezauberte mein junges Herz mit aller Macht. Ich flog um sie herum und gab mir alle Mühe durch den Wechsel meines Glanzes ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Voller Dankbarkeit sah ich, wie sie meinen Gruß gewahrte und sittsam ihr Lichtlein verdunkelte. Vor Rührung zitternd war ich im Begriff meine Flügel zusammenzulegen und verzückt auf meine strahlende Geliebte herabzusinken, als ein entsetzlicher Lärm die Luft erfüllte. Dunkle Gestalten näherten sich. Es waren Menschen. Erschreckt ergriff ich die Flucht – sie jagten hinter mir her und schlugen nach mir mit großen dunklen Gegenständen. Doch meine Flügel waren schneller. Als ich zurückkehrte..."
Hier versagte des Erzählers Stimme. Nach einem Augenblick tiefster Ergriffenheit fuhr das Glühwürmchen fort, während die drei Zuhörer ehrfurchtsvoll schwiegen:
"Ihr werdet es wohl schon vermuten. Meine zarte Braut – die strahlendste und schönste unter allen – war verschwunden, fortgeschleppt von den bösartigen Menschen. Das stille feuchte Rasenplätzchen war zertreten und ihr Lieblingsfleckchen am Graben dunkel und verödet. Ich war allein auf der Welt."
Bei diesen Worten zog sich das empfindsame Kaninchen wiederum ein Ohr über den Kopf, um sich eine Träne aus dem Auge zu wischen.
"Von dem Augenblick an bin ich anders geworden. Alle eitlen Vergnügungen flößen mir seither Abscheu ein. Ich denke nur an sie, die ich verloren habe und an die Zeit, da ich sie wiedersehen werde."
"So, hast du noch immer Hoffnung?" fragte das Kaninchen erfreut.
"Mehr sogar als Hoffnung, – ich habe Gewißheit. Dort oben werde ich meine Geliebte wiedersehen."
"Aber..." wollte das Kaninchen einwenden.
"Kaninchen," sprach das Glühwürmchen ernsthaft, "ich kann mir denken, daß der, welcher in der Dunkelheit umhertasten muß, zu zweifeln beginnt. Aber wenn man sehen, mit eigenen Augen sehen kann, dann ist mir jegliche Ungewißheit ein Rätsel. Dort oben," fuhr das Glühwürmchen fort, während es voller Ehrfurcht zu dem sternenfunkelnden Himmel emporblickte, "dort oben sehe ich all meine Vorväter, all meine Freunde und auch sie in noch herrlicherem Glanz erstrahlen als hier auf Erden. Ach, wann werde ich mich aus diesem niederen Dasein emporschwingen können, um zu ihr zu fliegen, die mir lockend winkt? Ja, wann? wann?"
Seufzend verließ das Glühwürmchen seine Zuhörer und kroch wiederum in die dunkle Höhle zurück.
"Armes Geschöpf," sagte das Kaninchen, "ich will nur hoffen, daß es recht behält."
"Ja, das hoffe ich auch," fügte Johannes hinzu.
"Mir ist ein wenig bange davor," sagte Windekind, "aber es war wirklich sehr ergreifend."
"Lieber Windekind," hub Johannes nun an, "ich bin sehr müde und schläfrig."
"So komm zu mir, damit ich dich mit meinem Mantel bedecke."
Windekind nahm sein blaues Mäntelchen und breitete es über Johannes und über sich selber aus. So streckten sie sich hin in das duftende Gras am Dünenhang und hielten sich inniglich umschlungen.
"Ihr liegt mit dem Kopf ein wenig tief," sagte das Kaninchen, "wollt ihr euch auf mich stützen?"
Und das taten sie.
"Gute Nacht, Mutter," sagte Windekind zum Monde.
Darauf umschloß Johannes sein goldenes Schlüsselein fest mit der Hand, grub seinen Kopf tief in das flaumige Fell des Kaninchens und schlief ruhig ein.
"Wo ist er denn, Presto?" – Wo ist das kleine Herrchen denn? – was für ein Schrecken, in dem Boot zu erwachen, mitten im Schilf und gänzlich allein und zu sehen, daß der Herr spurlos verschwunden ist. Wahrlich, dabei konnte einem ganz angst und bange werden.
Und läufst du nun schon so lange umher, um ihn zu suchen, winselnd und klagend, du armer Presto? Wie konntest du auch nur so fest schlafen und es gar nicht merken, daß dein Herr das Boot verließ? Sonst pflegst du doch immer sofort aufzuwachen, bei der leisesten Bewegung schon.
Kaum vermochtest du zu erkennen, wo dein Herr an Land gegangen war, und hier in den Dünen hast du nun gänzlich die Spur verloren. Und alles eifrige Schnüffeln hilft dir nichts. Was für ein Entsetzen! Der Herr fort! Spurlos verschwunden! – So such' doch, Presto, such' ihn doch!
Halt! Da gerade vor dir, an dem Dünenhang, liegt da nicht eine kleine dunkle Gestalt? Schau mal gut hin!"
Einen Augenblick steht das Hündchen unbeweglich und blickt gespannt in die Ferne. Dann streckt es plötzlich den Kopf vor und rennt und rennt, was es nur rennen kann, mit seinen vier dünnen Pfötchen nach der dunklen Stelle am Dünenhang.
Und als es sich wirklich herausstellte, daß das so schmerzlich vermißte Herrchen dalag, wollten ihm all seine Bemühungen, seine Freude und Dankbarkeit so recht zum Ausdruck zu bringen, noch unzureichend erscheinen. Er wedelte mit dem Schwanz, wand seinen ganzen kleinen Körper hin und her, sprang, winselte, bellte und stieß dem lange Gesuchten seine kalte Nase leckend und schnüffelnd ins Gesicht.
"Kusch dich, Presto, in deinen Korb!" rief Johannes halb schlafend.
Wie dumm von dem Herrn! Da war weit und breit kein Korb zu sehen.
Da begann es in des kleinen Schläfers Seele langsam zu dämmern. Prestos Schnüffeln – das war er jeden Morgen so gewohnt – allein vor seinem Geiste hingen noch lichte Traumbilder von Elfen und Mondenschein, wie Frühnebel um eine Dünenlandschaft. Er fürchtete, des Morgens kalter Atem könne sie verscheuchen. "Nur fest die Augen zu", dachte er, "sonst sehe ich gleich wieder die Uhr und die Tapete, wie immer."
Aber er lag so eigentümlich. Er fühlte, daß er keine Decke auf sich hatte. – Langsam und vorsichtig öffnete er die Lider. Ein ganz klein wenig nur.
Helles Tageslicht. Blauer Himmel. Wolken.
Da öffnete Johannes die Augen sperrangelweit und sagte: "Ist es denn doch wahr?"
Ja, er lag mitten in den Dünen. Milder Sonnenschein wärmte ihn, er atmete die frische Morgenluft, und noch waren die fernen Wälder von einem seinen Nebel umschleiert. Er sah nur die hohe Buche am Teich und das Dach seines Hauses, das über all das Grün hinausragte. Bienen und Käfer umschwirrten ihn, über ihm sang die hochaufsteigende Lerche, aus der Ferne klang das Bellen eines Hundes und das Lärmen der entlegenen Stadt herüber. Es war alles greifbare Wirklichkeit.
Aber was hatte er denn nur geträumt und was nicht? Und wo war Windekind? Und das Kaninchen?
Er sah keinen von beiden. Nur Presto saß so dicht wie möglich neben ihm und schaute ihn erwartungsvoll an.
"Sollte das Nachtwandeln gewesen sein?" murmelte Johannes leise vor sich hin.
Neben ihm war ein Kaninchenbau. Aber in den Dünen gab es ihrer unzählige. Er richtete sich auf, um ihn aufmerksam anzusehen. Was fühlte er da in seiner fest geschlossenen Hand?
Ein Zucken durchfuhr ihn vom Scheitel bis zur Sohle, als er die Hand öffnete. Darinnen leuchtete ein kleines goldenes Schlüsselein.
Eine Weile blieb er sprachlos.
"Presto", fagte er dann, während ihm die Tränen in die Augen traten, "Presto, so ist es dennoch wahr?"
Presto sprang auf und versuchte seinem Herrn durch Bellen zu verstehen zu geben, daß er Hunger habe und nach Hause wolle.
Nach Hause? Ja, daran hatte Johannes noch gar nicht gedacht; und er verspürte auch herzlich wenig Lust dazu. Alsbald aber hörte er von verschiedenen Stimmen seinen Namen rufen. Da begann er zu verstehen, daß man sein Betragen durchaus nicht brav und artig finden würde und daß er wohl nichts weniger als freundliche Worte zu erwarten habe.
Einen Augenblick schien es, als ob sich seine Freudentränen mit einem Schlage in Tränen der Reue und der Angst wandeln wollten. Dann aber dachte er an Windekind, der nun sein Freund war, sein Freund und sein Vertrauter, an das Geschenk des Elfenkönigs und an die köstliche unantastbare Wahrheit alles dessen, was geschehen war. Und ruhig und auf alles gefaßt trat er den Heimweg an.
Die Begegnung war indessen noch schlimmer, als er sie sich vorgestellt. Gar so arg hatte er sich die Unruhe und die Angst seiner Hausgenossen denn doch nicht gedacht. Er mußte feierlich geloben, nimmermehr so unfolgsam und so unvorsichtig sein zu wollen.
"Das kann ich nicht", sagte er entschlossen. Darob wunderte man sich gar sehr. Man fragte ihn aus, flehte ihn an, drohte ihm sogar. Er aber dachte an Windekind und blieb standhaft. Was kümmerten ihn alle Strafen der Welt, wenn ihm nur Windekinds Freundschaft erhalten blieb – und was hätte er um Windekinds willen wohl nicht alles erdulden wollen! Fest preßte er das Schlüsselein an seine Brust und biß die Zähne zusammen, während er eine Frage nach der anderen mit einem Achselzucken beantwortete. "Ich kann nichts versprechen," sagte er immer wieder.
Allein sein Vater sprach: "Laßt ihn jetzt nur in Frieden, es ist ihm ernst. Ihm muß etwas Seltsames widerfahren sein. Einst wird er es uns schon erzählen."
Johannes lächelte, verzehrte schweigend sein Butterbrot und schlich dann in sein Kämmerlein. Dort schnitt er ein Stück von der Gardinenschnur ab, band das kostbare Schlüsselein daran fest und hing es sich auf die nackte Brust. Darauf wanderte er getrost zur Schule.
An jenem Tage erging es ihm in der Schule herzlich schlecht. Er konnte keine einzige von seinen Aufgaben und war nicht im mindesten aufmerksam. Unaufhörlich irrten seine Gedanken zum Teiche hinüber und zu den wunderseltsamen Ereignissen des vorigen Abends. Er konnte es sich kaum vorstellen, daß ein Freund des Elfenkönigs jetzt wieder verpflichtet sein sollte, Rechenexempel zu lösen und Zeitwörter zu konjugieren. Dennoch aber war alles wahr gewesen und keiner von allen, die um ihn her waren, wußte etwas davon, oder würde es glauben oder auch nur verstehen können, nicht einmal der Lehrer, mochte er auch noch so grimmig dreinschauen und Johannes auch noch so verächtlich einen faulen Schlingel schelten. Freudig ließ er die Tadel über sich ergehen und freudig machte er die Strafarbeit, die ihm seine Zerstreutheit eingetragen.
"Sie verstehen es doch nicht, keiner von allen. Sie mögen mich schelten so viel sie wollen. Ich bleibe Windekinds Freund und Windekind gilt mir mehr als sie alle zusammen. Jawohl, der Lehrer mit inbegriffen."
Das war nichts weniger als ehrerbietig von Johannes. Aber die Achtung vor seinen Mitmenschen war nach all dem Üblen, das er am vorigen Abend über sie hatte anhören müssen, nicht gerade gewachsen.
Allein, wie das öfter zu gehen pflegt: er wußte seine Weisheit noch nicht vernünftig genug anzubringen oder besser gesagt, zu verschweigen.
Als der Lehrer erzählte, daß nur der Mensch von Gott mit Vernunft begabt und als Herrscher über alle andern Tiere gestellt sei, fing er zu lachen an; was ihm eine schlechte Zensur und eine ernsthafte Ermahnung einbrachte. Und als sein Nachbar aus einem Aufgabenheft das Folgende vorlas: "Das Alter meiner mutwilligen Tante ist groß, aber nicht so groß wie das der Sonne" – rief Johannes laut: "Des Sonne."
Alle lachten ihn aus und der Lehrer, der über solch eine anmaßende Dummheit, wie er es nannte, höchlichst erstaunt war, ließ Johannes nachsitzen und hundertmal den Satz schreiben: "Das Alter meiner mutwilligen Tante ist groß, aber nicht so groß wie das der Sonne. – Am größten indessen ist meine anmaßende Dummheit."
Die Schüler waren gegangen und Johannes saß einsam in dem großen Schulzimmer und schrieb. Das Sonnenlicht schien lustig hinein, ließ Tausende von Stäubchen auf seinem Wege erglänzen und bildete auf der weißgetünchten Wand helle Lichtflecken, die, dem Wechsel der Stunden gemäß, langsam weiterkrochen. Auch der Lehrer war gegangen und hatte die Türe unwirsch hinter sich zugeworfen. Johannes war bereits bei der zweiundfünfzigsten mutwilligen Tante angelangt, als ein kleines flinkes Mäuschen mit kohlschwarzen Äuglein und seidenweichen Öhrchen aus dem fernsten Winkel des Schulzimmers unhörbar an der Wand entlang geschlichen kam. Johannes verhielt sich totenstill, um das reizende Tierchen nicht zu verscheuchen. Das aber war garnicht furchtsam, sondern kam ganz dicht an Johannes heran. Dort spähte es eine Weile mit seinen kleinen klaren Äuglein scharf umher – und sprang dann behende in einem Satz auf die Bank und in einem zweiten auf das Pult, an dem Johannes schrieb.
"Ei, ei," sagte dieser, halb zu sich selber, "du bist mal ein tapferes Mäuschen."
"Ich würde auch nicht wissen, vor wem ich mich zu fürchten hätte", antwortete ein feines Stimmchen – und dabei zeigte das Mäuschen die Zähne, gleich als lächle es.
Johannes war bereits an viel Wunderliches gewöhnt – aber jetzt sperrte er die Augen doch wieder ganz weit auf. So bei hellerlichtem Tage und in der Schule, – es war unglaublich!
"Vor mir brauchst du dich nicht zu fürchten," sagte er leise, aus Angst, er könne das Mäuschen dennoch erschrecken, – "kommst du von Windekind?"
"Ich komme, um dir zu sagen, daß der Lehrer ganz recht hat und daß du deine Strafarbeit reichlich verdient hast."
"Aber Windekind sagte doch, daß die Sonne männlich sei. – Die Sonne sei unser Vater," sagte er.
"Jawohl, aber das braucht doch kein anderer zu wissen. Was geht das die Menschen an! Du sollst mit den Menschen niemals über so zarte Dinge sprechen. Dazu sind sie viel zu grob. Der Mensch ist ein erstaunlich bösartiges und ungeschlachtes Geschöpf, das am liebsten alles, was in seinen Bereich kommt, einfangen und zertreten möchte. Darüber können wir Mäuse ein Wörtchen mitreden."
"Aber Mäuschen, warum bleibst du denn in ihrer Nähe? Warum ziehst du nicht fort, weit fort in die Wälder?"
"Ach, das können wir jetzt nicht mehr. Wir haben uns viel zu sehr an die Stadtluft gewöhnt. Und wenn man vorsichtig ist und immer hübsch aufpaßt, daß man ihren Fallen und ihren plumpen Füßen aus dem Wege geht, dann ist es unter den Menschen ganz gut auszuhalten. Wir sind ja Gott sei Dank ziemlich flink. Am schlimmsten ist es, daß der Mensch seiner eigenen Schwerfälligkeit zu Hilfe kommt, indem er mit der Katze einen Bund schließt. – Das ist eine schwere Heimsuchung – aber im Walde gibt es Sperber und Eulen, und sterben müssen wir ja doch alle einmal. Nun, Johannes, sei meines Rates eingedenk – da kommt der Lehrer!"
"Mäuschen, Mäuschen, geh nicht fort. – Frage Windekind, was ich mit meinem Schlüsselein tun soll. Ich habe es mir um den Hals gehängt, auf meine nackte Brust. Aber jeden Sonnabend zieht man mir reine Wäsche an, und ich fürchte so sehr, daß irgend jemand es dann bei mir entdecken wird. Sage mir doch, wo ich es sicher bergen kann, mein liebes, liebes Mäuschen!"
"Unter der Erde – immer unter der Erde – da ist alles am sichersten aufgehoben. Soll ich es für dich verwahren?"
"Nein, nicht hier in der Schule."
"So vergrabe es draußen in den Dünen. Ich werde meiner Base, der Feldmaus, sagen lassen, daß sie acht darauf geben soll."
"Ich danke dir, Mäuschen."
Bum bum, da kam der Lehrer angeschritten. Und während Johannes seine Feder eintauchte, war das Mäuschen auch schon im Nu verschwunden. Der Lehrer, der selber gern heimgehen wollte, erließ Johannes achtundvierzig Sätze.
Während der zwei folgenden Tage lebte Johannes in steter Angst. Man bewachte ihn aufs Strengste und nahm ihm jede Gelegenheit, in die Dünen zu entwischen. Es ward Freitag und noch immer ging er mit dem kostbaren Schlüsselein umher. Am nächsten Abend würde man ihm reine Wäsche anziehen, das Schlüsselein entdecken und es ihm wegnehmen – ihn schauderte bei dem Gedanken. Im Hause oder im Garten wagte er es nicht zu verbergen – kein einziges Fleckchen erschien ihm sicher genug.
Es ward Freitag Abend und die Dämmerung begann hereinzubrechen. Johannes saß in seinem Kämmerlein am Fenster und schaute sehnsüchtig hinaus über die grünen Sträucher im Garten und nach den fernen, fernen Dünen.
"Windekind, Windekind, so hilf mir doch!" flüsterte er angstbeklommen.
Da rauschte neben ihm ein leichter Flügelschlag, er roch den Duft von Maiblumen und hörte plötzlich die wohlbekannte süße Stimme.
Windekind saß neben ihm auf dem Fenstersims und ließ die Glöckchen einer Maiblume auf schlankem Stengel sich wiegen.
"Bist du endlich da? Ich habe mich so nach dir gesehnt," sagte Johannes.
"Komm mit mir, Johannes, wir wollen das Schlüsselein vergraben."
"Ich kann nicht", seufzte Johannes betrübt.
Allein Windekind nahm ihn bei der Hand, und er fühlte, wie er, leichter noch als der Samen einer Pferdeblume, durch die stillen Abendlüfte davonschwebte.
"Windekind", sagte Johannes während des Schwebens, "ich habe dich doch so lieb. Ich glaube, daß ich alle Menschen für dich hergeben möchte und Presto auch."
Windekind sagte: "Und Simon?"
"Ach, dem Simon liegt nicht so viel daran, ob ich ihn lieb habe oder nicht. Ich glaube, daß er das zu kindisch findet. Simon liebt nur die Fischfrau, und auch nur dann, wenn er gerade Hunger hat. Glaubst du, daß Simon ein ganz gewöhnlicher Kater ist, Windekind?"
"Nein, früher ist er ein Mensch gewesen."
Huh, huh! bums! – da prallte ein dicker Maikäfer gerade gegen den kleinen Johannes.
"Kannst du denn nicht besser aus den Augen sehen?" brummte der Maikäfer. "Das Elfenvolk fliegt nur so umher als ob es den ganzen Himmel in Pacht genommen hätte. Das hat man von solchen Nichtstuern, die immerfort nur zu ihrem Vergnügen herumschwirren. Unsereiner, der wie ich seine Pflicht tut, der immerwährend Nahrung sucht und so viel frißt wie er nur eben vermag, gerät dadurch ganz außer Kurs."
Unter lautem Gesumme flog er weiter.
"Nimmt er es uns übel, daß wir nicht essen?" fragte Johannes.
"Ja, das ist nun einmal Maikäfergewohnheit. Bei den Maikäfern wird es als die höchste Pflicht erachtet viel zu essen. Soll ich dir einmal die Geschichte eines jungen Maikäfers erzählen?"
"Ach ja, Windekind, tue das."
"Es war einmal ein schöner, junger Maikäfer, der eben erst aus der Erde hervorgekrochen war. Nun, und das war für ihn eine große Überraschung. Ein ganzes Jahr lang hatte er unter der dunklen Erde gesteckt und auf den ersten warmen Abend gewartet. Und als er seinen Kopf aus den Erdschollen hervorstreckte, da brachten ihn all die wogenden Grashalme und das junge Grün und die singenden Vögel gänzlich in Verwirrung. Er wußte nicht, was er eigentlich anfangen sollte. Er betastete die kleinen Grashalme rings umher mit seinen Fühlhörnern, die er fächerförmig ausbreitete. Daran merkte er, Johannes, daß er ein Männchen war. Er war in seiner Art sehr schön, hatte glänzende schwarze Beine, einen dicken bestäubten Hinterleib und einen Brustschild, der wie ein Spiegel glänzte. – Zum Glück traf er schon bald in ganz geringer Entfernung einen anderen Maikäfer, der zwar nicht so schön, dafür aber um einen Tag früher ausgeflogen und infolgedessen schon sehr alt war. Bescheiden und zaghaft, weil er noch gar so jung, rief er diesen an.
"Was gibt's Freundchen?" antwortete der zweite, sehr von oben herab, weil er sofort sah, daß er es mit einem Neuling zu tun hatte, "wolltest du mich nach dem Weg fragen?"
"Ach nein, das nicht," sagte der Jüngere sehr höflich, "aber ich weiß nicht, was ich hier eigentlich anfangen soll. Was treibt man denn so als Maikäfer?"
"So, so," sagte der andere, "also das weißt du nicht? Nun, ich nehme dir das nicht weiter übel, denn ich bin selber auch so gewesen. Nun höre mir mal aufmerksam zu, dann werde ich es dir sagen. Das Wichtigste in einem Maikäferdasein ist das Fressen. Nicht weit von hier ist ein köstlicher Lindenhag, der ist um unsretwillen dort hingepflanzt, damit wir so fleißig wie möglich davon essen."
"Wer hat den Lindenhag denn dorthin gepflanzt?" fragte der junge Käfer.
"Ei nun, ein großes Wesen, das es sehr gut mit uns meint. Jeden Morgen kommt es an dem Hag vorüber, und die, die am meisten gefressen haben, nimmt es mit sich in ein herrliches Haus, wo ein schönes helles Licht leuchtet und wo alle Maikäfer glücklich beisammen leben. Wer aber, anstatt zu fressen, während der ganzen Nacht umherfliegt, der wird von der Fledermaus eingefangen."
"Wer ist das?" fragte der Neuling.
"O, das ist ein furchtbares Ungeheuer mit scharfen Zähnen; es kommt ganz plötzlich hinter uns hergeflattert und frißt uns unter abscheulichem Gekrache auf. Während der Käfer dies sagte, hörten sie über sich ein schrilles Piepen, das ihnen durch Mark und Bein ging. "Huh, da ist sie", rief der Ältere, "nimm dich vor ihr in acht, junger Freund, und sei mir dankbar, daß ich dich bei Zeiten gewarnt habe. Du hast eine ganze Nacht vor dir, vergeude sie ja nicht. Je weniger du frißt, desto mehr Gefahr läufst du, von der Fledermaus verschlungen zu werden. Und nur die, die sich einen ernsten Lebensberuf erwählen, gelangen in das Haus mit dem hellen Lichtschein. Sei dessen eingedenk: einen ernsten Lebensberuf!"
Darauf kroch der Käfer, der um einen ganzen Tag älter war, zwischen den Grashalmen weiter und ließ den andern betroffen zurück. "Weißt du, was das ist, ein ernster Lebensberuf, Johannes? Nicht? Nun also, das eben wußte der junge Käfer auch nicht. So viel begriff er wohl, daß es mit dem Essen in irgend einem Zusammenhang stand. Wie aber sollte er zu dem Lindenhag gelangen? Dicht neben ihm strebte ein schlanker kräftiger Grashalm empor, der sich leicht im Abendwinde wiegte. An den klammerte er sich so fest wie möglich mit seinen sechs krummen Beinchen. Von unten gesehen, schien er ein hoher Koloß zu sein, und außerdem recht steil; dennoch wollte der Maikäfer hinauf.
"Das ist ein Lebensberuf!" dachte er und begann mutig emporzuklimmen. Es ging langsam – unzählige Male rutschte er zurück, kam aber dennoch vorwärts; und als er endlich die höchste Spitze erklommen hatte und sich hoch oben auf ihr schaukelte und wiegte, da fühlte er sich zufrieden und glücklich. Was für eine Aussicht hatte er von dort! Ihm war es, als überschaue er die ganze Welt. Wie selig war es, so an allen Seiten von Luft und Himmel umgeben zu sein! Gierig zog er den Hinterleib voll. Wie wunderlich ward ihm dabei zu Mute! Er wollte noch höher hinauf.
Voller Entzücken lüftete er die Deckschilder und ließ die Flügel einen Augenblick erzittern – höher wollte er hinauf! noch höher! – Wiederum erzitterten seine Flügel – die Beinchen ließen den Grashalm los und – o Wonne! ... hu huh! da flog er – frei und fröhlich durch die stille warme Abendluft."
"Und dann?" fragte Johannes.
"Was dann geschah, das ist nicht lustig. Das will ich dir lieber später einmal erzählen."
Sie waren während dessen über den Teich dahingeflogen. Ein paar verspätete weiße Falterchen begleiteten sie flatternd.
"Wohin geht die Reise, ihr Elfen?" fragten sie.
"Zu der großen Dünenrose, die dort drüben am Abhang blüht."
"Wir gehen mit, wir gehen mit."
Von weitem schon war sie sichtbar mit ihren unzähligen, mattgelben seidenweichen Blüten. Die Knospen waren leicht gerötet und die geöffneten Blumen zeigten schmale rote Streifen, als Merkmale aus jener Zeit, da sie noch Knospen waren.
In einsamer Ruhe blühte die wilde Dünenrose und erfüllte die ganze Luft mit ihren wundersüßen Düften. So köstlich sind die, daß die Dünenelfen von ihnen allein sich nähren.
Die Falter flogen auf sie zu und küßten eine Blüte nach der andern.
"Wir kommen, um dir einen Schatz anzuvertrauen," rief Windekind, "willst du ihn uns behüten?"
"Warum denn nicht? warum denn nicht?" flüsterte die Dünenrose. Gerne will ich ihn bewachen, und niemals gedenke ich von hier fortzugehen, wenn man mich nicht holt. Auch habe ich scharfe Dornen."
Da kam die Feldmaus, die Base jenes Mäuschens, das in der Schule gewesen, und grub unter den Wurzeln der Rose einen tiefen Gang und trug das Schlüsselchen hinein.
"Wenn du es nun wieder haben willst, dann mußt du mich nur rufen. Du brauchst der Rose dann keinerlei Schaden zuzufügen."
Die Rose schloß ihre dornigen Zweige dicht über dem Eingang zusammen und gelobte feierlich das Schlüsselein getreulich zu behüten. Die kleinen Falter waren Zeugen.
Am nächsten Morgen erwachte Johannes in seinem eigenen Bettchen, bei Presto, der Uhr und der Tapete. Die Schnur, die er um den Hals getragen, war verschwunden und auch das Schlüsselein, das daran gehangen hatte.
"Sapperlot, wie ist solch ein Sommer doch schauderhaft langweilig!" seufzte einer der großen Öfen, die auf dem Boden des alten Hauses in einem dunklen Winkel griesgrämig beisammen standen. "Seit Wochen schon habe ich keine lebende Seele mehr gesehen und kein vernünftiges Wort gehört. Und dazu diese innere Leere! Es ist geradezu abscheulich."
"Ich bin ganz mit Spinngeweben bedeckt," sagte der zweite, "das könnte mir während des Winters auch nicht passieren."