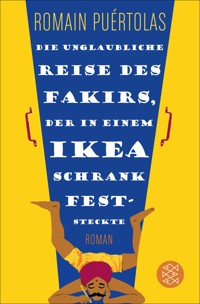9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein köstlicher Moment folgt auf den anderen, doch Romain Puértolas zeigt auch, welch wirksame Waffe der Humor sein kann.« Le Soir Er ist wieder da! Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, wird von einem norwegischen Fischer aus den Wassern des Polarmeers gezogen – gut konserviert in einem Eisklumpen. Wieder aufgetaut, zeigt Napoleon sich quicklebendig und voller Tatendrang: Es gilt, die Erfindungen der letzten zweihundert Jahre (allen voran das Internet, Cola Light und ein Ferrari) zu erkunden und einen wohlverdienten Urlaub auf Korsika zu machen. Doch dazu bleibt keine Zeit, denn in Paris geschieht ein Attentat. Die Franzosen brauchen ihren Kaiser! Napoleon stellt eine kleine Grande Armée zusammen – darunter fünf Cancan-Tänzerinnen, ein Straßenfeger und der Imam von Paris –, um Frankreich zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Romain Puértolas
Der kleine Kaiser ist zurück
Roman
Aus dem Französischen von Maja Ueberle-Pfaff
Atlantik
Für Papa, ein Genie des Krieges,
für Mama, ein Genie des Feierns
Jeden Tag ein Abenteuer mit Käpt’n Iglo!
Werbung aus den achtziger Jahren
Das Herz, das ist so etwas wie ein großer Hut.
Napoleon Bonaparte
Napoleon entdeckt die Cola light
Das erste Wort, das Napoleon Bonaparte von sich gab, als ihn Flug SK0407 der Scandinavian Airlines nach einer Abwesenheit von zwei Jahrhunderten nach Frankreich zurückbrachte, war ein amerikanisches.
»Coca-Cola.«
Dieses Wort hatte für ihn noch keinerlei Bedeutung, es war nichts weiter als ein merkwürdiger Schnörkel aus weißen Buchstaben, der sich über den roten Grund der komischen geschwungenen Trinkflasche zog, die auf dem Tablett seines Sitznachbarn stand. Und als die Flugbegleiterin, eine hochgewachsene Blondine, die sich in eine viel zu enge blaue Uniform gezwängt hatte und ein Hütchen in Form einer Camembert-Schachtel trug, in der Schublade ihres Wägelchens kramte, wiederholte er das Wort mit leiser Stimme, wie eine Beschwörungsformel, um sein Wesen zu ergründen und dem Geschmack des schwärzlichen Gebräus auf die Spur zu kommen, das in dem Becher neben ihm sprudelte und ihn an die Funkengarben erinnerte, die an jenem lang vergangenen Nachmittag des 14. Juli 1789 die Festung der Bastille illuminiert hatten. Er war damals erst zwanzig gewesen, aber er hatte es nie vergessen.
Coca-Cola.
Der Exkaiser hätte nie geglaubt, dass er jemals wieder gezwungen sein würde, Englisch zu sprechen. Zum einen, weil er sich für tot gehalten hatte und die Toten, bis zum Beweis des Gegenteils, weder die Sprache Shakespeares noch irgendeine andere Sprache sprechen, zum anderen, weil er gegenüber dem Volk mit den rosigen Wangen und dem oberlehrerhaften Akzent einen grenzenlosen Groll empfand, den die langen Jahre in Krieg und Exil nur noch verschärft hatten.
»Normal, Zero, light, Cherry? Mit oder ohne Eis? Ein Scheibchen Zitrone? Eine grüne Olive? Ein Cocktailschirmchen?«, fragte die Flugbegleiterin in ihrem überkorrekten Französisch und lächelte strahlend, über die kleine, bartlose Person gebeugt, die so tief in ihrem Sitz versunken war, dass sie fast wie ein Kind wirkte.
Und da sich Napoleon während seiner Karriere als großer Eroberer immer alles genommen hatte, was sich ihm bot, verlangte er eine »Cola normal, Zero, light, Cherry, mit Eis, einem Scheibchen Zitrone, einer grünen Olive und einem Cocktailschirmchen« und wartete darauf, dass man ihm alles servierte.
Wie er es gewohnt war.
Der wunderbare Fischzug
Zwei Wochen zuvor hatte der norwegische Kutter Usenkbare vor der norwegischen Küste mit seinen Netzen zwei riesige Holzkisten aus dem Meer gehoben, in denen die Fischer zu ihrer großen Verwunderung einen Menschen und ein Pferd entdeckt hatten. In den dreißig Jahren, die sie das Meer vor Norwegen durchkämmten, war ihnen so einiges an Müll ins Netz geraten. Einzelne Schuhe, Schirme mit geknickten Streben, leere Benzinkanister und Plastiktüten von Supermärkten aus der ganzen Welt. Dutzende von Plastiktüten von der Sorte, die dem Meer noch Jahrhunderte im Magen liegen würde; die Tüten schenkten sie Mårten, dem Sohn des Dorfkrämers Gunnfrød. Er hatte angefangen, sie zu sammeln. Die geographischen Kenntnisse des Jugendlichen beschränkten sich allerdings auf die Logos der verschiedenen Marken, die er an seine Zimmerwände pinnte. Carrefour, Tesco, Lidl, Neukauf, Walmart, Ikea, Amazon, Migros, Aldi, Penny, jede Menge exotischer Namen, die auf seine geblümte Tapete – und in seinen Kopf – die Umrisse eines neuen Kontinents zeichneten. Diese Reise um die Welt in vierundzwanzig Markennamen wäre eine sehr sympathische Sache gewesen, hätte sie nicht für Mårten in der Schule ärgerliche Folgen gehabt. Der Lehrer sollte sich sein Leben lang an die Prüfung erinnern, bei der er seine Schüler aufgefordert hatte, die bedeutendsten Denkmäler der europäischen Hauptstädte aufzuzählen. Auf dem Blatt des Krämersohnes standen statt Eiffelturm, Big Ben und Brandenburger Tor Neukauf, Ikea und Lidl.
Einmal hatten die Fischer sogar eine Volvo-Tür in ihrem Netz gefunden, ein anderes Mal einen Motor, mehrere Autoreifen, aber niemals genug Teile für ein vollständiges Automobil. Und das wäre bitter nötig gewesen, denn der alte Škoda von Kapitän Vebjørn Hansen hatte zwei Jahre zuvor den Geist aufgegeben, und der Käpt’n hatte aufs Fahrrad umsteigen müssen.
Ja, sie hatten schon ziemlich merkwürdiges Zeug herausgefischt, aber bei Gott noch nie zwei riesengroße Kisten mit einem Menschen und einem Pferd.
Die vier Norweger, schwer verblüfft angesichts ihres Funds, hatten den Körper sofort aus seinem Sarg gehoben, um ihn aus der Nähe untersuchen zu können, und vorläufig das Pferd vernachlässigt, denn ein Gaul war schließlich nur ein Gaul, und der hier würde gewiss nicht so schnell davongaloppieren.
Der Gesichtsausdruck des Mannes war heiter, und hätte man ihn nicht in einer Kiste in den eisigen Gewässern vor der isländischen Küste gefunden, in fast hundert Metern Tiefe, so hätte man meinen können, er schliefe den erholsamen Schlaf des Gerechten. Zweifellos waren eben diese eisigen Gewässer für seinen bemerkenswert guten Zustand verantwortlich.
Die Fischer hatten ihn auf ein Kabeljaupolster gelegt. Vorsichtig. Mehr wegen der Kabeljaus, die sie zu einem guten Preis an einen Marktführer im Bereich Tiefkühlkost mit Namen Iglo verkauften, als wegen des Leichnams, von dem man sich keinerlei Nutzen versprach. Nach der Anzahl der Fische zu urteilen, die er verdeckte, schien der Mann recht klein zu sein. »Ein Meter achtundsechzig!«, hatte der Kapitän der Usenkbare gestaunt, der es gewohnt war, mit einem einzigen Blick die Größe seines Fangs abzuschätzen. Die Kleidung des Mannes – ein weites, naturfarbenes Hemd, das mit bräunlich verfärbten Blutflecken gesprenkelt war, eine seltsam geformte Hose und zierliche Schnallenschuhe – sah aus, als stammte sie aus einem früheren Jahrhundert. Und nachdem der Kapitän einem seiner Männer befohlen hatte, Kurs auf den Hafen zu nehmen, hatte die Besatzung ihre Vermutungen geäußert. Ein Österreicher!, hatte ein Fischer versichert. Ein deutscher Offizier!, hatte ein anderer behauptet. Doch dann hatte der Kapitän die Aufmerksamkeit auf die schwarzen Haare des Verstorbenen und seine geringe Körpergröße gelenkt.
»Ein Südländer. Ein Spanier oder Italiener. Vielleicht sogar ein Franzose.«
»Sehen Sie sich das an, Käpt’n«, rief ein dritter Fischer, der sich durch die zuckenden Fische hindurch einen Weg bis zu der größeren der beiden Kisten gebahnt hatte.
Neben dem Pferd kniend, strich er mit seiner rissigen Handfläche über das weiche Fell des Tieres. Vebjørn Hansen stellte sich neben ihn. Er begutachtete die kostbare rote Samtschabracke. Das hier war kein Unbekannter. An der Seite war mit Goldfäden ein N eingestickt, von einem Sonnenkranz umgeben. Derselbe Buchstabe, von einer Krone überwölbt, fand sich als Brandzeichen auf der linken Hinterhand. Dieses Symbol kannte er nur zu gut.
»Leute, wenn der Mann da nicht Napoleon Bonaparte ist, fresse ich mein Boot!«, erklärte der Bärtige kopfschüttelnd.
Napoleon? Die Matrosen starrten ihn mit kugelfischrunden Augen und offenem Mund an, aber sie wussten auch, wie brennend sich der alte Seebär für die französische Geschichte interessierte.
»Der Napoleon, meinen Sie?«
»So viel ich weiß, gibt es keine sechsunddreißig!«
Tatsächlich hatte es in Frankreich nur vier gegeben.
Im Hafen hatten sie dann klammheimlich ihre wertvolle Fracht entladen. Und so kam es, dass der Kaiser und Le Vizir, sein treues Ross, in der Eiskammer des Unternehmens Hansen og Sønn gelandet waren, inmitten von Kabeljaus, die bald in hübschen recycelbaren Verpackungen die Regale der französischen Supermärkte schmücken würden. Laut Kapitän mussten sich die beiden tiefgekühlten Körper langsam an die neue Temperatur anpassen, die, wenn auch niedrig für jeden Menschen, der das norwegische Klima nicht gewohnt war – und ausgesprochen niedrig für einen Korsen –, doch noch eher der Temperatur entsprach, in der sie sich bis dahin befunden hatten. Zwei Wochen lang waren also der Franzose und sein Pferd langsam im Kühlraum aufgetaut, geschützt vor neugierigen Blicken und getreulich bewacht von Vebjørn und seinem Sohn.
Niemand hatte je einen solchen Temperaturwechsel überlebt. Niemand außer Napoleon, der schon ganz andere Dinge überlebt hatte. Was war schließlich ein Kühlraum im Vergleich zur Beresina im tiefsten Winter?
Was man über Napoleon weiß
»Sie wollen also eine Cola normal Zero light Cherry mit Eis, einem Zitronenscheibchen, einer grünen Olive und einem Cocktailschirmchen?«, wiederholte die Flugbegleiterin. »Stimmt das so?«
Napoleon nickte, und sie brach in ein glockenhelles Gelächter aus.
»Sind Sie unersättlich oder einfach nur unentschlossen?«, fragte sie mit neckischem Unterton.
Kapitän Vebjørn Hansen, der Mann mit dem blonden Rauschebart, der links neben dem Kaiser der Franzosen saß, legte diesem rasch die Hand auf den Arm, damit er nicht noch mehr sagte, und entschuldigte sich bei der jungen Frau mit der Erklärung, es sei die erste Flugreise seines Sitznachbarn.
»Machen Sie sich keine Gedanken«, beruhigte ihn die Flugbegleiterin mit ihrem unentwegten Lächeln, »ich bin an so etwas gewöhnt.«
Dann goss sie dem Fluggast, den sie für ein Kind hielt, auf Anweisung des Rauschebarts, den sie für seinen Vater hielt, eine Cola light ein.
»Guillotine!«
Napoleon war ein Mann der Tat. Er mochte keine langen Sätze, sondern äußerte sich schnell und knapp.
»Wie bitte?«
»Fassen Sie mich nie wieder an!«, fuhr der Kaiser den norwegischen Fischer an, als die Flugbegleiterin weitergegangen war und dabei zehn Sitzreihen mit ihrem billigen Parfüm eingenebelt hatte. »Sonst gebe ich Order, Sie auf der Stelle zu guillotinieren!«
»Es tut mir sehr leid, Sire, aber ich hatte keine andere Wahl«, rechtfertigte sich der Kapitän in seinem gezischelten Nordfranzösisch mit skandinavischem Einschlag. »Es gibt Dinge, deren Funktionsweise Sie noch nicht kennen, und Ihre Drohung mit der Guillotine in unserem Zeitalter des Gesinnungs-Sozialismus ist der Beweis dafür. In Ihrem Land wird sie, glaube ich, seit den siebziger Jahren nicht mehr angewendet.«
»1870?«
»1970«, korrigierte der Seemann. »Ein solcher Irrtum Ihrerseits könnte uns teuer zu stehen kommen. Deshalb möchte ich Sie bitten, künftig so wenig wie möglich mit Unbekannten zu sprechen. Muss ich Sie daran erinnern, dass wir inkognito reisen und es wichtig ist, dass man Sie für einen modernen Menschen hält? In wenigen Stunden werden Sie auf Korsika sein. Danach werden Sie einen zweiten, wohlverdienten Ruhestand antreten, fernab des Weltgeschehens und geschützt vor neugierigen Menschen, und dann können Sie tun, was immer Ihnen beliebt.«
Die Worte des Fischers hallten in Napoleon nach. Nein, es war nicht nötig, ihn daran zu erinnern. Dieses war nicht sein Jahrhundert. Das hatte er nicht vergessen. Wie hätte das auch möglich sein sollen? Was ihm in den vergangenen vierundzwanzig Stunden widerfahren war, grenzte ans Übernatürliche. Er hatte die Augen aufgeschlagen und festgestellt, dass er auf einer Fischtheke lag, in einem Kühlraum. Ein bärtiger Kretin hatte sich über ihn gebeugt – er hatte das Bild noch genau vor Augen – und ihm in gebrochenem Französisch ein heiteres »Willkommen im 21. Jahrhundert« entgegengerufen. Man musste schon ganz schön hart im Nehmen sein, wenn man es schaffte, sich so etwas seelenruhig anzuhören, vor allem, wenn auf dem letzten Kalender, auf den er einen Blick geworfen hatte, dem mit hübschen Stichen verzierten Almanach des Postes, noch die Jahreszahl 1821 stand.
Napoleon hatte Hansen sofort als Skandinavier identifiziert. Der Kapitän ähnelte ganz und gar nicht den Männern, die die Britische Insel bewohnten, auf die man ihn verschleppt hatte, damit er dort den Rest seiner Tage absaß. Die Inselmänner hatten einen rosigen Teint, sie wurden beim geringsten Sonnenstrahl rot wie gekochte Krabben, und ihr Haar und ihr Bart ähnelten geraspelten Möhren. Haare und Bart der Nordmänner sahen eher aus wie italienische Pasta al dente.
»Im 21. Jahrhundert?«, hatte der Kaiser gefragt, der nicht recht wusste, wie er die Neuigkeit aufnehmen sollte.
»Ich weiß, Eure Majestät, das muss ein Schock sein. Für uns aber auch, wissen Sie. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ich eines Tages Napoleon I. aus dem Meer fischen würde! Übrigens entschuldige ich mich für mein Französisch, es ist ein wenig angestaubt.«
»Was soll ich da erst von meinem sagen!«
Als der Korse merkte, dass er splitternackt war, bedeckte er seinen Intimbereich rasch mit beiden Händen.
»Oh, da ist nichts mehr, was man verstecken müsste«, sagte der Fischer mit traurigem Gesicht.
»Was soll das heißen?«
Immer noch liegend, hatte der Franzose den Kopf gehoben, bis das Kinn die Brust berührte, und langsam die Finger weggenommen. Da, wo man ein männliches Geschlechtsteil erwartete, befand sich lediglich ein dichtes Gekräusel von Haaren. Ansonsten herrschte gähnende Leere.
»Ich muss Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, dass Sie seit Ihrer Autopsie im Jahre 1821 nicht mehr im Besitz Ihres Penis sind. Zunächst wurde Ihr Geschlecht in einem Museum ausgestellt, dann wurde es für 3000 Dollar bei einer Auktion von einem amerikanischen Urologen aus New Jersey ersteigert. Man kann sagen, dass er ganz schön herumgekommen ist.«
In Napoleons Blick glomm Panik auf.
»Ich verstehe nicht.«
»Bei Ihrem Tod, das heißt, als Sie ins Koma gefallen sind, weil Sie ja eigentlich nicht tot sind … das haben Sie doch verstanden, oder?«
»Ich glaube ja.«
»Denn wenn man Fischstäbchen auftaut, wird der Kabeljau nicht wieder lebendig. Zum Glück. Stellen Sie sich die Rache der panierten Fische vor, die die Welt zurückerobern wollen! Der Krieg der Welten, in der Iglo-Neufassung, mit Tom Cruise in der Rolle des Exterminators, der gegen riesige, menschenfressende Kabeljaus kämpft. Der Horror! Aber ich schweife ab. Bei Ihrem sogenannten Tod wurde also auf Anordnung des Priesters, der Ihnen die Sterbesakramente erteilte, Ihr Geschlechtsteil von dem Chirurgen Francesco Antommarchi abgetrennt, dem Sie den delikaten Auftrag erteilt hatten, Ihre sterblichen Überreste zu obduzieren.«
»Dieser Mistkerl von Vignali! Aber warum haben sie ihn mir abgeschnitten, den …«
»Wie es scheint, waren Sie und Vignali sich nicht grün. Und Ihre Reaktion bestätigt meine Vermutung.«
»Das ist noch milde ausgedrückt. Aber trotzdem muss man doch nicht gleich …«
»Es war eine gute Möglichkeit, sich an Ihnen zu rächen und nebenbei ein wenig Geld zu verdienen, und der Streit wurde auf Ihrem Rücken ausgetragen, beziehungsweise Ihrem … Dabei hat er ihn letztendlich doch nicht verkauft. Er blieb über mehrere Generationen in seiner Familie. Dann wanderte er von Hand zu Hand, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben. Unter anderem durch die eines gewissen Rosenbach, das war 1924, ein amerikanischer Büchersammler, der ihn später dem New Yorker Museum für französische Kunst lieh. 1999 kaufte ihn ein Dr. Lattimer, um seiner Liebhaberei nachzugehen.«
»Seiner Liebhaberei?«
»Wir sprechen über eine der größten Privatsammlungen historischer Gegenstände aus dem zivilen und militärischen Bereich. Zeichnungen von Hitler, Pistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, der blutbefleckte Kragen, den Präsident Lincoln trug, als er ermordet wurde. Und eben auch Ihr Penis, den er offenbar in einer Keksdose unter dem Bett aufbewahrte.«
Napoleon hatte keine Ahnung, wer dieser Hitler oder dieser Lincoln war, und noch weniger, was es mit dem Zweiten Weltkrieg auf sich hatte (er war noch nicht einmal über den Ersten informiert worden), aber er wusste genau, was eine Keksdose war, und die Vorstellung, dass sein Geschlechtsteil in einer gelandet war, amüsierte ihn ganz und gar nicht. Doch er beschloss, über dieses Detail hinwegzugehen, denn immerhin schien sein Geschlechtsorgan, das versteigert und in Museen ausgestellt worden war, zu einem Objekt der Verehrung und Wertschätzung geworden zu sein.
»Na ja, ist kein Grund, sich aufzuregen. Sie waren ja berühmt dafür, dass Sie einen kleinen Penis hatten«, fuhr der norwegische Fischkutterkapitän mit dem Taktgefühl eines norwegischen Fischkutterkapitäns fort. »Es heißt sogar, aus psychoanalytischer Sicht sei es sehr interessant, dass ein Mann, der so viele große Dinge erreicht hat, ein so … unauffälliges Geschlechtsteil hatte. Freud hat daraus die Grundzüge einer Theorie entwickelt, die sich auf der ganzen Welt verbreitet hat.«
Napoleon verschlug es die Sprache. Er begnügte sich damit, die Fingernägel in das Leder der Armstützen zu bohren.
»Glauben Sie mir, es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen das alles so um die Ohren hauen muss, aber ich halte es für meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, was meine Zeitgenossen über Sie wissen, bevor Sie es von Google erfahren.«
»Von wem?«
»Google, Internet. Eine Art große Enzyklopädie des menschlichen Wissens.«
»Wie die von Diderot und d’Alembert? Das ist interessant, Sie wissen besser über mich Bescheid als ich selbst. Wenn man Ihnen zuhört, mag man gar nicht glauben, dass Sie nur ein ganz ordinärer Fischer aus dem hintersten Winkel von Norwegen sind.«
Der Mann verfärbte sich.
»Das hindert mich nicht daran, mich unschlagbar gut in der Geschichte Frankreichs auszukennen«, wandte er ein, »und damit auch in allem, was Sie betrifft. Während des Krieges hat mein Vater eine Zeit lang bei der französischen Marine gearbeitet, und so hat sich bei mir ein gewisses Interesse für die Seeschlachten Ihres Landes entwickelt.«
Der Kaiser erschauerte bei dem Gedanken, dass dieser Mann nur seine Misserfolge kannte, von der Schlacht bei Trafalgar bis zu den Kapverden, von der Île-d’Aix bis Abukir. Zu Wasser hatte Napoleon sechzehn Niederlagen und zwei Siege zu verzeichnen. Ein Rekord, eher eines Fußballclubs wie Olympique Marseille würdig als eines Kriegshelden.
»Und außerdem müssen Sie heutzutage nur Ihren Namen in Wikipedia eingeben und erfahren alles über sich.«
»Dann ist es das, was das französische Volk von mir behalten hat?«, fragte der Aufgetaute nachdenklich. »Eine Niete in punkto Seeschlachten, in der Hose ein Minipenis?«
»Oh nein! Seien Sie unbesorgt, es wird auch viel über Ihre Hämorrhoiden gesprochen. Ich scherze. Ihre militärischen Leistungen sind weltberühmt. Man hat Sie als brillanten Kopf, klugen Taktiker und einen der größten französischen Generäle in Erinnerung behalten. Ihr Land verdankt Ihnen Hunderte von Reformen, neuen Gesetzen und eines der besten Bildungssysteme der Welt. Gymnasien, das Abitur, die Ehrenlegion, die Banque de France, das alles geht auf Sie zurück. Sie haben sämtliche Völker fasziniert und waren eine geistige Inspirationsquelle für zahlreiche Staatschefs. Neuerdings werden Sie sogar in Management-Seminaren als Role Model genannt. Sie werden in einem Atemzug mit Paulo Coelho und Sun Tsu genannt, wenn Angestellte motiviert werden sollen. Von McDonald’s bis IBM. Nein, ganz ehrlich, man stößt sich nicht an dieser … dieser …«
Hansen deutete auf Napoleons Schritt.
»… an dieser Winzigkeit. Wissen Sie, es gibt sogar Leute, die dafür zahlen. Vor allem die Brasilianer. Und außerdem brauchen Sie ihn ja für Ihren Ruhestand im sonnigen Süden auch nicht. Korsika erwartet Sie! Denken Sie an das süße Nichtstun, an Abende beim Boulespiel, an die Wurstwaren …«
»Korsika«, wiederholte Napoleon mit einem glückseligen Lächeln auf den Lippen, als würde allein der Klang dieses Wortes mit einem Schlag all die eben gehörten Grässlichkeiten auslöschen.
Zur Feier des Tages trank er den ersten Schluck Cola seines Lebens und wäre fast erstickt.
Eine glanzvolle Ära
Während sich Napoleon mit einer Papierserviette die kaiserlichen Nasenlöcher abtupfte, aus denen die Sprudelbläschen ebenso schnell wieder herauskamen, wie sie hineingekommen waren, biss Vebjørn Hansen herzhaft in einen Schokoriegel, der nach dem König der Tiere benannt war.
»Wissen Sie, was ich dachte, als ich Sie gefunden habe, Sie und Ihr Pferd, mitten im Europäischen Nordmeer?«
»Nein.«
»Dass Sie der größte Fisch und das größte Seepferdchen sind, die mir je ins Netz gegangen sind«, antwortete der Seemann mit einem breiten Lächeln, bei dem sich sein Nikolausbart verformte. »Es gibt nämlich einen Fisch namens Kaiserbarsch, auch Hoplostethus atlanticus genannt.«
Der Korse lächelte höflich, obwohl er dem etwas platten Humor des Fischers nichts abgewinnen konnte. Sein Blick schweifte durch das Fenster auf die ausgedehnte weiße Wolkendecke. Es gab in der gegenwärtigen Ära viel Interessanteres als den Kaiserbarsch. Dieses Flugzeug zum Beispiel. Wie konnte eine Maschine, in der er zusammen mit hundertfünfzig anderen Personen saß, eine Geschwindigkeit von achthundert Stundenkilometern erreichen? Napoleon war sehr intelligent, aber das ging über seinen Horizont. Es war das Zehnfache der Geschwindigkeit, die Marengo, das stärkste seiner Pferde, erreichte. Der Fischer hatte ihm gesagt, die Reise dauere nur drei Stunden. Drei mickrige Stunden von Norwegen nach Frankreich. Das war unglaublich! Zu seiner Zeit hätte die Reise mehrere Tage gedauert. Der Kaiser betrachtete die Flügel der Maschine. Anders als bei den Vögeln, flatterten sie nicht. Woher kam dann diese unsichtbare Kraft, die das Flugzeug in den Himmel schleuderte? Berührte wirklich kein Teil der stählernen Konstruktion den Erdboden? Es war eine großartige Erfindung, eine phantastische Kriegsmaschine, die man gut bei Trafalgar gegen die englische Flotte und diesen Hundsfott Nelson hätte einsetzen können. Oh ja, hätte er in dieser Schlacht Flugzeuge gehabt, wäre die Sache ganz anders ausgegangen! Was gab es Besseres als einen Angriff aus den Wolken? Man war unerreichbar. Die Welt lag einem zu Füßen. Und die Schlachtschiffe der Engländer waren lächerliche, winzig kleine Ameisen, ganz weit unten.
»Als ich Sie gefunden habe, Sire«, fing der Skandinavier wieder an, »wusste ich zuerst nicht, was ich mit Ihnen anfangen sollte. Was tun, wenn Sie erst einmal aufgetaut waren? Was würde passieren, wenn Sie noch am Leben waren? Stellen Sie sich diese Verantwortung vor! Mein Sohn hat mir spaßeshalber vorgeschlagen, doch einmal ›Napoleon wiedergefunden‹ zu googeln. Verrückt, was? Aber es hat funktioniert. Wir haben eine Webseite gefunden, die BUH hieß, www.napobuh.com. Dabei handelt es sich um den Bund der Unglücklichen Haudegen, eine alte korsische Organisation, die einige Zeit vor Ihrem Tod gegründet wurde. Früher hätte ich so etwas für eine Farce gehalten. Doch unter den gegebenen Umständen habe ich dort angerufen.«
Sieh mal einer an, neuerdings beschäftigten sich die Fischer in ihrer Freizeit mit der Lektüre von Enzyklopädien, dachte Napoleon amüsiert. In der heutigen Welt war offenbar der primitivste Sardinenfischer nicht weniger gebildet als der intelligenteste seiner Offiziere.
»Sie können sich vorstellen, wie sehr sie sich gefreut haben«, fuhr der Kapitän fort. »Sie haben seit Jahren auf diesen Augenblick gewartet, ach, was sage ich, seit Jahrhunderten! Sie haben mich aufgefordert, Sie wenigstens nach Paris zu bringen, zum Flughafen. Dort würden sie dann übernehmen. Sie haben mir sogar einen Pass geschickt, damit Sie problemlos die Kontrollpunkte passieren können. Ein gewisser Professor Bartoli erwartet Sie und wird Sie nach Korsika begleiten. Mehr haben sie mir nicht gesagt. Ich würde Ihnen gern erklären, wie Sie von der Insel St. Helena nach Norwegen gekommen sind, aber ich habe selbst nicht die geringste Ahnung. Alle vermuten Sie im Invalidendom, in Paris. Das heißt, Ihre Asche …«
»Invalidendom«, wiederholte der kleine Korse versonnen, und sein Gesicht leuchtete auf wie ein Weihnachtsbaum.
Sie hatten sich also an seine Verfügungen gehalten. Diese Nachricht ging ihm ans Herz. Viele schöne Erinnerungen wurden wach. Er dachte an die prunkvolle Zeremonie anlässlich der allerersten Verleihung der Orden der Ehrenlegion. Das war am 15. Juli 1804 gewesen. Von Licht umflossen hatte er auf seinem Thron gesessen. Aus Goldfäden gestickte Bienen hatten am Krönungstag seinen Mantel geschmückt. Aus der königlichen war eine kaiserliche Biene geworden. Die Bienen waren überall, auf Mänteln, Vorhängen, Wänden. Gestickt, modelliert. Zwei große Becken voller Orden standen zu Füßen des Kaisers, der im Chor thronte; in dem einen befanden sich die Orden in Gold für die Großoffiziere, Kommandeure und einfachen Offiziere, in dem anderen die silbernen für die Ritter. Er erinnerte sich, wie er die funkelnden Auszeichnungen an die Brust der verdienten Männer geheftet hatte. Armeeangehörige, Kirchenmänner, Wissenschaftler, Ärzte, aber auch Maler, Musiker – alle, die mit ihm gemeinsam ihren Beitrag zum Ruhm und zur Größe Frankreichs geleistet hatten. Er sah Joséphine vor sich, in diesem summenden Bienenhaus, im Kreis ihrer Hofdamen, herrlich und glanzvoll wie tausend Sonnen.
»Ich denke, Professor Bartoli wird Ihnen mehr darüber erzählen können.«
Der Kaiser seufzte. Hätte man ihn verbrannt, wie vorgesehen, wäre er nie in den Genuss gekommen, nach so vielen Jahren wieder ins Leben zurückzukehren und sein schönes Land wiederzusehen. Ihm wäre auch die Chance entgangen, Coca-Cola zu entdecken. Ah, hätte es Cola light nur zu seiner Zeit schon gegeben, dann wäre die Schlacht von Waterloo ganz anders ausgegangen! Sein Leben lang hatte er nur Champagner und Burgunderwein getrunken, genauer gesagt, fünf Jahre alten Chambertin, sein Lebenselixier, eine halbe Flasche zu jeder Mahlzeit, geliefert vom Haus Soupé et Pierrugues (was wohl aus denen geworden war?) an jeden beliebigen Ort, in die Stadt oder aufs Land, bei der Liebe oder im Krieg. Das Paradies zu sechs Francs pro Flasche. Er erinnerte sich mit Abscheu an den Clairet, an den er sich während seines Exils auf St. Helena zähneknirschend hatte gewöhnen müssen. Ein echter Rachenputzer. Um den bitteren Geschmack der Erinnerung zu vertreiben, bestellte Napoleon noch eine Dose Cola. Dieses Gebräu hatte den wohltuenden Effekt, kurzfristig die Magenschmerzen zu lindern, unter denen er litt, seit er denken konnte. Ein wahrer Zaubertrank.
»Es ist weit mehr als ein simples Getränk, ich betrachte es als Heilmittel für mein Magengeschwür«, rechtfertigte sich der Kaiser. »Schade, dass es keine Auswirkungen auf die Hämorrhoiden hat …«
»Coca-Cola ein Heilmittel? Vielleicht ganz zu Anfang. Ein amerikanischer Apotheker hat es erfunden, um sich von seiner Morphiumsucht zu heilen. Und was wäre besser geeignet, eine Sucht zu heilen, als die eine durch eine andere Sucht zu ersetzen, hm? Sie können mir glauben – seit ich die Glimmstängel aufgegeben habe, rauche ich viel mehr Pfeife! Mit Cola putze ich die Türgriffe auf meinem Kutter. Es heißt, dass es Löcher brennt … Vielleicht doch nicht das allerbeste Mittel, um Magengeschwüre zu kurieren … Sie sollten Rennie nehmen.«
»Hat Google Ihnen das alles beigebracht?«
»Nein, das war die Rote Liste.«
»Sagen Sie, wie viele Seiten hat denn Ihre Enzyklopädie Internet?«
»Oh, das ist kein Buch, wie Sie es kennen. Es ist ein bisschen kompliziert. Lassen Sie es sich gelegentlich mal vorführen. Aber Sie haben recht, wir leben in einer glanzvollen Ära!«
Und nun verbreitete sich der Schiffskapitän des Längeren und Breiteren über die Sitten und Gebräuche, die Verhaltensweisen und sozialen Normen seiner Zeitgenossen aus dem 21. Jahrhundert. Die SMS, das Fernsehen, die Computer, die Krise Europas, die Arbeitslosigkeit, das Wahlrecht der Männer, dann das der Frauen, dann das der Schwarzen, das Kino, die In-vitro-Fertilisation, der Nespresso, der Busen von Sabrina, der im Videoclip Boys, boys, boys aus dem Bikinioberteil gerutscht war, die Geschichte vom kontaminierten Blut, das Recht auf ein Leben in Würde, für Männer, dann für Frauen, dann für Tiere, dann für Schwarze, dann für Homosexuelle, der Bau der Berliner Mauer, der Fall der Berliner Mauer, und dazwischen wieder der Busen von Sabrina, der bei einer Wohltätigkeitsgala, die von einem großen italienischen Fernsehsender übertragen wurde, aus dem Abendkleid gerutscht war. Und das alles hatte Napoleon verpasst!
»Aha, dann kopuliert man neuerdings mit kleinen Glasröhrchen, um Kinder zu bekommen?«, folgerte der kleine Korse, sichtlich beeindruckt.
»Gelegentlich, aber nicht immer.«
»Unglaublich.«
»Und das Bildtelefon ist Ihnen auch entgangen. Aber Sie sind gerade noch rechtzeitig zur Erfindung des Selfie-Stick wiedergekommen!«
»Hätte mir all das zu meiner Zeit bereits zur Verfügung gestanden, hätte ich die ganze Welt erobert! Daran besteht kein Zweifel. Trafalgar, Beresina, Waterloo wären Siege gewesen …«
»Ich weiß nicht, wie Ihnen ein Selfie-Stick hätte helfen können, Waterloo zu gewinnen! Aber Sie sind sehr streng mit sich, Sire. Was ist mit Austerlitz, Wagram, Jena? Das wissen auch alle. Machen Sie sich nicht fertig. Nach Ihren Siegen sind einige der schönsten Straßen von Paris benannt. Und Beresina bleibt zur Hälfte ein Erfolg, auch wenn man den Namen heutzutage in pejorativem Sinn gebraucht. Dank des Heldenmuts einer Ihrer Generäle konnten Sie der russischen Schlinge entkommen, die sich um Sie zugezogen hatte.«
»Der arme Eblé, er starb wenige Tage später, wo ich ihn doch zum Grafen ernennen wollte. Ich und die ganze Welt haben an jenem Tag einen großen Mann verloren … Der kaiserliche Bienenstock hat eine große Arbeitsbiene verloren.«
Die Erwähnung seiner Siege schien den Kaiser, der sich nie mit dem begnügte, was er hatte, sondern immer mehr wollte, nicht zu trösten. Das traf sich gut, denn das Schicksal, das häufig zu Späßen aufgelegt ist, sollte ihm eine neue Chance geben, der Liste seiner Siege einen weiteren hinzuzufügen – und dieser war nicht von schlechten Eltern.
Der Angriff der Killerbiene konnte beginnen.
Die Geburt der kleinen Biene, die einmal die Welt retten sollte
An einem Novembermorgen des Jahres 1804, wenige Wochen vor seiner Krönung, spazierte Napoleon Bonaparte, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, mit seinem zweiten Konsul Jean-Jacques Régis de Cambacérès durch die zauberhaft angelegten Alleen des Jardin du Luxembourg, als er Zeuge eines höchst unerwarteten Schauspiels wurde. Ein Mann, der als einzigen Schutz einen Strohhut trug, von dem ein Schleier über das Gesicht hing, war in eine anscheinend sehr gefährliche Tätigkeit vertieft. Mit einem einfachen Schaber kratzte er den Honig, der von einem Holzgitter tropfte, in einen Zinkeimer. Über ihm summte bedrohlich eine dichte Wolke aus Bienen. Er ließ sich von ihrem Kriegstanz jedoch nicht beeindrucken und schabte unbeirrt weiter.
»Die Biene«, sagte Napoleons Berater und deutete mit dem lackierten Nagel seines Zeigefingers auf den Bienenstock, der ein paar Meter vom Wegrand entfernt stand.
»Wie – die Biene?«
»Sie haben mich gefragt, Sire, welches Tier, neben dem Adler, sich gut für Ihr Wappen eignen würde, und ich antworte Ihnen: die Biene. Sie ist eines des ältesten Herrschaftssymbole.«
»Die Biene?«, fragte Napoleon, der nicht recht wusste, ob er die Bemerkung als Beleidigung auffassen sollte oder ob das eine weitere völlig überspannte Phantasie seines Freundes war.
Er blieb stehen und starrte seinen Begleiter so befremdet an, als hätte dieser statt seines Hutes einen Kochtopf aufgesetzt, als er am Morgen aus dem Haus ging. Aber bei Cambacérès war alles möglich.
»Ich rede von einem Adler oder von einem Löwen, und Sie erzählen mir etwas von Insekten?«, protestierte der kleine Korse. »Warum nicht gleich eine Ameise oder Kakerlake?«
»Sire, ich glaube, Sie hegen Vorurteile gegenüber Insekten, die Sie noch einmal überdenken sollten. Gehen wir doch zu dem guten Mann und bitten wir ihn, uns zu erhellen.«
Bei diesen Worten machte er Anstalten, auf den Bienenstock zuzugehen. Der zukünftige Kaiser hielt ihn am Arm zurück.
»Tun Sie das nicht, Unglücklicher! Und wenn nun eine Sie stechen würde?«
»Eine Bagatellwunde«, entgegnete sein Begleiter lächelnd.
»Und wenn alle Sie stechen?«
»Dann würde ich sterben, kein Zweifel.«
Napoleon war beeindruckt. Konnte es sein, dass sein Vertrauter, homosexuell noch dazu, mutiger war als er?
»Bleiben Sie hier«, sagte er, um nicht als Feigling zu gelten. »Sie sind mir noch von Nutzen. Es wäre doch albern, gerade dann zu sterben, wenn ich Sie zum Staatskanzler ernennen will.«
Also warteten sie. Nach einigen Minuten kam der Imker, wie Napoleon insgeheim gehofft hatte, mit dem Eimer in der Hand auf sie zu. Er erkannte den Mann, von dem ganz Frankreich sprach, zog den Hut und grüßte mit einer anmutigen Geste.
»Kosten Sie, Sire.«
Der Herrscher steckte den Finger in den Eimer und führte ihn an die Lippen. Ein wundervoll kräftiger Geschmack nach Akazienblüten breitete sich auf seiner Zunge aus.
»Köstlich«, befand er.
»Das beste Gelée royale von ganz Paris, Sire.«
»Impériale«, verbesserte Cambacérès. »Bald wird man es ›Gelée impériale‹ nennen müssen.«
Die drei Männer lächelten.
»Sagen Sie, mein Bester, welches ist Ihr Geheimnis, dass diese schrecklichen Tiere Sie nicht stechen?«
»Man beißt nicht in die Hand, die einen nährt«, antwortete der Imker, nachdem er eine Biene von seiner Schulter gepustet hatte. »Geben Sie ihnen eine hübsche, gut eingerichtete Behausung, einen selbst im Winter blütenreichen Garten, und Sie können sie gefahrlos herumscheuchen, ohne dass sie jemals ihren fürchterlichen Stachel gegen Sie erheben.«
»Ihren fürchterlichen Stachel«, wiederholte Napoleon nachdenklich. »So unauffällig und zugleich so tödlich. Mein Freund rät mir, dieses Insekt als kaiserliches Wappensymbol zu wählen. Wie ist Ihre Meinung dazu?«
»Dass Ihr Freund ein Mann von Geschmack ist, Sire.«
»Das habe ich nie bezweifelt«, log der Herrscher und warf einen schrägen Blick auf die grauen Löckchen und den von Perlen und Diamanten besetzten Gehrock seines Begleiters, den er insgeheim Tante Turlurette nannte und der an diesem Vormittag einer in die Jahre gekommenen abgetakelten Operndiva ähnelte.
Cambacérès achtete mehr auf junge Männer als auf seine Garderobe.
»Ich kann dies nur bejahen«, fuhr der Imker fort, die Gedankengänge des Herrschers unterbrechend, der nicht gleich begriff, dass der Mann sich nicht auf die extravaganten Vorlieben seines Freundes bezog. »Wissen Sie, dass der Mensch, sollten die Bienen von der Erde verschwinden, nur noch vier Jahre zu leben hätte?« Der Mann ahnte nicht, dass über ein Jahrhundert später ein deutscher Physiker namens Albert Einstein sich diese Formel aneignen würde.
Das Gespräch wurde immer interessanter. Napoleon steckte den Finger gleich noch einmal in den Eimer. Er betrachtete ein paar Sekunden die goldene Flüssigkeit, die über seine Fingerkuppe floss, und saugte sie dann so geräuschvoll ein, als schlürfe er eine Auster.
»Wollen Sie damit sagen, dass die Bienen uns retten werden?«
»Ihnen verdanken wir es, dass wir jeden Tag Nahrung haben, Euer Hochwohlgeboren. Wir verdanken ihnen über ein Drittel dessen, was wir auf unserem Teller vorfinden. Ihr Wunderwerk der Bestäubung ist für die Fortpflanzung im Pflanzenreich verantwortlich und indirekt für alle Früchte und Schätze, die uns die Natur bietet. Ohne Bienen kein Leben mehr. Und wenn Sie nach einem geeigneten Symbol Ausschau halten, so sind die Bienen ein Musterbeispiel für Organisation und Fleiß. Eine perfekte Nation, wenn man so will. Mit Herzblut bei der Arbeit, alles für das Vaterland.«
»Glauben Sie es mir nun, Sire?«, fragte der Berater, um Napoleon daran zu erinnern, dass die gute Idee von ihm stammte.
»Ihre Sprache ist viel besser entwickelt als die unsere. Eine Honigbiene kann den anderen auf einen Meter genau den Ort anzeigen, an dem sie die Blume gefunden hat, die dann zum Ziel aller wird.«
»Ein Meter? Ist das nicht eine recht beträchtliche Abweichung, proportional gesehen, für die Biene?«, fragte der künftige Kaiser.
»Sire, wenn Christoph Kolumbus nicht zufällig auf Amerika gestoßen wäre, würde er heute noch auf der Suche nach Indien durch den Atlantischen Ozean paddeln … Ein Meter ist wenig. Selbst für eine Biene.«
Darüber mussten alle drei lächeln. Cambacérès brach als Erster das Schweigen.
»Wenn meine Erinnerung aus Schulzeiten mich nicht trügt, legt die Königin die Eier ganz allein, ohne Beteiligung eines Männchens, nicht wahr?«
»Das ist zutreffend. Im Bienenstock gibt es um die 50000 Individuen, die alle von einem einzigen Weibchen abstammen, der Bienenkönigin. Das Männchen, das man ›Drohne‹ nennt, ist in dieser weiblichen Gesellschaft so etwas wie ein Paria. Da er nicht in die täglichen Pflichten eingebunden ist, wird er als Parasit betrachtet. Er hat ein schweres Leben.«
»Eine vollkommene, männerlose Gesellschaft, könnte man sagen«, schloss Cambacérès, der exakt vom Gegenteil träumte.
»Sehr schön, das war eine hochinteressante Unterhaltung«, sagte der Herrscher und setzte ihr damit ein Ende. »Vielen Dank für die wertvollen Einblicke.«
Und er setzte seinen Spaziergang fort, die Hände auf dem Rücken verschränkt, an der Seite seines zweiten Konsuls, der lächelnd neben ihm einherstolzierte, behängt mit Troddeln, Quasten und schmückendem Beiwerk aller Art. Sie waren noch keine zehn Meter gegangen, als der Imker ihnen hinterherlief.
»Sire, die Ägypter!«, rief er, nach Atem ringend. »Die Ägypter!«
»Wo sind die Ägypter?«, fragte der kleine Korse argwöhnisch und fuhr herum. Hatten ihn seine Gegner aus dem Ägyptenfeldzug womöglich bis nach Paris verfolgt? Aber hinter ihm stand – nur ein Stück entfernt – ungerührt seine Leibgarde. Keine einzige bandagierte Mumie weit und breit.
»Ich habe ganz vergessen, es Ihnen zu sagen«, keuchte der Imker. »Die Ägypter haben schon zu Pharaos Zeiten Bienenzucht betrieben. Sogar in ihren Hieroglyphen findet man Bienen.«
»Und weiter?«
»Nun, Sire, Sie sind doch auf der Suche nach einem Symbol. Für die Ägypter stand die Biene für Unsterblichkeit und Auferstehung. Nehmen Sie die Biene in Ihr Wappen auf, und Sie werden niemals sterben …«
Napoleons Miene erhellte sich, und in seine Augen trat ein neuer Glanz. Er fragte seinen Berater, wie lange es dauern würde, seine Kleidung mit Bienen zu besticken, anstelle der Lilien, die bisher die Könige traditionell auf ihrer Kleidung zur Schau trugen. Aber nein, zum Teufel, er musste jetzt schon kaiserlich handeln! Es spielte keine Rolle, wie lange es dauern würde. Er befahl, dass seine mit goldenen Bienen bestickte Garderobe ausnahmslos bis zum 2. Dezember fertig sein müsse, dem Tag seiner Krönung. Dann schritt er von dannen, die Hände auf dem Rücken, in angenehme Tagträume versunken, in denen er zum kaiserlichen Insekt wurde, das eines Tages die Welt retten und niemals sterben würde.
Napoleon begegnet einem Landsmann
Es ließ sich nicht leugnen: Ohne seinen Zweispitz war Napoleon Bonaparte nicht zu erkennen. Umso weniger, als er eine schwarze Anzugjacke, ein weißes Hemd, eine hautenge Slim-Fit-Jeans und an den Füßen ein Paar Converse trug. So bekleidet landete er in Begleitung des alten Seemanns an einem schönen Frühlingsmorgen auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle.
»Dort ist Professor Bartoli«, verkündete der Norweger, als sie vor dem nächsten Abflug-Gate standen. »Er wird Sie nach Korsika begleiten.«
Er deutete auf einen Mann um die fünfzig, ein mediterraner Typ, hochgewachsen und dünn wie Pergament, der in einen Roman von Deon Meyer vertieft war. Er entsprach voll und ganz der Fotografie, die er dem Kapitän geschickt hatte, mit dem einzigen Unterschied, dass er seinen mit Angelhaken besetzten Regenhut gegen eine etwas urbanere Kopfbedeckung eingetauscht hatte, nämlich eine Baselballcap der Lakers.
»Einer Ihrer Landsleute, ein Korse. Sie haben immer noch Tausende von Fans auf der Welt, müssen Sie wissen, die Ihr Ableben bedauern. Es gibt sogar einige, die behaupten, Sie seien noch am Leben und im Casino beim Kartenspiel mit John Lennon und Elvis Presley gesehen worden.«
Das war Blödsinn, Napoleon hätte keine Minute seiner wertvollen Zeit mit Kartenspielen vergeudet, mit Dschonle Non und El Vipressli oder sonst wem, aber damit, dass er nicht tot war, hatten sie ja recht.
Als sie sich dem Gate näherten, hob der Mann, der davor wartete, den Blick von seiner Lektüre. Seine Augen wurden rund und groß wie Untertassen.
»Unmöglich!«, stieß er hervor.
»Unmöglich ist kein französisches Wort«, antwortete Napoleon.
Bartoli beäugte den Neuankömmling wie ein Zollbeamter, der am Grenzübergang in Ventimiglia die Vuitton-Tasche eines französischen Touristen inspiziert. Das ist er, er steht tatsächlich vor mir, dachte er, der große Mann, der große Mann mit seinen 1,68 Meter … Jetzt verstand er, warum Napoleon seine geringe Körpergröße immer durch seine Gier nach Macht und Eroberungen kompensiert hatte.
»Ein königliches Vergnügen!«, erklärte er, nachdem er seine eingehende Musterung beendet hatte.
»Sie meinen wohl kaiserlich«, korrigierte Napoleon und warf einen misstrauischen Blick auf die Pranke, die der Unbekannte ihm entgegenstreckte.
»Professor Bartoli, vom BUH, dem Bund der Unglücklichen Haudegen.«
Das Wort Haudegen stimmte den Kaiser gleich milder. Seine tapferen Haudegen, seine Grognards, seine treuen Soldaten. Sie nörgelten ständig, doch das hinderte sie nicht daran, immer weiter vorzudringen, in Kälte und Schlamm, krank oder wohlauf, sie folgten ihm und triumphierten oder steckten Niederlagen ein, immer mit ihm gemeinsam auf dem Schlachtfeld.
Er ergriff die Pranke des Mannes und drückte sie herzhaft.
»Was ist das für ein Bund?«
»Das ist eine lange, haarige Geschichte. Der BUH ist eine Geheimgesellschaft, die 1821 gegründet wurde, mit der einzigen Absicht, sich Ihrer sterblichen Hülle anzunehmen und sie nach Korsika zu überführen, wo sie bestattet werden sollte.«
»Dann ist wohl nicht alles nach Plan verlaufen«, spöttelte Napoleon.
»Aus diesem Grund bin ich heute hier, Sire. Um die Mission zu vollenden, die meine Vorgänger begonnen haben.«
»Da wir schon von Mission sprechen«, unterbrach der Seemann das Gespräch, »meine ist hiermit beendet. Ich fahre nach Hause zurück. Mein Kabeljau wartet!«
»Ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass Sie Kontakt mit mir aufgenommen haben, Monsieur Hansen«, sagte Professor Bartoli mit Wärme. »Korsika ist Ihnen etwas schuldig. Sie sind dort jederzeit willkommen. Jederzeit.«
»Ihr Mittelmeer ist eine Suppe. Zu warm. Aber danke für die Einladung. Professor. Sire.«
Der alte Seebär streckte dem Kaiser die Hand entgegen, der Kraft, Respekt und Herzlichkeit in seinen Händedruck legte.
»Ich danke Ihnen, Vebjørn, dass Sie mich geborgen und aufgetaut haben.«
»Das ist mein Beruf«, erwiderte der Norweger lächelnd. »Essen Sie hin und wieder Fischstäbchen und denken Sie dabei an mich … Und genießen Sie Ihren Ruhestand. Muße ist das wahre Leben. Und Sonne. Sie sollten etwas Farbe ins Gesicht bekommen, Sie sind käsebleich.«
»Ein Zeichen von Adel.«
»Nicht mehr, Sire. Heutzutage liegt Bräune im Trend.«
Mit diesen Worten nickte der Kapitän Professor Bartoli zu, drehte sich um und verschwand im Strom der Touristen.
»Ich fasse es nicht«, sagte der Professor, als sie allein waren. »Das kommt so unerw…«
»Wo ist mein Pferd?«, unterbrach ihn der Kaiser, unbeeindruckt von der Bewunderung seines Landsmanns.
»Beunruhigen Sie sich nicht, der Amtsschimmel wiehert, aber er wird bald weitertransportiert.«
»Ich habe Sie nicht nach seinen stimmlichen Äußerungen gefragt, aber besten Dank für die Information.«
»Oh«, rief Bartoli aus, als ihm die Doppeldeutigkeit seiner Worte aufging. »Das ist nur eine Redensart dafür, dass die Bürokratie ihre Zeit braucht. Ihr Reittier wird bald zum Zielort gebracht. Sie werden es in Ajaccio wiederbekommen. Das hat nichts mit Ihrem Schimmel zu tun … ach, wie drollig!«
»Schon gut«, grummelte Napoleon, der nicht in Stimmung für Scherze war.
»Wir haben noch eine gute Stunde bis zum Boarding. Wollen Sie, dass ich Ihnen Sudoku beibringe? Es ist lustig, Sie werden sehen.«
»Spielen? Lustig? Halten Sie mich für ein Kind, das unterhalten werden muss? Erzählen Sie mir lieber, wie es kommt, dass ich in Norwegen auftauche, obwohl alle Welt glaubt, dass meine Asche im Invalidendom liegt.«
Der Professor bat den Kaiser, Platz zu nehmen. Er selbst setzte sich auf den Plastiksessel neben ihm und räusperte sich ausgiebig, als habe er die Absicht, vor dem Kaminfeuer eine lange Geschichte zu erzählen.
Wir erfahren, wie Napoleon bis hierher gekommen ist
»Sie haben, könnte man sagen, einen weiten Weg zurückgelegt, Sire. Offiziell sind Sie am 5. Mai 1821 um 17 Uhr 49 in Longwood House gestorben. In Wirklichkeit sind Sie um diese Uhrzeit ins Koma gefallen. Koma oder Ableben, das war für die Ärzte jener Zeit kein großer Unterschied. Außerdem warteten sie voller Ungeduld darauf, Sie aufschneiden zu können, um Ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Manche behaupteten sogar, Sie seien vergiftet worden.«
»Vergiftet? Aber von wem denn?«, fragte Napoleon, der auf einmal eine leichte Zyankalinote aus seinem letzten Schluck Cola herauszuschmecken glaubte.
»Oh, es gibt jede Menge Bücher darüber, aber endgültig geklärt wurde es nie. Genau wie bei JFK, was aber nichts mit den Hähnchen-Nuggets zu tun hat. Wie auch immer, wir konnten ein solches Gemetzel nicht dulden. Obwohl Sie selbst das Blutbad in gewisser Weise angeordnet hatten. Sie hatten doch tatsächlich gewünscht, dass Ihr Herz dem Körper entnommen und Ihrer zweiten Ehefrau Marie-Louise übersandt werden sollte, was – das muss ich anerkennen – von einer beispiellos romantischen Veranlagung zeugt.«
»Meine arme Marie-Louise … Ich habe sie sowieso nicht geliebt. Ich habe sie nie geliebt. Da ich ihr als Lebender mein Herz nicht schenken konnte, wollte ich es ihr wenigstens posthum überlassen.«
»Sie hat eines bekommen, aber es war das Herz eines Ochsen … Das Ihre schlägt weiterhin hier«, er deutete auf die Brust des Kaisers. »In Wahrheit hatten meine Vorfahren die Idee, Ihre kaiserlichen Überreste mit denen eines armen Kerls zu vertauschen, der an akutem Durchfall verstorben war, nachdem er die unsterblichen Worte ›Rasch, bringt mir einen Nachttopf‹ von sich gegeben hatte. Nur leider sind wir etwas zu spät gekommen. Der Kirchenmann hatte bereits Ihr Geschlecht zwischen seinen dicken Fingern … die im Grunde normal groß waren, nur wirkten sie riesig im Vergleich zu Ihrem kleinen …«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Napoleon leicht pikiert. »Joséphine und Marie-Louise und auch all die anderen Damen, die ich auf dem Schlachtfeld oder in den Bordellen während meiner Feldzüge beehrt habe, haben sich nie beklagt.«
Natürlich bewahrte er Stillschweigen über den Tag, an dem Madame Duchâtel beim Schäferstündchen in Gelächter ausgebrochen war.
»Das ist Ihre Privatangelegenheit. Kommen wir auf unsere Geschichte zurück. Stellen Sie sich die Szene vor: Der Priester nimmt Ihr Geschlecht in die Hand …«
»Schwer vorstellbar.«
»… wir hauen ihm eins über den Schädel, und dann vertauschen wir die Körper. Ich sage ›wir‹, aber Sie verstehen sicher, dass ich von meinen Vorfahren spreche.«
»Das verstehe ich sehr wohl. Es wäre idiotisch anzunehmen, dass jemand, der vor zweihundert Jahren dabei war, heute davon erzählen könnte …«
»Kurz, wir haben Sie auf Eis gelegt, im Ganzen, mitsamt Ihrem Pferd. Ein wenig wie in Louis taut auf. Ah, Sie haben den Film nicht gesehen … natürlich. Und Sie kennen auch Louis de Funès nicht …«
Der Kaiser schüttelte den Kopf.
»Sie lagen also auf Eis, zu Zwecken der Konservierung, und der BUH wollte Sie entführen und nach Korsika transportieren, um Sie dort zu bestatten, obwohl Sie in Ihrem Testament ausdrücklich gewünscht hatten, dass Ihre Asche an den Ufern der Seine verstreut werden möge. Aber wissen Sie, wir Korsen sind ein wenig wie die jüdischen Mütter, wir teilen unsere Kinder auch nicht gern. Die Engländer haben es abgelehnt, um die Heldenverehrung nicht zu befördern, und Sie deshalb auf der Insel behalten, das heißt, denjenigen, den sie für Sie gehalten haben, und der in Wirklichkeit der Typ mit dem Dünnschiss war. Sie können mir folgen? Währenddessen hat man Sie in Kisten gelagert und abgewartet, dass Gras drüber wuchs. Nicht über Sie. Die Situation. Dass Sie in Vergessenheit geraten.«
Napoleon verzog das Gesicht. Er wäre lieber in einen Tümpel voller Krokodile geraten als in Vergessenheit.
Während der echte Bonaparte gut gekühlt auf der Insel lag, erklärte der Professor weiter, war der falsche nach Paris zurückgekehrt, wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten. Bartoli erläuterte die Finanzierungsprobleme in Zusammenhang mit der Repatriierung, die Geschichte vom Schiff, das aufgrund des Sturzes der Thiers-Regierung in Cherbourg aufgehalten wurde, sowie die Einrichtung eines neuen antibonapartistischen Ministeriums und den Bau des Grabmals im Invalidendom. Der Hoch- und Tiefbau hatte einen beispiellosen Boom erlebt.
»Und dann waren Sie an der Reihe, aber nicht in dieselbe Richtung, sondern mit Kurs auf Korsika. Nur leider hat auf der Höhe der Kanarischen Inseln eine englische Brigg das Schiff angegriffen, auf dem Sie sich befanden.«
»Schon wieder diese verdammten Engländer! Wann werden sie endlich aufhören, mich zu quälen!«
»Sie haben Ihr Schiff in ihr Land geschleppt, ohne nachzusehen, was sich im Schiffsraum befand. Aber die schlechten Wetterbedingungen haben den Engländern übel mitgespielt – und damit auch Ihnen. Sie haben vor Schottland Schiffbruch erlitten, und dann haben die beiden Kisten, das heißt Sie und Le Vizir, die Reise allein fortgesetzt. Jahrelang trieben Sie in den eisigen Gewässern nördlich von Norwegen. Den Rest kennen Sie … Gepriesen sei der Iglo-Kutter! Ich konnte es kaum glauben. Ehrlich gesagt, hielten wir es nicht mehr für möglich.«
»Auf jeden Fall könnte man sagen, dass Gott immer noch über mich wacht«, schloss der Kaiser. »Da es dem BUH nicht gelungen ist …«
»Aber der BUH hat Sie wiedergefunden!«
»Nun gut, es lebe der BUH.«
»Es lebe der BUH!«, rief der Professor und reckte eine Siegerfaust in die Höhe.
Da der Reisende, der sich gerade neben sie gesetzt hatte, ein Abgeordneter des Front National auf dem Weg nach Ajaccio, darin eine gegen sich persönlich gerichtete Provokation sowie ein schlechtes Omen für seine erste Reise nach Korsika sah, täuschte er den dringenden Wunsch nach einer Zigarette vor, sprang auf und verschwand mit gebeugtem Rückgrat und eingezogenem Schwanz.
Die Frauen und die Hose
Der Kaiser wandte den Kopf und bemerkte aus dem Augenwinkel eine drei Mann starke Patrouille in einem merkwürdigen grünen Aufzug. Komische kleine Gewehre hingen ihnen um den Hals.
»Wer ist das?«, fragte Napoleon.
»Vigipiraten.«
Der kleine Korse erstarrte. »Piraten?«
»Im Gegenteil. Es handelt sich um die französische Armee. Sie sind zu unserem Schutz abgestellt«, erklärte der Professor, peinlich berührt.
»Soldaten!«, rief der Exchef der französischen Armee, und seine Augen leuchteten wie tausend Medaillen. Er wollte aufstehen und auf sie zugehen, aber Professor Bartoli packte ihn am Arm. Es war schon das zweite Mal seit seiner Rückkehr ins Leben, dass jemand sich erdreistete, ihn mit einer solchen Unverfrorenheit anzufassen.
»Guillotine!«
»Wie bitte?«
»Tun Sie das nie wieder!«, herrschte der Kleine den Großen an, während er sich dessen Griff entwand. »Ich weiß, dass man heutzutage keine Köpfe mehr abschlägt, aber ich kenne andere Mittel, Sie ruhig zu stellen.«
»Entschuldigen Sie, Sire, ich weiß, dass Sie vor Verlangen brennen, diese Soldaten kennenzulernen, aber ich möchte Sie daran erinnern, dass Ihre Identität geheim bleiben muss. Sie wissen sicher nicht, wer Sacha Guitry ist, aber er hat etwas Nützliches gesagt: ›Um glücklich zu leben, müssen wir im Verborgenen leben.‹«
Und nun erklärte Bartoli, wie der alte Fischer vor ihm, dass die Welt nicht über seine Rückkehr informiert werden dürfe. Es wäre ein zu großer Schock. Keiner könne wissen, wie man auf diese Nachricht reagieren würde. Wer weiß, vielleicht würde er zum Versuchskaninchen für skrupellose Wissenschaftler. Bartoli kannte sie gut, er war schließlich selbst einer und wusste, was sie mit lebenden Fröschen anstellten. Er frischte das Gedächtnis des Kaisers auf, indem er ihn an seine Rückkehr von Elba im Februar 1815 erinnerte. Diese – bei den Franzosen sehr umstrittene – Rückkehr hatte Napoleon in den Untergang getrieben. Erst die Herrschaft der Hundert Tage, dann Waterloo.
»Und in unserer Zeit können Sie nicht herumspazieren und lauthals verkünden, Sie seien Napoleon Bonaparte. Man würde Sie in eine psychiatrische Anstalt sperren.«
Der Kaiser betrachtete das als einen sehr merkwürdigen Brauch. Andererseits konnte er es nur gutheißen, dass man Leute einsperrte, die vorgaben, er zu sein. Eine derartige Anmaßung konnte man in seinem Reich nicht dulden. Es hatte immer nur einen Napoleon Bonaparte gegeben und würde immer nur einen geben. Ihn.
Er deutete mit dem Finger auf die Person in der Mitte des Trios. Es war eine junge Frau mit dunkler Haut und sehr ansprechenden Kurven, die die Uniform ordentlich strapazierten und jeden Moment zu sprengen drohten. Ihn erstaunte nicht so sehr die Anwesenheit einer Nachfahrin von Sklaven in der Hauptstadt, denn er hatte 1815 die Abschaffung des Sklavenhandels verfügt, um die Gunst der Briten zu gewinnen, nein, was ihn weit mehr erstaunte, war die Tatsache, dass sie als Soldat verkleidet war. Und dass sie eine Hose trug.
»Seit wann kämpfen Frauen?«, fragte er seinen Landsmann. »Und seit wann tragen sie Hosen? Das letzte Mal habe ich so etwas während der Revolution gesehen.«
Er deutete auf die vielen jungen und weniger jungen Frauen um ihn herum, die Hosen trugen. Neuerdings, erklärte der Professor, arbeiteten Frauen genauso wie die Männer, sie trugen Hosen, rauchten und waren sexuell emanzipiert.
»Wie kann man sie dann von Männern unterscheiden?«, fragte Napoleon, der ein praktisch denkender Mensch war.
»Man versucht sie ja gerade nicht mehr zu unterscheiden.«
»Mein Gott!«
»Es gibt sogar Frauen, die Männerhüte aufsetzen. Geneviève de Fontenay zum Beispiel.«
»Und ich habe Cambarérès für ein verkommenes Subjekt gehalten, dabei war er in Wirklichkeit ein Visionär …«