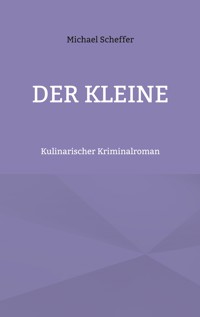
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Thomas und Gila, ein Juristenpaar mittleren Alters aus Köln, leben in ihrem südfranzösischen Ferienhaus ihren Traum von mediterraner Lebensart: Sprache, Kultur, Geschichte, die Menschen - aber auch Essen und Trinken kommen nicht zu kurz. Und doch - fehlt da nicht noch etwas? Genau: ein Renault 4, herrlich, mit ihm unter des Sonne des Südens durch Lavendelfelder und Olivenhaine zu schaukeln, oder doch nicht? Ein irritierender Fund im Oldtimer führt in die 1970er Jahre zurück. Ihr Paradies gerät ins Wanken, es wird bedrohlich. Ihr Nachbar, frisch pensionierter Polizeichef, kommt ihnen zu Hilfe. Gemeinsam decken sie bei ihren Ermittlungen unter idyllischer Oberfläche Amouren, Intrigen und dunkle Machenschaften auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 1
Ereifert hatte er sich, ihr Nachbar, ja geradezu in Rage geredet beim eigentlich harmlosen Oster-Schwatz vor ihrem südfranzösischen Ferienhaus, so kannten sie ihn gar nicht. Und dieser sein Temperamentsausbruch ausgelöst allein dadurch, dass sein Blick auf den nostalgischen Kult-Kleinwagen R 4 von Renault gefallen war, den sie sich vor kurzem, am Ende ihres Neujahrs-Urlaubs, gekauft und damit ihrem Traum vom Leben im Süden ein weiteres Stück näher gekommen waren.
Sie, das ist ein Paar, zum einen Thomas, Rechtsanwalt aus Köln und Mitte 50, mittelgroß, noch volles braunes Haar mit grauen Schläfen, sportlich-schlank oder „drahtig“, wie manche Freunde sagen. Als Strafverteidiger ist er Teilhaber einer bekannten Kanzlei mit Schwerpunkt „OK“, wie es im Justiz- und Polizei-Jargon heißt; das Kürzel bedeutet „Organisierte Kriminalität“ und bezeichnet Delikte wie den Handel mit Rauschgift, mit Waffen oder auch mit Menschen, die Prostitution, die Schutzgelderpressung, aber auch die oft blutigen Auseinandersetzungen verschiedener in diesem Metier tätiger Banden.
Und das ist zum zweiten Gila, eigentlich Gisela, Ende 40, auch sie schlank, nicht viel kleiner als Thomas, auch sie Juristin, mit schulterlangen Natur-Locken von der Farbe hellen Honigs. Als Richterin am Kölner Amtsgericht ist sie für Haftsachen zuständig, so etwa die Anordnung oder die Aufhebung von Untersuchungshaft, insofern auch immer wieder mal für die Mandanten von Thomas.
Und genau genommen waren „ihre Jungs“, wie die beiden sie unter sich nannten, ihre gemeinsamen Fälle also, auch die Stifter ihrer Beziehung gewesen, denn über ihre beruflichen Kontakte, wenn auch in unterschiedlichen Rollen, hatten sie sich im Lauf der Jahre schließlich auch privat kennen und lieben gelernt.
Er, das ist die dritte Hauptfigur dieser Geschichte, ihr – diesmal sehr aufgebrachter – Nachbar im Süden, Robert Delvigne, 58 Jahre alt, eisgraue Haare im Millimeter-Bereich, mit einer ebensolchen moustache, einem kurzgehaltenen Schnurrbart; er ist einen halben Kopf größer und von der Statur deutlich kräftiger als Thomas, eher muskulös als dick und augenscheinlich durchtrainiert, auch nach seiner Pensionierung hält Monsieur le Colonel sich fit. Demnach im Rang eines Obersts, war er bis vor kurzem Chef der gendarmerie des gesamten Departements, der „richtigen“ Polizei, wie er gern betont, im Gegensatz zur police municipale, der Gemeindepolizei, zu deren Höhepunkten die Abwicklung des Wochenmarktes, einer Beule im Auto oder einer Schafherde auf der Dorfstraße zähle. Noch ahnen die beiden Deutschen nicht einmal, welche Bedeutung dieser sein beruflicher Hintergrund schon binnen kurzem für sie gewinnen wird.
Dass der Herr Oberst und die beiden Deutschen nun seit vier Jahren zumindest zeitweise Nachbarn in Südfrankreich sind, kam so:
Beruflich hatten Gila und Thomas schon seit über zwanzig Jahren miteinander zu tun, naturgemäß meist in Haftsachen, manchmal war es in Verhandlungspausen zu einem eher privaten Schwätzchen gekommen, letztlich war ihre Beziehung aber aufs Professionelle beschränkt geblieben.
Nachhaltig verändert hatte dies ein zufälliges Aufeinandertreffen beim privaten Umzug eines gemeinsamen Studienkollegen: bei dem anschließenden Umtrunk tauschten sie ihre privaten Telefonnummern aus. Kurz darauf hatten sie sich für einen Samstagnachmittag im „Früh am Dom“ verabredet.
Nach ein paar braufrischen Kölsch hatten plötzlich ganz andere Themen als die Fälle ihrer schweren Jungs im Vordergrund gestanden, nämlich Fragen eher der Art, wer eigentlich nun noch fahren könne und was man mit dem ebenso sonnigen wie prickelnden Tag noch anfangen könne. Bei einem langen Spaziergang am Rhein war man gemeinsam ins Schwärmen gekommen für den mediterranen Lebensraum und seine Menschen, für ihre Träume von einem Haus im Süden. Ihr Gleichklang kreiste vor allem um das ganz besondere Licht der Provence, das nicht nur Generationen von Malern und Dichtern schon immer fasziniert hat. Gila hatte geradezu geschwelgt in Bildern von der Mandelblüte manchmal schon Ende Januar/Anfang Februar, von der Kirschblüte im März und vom Duft der blühenden garrigue, der mediterranen Heide im Mai und der Lavendelblüte Ende Juni, begleitet im Sommer durch den typisch zirpenden Gesang der Zikaden, oft ein wahres Fest der Sinne.
Thomas, überwältigt von Gilas Schwärmerei, hatte nur nicken können, aber auch, typisch Mann und so ein bisschen nüchterner, den ganz andersartigen Reiz des provenzalischen Winters betont: mit ein bisschen Glück könne man, das habe er schon zweimal erlebt, am Neujahrstag zur Mittagszeit windgeschützt in der knalligen Sonne am tiefblauen Himmel draußen sitzen, während es zu gleicher Zeit in Köln nasskalt und trüb war.
Die frische Rhein-Luft hatte Appetit gemacht, und zur neu entdeckten Gemeinsamkeit erschien ein frühes Abendessen in einem französischen bistrot passend. Der Abend war immer beschwingter geworden und hatte schließlich in einem Hotelzimmer eine leidenschaftliche Fortsetzung gefunden; auch der nächste Morgen hatte nichts Schales oder Beklommenes gehabt.
Zwei Urlaube später hatten sie – bei weiterhin getrennten Wohnungen im Rheinland -- ihren gemeinsamen Standort in Südfrankreich gefunden. Sie hatten sich jeweils über Geschichte und aktuelle Situation verschiedener Regionen informiert, ganz klassisch über Reiseführer und Zeitschriften, und sich dann für das Bas-Vivarais entschieden, einen traditionell armen Landstrich, früher zur Provence gehörig, zwischen Rhône und Cévennes, also schon in der südlichmilden Klimazone gelegen - das war der Sonnenanbeterin Gila ganz wichtig gewesen - und dementsprechend mit mediterraner Vegetation; andererseits aber auch nicht weit entfernt von den ausgedehnten Kastanienwäldern im rasch ansteigenden und auch klimatisch raueren Norden der Region, dort hatte es eher Thomas hingezogen.
Seit Jahrtausenden hatte die Kastanie, so erfuhren sie, die Menschen dort ernährt, geröstet als sättigende Beilage zu Gartengemüse oder vermahlen als Ausgangsprodukt für Brot, eine Art Nudeln oder einen mit Honig und Kräutern zubereiteten Brotaufstrich, die crème de châtaigne. Zugleich war dieser Baum schon immer und ist bis heute Lieferant von Bau-, Möbel- und Feuerholz.
Zum Ende des Mittelalters hatten sich durch die Seidenraupenzucht ein paar neue Verdienstmöglichkeiten ergeben. Colbert (1619 – 1683), der bedeutendste der Finanzminister Ludwigs XIV., hatte sogar systematisch gerade in dieser Region auch die Weiterverarbeitung der Seide gefördert, meist an kleinen Heim-Webstühlen. Schon im 19. Jahrhundert aber hatten die Groß-Webereien im übermächtigen Lyon dominiert, bis auch diese der Konkurrenz aus Fernost erlegen waren. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts war dann nach und nach der touristische Wert der Region entdeckt worden, gelegen am westlichen Rand der schon früher boomenden Provence, mit Wildwasser-Kanu-Flüssen wie der Ardèche, der Cèze und ihren Nebenflüssen inklusive den entsprechenden Bademöglichkeiten allenthalben, im Westen die Cévennes, im Norden die Berge des Haut-Vivarais mit Händen zu greifen, beide schnell über 1000 m hoch, mit ihren Wanderparadiesen im Frühling und Sommer, im Herbst überquellend von Pilzen und Beeren, im Winter endlose Langlauf-Loipen und sogar einige kleinere Abfahrts-Pisten bietend, andererseits nur eine Autostunde entfernt von den Großstädten Nîmes oder Avignon, diese voller Kultur und Geschichte zurück bis in die Römerzeit, und südwärts auch nicht mehr als anderthalb, maximal zwei Autostunden zu den Stränden des Mittelmeers zwischen Montpellier und Marseille, nicht zu weit für einen Tagesausflug.
Wichtig für beide war aber auch eine klimatische Besonderheit der Region: sie liegt im Einflussbereich von Mistral und Tramontane, zweier gerade im Winterhalbjahr aktiver Winde, die für den berühmten blitzblauen Himmel Südfrankreichs sorgen, der Mistral aus Nord bis Nordost kräftig das untere Rhônetal hinunter blasend, also aus den westlichen Alpen kommend, daher kühl bis kalt und insofern bei den Einheimischen nicht gerade beliebt, von diesen gar als eine der drei „Geißeln der Provence“ bezeichnet, zusammen mit dem Hochwasser der Durance und – nota bene -- dem Parlament von Aix.
Gila und Thomas dagegen hatten von Anfang an die entsprechende Wetterlage auch wegen ihres strahlenden Blaus geliebt, insbesondere aber wegen ihrer trockenen klaren Luft und der damit verbundenen hervorragenden Fernsicht. Ganz ähnliche Vorteile bietet ihnen auch die Tramontane, ein gleichfalls kühler, trockener Nordwest-Wind aus dem Zentralmassiv, beide sorgen für ausgezeichnetes Wanderwetter.
Im Ergebnis waren Lage, Klima und Kultur für Gila und Thomas also die ausschlaggebenden Kriterien für ihren Standort gerade in dieser mediterranen Region gewesen.
Das Haus oder „ihr Häuschen“, wie sie es bald nennen würden, hatten sie in einem kaum 100 Seelen zählenden Ortschaft gefunden, gelegen auf einer Anhöhe, wie so viele Dörfer gehörig gebeutelt in den Religionskriegen Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts und danach ziemlich rasch und in einheitlichem Stil wiederaufgebaut, mit Schloss und Kapelle, wie man es sich als Nordeuropäer im mediterranen Süden vorstellt.
Das Haus, es war das sechste gewesen, das sie sich angesehen hatten, war zwar nur um die 90 qm klein mit kaum mehr als 50 oder 60 qm „Land“ drum herum. Aber gerade Letzteres war für sie, die sie noch für längere Zeit berufstätig sein würden, kaufentscheidend gewesen, denn ihnen beiden war klar, dass sie auch schon mal einen Kurzurlaub dort verbringen, dann aber weder Zeit noch Lust haben würden, sich mit irgendwelchen Schneidwerkzeugen durch große Flächen der im Frühjahr schnell einen halben Meter hohen Wiesen zu quälen.
Das Häuschen sei, so hatte es ihnen der Vor-Eigentümer geschildert, zumindest im unteren seiner zwei Geschosse etwa 400 Jahre alt; ein Bauhistoriker habe ihm gegenüber die wahrscheinliche Bauzeit, abgeleitet aus der Bauweise der beiden unteren Gewölbe und ihrer Lage zueinander, auf den Beginn des 17. Jahrhunderts, also in die eben genannte Wiederaufbauphase datiert; das Obergeschoss sei in seiner jetzigen Form wohl dem mittleren 19. Jahrhundert zuzuordnen.
Es steht für eine der traditionellen ländlichen Hausformen, nämlich das langgestreckte, typisch kleinbäuerliche Anwesen, im Gegensatz zu den größeren mas, den Gehöften, die manchmal schon an die Dimensionen eines Guts heranreichen.
Im ebenerdigen Untergeschoss des Häuschens gab es früher Ställe mit acht oder zehn Ziegen, ein paar Hühner und Kaninchen, vielleicht sogar für ein oder zwei Schweine, und andere Wirtschaftsräume, im Obergeschoss dagegen die Wohnräume. Wie bei vielen Kleinbauern erlaubte ein solcher Betrieb zusammen mit etwas Wein- und Gartenbau nicht mehr als eine sog. Subsistenzwirtschaft, vornehmer Ausdruck dafür, dass der Vierzehn-Stunden-Tag der Bewohner, abgesehen von minimalen Einnahmen durch ein bisschen Ziegenkäse-Verkauf, gerade mal die eigene Versorgung sicherstellen konnte, kurzum, so Thomas später sarkastisch, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel abgeworfen habe.
Diese Art von Existenz, ohne elektrischen Strom und mit Wasser aus dem Brunnen, sei bis zum Ende der 1960er Jahre betrieben worden, so der Verkäufer weiter, nämlich solange, bis die dann nachfolgende Generation die Landwirtschaft aufgegeben und das Häuschen erstmals an ihn, einen vacancier, einen Ferienhäusler, verkauft hatte, eine Entwicklung, in die immer mehr historische Häuser in Südfrankreich hineingerieten; inzwischen seien ganze Dörfer von den autochthones, den Alteingesessenen, verlassen und verfielen oder seien von einer bunten Mischung aus Künstlern, Aussteigern und eben vacanciers in Besitz genommen.
So wie sie es sich vorgenommen hatten, waren Gila und Thomas, wie bei den paar ernsthaft in Betracht kommenden Kaufangeboten vorher auch, brav in die permanence du maire, die Sprechstunde des Bürgermeisters, gegangen, hatten sich als Kaufinteressenten vorgestellt und den Bürgermeister gefragt, ob erstens Fremde überhaupt und zweitens Deutsche im Dorf willkommen seien. Sie hatten jeweils, so auch hier, positive Antworten erhalten, und ausgezahlt hatte sich der Aufwand auch, denn im Dorf machte es schnell und mit anerkennendem Unterton die Runde, sie seien die Deutschen, die vorher nachgefragt hätten, ob sie im Dorf genehm seien.
Von der Sprache einmal abgesehen, hatten sich der Gang zum Notar und die übrigen Formalitäten zu Thomas‘ und Gilas Überraschung – Europa sei Dank! -- keinen Deut von einer entsprechenden Transaktion in Deutschland unterschieden, und so war Thomas, und zwar - weil beiden gleichermaßen an klaren Verhältnissen gelegen war - er allein, Grundeigentümer im Süden des Departements Ardèche geworden, mit der laufenden Nr. 07 im code postal und auf den plaques, also bei der Postleitzahl und auf den Autokennzeichen.
Eine ausgefeilte Urlaubs- und Vertretungsplanung erlaubte es ihnen, regelmäßig vier Mal pro Jahr jeweils für eine, zwei oder manchmal auch drei Wochen dort zu sein, meist zu Ostern, im Früh- und im Spätsommer, dann mit Gilas Cabrio, dagegen mit Thomas‘ Kombi nach Weihnachten zum Jahreswechsel, bei anfangs manchmal 5 oder 6°C Temperatur im Haus wahrlich eine Herausforderung, mit nur zwei Holzöfen, zwei Ölradiatoren und einem Heizstrahler im Bad!
***
Zurück zum Oster-Schwatz der beiden, inmitten der Frühjahrsblüher in ihrem Gärtchen, mit ihrem Nachbarn, dem Herrn Oberst, und seinem Temperamentsausbruch: Eigentlich war es nicht der R 4 im Ganzen, sondern ein Detail daran, das ihn so aufbrachte: montiert waren nämlich noch immer die plaques mit der Nummer 30, also die Auto-Kennzeichen des Département du Gard, dies ganz einfach deshalb, weil seine letzten Besitzer in diesem südlich angrenzenden Verwaltungsbezirk lebten und die beiden Deutschen erst jetzt, mit Beginn ihres Osterurlaubs, Zeit für eine Ummeldung auf diesen ihren Ferien-Wohnsitz im Département de l’Ardèche mit der laufenden Nummer 07 haben würden.
Gerade der Umstand, dass dieser Verwaltungsakt anstand, war es auch, die ihn, ihren Nachbarn, derart auf die Palme brachte, ihn, der nach dem nordeuropäischen Klischee über mediterrane Menschen eigentlich stets entspannt und heiter, gesellig und umtriebig zu sein hat, jederzeit bereit zu einem kurzen Schwätzchen, am besten mit der Gauloise-Kippe im Mundwinkel und einem Gläschen Rotwein in der Hand.
Nicht so er, nicht in diesem Moment: «Pourquoi changer les plaques?? C’est tout juste, le 30!!» Also: warum die Schilder ändern, die 30 sei doch ganz richtig: „Denn wie ich es schon immer gesagt habe, hat unser Dorf richtigerweise nicht zum Departement Ardèche zu gehören, sondern vielmehr zum Gard, und schuld an diesem Missstand sind allein diese revolutionären Übeltäter, und obendrein sind sie auch noch inkonsequent gewesen!“
Der umfassenden bis heute gültigen administrativen Neuordnung Frankreichs, die in der Folge der Revolution von 1789 die feudale Gliederung in Provinzen, Grafschaften und Grundherrschaften wenige Jahre später hinweggefegt hatte, lag nämlich das Prinzip zugrunde, dass die neuen, ganz auf Paris zentrierten Verwaltungseinheiten mit nicht gewählten, sondern von oben eingesetzten Präfekten an der Spitze annähernd gleich groß und ihr jeweiliger Hauptort in einem Tagesritt zu Pferd erreichbar sein sollte.
Schon das, so der Herr Oberst, komme nicht hin, bei den 75 km nach Norden zur préfecture, in etwa einer deutschen Kreisverwaltung entsprechend, in Privas, jenem kalten zugigen Mittelgebirgs-Städtchen, umgeben von den bis zu 1500 m hohen Bergen des Zentralmassivs, zu erreichen im Winter nur über hoch verschneite Pässe!
Ebenso inkonsequent sei die Zugehörigkeit ihres Dörfchens zur Ardèche auch dann, wenn man darauf schaue, wie die 101 alphabetisch geordneten Départements an ihre Namen gekommen seien, nämlich nach den für die jeweilige Region typischen Landschaftsmerkmalen wie Gebirge oder ganz überwiegend nach den in ihnen fließenden Flüssen und deren Einzugsbereichen.
„Wohin aber fließt denn das Regenwasser aus unserem Dorf?“, so der Herr Oberst, rhetorisch zur Höchstform auflaufend, „etwa in die Ardèche?? Niemals, sondern vielmehr, wie Sie sicher auch schon wissen, in die Cèze!!“ Zwar habe es dieses Flüsschen, das wenige Kilometer südlich des malerischen Kanu- Wildwassers Ardèche viel ruhiger vor sich hin mäandert, in den nach-revolutionären Wirren mitnichten zu einem nach ihm benannten département gebracht. Aber das Pays de Cèze, also ihr Umland, zu dem sich eben wegen des Laufs des Regenwassers auch ihr Dörfchen zu rechnen habe, sei nun unzweifelhaft Teil des südlich gelegenen Département du Gard, weltweit bekannt für die über 2000 Jahre alte Meisterleistung römischer Ingenieure namens Pont du Gard, ein Aquädukt, das ihn, den Gard, zur Versorgung des römischen „Nemausus“, des heutigen Nîmes, mit Trinkwasser aus den westlich angrenzenden Cevennen überquert, als Bauwerk längst aufgenommen in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO.
„Allein schon deswegen,“ so Herr Oberst weiter, „gehören wir in den Gard!! Gut, auch nach Nîmes, dort wäre dann unsere préfecture, sind es kaum weniger als 75 km, aber das ist doch ganz etwas anderes!!“ Es gehe südwärts, durch die nach den Kräutern des Südens duftende garrigue, durch ein sonnenverbranntes Hügel- und Heideland, verwöhnt durch das magische mediterrane Licht, viel angenehmer und vor allem auch im Winter problemlos zurückzulegen. Schließlich: alle compatriotes, Landsleute, die er in seiner Funktion als Polizeichef des Departements kennengelernt habe, und das seien viele, sie alle fühlten sich als Provençaux, Provenzalen also, wie ja auch das Dörfchen zu den guten alten, den feudalen Zeiten zur Grafschaft Provence gehört hatte, die damals auch ein paar Landstriche auf der rechten Rhône-Seite mit umfasste, was erst die nachrevolutionären Eiferer und Verwaltungsstruktur-Reformer geändert hätten. Mehr als 200 Jahre später, vielleicht seit 30 Jahren, hätten die Menschen hier das aus dem Mittelalter stammende Provenzalisch, zur Sprachfamilie des Okzitanischen gehörig, für sich wiederentdeckt, und diese Regionalsprache werde nun mal im Languedoc gesprochen, wozu der eindeutig in den sonnigen Süden ausgerichtete Gard gehöre. Dagegen habe man mit der dem Departement Ardèche übergeordneten Region Rhône-Alpes im unwirtlichen Nordosten sprachlich und auch sonst rein gar nichts zu tun…..Und ob sie als Zugereiste überhaupt wüssten, woher der Name Languedoc stamme? Das Wort gehe nämlich zurück auf langue d’oc, wörtlich „Sprache des oc“, zum Unterschied zur langue d’oïl, wobei der zweite Wortteil früher die jeweilige altfranzösische Vokabel für das heutige oui benenne, oïl im Norden und oc im Süden, Languedoc also etwa in dem Sinne das Land, in dessen Sprache „oc“ das Wort für ‚ja‘ ist“, „comprenez-vous?“, „verstehen Sie?“, so wie das oc auch die erste Silbe des Namens ihrer althergebrachten Regionalsprache Occitane sei……Und das seien beileibe nur die wichtigsten Argumente, bei Interesse ihrerseits sei es ihm, der früher ihnen gegenüber zwar freundlich, aber doch meist kurz angebunden war, ein Vergnügen, ihnen das einmal etwas ausführlicher darzustellen…
Kapitel 2
Wie aber sind unsere beiden Frankophilen an das Auto ihrer Sehnsüchte, den betagten R 4, gekommen? Werden sich mit ihm ihre Träume erfüllen, oder werden sie schon bald nur noch wünschen, die Finger von ihm gelassen zu haben?
Davon handelt diese Geschichte.
Schon seit längerem waren Gila und Thomas der Auffassung, dass vor so ein historisches südfranzösisches Bruchstein-Häuschen wie ihres ein dazu passendes Gefährt gehöre, praktisch kam nur ein Citroën 2 CV, die berühmte „Ente“, oder eben ein Renault 4 in Betracht. Diese Grundsatzfrage, unter Kundigen heiß umstritten, stellte sich Thomas allerdings nie wirklich: lag es am knuffigeren Äußeren, an vier statt zwei Zylindern und den paar PS mehr oder an Wasser- statt Luftkühlung, also mit einer ordentlichen Heizung im Winter – für ihn war schon immer klar: ein R 4 muss es sein, und auch Gila hatte keine Einwände.
Dieses französische Pendant des VW-Käfers wurde von 1961 bis 1993 über 8 Millionen Mal gebaut, mit seiner revolutionären Heckklappe und den umklappbaren Rücksitzen bahnbrechend in Sachen Verwandlungsfähigkeit Limousine – Kleinkombi, mit unverwüstlicher geschraubter Karosserie, Sieger in vielen Querfeldein-Rallys, sein einziger Feind nur der Rost am Chassis….
Ein paar Monate vor dem Oster-Schwatz sollte es endlich konkret werden. Zum Ende ihres Neujahrsurlaubs also fahren Gila und Thomas nach Bagnols im Rhône-Tal, weil sie sich erinnern, im letzten September dort auf einem Werkstatthof kurz vor der Cèze-Brücke zwei oder drei R 4 gesehen zu haben. Sie finden sie auch, aber sie stehen dort zur Reparatur, nicht zum Verkauf. Einmal dabei, klappern sie die beiden offiziellen Renault-Händler vor Ort ab, mit demselben Ergebnis wie zuvor bei anderen Vertragswerkstätten: „Ah oui, les vieilles Quatrelles – ach ja, die alten R 4“….sie seien sehr nachgefragt, aber man handele nicht damit! Diese mehrfach gehörte Einschätzung ist den beiden unverständlich: wenn sie so gesucht sind, gäbe es doch wohl was zu verdienen, oder? Niedlicher französischer Jargon übrigens, Quatrelle ist nichts anderes als die Renault-Typbezeichnung „4 L“ in ein französisches Wort gefasst, und wohlgemerkt: im Französischen sind Autos weiblichen Geschlechts!
Nur wenig weiter stoßen sie auf die Fa. Roux, nach den zahlreichen demolierten Fahrzeugen im Hof wohl ein Bergungs- und Abschleppunternehmen. Le patron, der Chef ist gerade mit der Seilwinde seines Bergungs-LKW beschäftigt und winkt Thomas mit seinem Anliegen freundlich in den accueil, den Empfang durch, in dem seine Gattin agiert. Auf Thomas‘ Frage nach einem R 4: ja, man habe einen Kunden, der eine Quatrelle zu verkaufen habe, die hier in der Werkstatt gewartet worden sei, …einziges Problem: ihr falle der Name des Eigentümers im Moment nicht ein… „Aber warten Sie… kommen Sie mit zu meinem Mann, der wird sich an den Namen erinnern.“ Also wieder raus zum Besten aller Ehemänner an den Tieflader…. Jaja, so nebenher über die Schulter, natürlich erinnere er sich an den Kunden mit dem R 4, technisch gut in Schuss, neue Batterie, neuer Anlasser, habe man hier eingebaut… aber den Namen, nein, den wisse auch er im Moment nicht! Kein Problem, fragen wir doch den Gesellen, vielleicht weiß der weiter… nach kurzem Small-Talk mit Monsieur – Madame wird ans Telefon gerufen - kommt der apprenti, der Lehrjunge, ihn schicke der Geselle, weil es doch wohl um den R 4 gehe, den habe er in Händen gehabt, neue Batterie, neuer Anlasser .. aber den Namen des Kunden, nein, beim besten Willen nicht, ob vielleicht Madame im Büro….
Nach kurzem Zögern, ob Thomas sich damit vielleicht zufrieden gibt, fällt dem patron doch noch etwas ein: „Attendez voir“, warten Sie, der Kunde wohnt nicht weit entfernt, es ist nicht ganz einfach, aber überhaupt nicht weit…dann folgt eine längere Wegbeschreibung: „Alors, écoutez-moi bien – Also, hören Sie mir gut zu!“
Die dann folgende detaillierte Beschreibung über zwei Kreisverkehre und hinter einem Altenheim einen Kiesweg rechts rein bis vor ein Schlösschen mit einem sandfarbenen Tor und einem roten Renault Clio davor erweist sich zu ihrer Überraschung als präzise und zielführend: Nach kaum drei Minuten finden die beiden ein beiges Tor zu einer Grundstückseinfahrt, dahinter ein Anwesen mit Türmchen und schönen Fayence-Verzierungen in der Fassade, allerdings weit und breit keine Klingel oder Glocke in Sicht… In ihre Ratlosigkeit platzt die freundliche Frage der Nachbarin, wen oder was sie suchten: jaja, die Nachbarn hätten einen R 4 zu verkaufen, er stehe unten im Hof… nein, eine Klingel o. ä. gebe es nicht, „tappez fort au portail!“…so ermutigt, klopft Thomas mehrfach kräftig an das Metall-Portal, aber nichts tut sich…was nun? Einen Zettel mit ihrer Telefonnummer, wie Gila meint, in den immerhin vorhandenen Briefkasten werfen? – Briefkästen sind in Frankreich ganz wichtig, dazu später mehr. Nein, so entscheiden sie sich, fahren wir lieber mit dem am Briefkasten abgelesenen Namen des Eigentümers zurück zu M. et Mme Roux, um voranzukommen.
Mit einem leicht zögerlichen „Re-Bonjour!“, etwa „Nochmals Guten Tag!“, unterbricht Thomas erneut die geschäftige patronne bei ihrer Schreibtischarbeit, lächelt sie verhalten an und bemerkt ein bisschen verlegen, so, den Namen habe er jetzt, ob sie, wenn es denn jetzt passen würde, vielleicht in ihren Unterlagen nachsehen könne….Lächelnd und mit einer Geste „Das haben wir gleich!“ lässt sie sofort alles stehen und liegen. In wenigen Augenblicken findet sie im PC den Gesuchten, nämlich M. Monthan, und druckt ihm alles Mögliche aus, so auch die letzten drei Werkstattrechnungen, zum Beweis ordnungsgemäßer Wartung, wie sie selbstbewusst meint, für – man ahnt es bereits – die neue Batterie, den neuen Anlasser und, ach ja, auch noch einen neuen Auspuff!!
Leicht verdutzt steht Thomas da mit den drei Rechnungen auf fremden Namen in der Hand, ist aber – das mediterrane Verständnis von Datenschutz hin oder her -- dankbar für die daraus hervorgehende Telefonnummer.
Noch vom Werkstattgelände aus – es ist jetzt kurz vor Mittag – ruft Thomas an, es meldet sich Mme Monthan. Ja, man habe eine Quatrelle zu verkaufen, bestens in Schuss, mit – wir wissen es schon -- neuer Batterie und neuem Anlasser, immer bei Fa. Roux gewartet, man habe noch alle Rechnungen, es sei das Auto ihres vor einem Jahr verstorbenen Schwiegervaters … es folgen Schilderungen der zum Tode führenden Krankheiten und ihrer Verläufe.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen und gefühlten fünfzehn damals noch teuren Auslands-Handy-Minuten gelingt es Thomas, das Thema auf den R 4 zurückzuführen: jaja, so die ihm bis dato unbekannte Mme Monthan mit leicht spitzem Unterton, es solle nur um die Sache gehen, und das sei die Quatrelle ihres Schwiegervaters in bestem Zustand, mit neuer Batterie und neuem Anlasser … und überhaupt, ob er denn mit dem Preis einverstanden sei?? Also der - bislang gar nicht genannte -- Preis sei auf jeden Fall gerechtfertigt, denn es handele sich schließlich um das Fahrzeug ihres Schwiegervaters, sie habe es bereits gesagt, sehr gut gepflegt, mit neuer Batterie und neuem Anlasser…





























