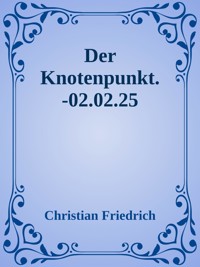
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Sachsen – Roman "Der Knotenpunkt". Zum Inhalt: Der Soldat Carl August fällt in der Kaserne auf der Festung Königstein bei einem Vorgesetzten in Ungnade. Er wird nach Leipzig abkommandiert, um als Gleisbauer auf der neuen Strecke, die die Messestadt mit Bayern verbinden soll, zu arbeiten. Dabei wird er von seiner Liebsten getrennt, die er nicht so schnell wiederfindet. Unterwegs begegnet er einen sizilianischen Tiefbauarbeiter, mit dem er Freundschaft schließt. Über Altenburg und Crimmitschau kommen sie nach Werdau, wo sie gemeinsam Quartier beziehen. Man trifft auf gleichgesinnte Zugereiste, die zum fahrenden Personal oder zu den Brückenbauern gehören und 1845 den Bahnhof Werdau einweihen. Die meisten von ihnen treffen in Werdau, Leubnitz und Ruppertsgrün auf ihr großes Glück und werden ortsansässig. So heiratet Carl August eine Bäuerin in Ruppertsgrün. Mario der Sizilianer findet Arbeit im Werdauer Maschinenbau. Eine entscheidende Rolle spielt in der Handlung Otto Ullrich, der Textilfabrikant. Christian der Maurer aus dem Frankenwald verliebt sich in Leubnitz und die ansässig gewordenen Lokführer sind bei der großen Lokomotivenflucht von 1866 dabei. Nicht alle überleben die Epidemie von 1865.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Knotenpunkt. -ebook
Der Werdau-Roman.
Geschichten einer Kleinstadt
Von
Christian Friedrich
2. Edition, Januar 2025 (leicht verändert).
© 2024 All rights reserved.
Das Buch:
Der Anschluss an die Eisenbahn im Jahre 1845 verändert radikal das Leben der sächsischen Kleinstadt Werdau. Fremde kommen in die Stadt und in die umliegenden Dörfer und bringen alte Strukturen zum Wanken. Die vorhandenen familiären Manufakturen erhalten durch die Bahn neue Absatzmärkte und preiswerte Rohstofflieferungen. Sie entwickeln sich weiter, jedoch nicht immer mit den Vorstellungen der alten Innungen und Zünfte. Diese Entwicklungen liefen überall in Sachsen ab, wo die Eisenbahn hinkam. Die ersten Dampfmaschinen finden Eingang in die Stadt, scheitern vorerst an fehlenden gebildeten Arbeitskräften. Später sind die rauchenden Monster, die die Straßen und Häuser in Ruß hüllen, nicht mehr aufzuhalten. Die Stadt steht an der Schwelle des Industriezeitalters mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt Zeiten des Wohlstands und der Rezession. Die Parallelen zur heutigen Zeit sind an den Ereignissen wiederzufinden. Man kämpft damals wie heute gegen Epidemien. Absatzmärkte brechen weg und Lieferketten werden nach wie vor periodisch unterbrochen. Krieg wird salonfähig gestaltet und vorbereitet, und wie sieht das in unserem Zeitalter aus?
Beim Lesen der Stammbücher der Eltern stellte ich fest, dass alle meine Vorfahren Einwanderer aus dieser Zeit waren. Eigentlich waren es „Wirtschaftsflüchtlinge“, weil in vielen Teilen des Heimatlandes extreme Armut herrschte. Alle fanden hier Arbeit und Familie. Ich sammelte die Fakten über alte Bücher und Archive sowie Erzählungen meiner Großeltern und versuchte, das Leben der Vorfahren zu rekonstruieren. In erster Linie hielt ich mich beim Schreiben an historische Hintergründe, ließ aber auch einige Male die Fantasie walten und passte Jahreszahlen an.
Der Autor:
Christian Friedrich wurde am 14. April 1957 geboren und besuchte bis zur 8. Klasse die Polytechnische Oberschule in Leubnitz. Von 1971 bis 1975 folgte das Abitur an der Erweiterten Oberschule „Alexander von Humboldt“ in Werdau. Es schloss sich die Lehre als Textilfacharbeiter an, die durch 18 Monate Armeedienst unterbrochen wurde. Ab September 1977 studierte er an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt einen Lehrerberuf. Dann folgte eine Zeit als Lehrer und Schulleiter an der Oberschule in Trünzig. Nach einer Kündigung aus politischen Gründen eröffnete er eine Servicefirma für Computer. Die Justiz ließ sich jedoch von den Racheplänen einer Landesregierung nicht beeinflussen und es kam ein erneuter Einstieg in das Bildungssystem mit allen Höhen und Tiefen, die dieser Beruf bietet. Von Physik- und Geografielehrer zum Kunsterzieher und Lehrer für Technik. Die Planlosigkeit des Systems und der Aktionismus des Löcherstopfens der Ämter führten ihn über die Astronomie und Informatik bis zum Kochen, Nähen und der Hauswirtschaft. Zwischendurch unterrichtete er an einer Berufsschule die Mediendesigner und die Lehrlinge für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Im Ruhestand entstand der vierteilige Buchzyklus „Der Opa, der im Osten geboren wurde“. Er ist seit 2021 verwitwet und hat zwei Kinder und vier Enkel.
Für die Hilfe beim Suchen nach den historischen Fakten bedanke ich mich bei Frau Bauer vom Stadtarchiv Werdau. Weiterhin sage ich danke an die Helfer und produktiven Kritiker, die das Buch ermöglichten und vagabundierenden Buchstaben an die richtige Stelle brachten: Herr Rohleder, Frau Herrnberger, Frau Kinzel-Nürnberger und meiner Tochter Susann Georgi.
Da die Seiten nicht den professionellen Werdegang eines Lektorates durchschritten haben, es ist eine finanzielle Frage, sind doch wieder einige Buchstaben, von denen es so viele gibt, an die falsche Stelle gerutscht. Trotz Sorgfalt schließe ich es nicht aus und bitte um Entschuldigung. Für Hinweise und Anregungen bin ich aufgeschlossen und bringe diese in der nächsten Auflage unter.
Christian Friedrich
1. Kapitel
Die Bahn kommt.
„Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das Ihrige thun. Vor allem aber sei es eins in Liebe untereinander, und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind; eins, daß der deutsche Thaler und Groschen im ganzen Reiche gleichen Werth habe; eins, daß mein Reisekoffer durch alle sechsunddreißig Staaten ungeöffnet passieren könne.“
-Johann Wolfgang von Goethe-
Die Sonne brennt auf die Füsiliere der Königlich Sächsischen Armee, die vom Manöver auf die Festung Königstein zurückkehren. Die 1. Division des 9. Armeekorps der Infanterie war in den Augusttagen eine Woche entlang des Elbtales unterwegs. Unter ihnen marschiert mit seinem Gewehr über den Schultern Carl August Mättig, der als Wehrpflichtiger die Hälfte des Wehrdienstes überstanden hat.
Der kräftige 1822 geborene, große Mann mit Oberlippenbart verdeckt mit dem Tschako die struppigen Haare.
Drei Jahre Dienst stehen noch vor ihm. Oben, über der Elbe, in einer Schleife des Flusses thront die Befestigungsanlage vor der Hauptstadt Dresden. Die Soldaten des Fußvolkes, gekleidet in typisch weißer Uniform mit grünen Rändern, der Dublüre, nehmen ihre letzten Kräfte in Anspruch, um die Anhöhe zu erreichen, die im Gleichschritt nicht zu bewältigen ist. Trotzdem treibt der Vizefeldwebel die Truppe mit lautem Geschrei voran. Völlig entkräftet kommt Carl August am Torhaus der Festung an. Dort wartete ein Wachmann auf die Einheit:
„Grenadier Mättig sofort zum Rittmeister in die Hauptwache!“
„Was hast Du denn verbockt?“, fragt sein Freund Hans, der aus Görlitz stammt.
„Ich weiß nicht, was ich mit den Berittenen zu tun habe? Lass mich überraschen“, antwortet Carl August. Trotz der Ansage hat er es nicht eilig zum befohlenen Ort zu kommen. Am Zeughaus vorbei und über den Kommandantengarten erreicht er auf Pflastersteinen vorerst das Kasernengebäude, um seine persönlichen Ausrüstungsgegenstände abzulegen. Mit wackeligen Knien bewegt er sich nun zum Rittmeister Schulz, der von der alten Garde war und den Spießrutenlauf vor nicht allzu langer Zeit noch durchführte. Carl August hat keine Vorahnung, was ihn erwartet. Nach dem Anklopfen lässt der drahtige kleine Mann den Füsilier eintreten und strammstehen.
„Sie waren während der freien Tage in ihrer Heimat in Berthelsdorf?“, fragt ihn der Vorgesetzte, der vom Alter her kurz vor der Pensionierung steht. So ordnet er den Offizier ein, den er stets aus dem Weg ging. Jetzt schießen ihm Gedanken durch den Kopf, Erinnerungen werden wach, die keinen Zusammenhang hervorbringen. Nach einer Pause antwortet der Füsilier:
„Jawohl, ich war zuhause“.
„Sie haben eine Dame dort im Nachbardorf Oybin kennengelernt?“
„Jawohl, Herr Rittmeister“, entgegnet er.
„Sie werden die Frau nicht wiedersehen. Wegtreten!“, brüllt der kleine Offizier. Carl August bewegt sich auf kürzestem Weg zur Unterkunft, wo der Vizefeldwebel auf ihn wartet.
„Ich weiß, was auf Dich zukommt“, bekommt er zu hören.
„Wir sprechen uns heute Abend“, meint der Vorgesetzte und befreit ihn vom Tagesdienst. Er findet keine Ruhe und denkt nach:
„Was hat Josefine mit dem alten Rittmeister zu tun?“ Eine ausgiebige Runde entlang der Festungsmauer bringt zwar Entspannung, aber nicht die Lösung seiner Fragen. Zu vorgerückter Stunde betritt der Vize die Mannschaftsunterkunft und deutet Carl August an, dass er beabsichtigt, mit ihm allein zu sprechen.
„Von Schulz habe ich die Anordnung bekommen, dich zu beobachten. Ich weiß nicht, was er von Dir will. Sei also vorsichtig!“
Es vergeht eine Woche und er sorgt sich um Josephine. Eine Beurlaubung wurde von dem Vorgesetzten vorerst abgelehnt.
„Wenn Sie nicht nach Berthelsdorf fahren, kann ich Sie für zwei Tage freistellen. Der Rittmeister darf es trotzdem nicht erfahren.“
An einem Samstag im Frühherbst 1840 begibt sich Carl August auf den Marsch nach Warnsdorf, wo er bei Verwandten übernachtet, um von dort am folgenden Tag Oybin zu erreichen. Ein Besuch im Geburtsort kommt ihm nicht in den Sinn. Schließlich lebt Josephine in der Nähe der Burg des Ortes. Angekommen, überlegt er, wie er unbemerkt die Geliebte erreicht. Da fällt ihm die Tochter Elisa vom Schreiner ein. Sie waren gemeinsam auf dem Sommerball des Dorfes, wo Carl August Josefine kennenlernte. Vor dem Haus arbeitet die Freundin im Garten und sie begrüßt den Soldaten mit freundlichen Worten, wobei er den Zweck des Besuches erklärt:
„Gern würde ich mich mit Josefine treffen“.
„Ich kümmere mich darum“, antwortet Elisa und verschwindet im Dorf. Nach wenigen Minuten erscheint sie wieder:
„Sie kommt am späten Nachmittag zum Platz unterhalb des Klosters, dort, wo Sie sich verabschiedeten“, sagte die Freundin zu ihm ganz leise, worauf er sich auf den Weg macht und wartet.
Die Geduld zahlt sich aus. Er schließt sie in die Arme.
„Ich habe mich bei Mutter zu Julia abgemeldet“, flüstert sie ihm aufgeregt ins Ohr. Durch ihr langes blondes Haar scheint die Sonne und die blauen Augen der kleinen Josephine leuchten. Gemeinsam laufen sie auf ein Waldstück weit außerhalb des Ortes zu. Sie führt ihn bis zu einer Jagdhütte mitten im Wald.
„Sie gehört meinem Onkel. Er hat für die Jagd jetzt keine Zeit“, erklärt das Mädchen. Am verschlagenen Fenster greift sie sicher zum Schlüssel und öffnet die Hütte. Carl August staunt. Ihm ist die Angelegenheit nicht so recht geheuer. Josefine zündet zwei Kerzen an und sie schauen sich um. Ein Tisch, ein Hocker, ein Schränkchen und eine Ecke für das Nachtlager, das aus Stroh und Reisig besteht. Dann sieht er sich das Mädchen an. Die Schnürung, die ihr Kleid vorn zusammenbindet, hielt nur locker beide Seiten zusammen. Ihre prallen Brüste schauten hervor. Noch immer hat er die Situation nicht erfasst. Sie kommt zwei Schritte auf Carl August zu und richtet ihren Blick nach oben in seine Augen. Ihre Hände umschlingen seine Taille. Wie versteinert steht er vor ihr. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Langsam nimmt er auch seine Arme hoch, drückt Josefine an sich heran und küsst sie. Draußen wird es dunkel und mit flinken Griffen holt sie aus dem Schrank eine Flasche Wein, ein Trinkgefäß und eine weitere Kerze hervor, die sie mithilfe einer anderen Flamme zündet. Zuerst gibt sie Carl August zu trinken, schenkt nach und nimmt sich selbst einen kräftigen Schluck. Unterdessen zieht er den Uniformrock aus, streift ihn auf dem Nachtlager ab und setzt sich auf den Hocker. Josefine breitet die Uniform auf dem Stroh aus und legt sich rückwärts darauf.
„Komm her!“, haucht sie ihn an. Er kniet sich neben sie und streicht über ihren linken Arm. Mit der anderen Hand öffnet sie ihr Kleid noch weiter. Carl August kann nicht mehr widerstehen.
In den frühen Morgenstunden werden sie von Tiergeräuschen geweckt. Er schüttelt sich und meint nur geträumt zu haben. Doch dann umarmt ihn Josefine und er merkt, dass er in der Wirklichkeit angekommen ist. Beiden kommt vorerst kein Wort über die Lippen und nachdem sie die Tür öffnen und Licht in die Hütte dringt, schauen sie sich in die Augen.
„Wie soll das weitergehen?“, fragt Carl August.
„Wenn Du von den Soldaten entlassen wirst, heiraten wir.“, erklärt sie ihm.
„Das ist doch noch eine lange Zeit und von was wollen wir leben?“ Wirft er ein.
„Mein Vater ist wohlhabend. Du kannst später bei ihm arbeiten“, zeigt sie als Weg auf.
„Ich muss jetzt nach Hause über den Umweg bei Elisa, damit die Eltern nichts merken. Ich gehe ein Stück vor Dir. Wir sehen uns wieder, wenn Du Urlaub bekommst. Schreib mir an die Adresse von Elisa“, sagt sie ihm zum Abschied.
Carl August erreicht zum Wochenanfang die Kaserne, sein Freund Hans wartet schon auf ihn:
„Der Rittmeister war hier beim Vize. Wie ich mitbekommen habe, ging es um dich. Ich hörte nur dass er sagte, Du seiest zum Wegebaukommando abkommandiert worden.“ „Danke, Hans“
„Bedanke Dich beim Vizefeldwebel!“, meint sein Freund. An den nächsten Tagen ist er mit seiner Kompanie wirklich an der Elbe beschäftigt, um Treidler Wege zu reparieren. Ausgeschwemmte Pflastersteine werden wieder eingesetzt. Carl August hat sich mit Engagement hervorgetan, so dass er das Neuverlegen der Steine leitet. Nach drei Wochen bekommt er mittels Hans, den er in die „Liebesangelegenheiten“ eingeweiht hat, Post von Josefine. Der letzte Satz belastet ihn:
„..ich muss Dich dringend sehen.“ Und erneut stand der Vize auf seiner Seite und versprach Urlaub in der kommenden Woche, wenn die Pflasterarbeiten beendet sind. Über Elisa erhält die Geliebte den Brief. Unter herbstliche Bäume führt wieder der Weg durch Warnsdorf nach Oybin zur Schreinerei, wo die Freundin lebt. Diese wiederum rennt zu Josefine und alles läuft so wie beim letzten Treffen ab.
„Komm schnell! Uns darf niemand sehen“, haucht das Mädchen dem Soldaten ins Ohr. Mit flotten Schritten durchqueren sie das Wäldchen, bis sie die Hütte erreichen. Kaum hatte Carl August die Tür geschlossen, riss sie ihm den Rock vom Leib und warf das Kleidungsstück auf das Lager. Dann hatte sie es eilig, ihr Kleid auszuziehen, unter dem sie nur das Nötigste anhatte. Jetzt half sie dem Soldaten beim Knöpfeöffnen. Es war schon früh, nachdem beide etwas schliefen.
Fernes Hundegebell weckt Josefine.
„Schnell, wach auf! Ich höre den Jagdhund vom Onkel. Zieh Dich an!“, kommandiert das Mädchen. Kaum hatten sie sich angekleidet, stand der Bruder vom Vater in der Tür.
„Bitte, es ist nicht so, sage nichts dem Papa“, fleht sie. Er sagt kein Wort. Ebenso verhält sich Carl August. Nur eine Handbewegung des Jägers bedeutet, dass beide verschwinden sollen. Am Berg des Klosters verabschieden sie sich.
„Wir schreiben uns!“, vereinbaren sie miteinander. Am übernächsten Tag erreicht er wieder die Festung Königstein. Doch bevor er Hunger und Durst stillen kann, ruft ihn der Vize zu sich:
„Ich hoffe, der Rittmeister hat von der Reise keinen Wind bekommen.“
„Nein ich war nicht in Berthelsdorf, wo der Rittmeister mich vermutet“, antwortet Carl August, „ich war nur in Oybin.“
Für die kommenden Wochen war wieder Wegebau vorgesehen. Der Soldat wartet auf Post von Josefine, die er nicht erhält. Einen Monat nach dem letzten Besuch in Oybin ereilt ihn eine andere Überraschung.
„Mättig, sofort zum Schulz“ schreit die Wache über den Flur. „Was ist denn da los?“ Carl August nimmt den schnellsten Weg zum Dienstzimmer des Rittmeisters, klopft an und tritt ein. Noch bevor er Meldung erstattet, brüllt der alte Herr los:
„Sie haben sich entgegen der Anweisung mit der Tochter des Forstmeisters getroffen!“
„Forstmeister? welcher Förster?“, denkt Carl August. Ehe er antwortet, verkündete der Offizier die Strafe:
„In Absprache mit ihren Vorgesetzten werden Sie abkommandiert, so dass Sie nicht so schnell wieder kommen können. Am liebsten nach Russland, doch das ist leider nicht mehr möglich. Sie verbanne ich zu Majors Ritter Karl Theodor Kunz, der zurzeit in Dresden schafft. Dort kommen Sie auf andere Gedanken. Morgen verschwinden Sie!“ Carl August packt seine Sachen und verabschiedet sich von Hans.
„Schicke mir die Post nach, ich schreibe Dir, wo es mich hinführt.“
Am frühen Morgen fährt er mit der Versorgungskutsche mit in die Hauptstadt, wo er schon erwartet wird.
Er meldet sich bei einem Vizefeldwebel, der ihm sein vorläufiges Quartier zeigt und verkündet:
„Morgen werden Sie Ihren neuen Vorgesetzten kennenlernen.“ Er ist gespannt, aber noch mehr quält ihn der Gedanke, wie es wohl Josefine ergeht.
Ab Dresden fährt seit diesem Jahr die Eisenbahn nach Leipzig. Carl August hörte von dieser Art zu reisen, nahm jedoch den Hokuspokus nicht ernst. Er ahnt nicht, was ihm morgen begegnet.
Mit einem Unteroffizier an der Seite verlässt er die Kaserne und ihm wird der Bahnhof von Dresden gezeigt. Er sieht dort von weitem ein Ungetüm, das mit Qualm und Krach Wagen zieht. Am liebsten hätte er wieder beigedreht, doch eine Kompanie von Soldaten ohne Waffen wartet auf einem Bahnsteig auf ihn. Der Vizefeldwebel erklärt, was hier die Aufgaben sind:
„Ein Teil dieser Leute hat die Bahn von Leipzig bis hierher gebaut. Sie haben diese Gleise verlegt. Der Major Kunz, der den Bau leitet, benötigt neue und fähige Köpfe, um die Eisenbahn weiter zu bauen.“
„Ich kann nur Pflastersteine verlegen!“, wirft Carl August ein. „Das ist ein guter Anfang. Wir probieren es morgen mit den Gleisen!“, entgegnet der Unteroffizier.
Gemeinsam schauen sie sich am nächsten Tag an, wie ein Abstellgleis gebaut wird.
„Da sind viele Dinge zu beachten: So zum Beispiel muss der Abstand der Eisenteile unbedingt gleich bleiben. Alles läuft fast immer nur geradeaus! Und nicht vergessen, was sich für schwere Fahrzeuge darauf bewegen.“ Der Vizefeldwebel hört auf zu sprechen, denn es kommt eine Dampflok auf dem Nachbargleis gefahren. Carl August bleibt versteinert stehen und bewundert das Stahlross. Einige Soldaten vom Bahnsteig, der Unteroffizier und er steigen zu den Arbeiten am Abstellgleis hinab und man zeigt dem Neuling gern, wie gearbeitet wird. Vier Gleisarbeiter führen vor, wie die Schwellen ausgerichtet und eingebettet werden. Gemeinsam holt man mit einer Art von Zangen einen Schienenstrang und justiert den Zweiten. Der Vorgesetzte lässt es sich nicht nehmen, das Einschlagen der Nägel zu demonstrieren. Er übergibt Carl August den Hammer und fordert ihn auf, dies nachzumachen. Der vorbereitete Stahlstift springt beim ersten Schlag davon und er erntet eine Lachkanonade der Soldaten.
„Das lernst Du alles“, tröstet ihn der Unteroffizier. Bis in das Jahr 1841 hinein arbeitet man an den Gleisen am Bahnhof Dresden und er erlernt die wesentlichen Aufgaben des Gleisbaus. Unter das arbeitende Volk mischt sich unangekündigt und unauffällig Major Ritter Karl Theodor Kunz, der Leiter des Baugeschehens und beobachtet seine Kompanie beim Schaffen. Carl August fällt ihm auf: Er langt einerseits kräftig zu und anderseits hantiert er erfolgreich mit empfindlichen Messgeräten. Zudem nutzt er seine Begabung, Menschen zu motivieren.
„Junger Herr (nicht Soldat), ich nehme Sie mit zur Leipzig-Hofer Bahn!“, verkündet er. Abends überdenkt er die sich anbahnende Zukunft beim Gleisbau. Es gefällt ihm bei der Truppe. Von Dresden aus ist es jedoch schwer, zu Josefine zu kommen. Aber was wird das mit der noch weiter entfernten Stadt? Für das Angebot von Kunz gibt es vorerst keine Alternative. Zu Neujahr werden Soldaten von hier nach Leipzig abkommandiert. Unter ihnen ist auch Carl August. Die Staatsregierung in Bayern hat am 14. Januar schriftlich erklärt, die Bahn zwischen Hof und Nürnberg zu realisieren. Er fährt das erste Mal mit der Eisenbahn und ist entsprechend aufgeregt. Ständig fragt er sich, ob er wohl bald auch in die Gegenrichtung reist, um Josefine zu erreichen.
Kurz vor der Abfahrt erhält er noch einen Brief von Hans, in dem die Worte der Geliebten verpackt sind.
„Teurer Schatz, wenn ich diese Zeilen schreibe, ergeht es mir gut. Erschrecke nicht! Ich erwarte ein Kind.“ Carl August atmet tief durch und liest die nächsten Worte:
„Für das Kindlein ist gesorgt. Rittmeister Schulz wird mich heiraten...“Alles Weitere überliest er, zerknüllt das Papier und wirft es weg.
Seine Reisegruppe hat ein Ticket der 4. Klasse. In den Wagen gibt es keine Sitzplätze und Fenster. Die Türen sind an den Stirnseiten angeordnet und er steigt über die Gleise und zwischen den Puffern ein. Die ersten Fahrgäste setzen sich auf den Boden und lehnen sich an die Wand. Gewärmt wird er nur von seiner Uniform. Zum Glück wird der Wagen nicht so voll und damit braucht kein Reisender zu stehen. Der Schaffner klappt die Türenbretter hoch, ein Pfiff, ein Ruck und ab geht die 116 Kilometer weite Reise. In Radebeul und Coswig hält der Zug das erste Mal. Die Fahrt durch den Tunnel Niederau bemerkt er nur am Geräusch und dem Qualm der Lok, der in den Wagen eindringt. Der Klang der Schienenstöße ändert sich, nachdem der Zug die Elbbrücke passiert. In Riesa steht die Bahn längere Zeit. Einige Fahrgäste nutzen die Toilette. Dann das Abfahrtsignal, ein Pfiff und ein Ruck und weiter bewegt sich der Zug in Richtung Leipzig. Nach ungefähr sechs Stunden Fahrt erreichen sie die Messestadt. Zwischen den Puffern steigen die Reisenden aus. Aus der dritten Klasse kam der Unteroffizier, der mit den Soldaten eine Kaserne aufsucht. Sie alle sind für den Eisenbahnbau abgestellt und haben ihre Aufgaben in der Erweiterung und Umgestaltung der Gleisanlagen der Bahnhöfe.
Im Juni 1841 steht es fest: Die Bahn wird von Leipzig nach Hof gebaut. Bei Major Kunz hat sich Besuch angesagt. Hauptmann Wilke, der für den Weiterbau zuständig ist, erklärt den Personen, die Verantwortung tragen, die vorläufige Streckenführung, wobei die wenigsten verstehen, was besprochen wird.
Im September 1841 werden endlich die Arbeiten aufgenommen. Das Vermessungskommando hat bis Crimmitschau die Planung fertiggestellt. Man hört, dass es dabei große Probleme gab. Beim Fortsetzen der Tätigkeit in Richtung Werdau ist einer der Ingenieure ermordet worden.
Die italienischen Arbeitskräfte fungieren als Vorhut, um das Gelände eben aufzubereiten. Es folgen die Leute, die den herangefahrenen Flussschotter verteilen, worauf die Schwellen gebettet werden. Jetzt sind die Spezialarbeiten der Truppe von Major Kunz gefragt. Der Sitz des Oberbaues wird geprüft, die Schienen werden herangetragen und justiert. Hier arbeitet Carl August mit und kommandiert die Gruppe, die den Stahlstrang auflegt. Mit Vorrichtungen überprüft er das Ergebnis und lässt notfalls korrigieren. Wenn alles funktioniert, vernageln die Leute den Stahl mit dem Holz.
In den nächsten Wochen verlassen sie die Kaserne, da der Bau vorangeschritten ist. Es entstehen Behelfsbaracken und Zelte für Personen und Material. In den Abendstunden kommen die Soldaten und die Arbeiter der verschiedensten Nationen zusammen. Meist sitzen sie getrennt um ihre Lagerfeuer herum. Auffällig ist die „italienische Formation“, denn sie singen gemeinsam ihre Lieder der Heimat. Die vielen Vokale ihrer Sprache lassen den Gesang emotional klingen. Carl August setzt sich mit zu den Südländern. Einen davon kannte er schon, da er eine Führungsrolle hat und am besten Deutsch spricht. Man lächelt sich zu und rückt zusammen.
„Du stammst aus Italien?“, fragt Carl August.
„Aber nein! Ich Sizilianer! Das ist Unterschied!“ Eigentlich war die Frage auf ein belangloses Gespräch ausgerichtet. Doch er hatte den Nerv getroffen und erkundigte sich deswegen weiter:
„Was ist denn da der Unterschied?“
„Unsere Insel wird unterdrückt und wir sind für gemeinsamen Staat. Wir nennen es Risorgimento“, informiert der schwarzgelockte Mann gegenüber,
„meine Familie Tod und ich bin nach dem Aufstand geflüchtet. Hierher.“
Ruhe. Wenige Minuten später:
„Ich bin Carl August und Du?“
„Mario Salvadore Luigi darf ich vorstellen, gerufen Mario“, erklärt der mittelgroße, gutgebaute Herr aus Sizilien. Beide finden sich irgendwie sympathisch.
Nach verrichteter Arbeit in den Abendstunden sitzen die zwei immer gemeinsam am Feuer. Der Sachse summt mittlerweile die fremden Lieder aus dem Süden mit und fühlt sich wohl dabei. Meist denkt er an Josefine und meint, dass doch alles gut wird. Inzwischen haben beide eine Nebenarbeit erhalten: Vorgesetzte erklären Carl August Aufgaben und Probleme, die italienische Arbeitskräfte betreffen. Er überträgt dies an Mario. Und er wiederum gibt es in seiner Landessprache aus. Das Problem „Babylon“ ist geklärt und erleichtert die Arbeit der Herren von der Bauleitung.
Doch dann kommt ein strenger Winter, der die Bauarbeiten ruhen lässt. Das Leben spielt sich in den Baracken ab. Einige Soldaten, die in der Nähe wohnen, beurlaubt man nach Hause. Für Carl August bietet sich die Chance, zum Heimatort von Josephine zu fahren. Noch immer weiß er nicht, ob sie nun verheiratet ist und was mit dem Kind ist. Mit dem letzten Schwellentransport reist er auf dem offenen Wagen, der das Ziel Riesa hat. Er ist dabei fast erfroren. In der sich entwickelnden Stahlstadt sucht er eine Herberge, um zu übernachten und sich aufzuwärmen. Allzu viel Geld sparte er bisher nicht und deswegen mietet er eine billige Absteige. Nebenan in einer Kaschemme verzehrt er eine heiße Suppe und ohne, dass er so etwas bestellte, brachte der vermeintliche Wirt einen Branntwein, der ihn sofort schlafen lässt. Nachdem er aufwacht, findet er sich ausgeplündert erneut auf der Straße. In der Pension und in der Kneipe erkennt man ihn nicht als Gast und schmeißt den Mann zur Tür hinaus. Er plant, so schnell wie möglich wieder zurück auf die Baustelle zu kommen. Auf dem Bahnhof fehlt ihm das Fahrgeld für ein Ticket. Nach einer kalten Nacht in einem Nebengebäude der Bahn, wo er in einer Kohlenecke schlief, schaut er sich bei Feuerleuten und Lokführern um, ob sie ihn mitnehmen. Ein bekannter Heizer, der schon oft zur Baustelle fuhr, überzeugt seinen Lokomotivführer, den Gestrandeten mitzunehmen. In Leipzig peilt er die Kaserne an, von der er umgehend zum Gleisbau geleitet wird.
„Was machst Du denn schon wieder hier?“, fragt der Sizilianer.
„Ich bin froh wieder hier zu sein!“, verkündet er und erzählt die ganze Geschichte.
Nun versuchen sie, sich gemeinsam die Zeit zu vertreiben. Einen großen Teil davon nutzen sie, um die jeweils andere Sprache zu lernen. Der Sachse zeigt dem Sizilianer, was man über Weihnachten isst. Die Begeisterung von Mario hält sich in Grenzen. Er hätte gern seine Küche gezeigt, wo die Zutaten dafür fehlen. Doch sie finden immer neue Ideen, die Wintertage zu überbrücken.
Mit dem Neujahr 1842 bereitet man die Tätigkeiten für den Bau nach Altenburg vor. Die Führung der Arbeiten übertrug man nun in zivile Hände, in die der Eisenbahngesellschaft. Es änderte sich wenig, nur die Entlohnung der Vorgesetzten verbessert sich. Auch für Mario und Carl August.
Der Fluss Pleiße bereitet der Gruppe von Italienern keine Probleme, da die Strecke meist flach oder am Wasserlauf entlang führt. Das Flussbett liefert überdies Schotter. Im Frühjahr verlegt man, nachdem der Frost aus dem Boden gewichen war, die Gleise. Vom alten Eisenwerk aus Riesa kam der erste Waggon mit vier Meter langen Schienen an. Carl August inspiziert die Stahlstränge auf dem Güterwagen. Er ruft den Kollegen, der gerade vorbei kommt:
„Mario, komm auf den Wagen und schau Dir den Stahl an. Fällt Dir etwas auf?“
„Schief gewachsen, das Eisen“, antwortet er und ergänzt,
„Schicke doch Arbeiter zu Wilke ins Lager. Er soll schauen.“
Die Erd- und Schotterarbeiten liefen problemlos weiter. Material liegt genügend bereit. Am nächsten Tag hören sie eine Lok herandampfen, die den Wagen mit den fehlerhaften Schienen holt. Nachmittags schiebt eine Lok zwei Waggons heran, die mit Stahlsträngen beladen sind. Carl August klettert hoch und schaut sich den Transport an und ruft zu Wilke, der auch mit gewartet hat:
„Gute Qualität, kommt aus England!“ Bis Sonnenuntergang wird fleißig am Gleis gebaut. Danach trifft man sich weiter am abendlichen Lagerfeuer.
An einem Sommerabend nimmt Wilke die Vorarbeiter zusammen:
„Es stehen schwierige Aufgaben vor uns. Der Regent von Sachsen – Altenburg hat dem Bahnbau durch sein Land nur zugestimmt, wenn er auch wie Leipzig einen Kopfbahnhof erhält. Wir müssen Kurven in den Bahnhof hinein und heraus bauen.“
„Für uns ist Bewegung der Erde notwendig, wenn wir Fluss verlassen“, erkennt Mario.
„Das ist das kleinere Problem des Oberbaues“, meint Wilke und erklärt weiter, „die Mittellinie der Gleise wird weiterhin mittels kräftiger, sorgfältig eingetriebener Pfähle abgesteckt. Die Distanzen werden von 50 Meter auf 20 verkürzt, um die Kurve zu bauen. Die Schienenoberkante wird gehalten.“
Mit Schwerlastwagen, die von Pferden gezogen werden, kutschiert man die vorgefertigten Schienen quer durch Deutschland. Dank des trockenen Wetters verteilen Fuhrwerke problemlos alle Metallteile entlang der Strecke.
Im September 1842 werden die letzten Gleise nochmals an den Pfählen justiert und unterstopft. Der Bahnhof Altenburg ist nun mit Leipzig verbunden. Weiter, mittels einer Kurve, führt der Bau in Richtung Crimmitschau. Mario und Carl August laufen die Vermessungspunkte ab.
„Da bauen wir die nächste Strecke am Fluss entlang. Das ist gut!“, freut sich der Sizilianer. Der Bau bis Gößnitz verzögert sich in das Jahr 1843, da es an Stahl fehlt. Der Bedarf ist europaweit gestiegen und die erzeugte Menge durch das Puddelverfahren der Stahlherstellung ist begrenzt.
Für den nahenden Winter bauen die Arbeiter Unterkünfte aus Holz außerhalb der Stadt auf. Für Vorrichtungen und Materialien entstehen Lagerschuppen. Alle Leute werden am Oberbau eingesetzt, so dass nur noch die Schienen montiert werden. Aber auch hier gibt es durch den aufgeweichten Boden Nachschubprobleme.
In dem Jahr zieht dann ein zeitiger Winter mit strengem Frost ins Land. Die Baracken halten trotz Öfen keine Wärme. Die Arbeiter, die bei Leipzig wohnen, bleiben zu Hause. Der Rest der Mannschaft friert. Carl August plant, während der Bauunterbrechung nach Oybin zu fahren, um Josephine zu besuchen. Doch er hat sich schwer erkältet und kommt zum Liegen.
„Mario versuche, in Altenburg eine Unterkunft zu finden, wo man Schlafen und Essen kann!“
„Ich laufe in die Stadt. Wir haben genügend Geld dafür“, meint der Sizilianer. Zuerst schaut er sich am neuen Bahnhof um. In einer Seitenstraße sieht er den Namen „Logier“. Er trifft Wilke an, der hier eingezogen ist.
„Das Haus ist voll. In der Schmöllnschen Straße ist ein Zimmer frei. Es hat wenigstens Betten und einen Ofen. ich war vorher dort“, empfiehlt der Bauleiter. Er findet das Gebäude und wird sich schnell mit dem Vermieter einig. Auf kürzestem Weg holt er Carl August heran, der sich schleppt. Mario stützt ihn.
„Es ist gut einen Freund zu haben!“, sagt der Kranke ganz leise. Nachdem der Ofen Wärme spendet und der Patient sich legt, holt der Sizilianer die wenigen Sachen aus der Baracke. Unterwegs entdeckt er eine Garküche und er überrascht mit einer Suppe. Unter den neuen Bedingungen wird Karl August langsam gesund.
Im März 1843 wurde das Gelände der zukünftigen Bahn frostfrei und die beiden ziehen wieder zum Bahntross um. Die Lastkutschen kommen mit dem gelieferten Stahl nicht an die Strecke, da alles aufgeweicht ist. Über weite Distanzen werden die vier Meter langen Schienen mit Tragevorrichtungen manuell bewegt. Wilke schaut sich den Vorgang an und sagt zu seinen Vorarbeitern:
„Zurzeit habe ich auch keine andere Lösung. Aber die neuen Lieferungen kommen vom Stahlwerk Riesa. Da fährt die Lok mit dem Waggon heran. Achtet darauf, ob die Qualität stimmt!“ Mario schüttet mit den Leuten einen Damm für die Gleise auf, damit bei Hochwasser der Pleiße die Strecke keinen Schaden nimmt. Das hält auf und sie werden wohl die geplante größere Ansiedlung in diesem Jahr nicht mehr erreichen.
„Für den nächsten Winter suchen wir ein Quartier in einer Pension der folgenden Stadt“, legt Carl August fest und ergänzt, „ich meine, das ist Gößnitz oder Crimmitschau. Aber ich denke, im Sommer kommen wir bis Gößnitz. Das Winterquartier wird wohl Crimmischau sein.“ Immer der Pleiße entlang verlegt man die Gleise. Das Gelände ist gefällig, aber mit den Stahllieferungen gibt es Verzug. Im September 1843 erinnern sich Carl August und Mario, dass doch auch wieder ein Winter kommt und dass sie einen Winterplan hatten.
Die Truppe des Sizilianers ist mit ihren Erdarbeiten dem Gleisbau weit voraus und sie stehen damit vor den Toren von Crimmitschau. Bei einer Besprechung mit Bauleiter Wilke fragt Carl August, ob er eine Möglichkeit der privaten Übernachtung kennt, und er antwortet prompt:
„Die Stadt ist für die Eisenbahn sehr aufgeschlossen. Die Betriebe warten auf Gleisanschluss und unterstützen uns. Die Bauleitung hat schon Quartier bezogen. Gestern kam noch ein Angebot vom Textilfabrikanten Kürzel zu uns. Das wäre was für Euch.“
Carl August schaut sich die erledigten Erdarbeiten mit Mario zusammen an. Kurz vor Crimmitschau kommt man auf die Idee, nach der Übernachtungsmöglichkeit zu fragen, und sie suchen die Fabrik von Kürzel, die sie auch mit Hilfe von Passanten finden. Am Eingang werden sie auf Nachfrage zur Verwalterin des Gästehauses verwiesen.
Sie mieten für den Herbst zusammen ein Zimmer. Das Haus wird von Reisenden und Vertreter anderer Firmen, genutzt. Ab November stellt man wetterbedingt die Arbeiten an der Bahnstrecke weitestgehend ein.
An den folgenden Wintertagen helfen beide im Textilbetrieb des Vermieters mit und verdienen sich Kost und Logier mit Hilfs- und Transportaufgaben.
An einem Dezemberabend werden sie beim Fabrikbesitzer eingeladen, dem der Fleiß der Streckenarbeiter auffiel. Da entstand bei den beiden Männern Ratlosigkeit. Wie benimmt man sich? Was wird erzählt? Und die wichtigste Frage, was zieht man an? Sie bitten die Haushälterin um Rat.
„Der Herr ist ein toleranter Mensch. Trotzdem würde ich auf seine Einladung hin saubere Kleider anziehen.“ Carl August hat immer noch die Soldatenkleidung an, die sehr gelitten hat. Mario sieht schlimmer aus.
„Ich glaube, mit Waschen ist ihnen geholfen, aber nicht wenn Sie mit Herrn Kürzel zusammenkommen.“ Ratlosigkeit.
„Die Sachen von meinem verstorbenen Mann dürfte keinen passen. Er war klein und schlank“, erklärt die Hausdame. Beide immer noch ohne Plan.
„Ich habe eine Idee“, wirft die Frau ein, „wir haben in Crimmitschau einen Verleih, eben für Anzüge, Smoking und so weiter. Wir besuchen morgen das Geschäft.“ Wie vereinbart, marschieren sie gemeinsam in den Garderobeverleih. Der Angestellte mustert die beiden Herren und äußert:
„Schwierig, schwierig, zu groß, zu dick.“ Es wird probiert und probiert. Es gibt Hochwasser oder ein Keil fehlt. Dann greift der Ladenbesitzer in die Abteilung der ausgemusterten Stücke, die noch von den Franzosen stammen. Wie wundersam. Beide finden etwas Passendes. Doch Knöpfe fehlen und die Motten haben an den Sachen genagt. Die Haushälterin mischt sich ein:
„Wir kaufen die zwei Anzüge. Ich repariere sie.“
Vor dem Abend mit Herrn Kürzel werden sie eingekleidet und erkennen sich selbst nicht wieder. Dumme Sprüche verteilen sie sich gegenseitig: „Du Hofnarr“, „du Kammerdiener“, „du Pinguin“, „du Vogel“ und so weiter. Am Ende liegen sie sich lachend in den Armen. Nur die Dame des Hauses bleibt ernst.
„Wie werden bloß feine Leute aus Euch?“
Sie betreten die Villa und zum Glück ist die Haushälterin wieder in der Nähe, die Sicherheit vermittelt. Ihnen wird der neuvernähte Mantel abgenommen. In dem mit Marmor verschalten Raum führt eine geschwungene Basalttreppe in den ersten Stock. Ein Diener des Hauses öffnet die schwere Eichentür des Empfangsraumes. An einer langen Tafel sitzt am Ende Herr Kürzel. Hinter ihm brennt der offene Kamin. Ein prachtvoller Leuchter spendet das passende Licht. Die zwei wären am liebsten umgekehrt und sehen sich um. Diener und Haushälterin versperren jedoch die Tür.
„Bitte, nehmen Sie Platz, meine Herren.“ Einstimmend fragt der Hausherr:
„Wie gefällt Ihnen die Stadt?“
„Wir haben nicht viel gesehen“, meint Carl August.
„Aber die Unterkunft wunderschön“, ergänzt Mario.
„Aufgefallen ist der riesige Qualm und Gestank der Schornsteine“, wirft der Sachse ein.
„Das bringt den Reichtum in die Stadt. Jeder Schlot in der Stadt vermehrt unseren Reichtum.“
„Es ist der gleiche Geruch, den auch die Bahn verbreitet. Überall sind die Dampfmaschinen versteckt, die unsere Zukunft sind. Die Schornsteine sind nur das notwendige Übel“, erklärt Herr Kürzel. „Aber nun zu Ihnen. Wie kommen Sie zum Bahnbau?“
„Eine lange Geschichte bei uns, kurz gefasst: Ich war Soldat auf Königstein. Bin bei einem Rittmeister in Ungnade gefallen und bin dadurch zum Eisenbahnbau gekommen.“
Mario beschreibt es so:
„Ich komme von der Insel Sizilien. Meine Familie kämpfte für Freiheit. Alle wurden getötet. Ich konnte fliehen und fand Arbeit bei Eisenbahn.“
„Darf ich Sie zum Essen bitten. Dann erzähle ich von mir, der Firma und warum ich die Eisenbahn unterstütze“, erklärt Herr Kürzel. Der Diener öffnet eine Seitentür des Empfangsraumes, die zum Esszimmer führt. Sofort fallen Carl August der riesige Leuchter und die stuckverzierte Decke auf. Mario fällt das viele Geschirr auf, das leer ist. Dann bestaunt er die Bilder an der Wand und die Bleiverglasung der Fenster. Sie setzen sich auf die geschwungenen Polstersessel und die vertraute Haushälterin und der Diener bringen das Essen. Ein Schweinebraten mit Kartoffeln und Kraut. Beide sind hungrig, doch erinnern sie sich an die Belehrungen der Hausdame, langsam zu speisen.
Es wird Wein gereicht und zum Nachtisch gibt es gekochte Apfelscheiben. Sie verlassen den Raum in Richtung Rauchersalon. Ein rot tapeziertes Zimmer mit Sesseln, einem kleinen Tisch und einem Kamin. Herr Kürzel teilt Zigarren aus, wobei er das Anschneiden vorführt. Gemütlichkeit kommt auf und der Hausherr erklärt, warum sie gemeinsam hier sitzen. Er schaut zu Mario und meint:
„Auch bei uns sind die Fürsten ein Problem, nicht, dass Menschen von denen auf der Straße ermordet werden, wie bei Ihnen. Sie stehen bei uns im Weg. Behindern Handel und Wirtschaft und plündern das Volk aus.“
„Aber unser König ist doch wichtig“, meint Carl August.
„Schauen Sie in Richtung Amerika. Dort gibt es keinen Monarchen. Und das funktioniert.“ Mit einer Denkpause fährt Kürzel fort:
„Viele Menschen im Land streben nach einem geeinten Staat, ohne Fürsten. Es sind Bürgermeister, Abgeordnete, Ingenieure und Leute wie Sie.“
„Ich verstehe das, wir kämpfen auch für ein gemeinsames Italien“, wirft Mario ein.
„Und nun zur Eisenbahn“, der Hausherr holt weit aus, „die Bahn ist ein wichtiges Instrument, um unsere Ideen zu verwirklichen. Deswegen sitzen Sie heute hier, weil ich ihnen Hochachtung zolle. Es wird ein Deutschland geben ohne innere Grenzen und Schranken. Alle Waren können frei fließen. Einigen Leuten von uns, den Republikanern, werden Sie noch begegnen, da viele auch für die Bahn arbeiten.“ Nun erzählen sie von ihrem Alltag. Carl August und Mario beschreiben Stahl, Oberbau, Montage und so weiter. Kürzel will es genau wissen. Dann erklärt der Hausherr seine Firma.
„Sie haben mitgeholfen, die schweren Wollballen im Betrieb zu bewegen. Ich kaufe die rohe Baumwolle. Sie kommt von Übersee. Mit Lastkutschen wird sie aufwendig hierher transportiert. Die Eisenbahn erledigt es schneller und billiger. Dann färbe oder bleiche ich das Material und wieder werden große Teile mit Pferdekutschen wegtransportiert oder wir spinnen Fäden daraus.“ „Und dann wird wieder alles transportiert, am besten mit der Eisenbahn“, erkennt Carl August.
„Unser zweites Problem sind neue Ideen, die oft von Engländern, Belgier und Holländer kamen. Wir brauchen fähige Köpfe hier im Land“, erklärt Herr Kürzel und fährt fort,
„für mich war zum Beispiel ein Fabrikant, ein Färber aus dem Ort, David Oehler, ein Vorbild. Er war ein Wegbereiter bei der Entwicklung von Farbstoffen für unser Tuch. So ein Genius entwickelt sich aber nur in einer freien Wirtschaft und im Handel mit anderen Regionen.“ Dann bittet Kürzel die Haushälterin, sie möge die gefärbten Textilien von Oehler zeigen. Die Herren von der Bahn sehen Tuche, die im Kerzenschein bewegt, verschiedene Farbtöne annehmen.
„Sie waren weltweit gefragt und haben Crimmitschau berühmt gemacht“, ergänzt der Hausherr. An dem Abend vertiefen sie die Diskussion zum einigen Deutschland. Carl August hätte nie erwartet, dass am König gezweifelt wird.
In den Tagen vor Weihnachten helfen beide in der Färberei und übernehmen das Pressen der gefärbten Wolle. Zum Fest sind die Familie, die zwei Bahnarbeiter und Freunde aus Werdau eingeladen. Die Ehefrau von Kürzel erscheint als seltener Gast zum Weihnachtsfest am 1. Feiertag. Eine kleine schlanke Frau, die gehbehindert ist und nach dem Essen von den Bediensteten auf ihr Zimmer getragen wird. Nachdem die Mitarbeiter des Hauses auch zu ihrer Feier freigestellt sind, sitzt man noch zu fünft im Empfangszimmer. Der Kamin wurde vorher nochmals ordentlich nachgelegt und die Freunde aus Werdau stellen sich mit dem Namen Göldner vor. Kürzel ergänzt, dass sie in der Nachbarstadt eine Baumwollspinnerei besitzen. Auch sie gehören zu den Republikanern, worüber Carl August staunt, denn er kannte vorher nur Königsgetreue. Die Frau des Werdauer Gastes, eine große schlanke Dame mit blonden Haaren in den besten Jahren, erzählt von der Baumwolle und von dem Land, wo diese herkommt.
„Dort gibt es zwar keine Könige und Fürsten“, erklärt die Frau, „aber trotzdem arbeiten dort Leibeigene, Sklaven auf den Feldern.“ Auch Kürzel weiß noch viel über den Staat zu berichten. Mario berichtet dann von seiner Insel und dem feuerspeienden Berg darauf. Carl August beschreibt seine Lausitzer Heimat und ist stolz auf das Land. Der wortkarge Göldner im feinen Zwirn mit einer Halbglatze meint nur, dass er einen Vertreter beauftragt, der beiden Herren Werdau und Umgebung zeigt.
Mario kam noch auf die Idee, die Familie zu fragen, ob sie eine Pension auf dem weiteren Weg empfehlen könnten.
Mit reichlich Geld ausgestattet plant Carl August endlich die Reise zu Josephine. Er erhielt weiterhin kein Lebenszeichen von ihr. Im Januar werden die Baumaßnahmen noch nicht aufgenommen und so fährt er mit einem Ticket 3. Klasse nach Dresden und leistet sich eine Kutschfahrt zum Heimatort von Josephine. In Oybin angekommen, führt der Weg zur Freundin von ihr. Erschrocken empfängt sie Carl August:
„Komm herein, ich kann mir denken, warum Du hier bist.“
„Wo ist Josephine, was ist mit ihr?“, fragt er.
„Setz Dich, ich erzähle Dir, was ich weiß“, sagt beruhigend die Freundin.
„Im Frühling, in dem Du schon weg warst, sollte die Hochzeit stattfinden. Doch da war offensichtlich, dass sie ein Kind bekommt. Es gab Streit mit dem Offizier und sie trennten sich. Das wiederum rief ihren Vater auf den Plan, der völlig durchdrehte und sie ´rausschmiss.“
„Und wo ist sie jetzt?“, fragt Carl August.
„Sie übernachtete bei mir, und sie sollte mit dem dicken Bauch hierbleiben. Doch sie wollte weg. Ich vermutete, dass sie zu Dir fährt und ich ließ sie ziehen. Seitdem erhielt ich kein Lebenszeichen von ihr.“ Unverrichteter Dinge fährt er zur Festung Königstein, um nach Hans zu suchen, ob er etwas weiß. Dort erklärt man ihm nur, dass er laut Papiere entlassen wurde. Die Kameraden sind auf Nachfrage auch in alle Winde verstreut. Carl August fährt ratlos zurück.
Im Jahr 1844 kommt es zeitig zur Schneeschmelze und die Pleiße tritt über die Ufer. Wilke stellt mit Genugtuung fest, dass der Oberbau bis nach Gößnitz hält. Der Bau wird frühzeitig fortgeführt, so dass man schon im März den Bahnhof von Crimmitschau erreicht.
Die Honoratioren und Fabrikanten des Ortes feiern im zeitigen Frühjahr den Bahnanschluss nach Leipzig. Auf die Bauleitung kommen neue Probleme zu.
In Richtung Werdau und weiter sind riesige Erdbewegungenzu bewältigen. Ein Berg ist für das Bahngelände abzutragen. Ein breiter Graben im Westen der Stadt wird verfüllt. Eine Reihe von hohen Bahndämmen ist zu errichten.
Der Bau von vorerst vier großen Brücken folgt gleich danach. Die Maßnahmen brauchen Arbeiter, die über sachsenweite Annoncen und Aushänge geworben werden. Das geschieht nicht ohne Erfolg, denn auch das Textilhandwerk steckt in einer Krise und Arbeitskräfte sind frei.
Sie kommen aus allen Regionen Deutschlands, vor allem aus Böhmen, Altbayern, Franken und vom Balkan. Von Schlesien reisen ehemalige Weber als Handlanger, Hilfsarbeiter oder Maurer an.
Schon ab 1843 entwickelt sich mit der 10. und 11. Bausektion von Crimmitschau nach Zwickau ein Dorf im Ort Leubnitz. Zwischen dem Brückenbau in der Neustadt und dem Viadukt sind im Frühjahr 1844 zeitweise 1400 Arbeiter angestellt.
Die tiefe Schlucht mit einem verrohrten Bach mit dem gewonnenen Material aufzufüllen, scheint unmöglich zu sein. Oberbauleiter Wilke kommt auf die Idee, eine Feldbahn einzusetzen, was den Prozess ermöglicht und beschleunigt.
Ursprünglich ist nur der Dorfschmied mit den Aufträgen zumBrückenbau beschäftigt. Es folgen ein Holzplatz und Unterstellmöglichkeiten für Pferde. Zwischendurch entstehen die Baracken für die Arbeiter, der Hufschmied nimmt ebenfalls die Tätigkeit auf.
Den Militärkolonnen nachgeahmt, gibt es die Marketender, die für die Waren und Dienstleistungen im privaten Bereich sorgen. Für die Vorrichtungen und Lehren braucht man dringend Tischler und Zimmerer, die auch ein Holzhaus als Werkstatt aufstellen. Die Bergleute aus Zwickau, die die Pumpen am Laufen halten, beziehen Zelte, die etwas außerhalb stehen. Den größten Arbeitsraum beanspruchen die Steinmetze.
Auf den lehmigen Wegen zwischen den Gebäuden bewegen sich die Pferdefuhrwerke. Wenn es regnet, entsteht Schlamm. Doch in den beginnenden Sommermonaten entwickelt sich auf den Zufahrten Staub, der das ganze Fort einnebelt. Um die Seiten des Lagers zu wechseln, gibt es eine Furt durch den Bach. Für trockene Füße der Arbeiter sorgt eine Behelfsbrücke über die wechselnde Strömung.
Der Bedarf an allen Formen von Baustoffen ist riesig. Die lokalen Bauern fällen und holen Baumstämme, um den Hunger an Bauholz zu stillen. Steine, Granit und Porphyr, stehen auf der Wunschliste der Brückenbauer ganz oben.
Schon vor einigen Jahren schickte die Bahngesellschaft Geologen an der zukünftigen Bahnstrecke entlang, um die begehrten Materialien zu finden. Überall stießen sie auf Lehm, der zwar für das Brennen von Ziegel geeignet ist, aber nicht für Fundamente und Natursteinbrücken. Neben dem unbrauchbaren Rotliegenden gibt es auch Kiesschichten, die alte Flüsse und Bäche hinterließen. Diese nutzen die Eisenbahnbauer nur bedingt. Erfolglos war die Suche nach speziellen Felsen, die man sich von der Härte her wünscht.
Schuld für die Misserfolge beim Aufspüren waren Kräfte der Erdgeschichte, die vor Millionen von Jahren ein altes Gebirge, das westlich von hier aufragte, abtrugen. Die tiefen Schichten der Berge wurden durch Wind und Wasser über unendlich lange Zeiträume freigelegt. Der „Abraum“ lag bei uns in Westsachsen. Das positive Resultat findet man auf der thüringischen Seite des Werdau - Greizer - Waldes. Dort stehen in den Steinbrüchen harte Felsensteine aus der Urzeit der Erde zum Abtransport bereit.





























