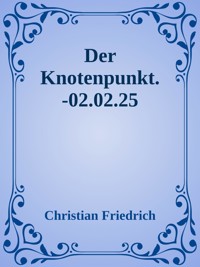8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wenn sich jemand vornimmt zu versagen, und dieser jemand versagt, hat er dann versagt oder sein Ziel erreicht. Warum versagen wir überhaupt? In diesem Werk werden die Gründe des Versagens in drei Hauptbereiche eingeteilt, die bildlich gesprochen als weicher Korpus (Körper, Zähigkeit, Wohlbefinden), weicher Kern (Charakter, Werte, Vorbilder) und weicher Keks (Denken, Wissen, Intelligenz) umschrieben werden. Mit Beispielen, die von der Antike bis zu Themen mit aktuellem Bezug reichen werden diese humoristische und zum Teil auch satirische Art und Weise erneut aufgearbeitet. Weicher Korpus, weicher Kern, weicher Keks - Die Dreifaltigkeit des Versagens!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über den Autor
Der Autor Christian Friedrich trat bisher nur als Fachbuchautor sehr erfolgreich in Erscheinung. Mit diesem Werk versucht er als Sachbuchautor an diese Erfolge anzuknüpfen. Er arbeitet in der Softwareentwicklung und der Qualitätssicherung hauptsächlich im Umfeld der Forschung und Entwicklung von Medizintechnik und In-Vitro-Diagnostik.
Mit seinen im bisherigen Berufsleben sehr geschätzten analytischen Fähigkeiten, gepaart mit einem Humor, dessen Palette von feinsinnig bis bärbeißig jede Schattierung aufweist, beleuchtet er die Entwicklung des Zeitgeistes über die letzten 30 Jahre aus einer ganz besonderen und facettenreichen Perspektive.
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich allen fleißigen Händen danken, die direkt oder indirekt an der Produktion und dem Vertrieb eines solchen Werkes beteiligt sind und die ansonsten eher keine Erwähnung und Würdigung ihrer Leistung finden.
Mein besonderer Dank geht an meine kongeniale Ex-Kollegin Carola, die mich in der Entstehungszeit dieses Werkes immer wieder darin bestärkt hat, auf dem richtigen Weg zu sein.
Außerdem möchte ich meinen speziellen Dank an meine Freunde Jan und Alex richten, die mich in der Endphase meines Schaffens quasi über die Ziellinie getragen haben.
Inhalt
Vorwort
Teil 1: Weicher Korpus
Körper :: Zähigkeit :: Wohlbefinden
Sport ist Mord
Begrabt mich an der Freiwurflinie
Die Garzeit eines Weicheis
Hurra, hurra Olympia
Rio 2016 - deutsche Schwimmer waren auch dabei
Ostblockhärte versus Sporthilfe-Softies
Nur einen deutschen Basketballspieler
Super Size Me vs. The Biggest Loser
Teil 2: Weicher Kern
Charakter :: Werte :: Vorbilder
New Values vs. Alte Werte
Der Kenianer, der zu faul war zum Laufen
David versus Goliath
Stehpisser vs. Sitzpinkler
Star Trek Voyager – oder: eine Frau als Captain
Katniss Everdeen vs. Greta Thunberg
Lena ML vs. Lena G
Man in the Mirror
Teil 3: Weicher Keks
Denken :: Wissen :: Intelligenz
Abwärtsgeneigte Lernkurven – IQ im Sinkflug
DU bist Kondom
Der Vater, der Sohn, das Buch
Thunberg - Tesla – Terminator
Der Thunberg-Epilog
Corona, meine Nachbarn und ich
Epilog
Vorwort
Kennen Sie das auch? Sie gehen einer täglichen Routine nach, alles scheint immer in denselben, festgelegten Bahnen zu verlaufen und nach Jahren stellen Sie unvermittelt fest, dass sich die Dinge signifikant geändert haben, langsam, kaum wahrnehmbar, in einem schleichenden Prozess. Was früher eher die Ausnahme war ist jetzt die Regel und auf einmal drängt sich die Veränderung ins Bewusstsein. Nicht dass Veränderung grundsätzlich etwas Schlechtes sein muss, hier gilt es erst mal nach den Konsequenzen dieser Veränderungen auf unser tägliches Leben zu fragen. Typische Gepflogenheiten und Verhaltensmuster für einen bestimmten zeitlichen Abschnitt bezeichnet mal Zeitgeist. Der Zeitgeist bestimmt die aktuellen und allgemein akzeptieren Denk- und Handlungsnormen. Betroffen sind alle Lebensbereiche, insbesondere auch der Sport (sowohl Breiten- als auch Leistungssport), den ich beruhend aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und Beobachtung als Gradmesser heranziehe.
Das Buch ist in drei große Teile aufgeteilt, in denen ich in lose verknüpften, amüsant-kritischen oder auch mal kritisch-amüsanten Episoden auf die Veränderungen der wesentlichen Aspekte des Individuums Mensch eingehe.
In Teil 1: Weicher Korpus geht es um die körperlichen Qualitäten, wie Durchhaltevermögen, Leistungsbereitschaft oder Leidensfähigkeit.
In Teil 2: Weicher Kern stehen Persönlichkeit und Charakter, aber auch das Wertesystem und deren Vorbilder im Vordergrund. Schließlich beschäftigt sich Teil 3: Weicher Keks mit dem großen Themenbereich Denken, Wissen, Bildung und Intelligenz.
Gemeinsam ist allen Teilen, dass es sich nicht um wissenschaftliche Abhandlungen handeln soll, sondern lediglich der Versuch, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, um sich einer neuen Sichtweise, einer neuen Perspektive zu öffnen und mit dem eigenen Status quo abzugleichen. Dass die vorliegenden Kapitel meine Perspektive wiedergeben und somit vollkommen subjektiv sind, liegt auf der Hand. Wer jedoch nur meine facettenreichen Ausführungen zum alleinigen Zwecke der Unterhaltung liest sei ebenso willkommen! Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre!
Korpus, Kern, Keks und alles in weich: die Dreifaltigkeit des Versagens!
Christian Friedrich, Autor
Teil 1: Weicher Korpus
Körper :: Zähigkeit :: Wohlbefinden
Geht es uns gut? Es geht uns gut! Und noch während ich den vorangegangenen Satz in mein Manuskript schreibe, höre ich bereits einen Teil meiner sehr geschätzten Leserschaft lauthals protestieren, dass es uns überhaupt nicht gut geht. Aber mal ehrlich, wir leben in einem politisch stabilen Umfeld und mit einer ebenso stabilen Wirtschaftslage, die es den meisten Menschen in unserem Land ermöglicht, zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren, einen Zweitwagen zu besitzen, ebenso einen Flatscreen, einen Computer, einen Laptop, ein Tablet, ein Smartphone, eine Spielekonsole und so weiter. Die Supermärkte sind prall gefüllt, unsere Lieblings-Website ist Amazon.deund als Hobbies haben wir Shopping und Chillen neu für uns entdeckt. Geht es uns gut? Es geht uns gut!
Schön, dass Sie schlussendlich doch noch meiner Meinung zustimmen konnten. Und was passiert, wenn es einer Gesellschaft gut geht? Richtig, Dekadenz breitet sich aus. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der sich des Öfteren in der Geschichte beobachten lässt, wie zum Beispiel bei den antiken Römer. In den Zeiten der Expansion des Römischen Reiches brauchte es Männer, die den körperlichen und seelischen Strapazen von Schlachten und wochenlangen Gewaltmärschen mit schwerer Ausrüstung gewachsen waren und das oft bei schlechter Ernährung und fern der Heimat. Ebenfalls brauchte es ein gerütteltes Maß an Disziplin. Ganz anders in den Perioden des Friedens, in denen auch wir das Privileg haben zu leben und der einzige Kampf, den wir in den Ländern der ersten Welt noch ausfechten müssen, ist eben jener gegen die Dekadenz. Aber obwohl wir gerade eine Fitness-Welle wie in den 1980er Jahren erleben und Fitness-Studios online und offline wie Pilze aus dem Boden schießen und neue, vor allem gesunde Ernährungstrends überall thematisiert werden, scheinen die Industrieländer diesen Kampf zu verlieren. Der zunehmende Prozentsatz an übergewichtigen Kindern und Erwachsenen an der Gesamtbevölkerung der Industrienationen mag nur ein Indiz dafür sein. Kulinarische Verlockungen finden sich an jeder Straßenecke. Gleichzeitig wird unser Alltagsleben durch dienstbare Geister wie Saugroboter oder automatische Rasenmäher immer bequemer und selbst unsere Micro-Mobilität wird zunehmend elektrisch unterstützt, wie E-Bikes, Scooter, Segway und Co beweisen. Außerdem wird für jede noch so kleine Besorgung der Monster-SUV aus der viel zu engen Garage befreit, nur um sich dann mit anderen Monster-SUVs dicht an dicht auf Parkplatzstellflächen der Supermärkte zu drängeln, deren Standard-Abmessungen wahrscheinlich noch aus einer Zeit stammen, in denen die Straßen mit Isetta und VW Käfer bevölkert waren.
Die fortschreitende Dekadenz hat nicht nur allgemeine gesellschaftliche Konsequenzen zur Folge, sondern auch in den Bereichen, in denen körperliche Robustheit immer noch eine gefragte Eigenschaft ist, wie zum Beispiel dem Sport. Und mit Sport meine ich allen Bereichen des Sports, vom Breitensport bis zum Spitzensport.
Sport ist Mord
Es lebe der Sport, er ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei Alt und Jung…, so heißt es in Rainhard Fendrichs Augen zwinkernder Hymne an den Sport. Und mit ein wenig wienerischem Dialekt versehen reimt es sich sogar noch besser.
Ein bekannter Spruch lautet: Sport und Turnen füllen Gräber und Urnen. Oder noch bekannter ist: Sport ist Mord, was aber nicht ganz korrekt ist, denn wenn wir davon ausgehen, dass wir freiwillig Sport machen und wir gleichzeitig auch die Opfer unseres ureigensten Bewegungsdranges sind, dann müsste es natürlich Sport ist Selbstmord heißen. Aber obwohl es unbestritten ist, dass es bedauerlicherweise schon Todesfälle in nahezu jeder Sportart gegeben hat, so gilt Sport doch im Allgemeinen als gesundheitsfördernd und damit lebensverlängernd. Natürlich kommt es dabei sehr auf die jeweilige Sportart und deren spezifisches Risiko an, sowie auf die Intensität, mit der die Sportart betrieben wird.
Nun, ich bin weder Sportmediziner, der Sie mit Statistiken über Sportverletzungen konfrontieren möchte, noch bin ich Angestellter einer Versicherung, der Ihnen die jährlichen Kosten für Sportverletzungen aufrechnen will. Aber als Basketballspieler und Trainer mit Jahrzehnten an Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass man sich im Basketball ab und zu weh tut. Gelegentlich sogar sehr weh tut. Aber von Mord oder von Selbstmord kann absolut keine Rede sein. Der Spruch Sport ist Mord wurde vermutlich von einem Schöngeist geprägt, der bei der prägnanten Formulierung mehr den dichterischen Effekt, als den Wahrheitsgehalt der Aussage im Blick hatte. Wobei ich anmerken möchte, dass es sich um einen unsauberen Reim handelt, da ein hartes T auf ein weiches D trifft, was aber durch die gleich anlautenden Vokale und eine verschliffene Sprechweise am Wortende kaum ins Gewicht fällt.
Wie dem auch sei, jedenfalls haben die Bewegungsabstinenzler und Couch Potatoes dieser Welt eine griffige Formulierung an der Hand, um weiterhin die Polster der heimischen Sofas und Sessel zu strapazieren und Sporthallen und Sportplätze gleich welcher Art zu meiden. Dabei macht Sport Spaß, Sport hilft uns Stress abzubauen, hält uns jung und in Form und lässt uns die täglichen Herausforderungen des Alltags mit mehr Energie und Elan bewältigen. Aber versuchen Sie mal diese Vorzüge in eine ähnlich erfolgreiche Formulierung zu packen!
Dass Sport also kein Selbstmord ist, sondern sehr viele positive Aspekte hat, habe ich Ihnen hoffentlich klargemacht, sofern es Ihnen nicht schon vorher bekannt war. Dennoch möchte ich Ihnen nicht verhehlen, dass es im Sport immer zu kleineren Verletzungen und Blessuren kommen wird. Im Basketball sind das Blasen von den neuen Schuhen, die man erst 20 Minuten vor dem Training erworben hat, Schürf- und Kratzverletzungen, Hämatome von den Knien oder Ellenbogen des Gegners, Finger- und Kapselverletzungen, und so weiter. Und nicht selten bekommt man auch mal einen Ball an den Kopf oder ins Gesicht. Wenn Sie Basketball wettkampfmäßig betreiben, dann werden Sie zudem im Training an Ihre Leistungsgrenzen geführt und manchmal auch ein Stück darüber hinaus.
Aber ein Basketballer sollte in der Lage sein, all das zu ertragen und es kurzerhand wegzustecken, ohne viel Aufhebens darum zu machen. Denn Sportler zu sein heißt auch, ein gewisses Maß an körperlicher und psychischer Abhärtung zu entwickeln. Jeder Mensch besitzt eine physische Leidensfähigkeit, die oft auch als Schmerzgrenze bezeichnet wird. Je öfter der Mensch einem Schmerzimpuls ausgesetzt wird, desto unempfindlicher wird er gegenüber diesem Reiz und desto weiter verschiebt sich die Schmerzgrenze. Zudem muss ein Sportler in der Lage sein, Schmerzen mental auszublenden, im Wettkampf übernimmt diese Aufgabe der erhöhte Adrenalinspiegel. Doch Vorsicht, denn das Schmerzempfinden ist ein Warnsignal des Körpers, welches dem Gehirn mitteilt, beim Einsatz bestimmter Körperteile besonders vorsichtig zu sein, da ein Defekt vorliegt. Als Reaktion auf den Schmerz wird nun versucht, durch Änderung des Bewegungsablaufs die betroffene Körperpartie zu schonen. Als Sportler müssen Sie in der Lage sein, Ihren Körper genau zu lesen und zu verstehen, denn nur dann können Sie entscheiden, wann Sie einen Schmerz einfach ausblenden und wann Sie besser eine Pause einlegen oder das Training oder den Wettkampf sofort beenden. So ist eine Schürfverletzung vom Hallenboden sehr schmerzlich und unangenehm aber mit Sicherheit kein Grund, nicht weiter zu spielen.
In meinen über 25 Jahren als Basketball-Trainer habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Leidensfähigkeit der Spieler deutlich abgenommen hat. In den folgenden Kapiteln werde ich Ihnen mit einem Augenzwinkern schildern, wie die harte Schale von Sportlern und Sportverzichtlern gleichermaßen zunehmend im Aufweichen begriffen ist.
Begrabt mich an der Freiwurflinie
Es regnet, es regnet, die Erde wird nass.
Wir sind nicht aus Zucker uns macht es Spaß.
Deutschsprachiges Kinderlied aus dem 19. Jahrhundert
Sicher kennen Sie alle dieses bekannte Kinderlied. Doch während ich dem Wahrheitsgehalt der ersten Zeile uneingeschränkt zustimmen kann, bin ich mir bei der zweiten Zeile gar nicht so sicher. Im Gegenteil, manchmal habe ich sogar das Gefühl, das kristalliner Zucker immer noch mehr Widerstandskraft gegenüber Regenwasser aufbringt als viele Jugendliche gegenüber den Widrigkeiten einer Sportart, wie Basketball. Die Konsistenz ist da eher schon bei Zuckerwatte angelangt.
Natürlich trifft das nicht auf alle Jugendlichen zu, aber der Trend ist unverkennbar, sofern man überhaupt noch von einem Trend sprechen kann. Das Erstaunliche dabei ist, dass vor allem die Jungen davon betroffen sind, während die Mädchen doch wesentlich taffer sind. Spontan fällt mir eine Spielerin ein, die mit ihren 16 Jahren sehr zierlich gebaut war. Einmal hat sie einen sehr harten Pass aus unmittelbarer Nähe an den Kopf bekommen, der selbst beim bloßen Hinsehen Schmerzen verursachte. Doch die eben erwähnte Spielerin hat das absolut ungerührt weggesteckt, sie ist beim Einschlag nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde zusammengezuckt und hat danach mit keiner noch so kleinen Geste das Gefühl von Schmerz ausgedrückt. Sie zeigte genau die Art von Schmerzunempfindlichkeit, die ein Sportler haben sollte und die ich im vorangegangenen Kapitel angesprochen habe.
Doch leider gab und gibt es in unserer Abteilung nicht genug Spielerinnen und Spieler dieses Kalibers, wie ich in einem Spiel der männlichen U16 feststellen musste. Es war ein Heimspiel und zu Gast war ein neu gegründeter Verein, der einzige Gegner in der kleinen Liga, gegen den wir die Chance auf einen Sieg hatten. Doch dazu, so wusste ich genau, musste alles zusammenpassen. Leider verzichtete einer unserer besseren Spieler von vorneherein auf die Teilnahme am Spiel, er hatte wohl besseres zu tun. Aber das ist ein anderes Kapitel. So mussten also die verbliebenen Spieler aus dem ohnehin kleinen Kader die Sache richten. Meine Hoffnungen ruhten dabei unter anderem auf unserem Center. Stellen Sie sich einen jungen Kerl vor, groß, mit kräftigen Oberarmen und einer imposanten Statur. Vielleicht noch ein bisschen viel Babyspeck, aber OK. Jedenfalls war er mit Abstand der physisch dominante Spieler auf dem Feld.
Ein Basketballspiel beginnt mit einem Sprungball in der Mitte des Spielfeldes. Die beiden größten Spieler einer Mannschaft oder die Spieler, bei denen die Kombination aus Größe und Sprungkraft optimal ist, treten gegeneinander an, um den vom Schiedsrichter hoch geworfenen Ball zu einem ihrer Mitspieler zu tippen. Also: der Ball wird hochgeworfen, beide Spieler springen hoch, der Ball wird weggetippt und ein Mark erschütternder Schrei ertönt. Danach Stille und ich sehe nur noch meinen Center-Spieler regungslos auf dem Bauch liegend, das Gesicht zum Boden zeigend. Was war geschehen? Von meinem Standort sah es so aus, als habe der Fuß des gegnerischen Spielers beim Sprungball gegen das Schienbein getreten meines Spielers getreten, kurz oberhalb des Basketball-Schuhs. Das ist sicher sehr schmerzhaft, aber mit Sicherheit kein Grund ewig auf dem Boden liegen zu bleiben. Doch mein Spieler liegt und liegt und liegt und will überhaupt nicht mehr aufstehen. Er rührt sich einfach nicht mehr. Langsam beginne ich mich zu fragen, ob er vielleicht doch mehr abbekommen hat. Die nahe liegende Vermutung: Umknicken bei der Landung und Bänderriss. Aber davon habe ich nichts gesehen. Während ich also noch so in meine Überlegungen vertieft bin, erbarmt sich der Schiedsrichter und lässt einen Betreuer auf das Spielfeld, der die traurigen und humpelnden Überreste unseres Centers vom Platz führt.
Super! Noch nicht einmal fünf Sekunden gespielt und schon habe ich einen meiner wichtigsten Spieler verloren. Was kann man von einem Spiel erwarten, das schon so beginnt. Ich werde es Ihnen verraten, denn ich hatte ja das zweifelhafte Vergnügen, alles aus nächster Nähe zu beobachten. Und so wurde ich Zeuge eines kleinen Wunders, ja so möchte ich es nennen. Das Spiel lief schon eine ganze Zeit lang und längst hatte ich meinen Center-Spieler aus meinen taktischen Überlegungen verbannt, als eben jener Freude strahlend und quicklebendig hinter mir auftauchte und verkündete, wieder mitspielen zu können. Wenn das nicht an Wunderheilung grenzt, dann weiß ich auch nicht.
Nur einer war in Sachen Wunderheilung noch schneller, aber der war ja auch ein durchtrainierter Spitzensportler. Erinnern Sie sich noch? Damals bei der Fußball-WM 1990 in Italien im Gruppenspiel Deutschland gegen Kolumbien. Der kolumbianische Superstar Carlos Valderrama wurde von Klaus Augenthaler vermeintlich so bösartig gefoult, dass er minutenlang regungslos auf dem Boden liegen blieb. Schließlich wurde er auf einer Trage – oder sollte ich in diesem Fall eher von einer Bahre sprechen – vom Spielfeld getragen und die Partie wurde wieder angepfiffen. Es muss wohl doch eine Trage gewesen sein, denn kaum aufgeladen kamen auch schon die Lebensgeister zurück und er begann durch Gesten und Mimik die ungeheuren Schmerzen auszudrücken, die er verspürte. Kaum hatten die Träger die äußere Spielfeldmarkierung überschritten, als Valderrama von der Transportliege sprang und sich beim Schiedsrichter für das Spiel zurückmeldete. Wahnsinn! Gerade noch Sportinvalide mit Karriere terminierender Verletzung und nur ein paar Sekunden später schmerzfrei und voller Tatendrang. Wenn das keine Wunderheilung ist, dann weiß ich auch nicht. Egal, Hauptsache wieder gesund!
Doch zurück zu unserem Basketballspiel. Wenn Sie glauben, dass mit der Wunderheilung unseres Centers die Verletzungsgeschichte dieses Spiels geschrieben war, dann liegen Sie weit daneben. Denn was jetzt kommt geht richtig unter die Haut, ja, es fließt sogar fast Blut. Ein Flügelspieler hatte beim Kampf um den Ball vollen Einsatz gezeigt und dabei Kontakt mit dem Hallenboden aufgenommen. Und wie so oft in solchen Situationen hat der Hallenboden sein ewiges Mal eingebrannt, dass mindestens für fünf Tage sichtbar bleibt. Diesmal auf dem rechten Knie. Aber kein Problem, denn unser tapferer Flügelspieler ist mehr oder weniger gleich wieder aufgestanden. Die eigentliche Show begann als er wenig später wieder auf der Ersatzbank Platz nahm. Eilfertig kam seine Mutter von der Zuschauertribüne, um die Wunde fachgerecht zu versorgen. Bewaffnet war sie dazu mit einem frischen Papiertaschentuch und einer kleinen Flasche billigsten Mineralwassers. Die Flasche wurde aufgeschraubt, das Taschentuch vor die Öffnung der Flasche gehalten und die Flasche wurde schwungvoll gekippt – einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal… Danach wurde die Wunde sorgfältig abgetupft. Das sah alles sehr professionell aus, aber wen wundert es, denn soweit ich weiß arbeite die gute Frau als Gehilfin bei einem Tierarzt. Halb fassungslos und halb belustigt betrachtete ich den Vorgang, der sich mehrmals wiederholte und machte mir Gedanken über die Wirksamkeit dieser Prozedur. Sicherlich ist es nicht falsch eine solche Blessur mit klarem Wasser abzuspülen, allerdings eignen sich Papiertaschentücher nur bedingt zur Wundreinigung, da Fasern in die Wunde eingebracht werden können. Bei gepresstem Zellstoff ist das aber nicht besonders gefährlich. Als die Wundversorgung endlich abgeschlossen war und ich Flügelspieler wieder auf das Spielfeld schicken wollte, bat dieser darum, noch draußen bleiben zu dürfen, weil die Wunde noch brenne. So ist das eben nun mal: Schweiß enthält Salze und metallische Ionen, die bei oberflächlichen Verletzungen direkt an die Rezeptoren des Nervensystems gelangen können, was wir als Brennen empfinden. Ich wollte noch etwas sagen, habe es aber gelassen. Das Spiel war ohnehin längst gelaufen. Ich hatte nur noch einen letzten Wunsch: Begrabt mich an der Freiwurflinie!
Die Garzeit eines Weicheis
Oder wie es Sangeskamerad Herbert Grönemeyer einst aber für immer unvergesslich textete: Mama, Mama, wann ist man ein Mann?
Sicher mögen einige von Ihnen nach der Lektüre des voran gegangenen Kapitels die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und etwas Ähnliches sagen oder denken wie: Du meine Güte, es sind eben noch Kindern. Das ist schon richtig. Allerdings sollte man doch erwarten können, dass man mit 16 Jahren schon eine kleine Schürfverletzung am Bein verkraften kann. Die körperliche Abhärtung sollte einhergehen mit der Altersentwicklung, sonst entsteht hier ein Defizit, das bei der Ausübung bestimmter Sportarten durchaus zu Problemen führen kann, auch im mentalen Bereich. Ein weiteres Beispiel aus meiner Trainerzeit: es war bei einem U10-Turnier zu dem meine Co-Trainerin und ich mit unseren sieben- bis achtjährigen Kindern angetreten sind. Im Verlaufe des Turniers mussten wir auch gegen die U12-Mannschaft des gastgebenden Vereins antreten, die außer Konkurrenz mitspielte, da die Spieler dieser Mannschaft die Altersgrenze für dieses Turnier schon weit überschritten hatten. Wir stellten unsere Spieler mental auf die körperlichen Vorteile des Gegners ein und sagten ihnen sich nicht entmutigen zu lassen, ganz gleich wie dieses Spiel verlaufen möge. Und so entstand ein Spiel, in dem wir durchaus mithalten konnten. Eine Szene ist uns Trainern dabei besonders im Gedächtnis haften geblieben. Ein für sein Alter großer, schlaksiger Junge, mit der Frisur von Harry Potter und mit der Brille von Harry Potter – also dieser Harry-Potter-Verschnitt hatte in der Nähe unseres Korbes den Ball in beiden Händen und suchte nach einer Anspielstation. Ich rief eine unserer Spielerinnen beim Namen und sagte ihr, sie solle sich den Ball schnappen. Obwohl die angesprochene Spielerin vier Jahre jünger und nur halb so groß war wie Harry Potter, nahm sie ihr Herz in beide Hände und mit einem anderen Händepaar griff sie beherzt nach dem Ball. Ein kurzer, kräftiger Ruck und schon hatte sie den Ball für sich erobert und leitete den Angriff ein. Als wir bereits die Mittellinie mit einer 3:0 Überzahl überquert hatten und ich vor meinem geistigen Auge schon einen weiteren schönen Korberfolg sehen konnte, holte mich ein unerwarteter Pfiff des Schiedsrichters jäh in die Realität zurück. Was war geschehen? Ein technischer Fehler meiner Mannschaft? Nö, da war alles sauber. Nach einem Moment der Orientierungslosigkeit projizierte ich die Trajektorien der beiden Schiedsrichter zum gemeinsamen Schnittpunkt und fand schließlich den Grund für den Pfiff heraus. Noch am Ort des Ballverlustes stehend setzte Harry Potter heulend unsere Zone unter Trollrotz und Wasser. Auf die Befragung, was denn los sei, beschwerte er sich doch tatsächlich, dass man ihm den Ball weggenommen habe! Ist das zu fassen? Vier Jahre älter und drei Köpfe größer und er beschwert sich darüber, dass ein kleines Mädchen ihm den Ball weggenommen hatte? Doch anstatt dem Jungen zu erklären, dass Basketball nun einmal so gespielt wird, bekommt er zum Trost auch noch zwei Freiwürfe geschenkt. Müßig zu sagen, dass ich als Trainer ganz schön angefressen war ob dieser Entscheidung, denn damit wurden wir gleich mehrfach bestraft. Nicht nur, weil uns ein aussichtsreicher Angriff ohne einen vorliegenden Regelverstoß abgepfiffen wurde, zudem nahm man uns noch den Ballbesitz und damit nicht genug gab man dem Gegner auch noch die Möglichkeit selbst zu einfachen Punkten zu kommen. Und das Schlimmste an der Sache war, dass man Harry Potter damit bestätigte im Recht zu sein. Vermutlich hielten die beiden Schiedsrichter ihre Entscheidung für superpädagogisch aber das genaue Gegenteil ist der Fall, denn über kurz oder lang würde sich der Junge wieder in einer ähnlichen Lage befinden, in der er sich behaupten müsse und der Countdown dafür lief bereits. Auf der anderen Seite hatte meine kleine Spielerin, beseelt von der gelungenen Verteidigungsaktion und dem Lob ihrer beiden Trainer an Selbstvertrauen gewonnen und jeglichen Respekt vor der körperlichen Überlegenheit des Gegners verloren und jagte fortan jedem Ball nach, der in ihre Nähe kam. Und so konnte sie nur kurze Zeit später wieder einen Ballgewinn verbuchen und Sie ahnen es schon, natürlich traf es wieder Harry-Ich-bin-zu-lahm-um-den-Schokofrosch-zu-fangen-Potter. Die Spielsituation war nahezu identisch mit der vorherigen und das gilt auch für die darauffolgenden Reaktionsschemata bei allen aktiven oder passiven Beteiligten. Es ist nicht meine Art, mich in die Angelegenheiten anderer Mannschaften einzumischen, aber das Maß war voll. Genervt von den minutenlangen Unterbrechungen, der Inkompetenz der Schiedsrichter und der Hilflosigkeit der beiden Trainer der anderen Mannschaft fragte ich die Letzteren, ob man die Heulsuse nicht permanent und rückstandsfrei vom Spielfeld entfernen könne, damit wieder Basketball gespielt werden könne. Es ist nur allzu verständlich, dass ich mich mit diesen Äußerungen nicht gerade beliebt gemacht habe, allerdings kam der schärfste Protest von einer Seite, von der ich es am wenigsten erwartet hatte, nämlich von den Schiedsrichtern und den Trainern des Gegners. Bisher waren diese vier Akteure mehr wie die neugeborenen Lämmer in der Herde, anstatt deren Beschützer. Aber dieser akute Anfall von Courage sollte nicht allzu lange andauern, denn nachdem ich noch einmal die Fakten des Vorganges aufgezählt hatte herrschte danach wieder das Schweigen der Lämmer. Unerwartet viel Zuspruch bekam ich dagegen von den zuschauenden Eltern der anderen Mannschaften, die offensichtlich die Situation genauso bewerteten, wie ich es tat: der Junge war eindeutig mit den Anforderungen des sportlichen Wettkampfs überfordert. Das Fazit: der Trieb des Jungen sich selbst zu behaupten war zu dem damaligen Zeitpunkt völlig unterentwickelt und man muss die Frage stellen, in welche sozialen Strukturen er bisher eingebettet war. Zuallererst hege ich die Vermutung, dass er ein Einzelkind ist, denn der Konkurrenzkampf unter Geschwistern ist normalerweise der erste Prüfstein im Leben, ob man seine persönlichen Gegenstände gegen den Zugriff der anderer verteidigen oder im Notfall auch zurück fordern kann. Aber was ist mit Kindergarten oder Schule? Spätestens hier hätte der Junge die entsprechenden Qualitäten erlernen müssen, was aber auch nicht der Fall zu sein scheint. Ich bin kein Kinderpsychologe aber meines Erachtens wird diese Fähigkeit normalerweise im Kleinkindalter, etwa mit vier bis fünf Jahren erworben. Damit hängt der Junge in seiner Entwicklung bereits um etliche Jahre hinterher. Hier ist dringender Handlungsbedarf angesagt, damit er in Zukunft für sich und seine Angelegenheiten selbst einstehen kann.
Ein anderer Fall von akutem Weichei-Syndrom, diesmal aus der Kategorie Erheiternd, avancierte bei meinem damaligen Co-Trainer und mir über Jahre hinweg zu einem Running Gag. Unsere Mannschaft, diesmal eine U14, versammelte sich auf dem Parkplatz vor der Sporthalle zur gemeinsamen Abfahrt zum Auswärtsspiel als plötzlich unser Center auf uns zulief und schon vom weitem verkündete, nicht spielen zu können, da er verletzt sei. Dabei hielt er beide Arme voraus, die Hände mit den Daumen nach oben, die beide geschmückt waren mit handelsüblichen Heftpflastern. Auf die Frage nach der Art der Verletzung gab er Schnittwunden an, die ziemlich tief seien, wie er mehrfach betonte. Natürlich muss ich als verantwortlicher Trainer eine solchen Aussage ernst nehmen, obwohl die beiden Heftpflaster nicht gerade die Message transportierten, dass es sich hier um schwerwiegende Verletzungen handeln würde. Um sicher zu gehen begann ich mit der Befragung: wie kam es zu der Verletzung? Beim Frühstück wollte er sich ein Brötchen mit einer bekannten Nuss-Nugat-Creme schmieren. Wie kann man sich beim Schmieren eines Brötchens in den Daumen schneiden? Die Antwort: nicht beim Schmieren, sondern beim Aufschneiden des Brötchens. Aha. Und wieso sind beide Daumen verletzt? Nachdem er sich in den einen Daumen geschnitten hatte, hätte er das Messer in die andere Hand genommen und sich damit nochmals geschnitten. Aha. Mein Co-Trainer und ich konnten ein lautes Lachen kaum noch unterdrücken. Und weil unser Spieler merkte, dass wir die Geschichte nicht so ganz ernst nahmen, wurde er immer eindringlicher. Er nahm das Pflaster an einem Daumen ab und zeigte uns den Einschnitt. Doch weder mein Co-Trainer noch ich konnten einen Einschnitt erkennen. Auch keine Rötung oder einen ausgefranzten Wundrand, denn schließlich wird er ja nicht mit einem Skalpell sein Brötchen aufgeschnitten haben, sondern mit einem handelsüblichen Messer eines normalen Essbestecks. Schließlich begann unser Spieler noch wie verrückt am Daumen zu pressen, in der Hoffnung es würde noch ein bisschen Blut austreten oder zumindest etwas Blutplasma. Doch, während die Kuppe des Daumens stoisch weiß blieb lief sein Kopf rot an. Schließlich gab er seinen Widerstand auf und wurde von uns kurzerhand als spieltauglich erklärt.
In der Halle des Gegners angekommen wurde die zweite Garstufe von unserem Center-Weichei gezündet. Anstatt die Verletzung selbst zu präsentieren, demonstrierte er uns die fatalen Auswirkungen derselbigen auf sein Spiel: beim Fangen, Passen und Dribbeln des Balles versuchte er die verletzten Daumen zu schützen, was natürlich in der Praxis ziemlich ungeschickt aussah. Nun, wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass auch ein kleiner Schnitt in eine Fingerkuppe unangenehm und lästig ist. Genauso lästig wie in Heftpflaster, welches sich dauernd ablöst, weil man es bereits einmal abgenommen und wieder angeklebt hatte, um seinen ignoranten Trainern die Verletzung zu zeigen und zum anderen, weil Heftpflaster auf schweißnasser Haut nicht besonders gut haften. Doch unser Center benahm sich, als hätte man ihm beide Daumen amputiert. Da wurde es Zeit für eine klare Ansage unsererseits, sich auf das Spiel zu konzentrieren und nicht auf die Schmach, die ihm ein simples Tafelbrötchen am Frühstückstisch zugefügt hatte. Und siehe da, mit zunehmender Ablenkung durch das Spiel und der einsetzenden Wirkung des körpereigenen Adrenalins lieferte er die Performance ab, die wir von ihm gewohnt waren. Nach dem Spiel, beim Verlassen des Innenraumes der Halle stupste ich meinen Co-Trainer an und zeigte nur stumm auf eine Stelle des Hallenbodens, an dem ein uns wohlbekanntes Heftpflaster lag. Muss wohl jemand während des Spiels verloren haben. Wir lachten leise vor uns hin mit der Gewissheit, dass wir an jenem Tag Zeugen waren, wie aus einem Weichei ein Mann wurde.
Hurra, hurra Olympia
Fünf Ringe für die sie sich knechten,
Fackeln und Flammen entzünden
Und an den Olympischen Eid sich binden
Frei nach Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien
Olympische Spiele, Olympia, Olympiade – viele Leute benutzen die Wörter als Synonyme füreinander, aber das ist absolut falsch. Deshalb möchte ich gleich zu Beginn dieses Kapitels einmal die Begrifflichkeiten klarstellen. Die Olympischen Spiele – also die Veranstaltungen selbst - sind benannt nach dem Austragungsort Olympia, der im Nordwesten der griechischen Halbinsel Peloponnes gelegen ist. Als Olympiade wird dagegen ein Zeitraum von vier Jahren bezeichnet, der mit dem Beginn der Olympischen Spiele seinen Anfang nimmt. Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum die Olympischen Spiele – sowohl in der Antike als auch in der Neuzeit – nur alle vier Jahre ausgetragen werden. Das liegt daran, das in der Antike die Olympischen Spiele zwar die bedeutsamsten, aber bei weitem nicht die einzigen Spiele ihrer Art waren. Die Olympischen Spiele waren Teil eines Zyklus von vier panhellenischen Spielen, zu denen noch die Pythischen Spiele in Delphi, die Nemeischen Spiele in Nemea und die Isthmischen Spiele auf dem Isthmus von Korinth gehörten. Um diesen Zyklus einmal vollständig zu durchlaufen bedurfte es vier Jahren, bis eben wieder ein neuer Zyklus mit den Spielen von Olympia begann. Die Austragungsorte dieses Zyklus waren die bedeutendsten in der Antike, aber es gab auch noch eine Reihe anderer, die ich jedoch nicht alle aufzählen möchte.
Bei den Spielen der Antike wurden zwar sportliche Wettkämpfe ausgetragen, aber wie damals üblich waren diese zu Ehren der Götter (Zeus und des göttlichen Helden Pelops) gewidmet, so dass die Spiele an sich mehr einen kultischen Charakter hatten als einen rein sportlichen. So ist es auch weiter nicht verwunderlich, dass auch musische Veranstaltungen, wie Musik, Tanz und Theater bei den Spielen aufgeführt wurden. Ich will mich jedoch in diesem kurzen historischen Abriss auf den sportlichen Aspekt konzentrieren.
In den antiken Anfängen der Spiele, die vermutlich bis ins zweite Jahrtausend vor Christus zurückreichen, gab es nur eine Disziplin, und zwar das Rennen über eine Stadionlänge, die 600 Fuß betrug. Nun gibt es kleine Füße und es gibt auch etwas größere Füße, so dass 600 Fuß keine genaue Angabe war. Und so kam es, dass man je nach Austragungsort der Spiele zwischen 167 Meter in Delos und 192,24 Meter in Olympia bis ins Ziel zurücklegen musste. Im weiteren Verlauf kamen immer weitere Disziplinen hinzu und erreichten schließlich die stattliche Anzahl von 18 Disziplinen aus den Bereichen Leichtathletik, Schwerathletik, Reiten und dem antiken Fünfkampf Pentathlon (Speer, Diskus, Lauf, Sprung und Ringen). In der Hochzeit der Olympischen Spiele der Antike dauerten diese fünf Tage lang an, wobei der erste Tag ausschließlich den kultischen Weihen vorbehalten blieb.
Doch jede Tradition findet einmal ein Ende und für die Olympischen Spiele begann der Untergang 148 v.Chr. mit der Eroberung Griechenlands durch die Römer. Von da an waren die Spiele nicht mehr nur den panhellenischen Bürgern vorbehalten. Wann zum letzten Mal Olympische Spiele stattgefunden haben, ist nicht genau belegt, aber vermutlich war es im Jahre 393 n.Chr. Geschichte wurde zu Legende. Legende wurde zu Mythos. Und fast 1400 Jahre lang gedachte niemand mehr der antiken Spiele bis eines Tages im Jahre 1766 die Sport- und Tempelanlagen in Olympia wiederentdeckt wurden. Diese Entdeckung führte dazu, dass Versuche unternommen wurden, die Idee von sportlichen Wettkämpfen nach dem Vorbild der antiken Olympischen Spiele in Frankreich und England wiederzubeleben. So gab es in Frankreich von 1796 bis 1798 die Olympiades de la République, während sich in England seit 1850 in Much Wenlock (Grafschaft Shropshire) die Wenlock Olympian Games entwickelten und noch heute unter dem Namen Wenlock Olympian Society Annual Games durchgeführt werden. Aber auch im Mutterland der antiken Spiele gab es Bestrebungen, die alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Von 1859 bis 1889 wurden in Athen im Panathinaiko-Stadion mehrere Spiele durchgeführt.
In diesen Vorläufern der Olympischen Spiele der Neuzeit, sah Baron Pierre de Coubertin das Potential, eine Veranstaltung mit internationaler Beteiligung ins Leben zu rufen. Nach seinen Vorstellungen sollte sich die oft zitierte Jugend der Welt in sportlichen Wettkämpfen messen und nicht mehr auf Schlachtfeldern gegeneinander kämpfen. Die internationale Verständigung lag dem Baron sehr am Herzen. Auf einem Kongress an der Sorbonne in Paris im Jahre 1894 stellte de Coubertin seine Prinzipien vor, darunter auch eine Rotation bei den Austragungsorten. Am letzten Tag des Kongresses beschlossen die Teilnehmer die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen auszutragen. Zu deren Organisation wurde das Internationale Olympische Komitee (IOC) gegründet, dessen erster Präsident der Grieche Dimitrios Vikelas war. Pierre de Coubertin selbst wurde Generalsekretär.
An den Spielen in Athen nahmen 250 Athleten aus 14 Ländern teil und machten die Veranstaltung zu einem so großen Erfolg, dass die griechischen Verantwortlichen sich wünschten, zukünftig alle Spiele austragen zu dürfen. Doch das IOC hielt an seinem Rotationsprinzip bei den Austragungsorten fest und so wurden die Spiele von 1900 in Paris und von 1904 in St. Louis ausgetragen. Diese beiden Spiele hatten jedoch nicht annährend den Erfolg, wie die Spiele von Athen, was zum einen an der schlechten Organisation lag, zum anderen daran, dass die Spiele nicht als eigenständige Veranstaltungen durchgeführt wurden, sondern im Rahmen der jeweils parallel stattfindenden Weltausstellungen. Deshalb wurden die Spiele über Monate in die Länge gezogen, was deren Attraktivität nicht gerade erhöhte.
Im Jahre 1906 wurden in Athen erneut die Spiele durchgeführt, mit widerwilliger Zustimmung des IOC, jedoch ohne offizielle Anerkennung der sportlichen Ergebnisse. Seitens des IOC werden diese Spiele als Olympische Zwischenspiele geführt. Da die Spiele von 1906 an den Erfolg von 1896 anknüpfen konnten, beschloss das IOC weitere Spiele durchzuführen, so dass die Olympischen Spiele der Neuzeit uns auch heute noch erhalten sind.
Baron de Coubertin war es auch, der 1913 das Erkennungssymbol der neuzeitlichen Spiele entwarf: fünf ineinander verschlungene Ringe, in den Farben Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün auf einem weißen Untergrund. Jeder Ring steht für einen Erdteil und im offiziellen Handbuch der Olympischen Spiele war bis 1951 zu lesen, dass Blau für Europa, Schwarz für Afrika, Rot für Amerika, Gelb für Asien und Grün für Australien steht. Tatsächlich ist es nirgendwo belegt, dass Baron de Coubertin diese Zuordnung im Sinn gehabt hatte, weshalb dieser Eintrag aus dem Handbuch entfernt wurde. Belegt ist dagegen eine Aussage von de Coubertin aus dem Jahre 1931, dass die Farben der Ringe und der weiße Hintergrund die Farben aller Nationalflaggen der damals existierenden Nationalstaaten repräsentieren. Nichtsdestotrotz versuchen einige Journalisten und Kommentatoren auch heute noch die Mär von den farbigen Kontinenten aufrecht zu erhalten. Ein fachliches Update ist an dieser Stelle dringend angeraten.
Die ersten Spiele, die unter dem neuen Banner stattfinden sollten, hätten die Spiele 1916 in Berlin sein sollen. Diese Spiele fanden jedoch nicht statt, da gerade ein Weltkrieg mit der Seriennummer WWI das öffentliche Geschehen in Europa dominierte. So blieb es Antwerpen im Jahre 1920 vorbehalten, der erste Austragungsort unter der neuen Olympischen Fahne zu sein.
Aber nicht nur die Fahne änderte sich, auch die durchgeführten sportlichen Wettbewerbe waren stetigen Veränderungen unterworfen. Heute ist kaum mehr vorstellbar, dass Tauziehen einmal eine olympische Disziplin war. Wintersportarten wurden – sofern es möglich war – in die im Sommer stattfindenden Spiele integriert (Eiskunstlauf 1908 und 1920, Eishockey 1920). Das IOC reagierte darauf, indem es 1921 beschloss, Chamonix nicht nur die Spiele von 1924 durchführen sollte, sondern zusätzlich auch eine Internationale Wintersportwoche. Die Veranstaltung erwies sich als so großer Erfolg, dass diese nachträglich zu den ersten Olympischen Winterspielen erklärt wurden. Von da an wurden in einem olympischen Jahr immer zwei Spiele abgehalten, die traditionellen Sommerspiele und die Winterspiele, wobei der Austragungsort nicht notwendigerweise derselbe war, wie im Fall Chamonix. 1986 beschloss jedoch das IOC den Winterspielen einen eigenen Zyklus zuzuweisen, der gegenüber den Olympiaden der Sommerspiele um zwei Jahre nachfolgte. Erstmals umgesetzt wurde das neue Prinzip 1994 bei den Winterspielen von Lillehammer. Diese Neuerung führte dazu, dass zwischen den Spielen von Albertville (1992) und Lillehammer nur zwei Jahre lagen.
Es war ein langer Weg von der Antike bis heute und ich könnte noch etliche Seiten über die Geschichte der Olympischen Spiele schreiben – aber ich werde es nicht tun. Ihnen zuliebe, verehrte Leserinnen und Leser. Vielmehr möchte ich Ihnen ein paar meiner persönlichen Erfahrungen mit den Spielen nahebringen, denn wann immer Olympische Spiele stattfinden mutiere ich vom Sportfan zum Supersportfan. Da werden dann auch mal Sportarten angeschaut, die sonst nur wenig mediales oder persönliches Interesse finden. Vielleicht liegt meine Begeisterung für die Olympischen Spiele darin begründet, dass ich in einem olympischen Jahr geboren wurde, nämlich 1968. Das waren die Spiele von Mexiko-Stadt. Selbstredend sind meine Erinnerungen an diese Spiele gleich Null, ich kann noch nicht einmal mit Gewissheit sagen, ob wir zu jener Zeit einen Fernseher hatten. Vermutlich hatten wir einen aber wie gesagt, aus meinen eigenen Erinnerungen kann ich das nicht rekonstruieren. Spielt aber auch keine Rolle, ob wir einen Fernseher hatten oder nicht, denn meine Fernsehzeiten waren zu jedem Zeitpunkt noch auf ein absolutes Minimum beschränkt.
Vier Jahre später folgten die Spiele von München, also im eigenen Land. Aber wie wir wissen standen die Spiele in Deutschland bisher nie unter einem besonders guten Stern. Wie bereits erwähnt fanden die Spiele von Berlin 1916 gar nicht erst statt und als zwanzig Jahre später Berlin die Spiele tatsächlich ausgetragen hat, wurde der ohnehin schon Nicht-gute-Stern durch das Hakenkreuz ersetzt. Der negative Höhepunkt der Spiele von 1972 in München war die Geiselnahme und die Ermordung von elf israelischen Teilnehmern durch palästinensische Terroristen. Ein deutscher Polizist war auch noch als Opfer zu beklagen aber auch fünf Terroristen fanden damals den Tod. Die Spiele wurden für einen Tag ausgesetzt. Natürlich habe ich im Alter von vier Jahren noch nicht die Zusammenhänge verstanden, dennoch mir war klar, dass etwas Ungeheuerliches passiert war. Aber ich habe auch noch eine positive Erinnerung an diese Spiele: ein 16-jähriges dürres Mädchen, dass ungefähr drei Meter groß war- so kam es mir jedenfalls vor – sprang über eine horizontal angebrachte gelbschwarze Stange, die sogar noch höher lag als das Mädchen groß war und wurde damit Olympiasiegerin. Sie wissen es alle, die Rede ist von Ulrike Meyfahrt, einer der deutschen Leichtathletik-Stars bei den Frauen.
Es folgten die Spiele von Montreal (1976) und Moskau (1980), die mehr politische Schlagzeilen erzeugten als sportliche. So blieben 30 Staaten aus Afrika, Asien und Südamerika den Spielen von 1976 fern, um gegen die Teilnahme Neuseelands zu protestieren. Der Grund hierfür: die All Blacks, also das Nationalteam Neuseelands im Rugby hatte eine Tournee durch Südafrika gemacht, und damit gegen die Ächtung des Apartheidsystems durch den internationalen Sport verstoßen. Zudem wurde Taiwan von den Spielen ausgeschlossen, weil Kanada Taiwan nicht als souveränen Staat anerkannte.
Der Höhepunkt politisch-motivierten Boykotts der Olympischen Spiele war dann 1980 in Moskau angesagt. Allein 42 Staaten sagten die Teilnahme ab, wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan und weitere 24 Staaten verzichteten aus finanziellen oder sportlichen Gründen. Somit waren nur 80 teilnehmende Nationen zu verzeichnen, was gleichbedeutend war mit der niedrigsten Anzahl von Staaten seit den Spielen von 1956 in Melbourne. Da sich die westdeutsche Mannschaft dem Boykott anschloss, war ich wenig motiviert, den - wie ich es nannte - russischen Meisterschaften mit internationaler Beteiligung zuzusehen. Manche werden jetzt einwerfen wollen, dass zumindest die Deutsche Demokratische Republik an den Spielen beteiligt war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich für meinen Teil habe die DDR damals nie als Teil Westdeutschlands gesehen, sondern eben als konkurrierende Nation bei der Vergabe der Medaillen. Erfolge der DDR habe ich nie und werde ich auch nie als unsere Erfolge adaptieren.
Was blieb also in meinem Gedächtnis haften von den Spielen von 1976 und 1980? Vor allem die schlechte Übertragungsqualität von Bild und Ton. Ganz besonders beim Ton! Denn nicht selten ist damals eine Tonleitung zusammengebrochen und der Kommentator hatte dann über eine normale Telefonverbindung seine Arbeit fortsetzen müssen. Eine analoge Telefonverbindung wohl gemerkt! Das bedeutet, dass das Eingangssignal, also die zuckersüße Stimme des Kommentators erst mal auf den Frequenzbereich von 300 Hz bis 3400 Hz begrenzt wurde, was einer Bandbreite auf 3100 Hz entspricht. Legt man zu Grunde, dass die menschliche Stimme mit Obertönen einen Frequenzumfang von 80 Hz bis 12000 Hz umfasst, dann sorgt also das Telefon selbst für eine gehörige Beschränkung des Ausgangssignals. Hinzu kommen noch alle möglichen Dämpfungs- und Verzerrungseffekte aufgrund der langen Übertragungsstrecken. Aber ich will Sie nicht weiter mit physikalischen Details langweilen. Stattdessen werde ich Sie mit weiteren Details über die Olympischen Spiele langweilen.
Es folgten die Spiele von Los Angeles 1984 und weil die Sowjets sehr nachtragend waren, auch der entsprechende Gegenboykott durch die Sowjetunion und 18 weiterer Staaten. Und weil die Sowjets nicht nur sehr nachtragend sind, sondern auch noch schlechte Verlierer, veranstaltete die Sowjetunion zusammen mit anderen Boykott-Staaten die Wettkämpfe der Freundschaft (Druschba-84). Mir war das egal, denn zum einen waren meine Fernsehprivilegien mittlerweile fast uneingeschränkt, das heißt kein Zwangsmittagsschlaf mehr und bei besonderen Anlässen durfte ich auch mal länger aufbleiben, was bei einer Zeitverschiebung von minus neun Stunden unbedingt notwendig war, zumindest wenn man live dabei sein wollte. Zum anderen waren es die ersten Spiele, die ich bewusst verfolgen konnte und weil die deutsche Mannschaft (West) wieder daran teilnahm, auch verfolgen wollte. Ganz abgesehen davon, dass Los Angeles im sonnigen Kalifornien gelegen als Veranstaltungsort viel mehr auf meiner Wellenlänge liegt als Montreal und Moskau, wo es gefühlt nie wärmer wird als im Kühlschrank. Und Los Angeles, wegen der ortsansässigen Filmindustrie im Volksmund auch Showtown genannt, lieferte nahezu perfekte Spiele ab. Schon die Eröffnungsfeier war spektakulär, mit Raketenmann, einer Western-Show a la Winning the West und Superstar Lionel Richie, der seinen Hit All Night Long zum Besten gab. Eine laue kalifornische Sommernacht und Steeldrum-Klänge in der Instrumental Break – was gibt es Besseres, um in Cocktail-Laune zu kommen. Und was ist aus sportlicher Sicht von diesen Spielen bei mir hängen geblieben? Eine ganze Menge natürlich, zu viel um hier im Einzelnen aufgezählt zu werden, deshalb nur ein regenbogenfarbiges Spektrum meiner olympischen Momente aus dem Jahre 1984: ein amerikanischer Turmspringer mit griechischen Vorfahren, der den Vergleich mit Adonis selbst nicht zu scheuen brauchte, ein überragender chinesischer Turner, der heute eine große Sportartikelfirma sein eigen nennt, ein japanischer Turner, mit furchtbar schlechten Zähnen, der dem überragenden chinesischen Turner das Leben so schwer wie möglich machte und schließlich ein kleines 15-jähriges deutsches Mädchen mit großer Nase, dass den Demonstrationswettbewerb im Tennis gewann und von dem die Welt noch nicht ahnte, wie sehr sie ihrem Sport in den nächsten Jahren ihren Stempel aufdrücken sollte.
Vier Jahre später in Seoul waren dann wieder fast alle Nationen, die es sich leisten konnten, dabei. Ich sage fast, denn es gibt ja immer Nationen, die unbedingt aus der Reihe tanzen müssen. Damals waren es Äthiopien, Nicaragua, Kuba und – aus heutiger Sicht möchte ich sagen – selbstverständlich Nordkorea. Nordkorea begründete seinen Boykott damit, dass es nicht ausreichend in die Ausrichtung der Spiele mit einbezogen wurde – mit anderen Worten, die nordkoreanische Polit-Führung schmollte. Das tat den Spielen von Seoul jedoch keinen Abbruch: die Eröffnungsfeier war nicht weniger farbenfroh als die von Los Angeles aber deutlich von dem fernöstlichen Charme geprägt, d.h. perfekte Massenchoreographien, unterlegt von den fremden Klängen traditioneller Musikinstrumente, die man als durchschnittlich gebildeter Westeuropäer nicht einmal beim Namen nennen kann, beeindruckende Kampfsportdemonstrationen, sowie elegante und anmutige Tanzdarbietungen.
In den vier Jahren, die seit den Spielen von Los Angeles vergangen waren, ist aus dem kleinen Mädchen mit der großen Nase ein großes Mädchen mit großer Nase geworden – und ganz nebenbei die dominierende Tennisspielerin in der Welt. Sie wissen es längst, die Rede ist von unserer Steffi Graf. Zu einem Spiel von Steffi Graf sollte man immer pünktlich erscheinen, vor allem in den Vorrunden. Nur 20 Minuten Verspätung bedeuteten oft, dass man 90 bis 95 Prozent des Spiels bereits verpasst hat. 1988 siegte sie im Finale der French Open gegen Natalija Swereva in nur 34 Minuten (6:0, 6:0). Überhaupt war 1988 ihr erfolgreichstes Jahr, in dem sie nicht nur alle vier Grand Slam Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon Championships und US Open) gewann, sondern auch noch die Gold-Medaille im Dameneinzel in Seoul. Für diesen einmaligen Erfolg wurde der Begriff Golden Slam erfunden. Steffi Graf nahm noch eine zweite Medaille aus Seoul mit nach Hause. An der Seite von Claudia Kohde-Kilsch gewann sie auch noch Bronze im Damendoppel.