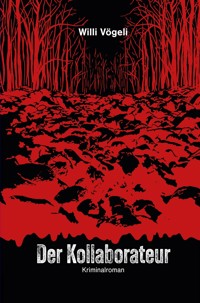
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bookmundo Direct
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
September 1982. Die verstümmelte Leiche eines jungen Mannes wird am Rand eines beliebten Wanderweges am Pfälzer Felsenmeer gefunden. Ein weiterer Toter liegt in der leer geräumten Wohnung eines Hochhauses, mit Genickschuss hingerichtet. Beiden Opfern sind rätselhafte Zeichen in die Haut geritzt. Das Ludwigshafener Team unter Leitung des in Speyer wohnenden Kriminalhauptkommissars Wilhelm Beck kommt mit den Ermittlungen nur schleppend voran. Als Beck erst selbst verschuldet in die Fänge einer skrupellosen Rockerbande gerät, dann auch noch einer Kommandozelle der RAF in die Quere kommt, trifft er eine verhängnisvolle Entscheidung. Zur gleichen Zeit stößt er auf eine Spur, die weit zurück in die Vergangenheit, in die Vogesen des Herbstes `44 führt. Wehrmacht und Gestapo foltern und ermorden Hunderte von Widerstandskämpfern, darunter auch zwei Rheinmatrosen aus Speyer. Beck beginnt zu verstehen, warum der junge Mann am pfälzischen Felsenmeer sterben musste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Kollaborateur
Kriminalroman
von
Willi Vögeli
Impressum
© 2023 Willi Vögeliwww.willivoegeli.deISBN 978-9-403-70424-1Druck und Distribution im Auftrag: Bookmundo, Mijnbestseller Nederland B.V. | Delftestraat 33 | 3013AE RotterdamCoverdesign: Franziska Lühmann, www.franziskaluehmann.deDas Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig
„Das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal vergangen.“ William FaulknerIn Erinnerung an Hugo und Henri Steigleiter, stellvertretend für die vielen unbekannten Frauen und Männer, die ihren Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit dem Leben bezahlten. Im Unterschied zu der frei erfundenen Geschichte im Buch wurden die realen Brüder wegen „Landesverrat und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, Verbreitung von kommunistischen Schriften, Unterstützung der Roten Hilfe und Mitgliedschaft im Kanal- und Rheinschifferverband“ am Morgen des 6. November 1940 in Berlin-Plötzensee mit einem Fallbeil hingerichtet. Hugo war 20 Jahre, Henri 23 Jahre alt.Zwischen August und November 1944 überzogen Wehrmacht und Gestapo die Menschen in den Dörfern am Vogesenflüsschen Rabodeau und seinen Nebentälern mit einem „Aktion Waldfest“ genannten grausamen Terrorregime. Nach der Befreiung Ende November 1944 wurde die Gegend „Tal der tausend Deportierten“, „Tal der Tränen“ (de Gaulle) oder „Tal der Witwen“ genannt.
<Prolog>
Oktober 1981Vom Spielplatz dringt leises Kindergeschrei in das kleine Wohnzimmer. Es ist so still, dass zwischen dem Rascheln der Seiten des Büchleins, in dem Wolfgang aufgewühlt blättert, das Ticken der alten Kommodenuhr zu hören ist. Duft von frisch gebrühtem Kaffee überdeckt den leicht muffigen Geruch der Polstergarnitur, die sie vor langer Zeit zusammen mit der Schrankwand und der Kommode gekauft hat. „Das Tagebuch meines Großvaters?“ Wolfgangs Stimme klingt hart. Als er zornig aufspringt, schreckt sie zusammen. Aufgebracht tigert er die wenigen Schritte zwischen Zimmertür und Couch hin und her. Es macht ihr Angst, wie fremd er ihr in seinem Zorn erscheint. Aufgewühlt blättert er weiter in dem Büchlein, das sie ihm vor wenigen Minuten geradezu feierlich überreicht hat. So hat sie ihn noch nie erlebt. Ihr kommt es vor, als würden ihm die pechschwarzen Haare noch widerspenstiger vom Kopf abstehen als sonst. Nach dem Selbstmord ihrer Tochter hat sie die Verantwortung für den damals Vierjährigen übernommen und ihn gegen alle Widrigkeiten großgezogen. Mit all der Liebe, die ihr zur Verfügung stand, hat sie ihn zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht. Anders wäre es nicht gegangen. „Aber hier steht …“ er fängt an, mit der linken Hand wild in der Luft herumzufuchteln „hier steht nichts von einem …“. Abrupt bleibt er stehen und fixiert sie mit wildem Ernst. „Hast du gewusst, dass deine große Liebe ein Maquisard war?“ Hitzig setzt er nach. „Maquis. Résistance. Auf jeden Fall im Widerstand gegen die Faschisten. Auf der Seite derer, die sich gewehrt haben!“Kaum erkennbar nickt sie. Noch nie hat sie ihn so aufbrausend erlebt. Obwohl sein Verhalten sie einschüchtert, hält sie seinem Blick stand. Sie weiß nicht so recht, was sie sagen soll. Schmerzhaft spürt sie die wütende Empörung, die sich gegen sie richtet, versteht aber nicht so ganz, was sie ausgelöst hat. Ohne großen Erfolg versucht sie ihre Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten.„Aus gutem Grund hat sich der Vater deines Kindes im Wald versteckt, anstatt bei dir zu sein? Und die Geschichte mit dem Schiffsunglück bei Straßburg? Warum erzählst du mir solche Märchen, wenn die Wahrheit doch so viel mehr wert ist?“ Ungläubig schüttelt er den Kopf und nimmt wieder seinen Raubtiergang zwischen Couch und Zimmertür auf. Die Augen konzentriert auf die schwer lesbare Handschrift gerichtet, blättert er weiter in dem Tagebuch.Als er unvermittelt vor ihr stehen bleibt, entfährt ihr ein leiser Schrei. Sie hat Mühe, aus der Tiefe des Sessels zu ihm aufzusehen. Wie groß er geworden ist. Und hager. Wahrscheinlich isst er zu wenig, seit er nicht mehr bei ihr wohnt. „Warum hast du in all den Jahren nie mit mir darüber geredet?“ An dem Beben in seiner Stimme hört sie, wie viel Mühe es ihn kostet, ruhig zu bleiben. Anklagend hält er ihr das rote Büchlein vor die Nase, dessen grober Einband Brandspuren zeigt. „Nach zwanzig Jahren erzählst du mir bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, dass die Nazis meinen Großvater umgebracht haben, weil er im Widerstand war. Und dass die Geschichte vom Schiffsunglück auf dem Rhein nichts weiter als ein Märchen ist.“Die unerwartet heftige Reaktion ihres Enkels erschüttert ihre ansonsten robuste Haltung. Ihr zierlicher Körper scheint zu schrumpfen, droht ganz in den durchgesessenen Polstern des Sessels zu verschwinden.„Aber das hier!“ Wieder hält er das Büchlein hoch. „Das ist kein Märchen. Hier drin hat der Vater meiner Mutter die letzten Monate seines Lebens beschrieben. Für dich! Für die große Liebe seines Lebens. Bedeutet dir das denn gar nichts?“Sie spürt, wie sich ihre Augen mit Tränen füllen. Er ist laut. Seiner Körperhaltung sieht sie an, dass er hin und hergerissen ist, zwischen dem Bedürfnis, einfach aus der Wohnung zu stürmen, und dem Verlangen weitere Erklärungen von ihr zu fordern. „Wolfgang, jetzt beruhig dich doch. Setz dich doch bitte wieder hin." Hilflos schaut sie zu dem Stück Kuchen auf seinem Teller, von dem er gerade mal einen Bissen probiert hat. Sanft, mit zitternder Stimme, spricht sie weiter. „Ich war gerade mal siebzehn, als ich schwanger wurde. Als Hugo im Spätsommer ‘44 ein letztes Mal nach Speyer kam, konnte ich ihn nur treffen, weil meine Mutter an dem Nachmittag für ein paar Stunden mit meinem völlig betrunkenen Vater beschäftigt war, der kurz vor unserem Hoftor mit seinem Fahrrad gestürzt war.“ Während sie sich mit einem Stofftaschentuch die Tränen von den Wangen tupft, hebt sie den Kopf und sucht seinen Blick. „Ja. Ich wusste, dass Hugo von der Polizei und der Gestapo gesucht wurde. Vielleicht ahnte ich den Grund. Sicher gewusst habe ich es nicht. Für meine Eltern waren Hugo und Henri immer nur Halbstarke, die ihren Beruf als Rheinmatrosen dazu nutzten, um Tabak und Schnaps zu schmuggeln. Genau wie ihr Vater.“ Sie hält inne, braucht einen Moment, um die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. In Erinnerungen versunken schweift ihr Blick zur Uhr, dann weiter zum Fenster. Für einen langen Moment ist es still. Dann atmet sie tief durch und sucht wieder seinen Blick. „Mitte der Fünfziger, Mireille, deine Mutter, war gerade mal zehn, kam ein Päckchen aus den Vogesen. In einem kurzen Brief erzählte mir ein junger Elsässer von seiner Frau, seinem Sohn und seinem Vater, die alle in einer Nacht von deutschen Soldaten erschossen wurden. In dieser Nacht starben auch Hugo und sein Bruder.“ Fahrig greift sie nach der Kanne und gießt sich Kaffee in ihre Tasse. Sie schaut auf das zerschlissene, in rote Pappe eingebundene Notizbuch in Wolfgangs Hand. „Das Büchlein lag bei dem Brief. Er hat es bei der Renovierung seines niedergebrannten Elternhauses gefunden.“ Wieder holt sie tief Luft. „Mehr als zehn lange Jahre wusste ich nicht, was mit Hugo passiert war.“ Wolfgang macht einen halben Schritt zurück und setzt sich widerstrebend auf die Lehne der Couch, jederzeit bereit wieder aufzuspringen. Sie sieht seine zornig zusammengezogenen Brauen, die aufeinandergepressten Lippen und ahnt, wie viel Kraft es ihn kostet, ihr zuzuhören. Da sie nicht genau weiß, was er von ihr hören will, redet sie einfach weiter. Angespannt umklammern ihre Hände die hölzernen Sessellehnen. In dem Bemühen ihrer brüchigen Stimme etwas mehr Halt zu geben, richtet sie sich auf. „Aber was hätte ich mit diesem Wissen anfangen sollen? Es änderte nichts daran, dass ich eine Mutter ohne Mann war und deine Mutter ein Bankert, ein in Schande gezeugtes Kind.“ Ein bitterer Unterton schleicht sich in ihre Stimme. „Nach ‘45 wollte keiner bei den Nazis mitgemacht haben. Man war Opfer der Nazipropaganda gewesen oder hatte weggeschaut, um zu überleben. Keiner hat von irgendwas gewusst. Schlimmstenfalls war man aufgrund widriger Umstände zum Mitläufer geworden. Widerständler haben da nur gestört, weil sie den anderen ein schlechtes Gewissen gemacht haben. Auch zehn Jahre nach Kriegsende sahen die meisten Leute in Henri und seinem Bruder nichts anderes als Kriminelle und Vaterlandsverräter. Verstehst du?“„Und heute ist es nicht viel anders.“ Wütend schüttelt er den Kopf. „Weißt du, wie viel alte und neue Nazis dort draußen rumlaufen?“ Er macht eine weiträumige Geste. „Keiner regt sich über den braunen Dreck auf, mit dem sie um sich werfen. Hier“, er deutet auf den Antifa-Aufnäher an seiner schwarzen Lederjacke, „irgendwer muss sich doch wehren. Du hättest dir doch denken können, was das für mich bedeutet!“„Es war nie der richtige Augenblick, Wolfgang. Du warst in den letzten Jahren mehr mit der Schule und deinen Freunden beschäftigt. Und seit du studierst und in Heidelberg wohnst ... Na ja … Wann haben wir das letzte Mal darüber geredet, was dich neben dem Studium so beschäftigt? “ Unsicher schnäuzt sie sich in ihr Taschentuch.„Aber Oma, verstehst du denn nicht, dass …“ Sie will ihm noch sagen, dass sie Angst um ihn hat, sich Sorgen macht, wenn er so laut und offen gegen alte und neue Nazis wettert, sich mit einem Plakat vor deren Türen setzt oder an Demonstrationen teilnimmt. Aber da ist er schon weg. Ohne ein weiteres Wort aufgesprungen und türenschlagend aus der Wohnung gestürmt.
1
September 1940An einem spätsommerlich warmen Septemberabend schlenderte Jean-François Mutzig durch Straßburgs Innenstadt in Richtung Gerberviertel. Seine Rückkehr war gerade mal zwei Wochen her, und es war ihm vom ersten Tag an schmerzlich aufgefallen, dass er nicht in die gleiche Stadt gekommen war, die er mit der Evakuierung im September des vergangenen Jahres verlassen hatte. Zu seiner Freude waren nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im Juni viele Straßburger in ihre Stadt zurückgekommen. Dass sich aber in den Verkaufsgeschäften und Straßen immer mehr Wehrmachtsuniformen unter die Rückkehrer mischten, ließ ihn schwermütig werden. Da half auch das Gerücht über die baldige Wiedereröffnung der Universität nicht. Vor den Westportalen der hoch aufragenden Cathétrale Notre-Dame blieb er kurz stehen. Bei dem Anblick der von riesigen Fahnen verunstalteten weltbekannten Fassade stieg Wut in ihm auf. Mit raschen Schritten ging er weiter zur erst vor ein paar Wochen in Krämergasse umbenannten Rue Dernière. Die ganze Stadt schien mit Tausenden Hakenkreuzfahnen mehr gefesselt als beflaggt. Immer wieder sah er Schaufenster und Haustüren, die mit großen, gelben und weißen Judensternen gebrandmarkt waren. Von der geschäftigen Lebensfreude in den menschengefüllten Gassen der Altstadt, die ihm, dem Gymnasiasten aus dem kleinen Dorf an der elsässischen Weinstraße, ein berauschendes Gefühl von Weltoffenheit und Toleranz vermittelt hatte, war nichts mehr zu spüren. Wie ein bösartiger Nebel hatte sich der gewalttätige Germanisierungswahn der Besatzer über die ganze Stadt gelegt. Aber noch etwas anderes vibrierte in den Straßen. Überall spürte man eine rohe, kraftstrotzende Stimmung des Aufbruchs. Jean-François selbst bemerkte eine widerwillig aufkeimende Neugierde in sich. Er überquerte den ebenfalls germanisierten Gutenbergplatz und entschied sich für den kürzesten Weg zur Pont Saint Martin. In den Weinstuben und Kneipen hörte man nur noch deutsche Lieder – und nicht wenige Straßburger sangen laut mit. So war es auch an diesem Abend, als er das in Gerberstube umbenannte Tanneurs betrat. Kräftiger Duft von gegartem Sauerkraut und geräuchertem Schweinefleisch schlug ihm entgegen und erinnerte ihn an die eher kargen Mahlzeiten der vergangenen Tage. So gut besucht hatte er die Weinstube noch nie erlebt. In dem ständigen Hin und Her der gut gelaunten Menge entdeckte er an der Theke Lucien Catieux, einen ehemaligen Kommilitonen, den er schon aus seiner Zeit am Gymnasium in Colmar kannte. In einem Anflug von Wehmut dachte er an den großen Freundes- und Bekanntenkreis, der ihm im Jahr vor der Besatzung zugewachsen war. Seit seiner Rückkehr nach Straßburg war es ihm nicht gelungen, auch nur einen vertrauten Menschen zu treffen. Voller Freude, endlich ein bekanntes Gesicht zu sehen, schob er sich durch die dicht gedrängte Menge auf die Theke zu. „Salut Lucien. Ca va?“ Er begrüßte seinen Bekannten mit Handschlag. Erst jetzt fiel ihm auf, dass in dem lauten Durcheinander von Stimmen kein einziges Wort Französisch zu hören war.„Wen haben wir denn da? Das ist doch Jean-François Mutzig. Wo bist du denn abgeblieben, die ganzen Jahre?“ Lucien grinste über das ganze Gesicht und schien sich ehrlich zu freuen. Er sah gut aus und war, soweit es Jean-François beurteilen konnte, nach der neuesten Mode gekleidet. Ihm fiel sein eigener, dürftig gefüllter Koffer ein, mit dem er nach Straßburg gekommen war, und er ertappte sich dabei, wie er sich nach einem Spiegel umschaute.„Die ganzen Jahre. Jetzt übertreib mal nicht. Es ist gerade mal ein Jahr her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.“ Er versuchte Blickkontakt zu der jungen Frau hinter der Theke aufzunehmen.„Aber was für ein Jahr, mein Freund. Ganz Europa ist im Aufbruch. Was das gerade für uns Junge an Chancen bringt. Im nächsten Jahr wird in Straßburg eine Reichsuniversität gegründet.“ Mit großen Augen schaute Lucien seinen Schulfreund an. „Jean-François. Wir können wieder studieren. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, lass das Französische. Die Deutschen verstehen da keinen Spaß. Wenn dir nach couragiertem Verhalten ist“, aus irgendeinem Grund fand er die Formulierung lustig, „halt dich ans Elsässische.“ Neben der Euphorie und dem Glanz in Luciens Augen registrierte Jean-François auch den kleinen Anstecker des elsässischen Hilfsdienstes am Revers seines Gegenübers. „Wenn es dir so gut geht, wie du aussiehst, Lucien, scheinst du ja diese Chancen schon optimal zu nutzen. Mit was verdienst du dein Geld? Wovon kann man in einer besetzten Stadt so gut leben, wenn man nicht zu den Besatzern gehört?“ Erschrocken über seine eigene Bemerkung schaute er um sich. Er hatte von Leuten gehört, die wegen des Tragens einer Baskenmütze für Monate in den Kerkern der deutschen Polizei verschwunden waren.Die Frau hinter der Theke fragte ihn mit hochgezogenen Brauen stumm, was er trinken wolle.Er musste fast schreien. „Einen Riesling bitte!“ Immer mehr weinlaunige Gäste kamen in die nicht sehr große Schankstube, und der Geräuschpegel stieg von Minute zu Minute.„Das entscheidest du doch ganz allein! Zum Wohl, mein Freund!“ Lucien hob das Glas und prostete ihm zu. „Was entscheide ich ganz alleine? Wovon redest du?“ Während er prüfend an seinem Wein nippte, musterte Jean-François die gut gelaunte Menge. Auch wenn die meisten Gäste Zivilisten waren, dominierten doch die deutschen Uniformen. Mancher Kragenspiegel zeigte die Runen der SS, andere die Streifen der Wehrmacht. Diese laute deutsche Heiterkeit um ihn herum machte ihn unsicher, und er fühlte sich zunehmend unwohl. Natürlich wusste er, wovon Lucien sprach. Von der Möglichkeit, mit den Wölfen zu heulen. Was nichts anderes bedeuten würde, als den Weg seines verhassten Vaters einzuschlagen. „Was ist, Jean-François, schmeckt dir der Wein nicht, oder fehlt dir das Geld für ein weiteres Glas? Wovon lebst du eigentlich? Immer noch von deinen kleinen Übersetzungen?“ „Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Das ist aber nicht so ganz einfach in diesen Zeiten.“ Sie mussten fast schreien, so laut war es in der Weinstube geworden. Die Menschen standen so eng, dass er ständig angerempelt wurde und nur mit festem Griff an die Theke seinen Platz halten konnte. Für einen kurzen Moment hatte die Menge Lucien zwei Armlängen von der Theke abgedrängt. Immer wieder tauchte sein Gesicht zwischen den vielen Köpfen auf, wie der Korken einer Angelschnur, an der ein unentschlossener Fisch knabbert. Es schien ihm überhaupt nichts auszumachen. Er machte eher den Eindruck, als fühlte er sich wohl. Im Unterschied zu Jean-François, der sich sehr zusammenreißen musste, um seinen ehemaligen Mitstudenten nicht zur Rede zu stellen. Er erinnerte sich an heißblütige Auseinandersetzungen am Ufer der Ill, oder, wenn sie Geld hatten, in einer der Kneipen, in denen vor allem Studenten verkehrten. Eine Debatte über Nietzsche fiel ihm ein, in der Lucien Nietzsche gegen heftige Anfeindungen seiner falsch verstandenen Herrenmoralthesen verteidigte. Gerne hätte er ihm ein Zitat Nietzsches entgegenhalten: „Nicht die Führer aus der Gefahr gefallen Euch am besten, sondern die Euch von allen Wegen abführen, die Verführer“. Aber eine innere Stimme riet ihm, dies jetzt und hier besser zu unterlassen.„Vielleicht kann ich dir ja helfen.“ Lucien hatte es wieder neben ihn an die Theke geschafft und schrie ihm ins Ohr. „Ich habe da ein paar Kontakte, die außergewöhnliche Talente zu schätzen wissen. Was meinst du?“ Mit beiden Armen fuchtelnd versuchte er, die junge Frau hinter der Theke auf sein leeres Glas aufmerksam zu machen.„Von welchen Talenten redest Du? Welche Talente meinst du?“, schrie Jean-François zurück. Er war praktisch mittellos, und wenn er nicht bald zu Geld kam, war er gezwungen, wieder nach Colmar zu ziehen, oder noch schlimmer, nach Kaysersberg.„Na ja, ich erinnere mich sehr gut an dein beneidenswertes Sprachtalent und wie beängstigend einfach es dir gelingt, das Vertrauen von Menschen zu gewinnen. Selbst Wildfremde fressen dir nach einer halben Stunde aus der Hand.“ Endlich hatte ihn die junge Frau bemerkt und stellte zwei volle Gläser auf die Theke. Lucien schob ihm einen Wein hin und schwadronierte mit steigender Euphorie weiter über die große Zukunft, die allen vernünftigen Menschen nun offenstehen würde. Früher als geplant verließ Jean-François das Tanneurs. Er hatte es einfach nicht mehr ausgehalten inmitten der laut feiernden Uniformträger. Am Ufer der Ill war die Luft immer noch sommerlich warm, und er trug seine Jacke locker in der Armbeuge. Verliebte Pärchen flanierten Arm in Arm am Wasser entlang, in dem sich das bernsteinfarbene Licht der Gaslaternen spiegelte. Trotz der friedlichen Abendstimmung wählte er den kürzesten Weg durch die Altstadt. Das Treffen mit Lucien hatte eine wachsende Verzweiflung in ihm ausgelöst, und er hoffte, seinen väterlichen Freund Pater Bruno anzutreffen. Als er in die Gasse einbog, in der das Kloster lag, fiel ihm der große schwarze Wagen unter der Gaslaterne zunächst nicht auf. Den Blick gedankenverloren auf den Boden gerichtet, steuerte er auf das kleine Seitentor zu, das zu den einfachen Zimmern des Junggesellenheims führte. Erst die Geräusche zweier sich öffnender Autotüren zogen seine Aufmerksamkeit wieder auf die Außenwelt. Mit erstaunten Augen sah er zwei Männer in dunklen Anzügen auf sich zukommen.„Herr Mutzig? Sind Sie Jean-François Mutzig?“ Die Frage klang nicht unfreundlich. Da ihm beide Männer den Weg versperrten, blieb er stehen. Er versuchte zu verstehen, wer ihn da spätabends auf der Straße nach seinem Namen fragte.„Warum wollen Sie das wissen und wer sind Sie?“ Obwohl ihm die Situation nicht ganz geheuer war, klang seine Stimme fest.„Es gibt da jemanden, der Sie sprechen möchte. Würden Sie uns bitte zum Wagen folgen, wir müssen ein Stück fahren?“ Der Wortführer machte eine einladende Geste in Richtung des Wagens.„Wer will mich sprechen, und wer sind Sie überhaupt? Ich werde den Teufel tun und mit Leuten in einen Wagen steigen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe.“ Er spürte, wie das beklemmende Gefühl aus dem Tanneurs wieder Besitz von ihm ergriff.„Aber aber Herr Mutzig. Wer wird denn vor einem Gotteshaus den Teufel ins Gespräch bringen. Apropos Teufel.“ Der Wortführer machte einen halben Schritt auf ihn zu, dann schaute er sich übertrieben verschwörerisch um. „Sie wissen, dass Ihre Frau Mutter Halbjüdin ist, oder?“ Jetzt klang die Stimme nicht mehr so freundlich. „Wenn Ihnen Ihr eigenes Schicksal schon egal ist, dann überlegen Sie bitte, was einer Halbjüdin in den heutigen Zeiten alles zustoßen kann. Also?“ Die schockartig einsetzende Furcht um seine Mutter lähmte jede Gegenwehr. Widerstandslos ließ er sich von den beiden Männern zu dem Wagen führen.Nicht weit von der Altstadt entfernt hielt der Wagen vor einem weiträumigen, viereinhalbstöckigen Bürgerhaus, vor dem neu errichtete Fahnenmasten zeigten, wer der neue Hausherr war. Der bisherige Wortführer wies ihm mit barschen Worten den Weg durch ein großes, von SS-Männern bewachtes Eingangsportal, zwischen Dutzenden in der Eingangshalle hin- und hereilenden Uniformierten hindurch, zu einer Treppe, die in den Keller des Gebäudes hinabführte. Am Ende eines Ganges schoben sie ihn an einer geöffneten, schweren Holztür vorbei in einen Raum, in dessen Mitte ein kleiner quadratischer Tisch mit zwei gegenüber platzierten Stühlen stand. Mit rasendem Puls begann er sich zu fragen, was den Aufwand lohnte, ihn, den mittellosen Studenten in Haft zu nehmen. Seine Bewacher wiesen ihn an, sich zu setzen. Dann fiel die schwere Tür ins Schloss – und er war allein. Verzweifelt schaute er sich um. Seine Füße standen auf nacktem Beton, die Wände waren rau verputzt und das Licht kam von einer schirmlosen Glühbirne an der Decke über dem Tisch, an dem er saß. Zwei schmale Kellerfenster waren mit massiven Brettern fachmännisch abgedeckt. Alles, was er sah, bestätigte seine schlimmsten Ängste.Im Laufe der folgenden Stunde versuchte er mit steigender Panik eine Erklärung für seine Situation zu finden. Was hatte er falsch gemacht? Welches Verhalten oder welche Bemerkung hatte ihn auf die Liste der Deutschen gesetzt? Die Vorgesetzten der beiden Männer konnten unmöglich von dem Gespräch mit Lucien wissen. Er wollte aufstehen, sich bewegen, traute sich aber nicht, seinen angewiesenen Platz zu verlassen. Hin und wieder jagten Stiefelschritte auf dem Gang oder ein dumpfer Schrei aus anderen Räumen seinen Puls in die Höhe. Das schiere Aushalten seiner Wehrlosigkeit und die alle Überlegungen überlagernde Angst vor Folter und Misshandlungen ließen ihn am ganzen Körper zittern.Nach einer weiteren Stunde, die ihm ausreichend Zeit gab, sich alles Hörensagen über die Methoden der SS und der deutschen Geheimpolizei ausführlich vor Augen zu führen, befürchtete er, allmählich die Kontrolle über seine Gedanken und seinen Körper zu verlieren. Was ihm am meisten zusetzte, war die Vorstellung, dass sie seiner Mutter etwas antun könnten und er nicht die Macht hätte, dies zu verhindern.Das Geräusch der sich öffnenden Tür riss ihn in die Realität zurück. Ein großgewachsener SS-Offizier mittleren Alters mit breiten Schultern, kurz geschorenem, blondem Haar und einem großflächigen, von reichlich Alkoholgenuss geröteten Gesicht trat forsch in den Raum. Nachdem er Jean-François einige Augenblicke grußlos gemustert hatte, schloss er die Tür und kam an den Tisch. Während er sich setzte, legte er eine dünne Kladde vor sich ab. Umständlich schlug er sie auf und begann mit großer Sorgfalt die wenigen Blätter darin durchzusehen.„Sie werden sich sicher schon gefragt haben, warum wir uns die Mühe machen, einen kleinen, unbedeutenden Studenten hierher in unsere Stadtvilla zu holen.“ Er schaut kurz hoch. „Die Herren haben sich doch hoffentlich korrekt verhalten?“Vergeblich suchte Jean-François nach einer Spur von Hohn oder Häme in der Stimme seines Gegenübers. Er riss sich zusammen, konnte aber ein leichtes Beben in seiner Erwiderung nicht verhindern. „Eine Antwort darauf ist mir bisher nicht eingefallen. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen.“ Der Offizier musterte ihn mit leichter Verwunderung. „Das will ich gerne tun, Herr Mutzig.“ Er erhob sich und begann auf und ab zu gehen. „Um es kurz zu machen. Das einzige Ziel unseres Hierseins ist es, die Kraft der nationalsozialistischen Idee auch in Frankreich wirken zu lassen. Unserer Überzeugung nach gibt es unter den Völkern nur eine Rasse, die für die Zukunft der Menschen steht. Wenn wir nicht rasch und konsequent in die Entwicklung eingreifen, ist die Erde in nicht allzu ferner Zukunft in der Mehrheit von minderwertigen Rassen, Irren und lebensunfähigen Kreaturen bevölkert. Unter der Führung von Adolf Hitler haben wir Deutsche es uns zur Aufgabe gemacht, das europäische Festland, Russland und England von bolschewistisch-jüdischem Ungeziefer zu befreien, um ein arisches Reich zu begründen, das eintausend Jahre und länger Bestand haben und die Evolution auf der Erde einen großen Sprung nach vorne bringen wird.“ Hier unterbrach der große Mann seine Wanderung für eine kurze Pause, nur um zu sehen, wie sein kleiner Vortrag auf Jean-François wirkte. Diesem stand die angestrengte Beherrschtheit ins Gesicht geschrieben. Der SS-Mann schien nichts anderes erwartet zu haben und fuhr mit seinem Monolog fort.„Wie stark Deutschland ist, brauche ich Ihnen nicht zu beschreiben, Sie können es leicht an Ihrer eigenen aktuellen Situation erkennen. Trotzdem brauchen wir Verbündete. Wir hätten es gerne, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Sie würden weiter wie bisher leben, mit der geringfügigen Änderung, dass wir eine kleine Wohnung für Sie anmieten und Ihnen ein zufriedenstellendes Auskommen sichern. Des Weiteren würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie nach der Gründung der Reichsuniversität Straßburg im nächsten Jahr wieder Ihr Studium aufnehmen. Als Gegenleistung erwarten wir regelmäßige Treffen und Gespräche. Unsere Vereinbarung würde auch die Übernahme spezieller Aufträge enthalten, die selbstverständlich zusätzlich und leistungsbezogen entlohnt werden.“ Der Offizier setzte sich an den Tisch. „Nun, Herr Mutzig. Mich würde sehr interessieren, wie Sie zu unserem Angebot stehen.“Jean-François‘ Zittern hatte sich verstärkt. Was gäbe er jetzt für einen Schluck Wasser. Krampfhaft versuchte er das Offensichtliche zu begreifen. Obwohl der rationale Kern seines Denkens schon die Ausweglosigkeit seiner Situation erkannt hatte, war er tief in seinem Innern noch nicht bereit aufzugeben. „Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen von Nutzen sein könnte. Ich kenne niemanden in Straßburg. Seit ich wieder hier bin, habe ich keinen einzigen bekannten Menschen getroffen. Ich glaube, Sie sehen in mir jemanden, der ich nicht bin.“ Das zunehmende Beben in seiner Stimme bekam er nicht in den Griff.„Das sehen wir anders, Herr Mutzig. Sie sprechen verschiedene Sprachen, insbesondere Französisch und Deutsch akzentfrei, ganz zu schweigen von dem hervorragenden Alemannisch, welches Sie in Ihrem Heimatstädtchen gelernt haben. Darüber hinaus sind Sie unseren Informationen nach, ein flexibel denkender Mensch, dem es leichtfällt, auf andere zuzugehen und der es anderen leicht macht, ihm zu vertrauen. Alles in allem also beste Voraussetzungen für die Arbeit, die wir zu vergeben haben.“ Wieder musterte er seinen Gefangenen kurz. „Und kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen moralischen Bedenken. Die Moral ist in der nationalsozialistischen Idee sehr gut aufgehoben. Besser als in jeder anderen.“„Ich soll mich an der Unterdrückung meiner Landsleute beteiligen, indem ich Spitzeldienste für Sie übernehme?“ Für einen kurzen Moment verdrängte aufschießende Wut seinen Überlebensinstinkt. „Euer Führer ist ein Brandstifter und ein Massenmörder zugleich! Den Teufel werde ich tun, um ...“ Weiter kam er nicht. Der Schlag traf ihn mit solcher Wucht, dass er mitsamt seinem Stuhl nach hinten kippte. Augenblicklich tauchte der Offizier über ihm auf und verpasste ihm ein paar schmerzhafte Fußtritte in die Rippen und in den Schritt. „Wir können gerne diskutieren, Herr Mutzig, aber Beleidigungen unseres Führers lasse ich nicht durchgehen. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Also reißen Sie sich zusammen, und setzen Sie sich wieder hin.“Stöhnend rappelte sich Jean-François auf, stellte den Stuhl an seinen Platz und setzte sich. Während er ein Taschentuch aus seiner Jacke zog und sich zitternd das Blut abwischte, das ihm aus der Nase lief, musterte ihn der Offizier nachdenklich. „Herr Mutzig, ich habe den Eindruck, dass Sie Bedenkzeit brauchen. Zu diesem Zweck werden Sie ein paar Tage unser Gast bleiben. Wir werden Ihnen in unserem speziellen Gästehaus ein Zimmer mit Vollpension zur Verfügung stellen. Allerdings müssen wir darauf bestehen, dass Sie uns zu regelmäßigen Gesprächen zur Verfügung stehen. Die Beamten dort interessieren sich vor allem für Ihre Unterstützung jüdischer Auswanderer. Verbindungsleute, Fluchtwege und so weiter, Sie wissen schon.“ Der Offizier stand auf und suchte Jean-François‘ Blick. „Damit wir uns richtig verstehen. Wenn wir uns nicht einig werden, wird Ihre Mutter zuerst ihre Arbeit verlieren. Im Deutschen Reich ist es nicht üblich, dass arische Kinder von Mischlingen ersten Grades unterrichtet werden. Als Nächstes wird sie eine kostenlose Fahrkarte von uns bekommen. Sie haben doch von Schirmeck oder Dachau gehört?“ Die Türklinke in der Hand warf er einen letzten Blick auf seinen Gefangenen. „Ach ja, einen schönen Gruß vom Herrn Papa soll ich bestellen. Hätte ich doch beinahe vergessen.“ Da war sie, die Erklärung. Sein Vater hatte also doch noch eine Möglichkeit gefunden, den eigenen Sohn auf den rechten nationalsozialistischen Weg zu bringen. Jahre vor der deutschen Annektierung hatte er, der nationalsozialistischen Idee folgend, die Ehe mit seiner Frau gelöst und war in die Pfalz gezogen. Jean-François erinnerte sich mit Wut und Ekel an die plumpen Versuche seines Vaters, ihn von der hehren Reinheit einer nationalsozialistischen Zukunft der Welt zu überzeugen. Für einen Moment ließ ihn der aufschießende Hass die Hoffnungslosigkeit seiner Situation vergessen. Nach einer gefühlten Ewigkeit schwang die Tür auf. Zwei uniformierte SS-Leute kamen in den Raum und fesselten ihm die Hände auf den Rücken. Sie nahmen ihn in die Mitte und führten ihn durch das Haus zu einem Wagen auf dem Hof, der ihn aus der Stadt hinaus aufs Land brachte. Die Verhöre folgten einem einfallslos geschriebenen Drehbuch. Zwei Uniformierte stellten ihm abwechselnd immer wieder die gleichen Fragen. Für welche jüdische Organisation er arbeite, welchen Juden er Kontakte vermittelt und welche Kontaktadressen er benutzt habe. Es gipfelte immer in der Drohung, wenn er nicht endlich mit Namen und Adressen herausrücke, würden sie seine Mutter noch am gleichen Tag in den Zug nach Dachau setzen. Während der stundenlangen Befragungen wurde er beschimpft, beleidigt und gedemütigt und immer wieder mit Schlägen auf Füße, Schienbeine und Knie gequält. Er schrie und jammerte vor Schmerzen und Verzweiflung. Manchmal nannte er irgendwelche Fantasieadressen, die niemanden zu interessieren schienen. Die Zeitpunkte der Verhöre waren willkürlich. Manchmal holten sie ihn mehrmals in der Stunde, dann ließen sie ihn einen halben Tag in Ruhe. Eine dieser längeren Pausen endete mit der Aufforderung des eintretenden SS-Unteroffiziers, er möge sich zusammenreißen und mitkommen. Sie stellten ihn unter eine heiße Dusche und ließen ihm Zeit, sich die vergangenen Tage von der Haut zu schrubben. In der Umkleidekabine fand er seine zuletzt getragenen Kleider, frisch gereinigt über einem Stuhl hängen. „Sie sehen etwas mitgenommen aus, Herr Mutzig.“ Wieder fiel Jean-François das Fehlen jeglichen Spotts oder Häme auf. Nachdem man ihn nach Straßburg zurückgebracht hatte, saß er in einem großen Büro vor einem massiven Schreibtisch aus Eiche. „Meinen ersten Urlaub auf dem Land hatte ich mir anders vorgestellt. Das Programm war doch etwas eintönig.“ Eine innere Stimme sagte ihm, dass es hier nicht ums Buckeln ging. „Sie haben sich Ihren Humor erhalten, Herr Mutzig. Respekt. Das erlebt man in meinem Beruf eher selten. Entschuldigen Sie, dass ich vergaß, mich bei unserem ersten Treffen vorzustellen: SS-Sturmbannführer Friedrich Scheel.“ Er erhob sich und begann, wie bei ihrem ersten Zusammentreffen im Zimmer auf und ab zu gehen. „Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber ich gehe davon aus, dass man das Ergebnis der Bedenkzeit, die wir Ihnen verordnet haben, mit einer gewissen Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit uns beschreiben kann. Wir wissen um die Grenzen menschlicher Leidensfähigkeit und erwarten nicht von Ihnen, dass Sie es mit Freude tun.“ Er machte sich an einem Schrankfach zu schaffen und kam mit einer Flasche französischem Cognac und zwei Gläsern zurück. „Natürlich werde ich für Sie arbeiten.“ Jean-François sagte es ein wenig zu schnell und zu laut, was Scheel aber nicht zu stören schien. „Mir ist nur noch nicht ganz klar, worin diese Arbeit bestehen soll und was genau Sie von mir erwarten.“ „Das werde ich Ihnen genauestens erklären, es besteht überhaupt kein Grund zur Eile. Sie trinken doch einen Cognac.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, stellte er ein großes, bauchiges Glas vor Jean-François, das andere schob er zur Mitte des Schreibtisches und schenkte großzügig in beide Gläser ein. Nachdem er wieder Platz genommen hatte, griff er zur Zigarrenkiste und wählte mit großer Sorgfalt eine Zigarre aus. „Ich nehme nicht an, dass Sie sich in der letzten Woche das Rauchen angewöhnt haben, oder liege ich da falsch.“ Kurz zog er die Augenbrauen nach oben. „Pardon. Das war jetzt wohl etwas unsensibel.“ Er kappte das Mundstück mit einem silbernen Zigarrenschneider und brannte die Zigarre genüsslich paffend an. „Kommen wir zum Geschäftlichen. Wir haben für Sie in der Nähe des Karl-Roos-Platzes, dem ehemaligen Place Kleber, eine kleine Wohnung angemietet. Mitten in der Altstadt, nicht weit von der Universität und ihren jüdischen Kontakten. Vor ein paar Tagen haben elsässisch-deutsche Patrioten die große Synagoge niedergebrannt, also können wir davon ausgehen, dass der Hilfebedarf schnell wachsen wird. Zu unserer Vereinbarung gehört, dass Sie jeglichen Kontakt zu Ihren kirchlichen Freunden aufgeben, insbesondere den Schwarzkitteln. Ihrem väterlichen Freund Pater Bruno haben wir die Nachricht zukommen lassen, dass Sie Straßburg wegen Ihrer schwer erkrankten Mutter verlassen mussten. Bei der landwirtschaftlichen Kreditkasse Elsass-Vogesen haben wir Ihnen ein Konto eingerichtet, auf das jeden Monat ein Betrag überwiesen wird, der Sie nicht reich macht, aber Ihre bisherigen finanziellen Möglichkeiten deutlich erweitert. Offiziell arbeiten Sie für die Verwaltung der Stadt Straßburg als freischaffender Übersetzer, also müssen Sie dort nicht täglich Ihre Stunden absitzen, um glaubwürdig zu bleiben. Wenn im nächsten Jahr die Reichsuniversität eröffnet wird, würden wir es begrüßen, wenn Sie wieder studieren.“ Er schob Jean-François eine dünne, schwarze Aktentasche über den Tisch. „Hier ist alles drin, was Sie brauchen: Mietvertrag, Kontonummer und so weiter.“ Dann schwenkte er den Cognac mit leichten Kreisbewegungen und erhob das Glas in Richtung seines Gesprächspartners. „Das wäre es fürs Erste. Auf eine gute Zusammenarbeit, Herr Mutzig!“
2
2. September 1982„Das darf doch alles nicht wahr sein Marx. Der Kerl führt uns doch an der Nase herum.“„Wir wissen noch nicht, ob es ein Mann ist, Herr Hauptkommissar.“Kriminalhauptkommissar Beck mustert seinen Oberkommissar mit kaum verhohlenem Ärger. Ohne handfeste Gründe dafür nennen zu können, mag er seinen engsten Mitarbeiter nicht. Es bleibt für ihn ein fortwährendes Rätsel, wieso er dennoch nie ernsthaft versucht hat, einen anderen Kollegen zugewiesen zu bekommen. Marx muss über verborgene Qualitäten verfügen, die ihn auf geheimnisvolle Weise wertvoll machen, anders kann er sich das nicht erklären. Vielleicht imponiert ihm der Mut eines Mannes, der sich ohne Not mit einem fliederfarbenen T-Shirt unter einem an den Schultern obszön ausgepolsterten, pastell-rosafarbenen Sakko in der Öffentlichkeit zeigt. Während er sich abwendet und die wenigen Schritte von Marx’ Schreibtisch zu dem offenstehenden Fenster geht, spricht er weiter.„Dieser Mensch ist dermaßen dilettantisch vorgegangen, dass es einfach Hinweise geben muss! Allein die Waffe? Ich gehe jede Wette ein, dass es eine Schreckschusspistole ist, mehr nicht. Oder eine Spielzeugpistole, für Karneval oder so. Wahrscheinlich hat er die im gleichen Geschäft gekauft wie die J.-R.-Ewing-Maske. Haben Sie sich das mal angeschaut? Dallas meine ich?“ Er winkt ab. „Egal. Mit zweifelndem Gesichtsausdruck schaut Oberkommissar Karl-Heinz Marx seinem Vorgesetzten hinterher. Am Fenster angekommen, lehnt sich Beck mit dem Gesäß gegen die Fensterbank. „Und ich biete noch eine weitere Wette an.“ „Ja, Herr Hauptkommissar?“ Mit missbilligender Miene mustert Beck die weißen Lederslipper, in denen die nackten Füße seines Untergebenen stecken. Er ertappt sich bei der Überlegung, ob Marx möglicherweise wöchentlich zum Friseur geht, anders ist der zu jedem Zeitpunkt einwandfreie Haarschnitt nicht zu erklären. „Wenn wir ihn diese Woche nicht kriegen, und danach sieht es ja im Moment aus, ist nächste Woche eine weitere Filiale dran.“ „Wir haben nichts, Herr Hauptkommissar. Allein in Ludwigshafen gibt es Dutzende Geschäfte, bei denen man diese Masken kaufen kann. Von Mannheim ganz zu schweigen. Die Fahndung läuft seit Tagen auf Hochtouren. Alles, was auch nur annähernd als Zeuge beschrieben werden kann, ist mehrfach vernommen worden. Nicht ein einziger Hinweis, der uns weiterhilft. Ich bin die kompletten letzten beiden Jahre nach ähnlichen Fällen in Ludwigshafen und Mannheim durchgegangen. Kein einziger Treffer.“ Mit einer müden Handbewegung deutet er auf die Aktenstapel, die seinen Schreibtisch zur Hälfte bedecken. „Die Telefonanrufe kommen von den üblichen Wichtigtuern, Verrückten und Einsamen. Zumindest bis jetzt. Heute Morgen habe ich noch einmal mit den Kollegen vom Rauschgift telefoniert. Nichts. Es ist wie verhext.“„Was erwarten Sie Marx. Dass jemand anruft, uns einen Namen nennt, möglichst mit Adresse. Hier ist gute alte Polizeiarbeit gefragt, Marx. Manchmal ist es wie Waldfegen. Also schnappen Sie sich verdammt noch mal zwei Uniformierte und telefonieren Sie alle Geschäfte ab!“ Ungewollt wird Beck laut. Es ist immer dasselbe. Überlässt er Marx oder anderen die Verantwortung für einen Fall, hängt ihm der Staatsanwalt im Nacken, warum es nicht vorwärtsgeht. Hält er alles auf seinem Schreibtisch, wird ihm vorgeworfen, er könne nicht delegieren, oder schlimmer noch, er traue seinen eigenen Leuten nichts zu.„Wie bitte? Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Herr Hauptkommissar.“ „Was ja nicht gerade das erste …“ Einen Augenblick zu spät unterbricht das Klingeln des Telefons die abschätzige Bemerkung. Beck meint, ein ärgerliches Blitzen in den Augen von Marx zu erkennen, bevor sich dieser von ihm abwendet und zum Hörer greift.„Kriminaloberkommissar Marx, Kommissariat zur Bearbeitung von Kapitaldelikten, was gibts?“Beck sieht, wie Marx’ Gesichtszüge einen ernsten Ausdruck annehmen. „Was ist los Marx?“ Völlig entgegen seiner Laune flüstert er. „Irgendetwas Neues von unserem Bankräuber?“ Beschwichtigend hebt Marx die freie Hand. Während er weiter konzentriert zuhört, macht er sich Notizen. „Ja! In Ordnung! Ja! ... Ja! ... Ich weiß, wo das ist. … Ja! … Wir kommen.“Schnell ist Beck beim Schreibtisch seines Oberkommissars. „Jetzt erzählen Sie schon, oder muss ich erst einen schriftlichen Antrag bei Ihnen stellen.“ Kein Flüstern mehr. Marx legt den Hörer auf und schaut auf seinen Block. „Wir haben eine Leiche.“„Wo, Mann? Lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen.“„Hinter St. Martin, unterhalb der Kalmit. Ein junger Mann ohne Gesicht.“ „Wie, ohne Gesicht?“ „Der Tote ist ziemlich übel zugerichtet. Der Hund eines Wanderers hat ihn beim Stöbern am Grund einer Bergfalte zwischen zwei Hängen, einer Art Trockental, gefunden.“ Ohne ein weiteres Wort eilt Beck über den Flur in sein eigenes Büro. Er hat den Hörer schon in der Hand, als er durch die offene Tür ruft: „Marx! Sagen Sie Senta Bescheid! Sie soll sich mit den Kollegen vor Ort in Verbindung setzen und die Kalmit dichtmachen! Es gibt da nur drei Straßen zum Gipfel! Die Kalmithöhenstraße ist, glaube ich, sowieso noch gesperrt. Und sagen sie Dr. Stein Bescheid.“ Ohne auf Marx‘ Reaktion zu warten, wählt er die beiden Ziffern des Erkennungsdienstes. Auf seiner Armbanduhr ist es kurz vor elf.„Hans, bist du das? Wir brauchen dich und deine Fährtenleser. Pack deinen Koffer und sammle deine Truppe, wir müssen nach Sankt Martin zum Felsenmeer! Wir treffen uns in zehn Minuten unten bei meinem Wagen.“Marx steht in der Tür und wartet auf Beck. Der schnappt sich sein Sakko, dann sind sie auf dem Flur. Eine knappe Stunde später rasen sie die holprige, in engen, unübersichtlichen Kurven zum Kalmitgipfel führende Totenkopfstraße hinauf. Wie in den Felsen eingefräst folgt die Fahrbahn auch der kleinsten Faltung der dicht mit Kiefern, Esskastanien, Eichen und Buchen bewachsenen Bergflanke. Links von ihnen begrenzt der steil aufsteigende Hang, unterbrochen durch längere Strecken meterhoher Sandsteinfelsen, die Gegenfahrbahn und verstellt in Linkskurven den Blick auf den Gegenverkehr. Rechts fällt der Hang steil ab. Zweimal erzwingen Motorradfahrer, die in sportlicher Schräglage aus einer engen Kurve auftauchen, waghalsige Ausweichmanöver. Fast verpassen sie die Abzweigung, die in spitzem Winkel vom Gipfel auf die Totenkopfstraße trifft.Als sie auf den großen Wanderparkplatz unterhalb des Gipfels rollen, sieht Beck einen Mannschaftswagen mit offenen Türen, daneben zwei Streifenwagen. Seine Laune hebt sich ein wenig, als er die kleine, schwarz gekleidete Gestalt mit den regenbogenfarbenen Haaren wahrnimmt, die rauchend an einer lehmverschmierten Enduro lehnt. Marx stellt den Passat neben dem Bulli ab. Schnell kommt die zierliche Frau zur Beifahrerseite und wartet ungeduldig, bis Beck aussteigt. Als er steht, überragt er seine Mitarbeiterin um einen Kopf.„Hallo Senta.“„Wir müssen ein Stück gehen, Chef. Der Doc ist schon vorgegangen.“ Die junge Kommissarin nickt Marx kurz zu. „Hallo Charlie!“ Marx grüßt freudlos zurück. „Ich habe die Straßen, die hier hochführen und alle Wanderwege im Umkreis von einem guten Kilometer um den Fundort abgeriegelt. Haben Sie ja gesehen, hinter Sankt Martin. Niemand kommt ungesehen auf den Berg oder runter, außer er schlägt sich quer durch den Wald.“Beck grinst sie mit großen Augen skeptisch an. „Du hast im Umkreis von einem Kilometer das Gelände abgeriegelt? Mitten im Wald? Innerhalb einer knappen halben Stunde?“ „Eigentlich war es ja fast eine Stunde. Ich kenne einen jungen Kollegen aus Neustadt. Gerade letztes Wochenende haben wir uns bei einem Punkkonzert in Frankfurt getroffen. Den hab ich angerufen. Der hat mit seinem Chef geredet, der wiederum mit seinem Kollegen in Landau und schon waren fünfzehn Mann unterwegs. Im Unterschied zu uns sind die hier ganz gut besetzt. So what! Hatte einfach Glück.“„Warum heißt so jemand wie du eigentlich Senta?“ Die beiden Augenbrauen-Piercings unter den bunten Haaren bewegen sich sorgenvoll aufeinander zu. „Hey Chef! Was ist los?“„Nichts. Nichts. Gute Arbeit! Hast du echt gut gemacht.“ Er schaut sich um. Unter der kritischen Beobachtung ihres Chefs, Hans Gauweiler, hieven die beiden jungen Kollegen vom Erkennungsdienst gerade ihre Alukoffer von der Ladefläche des Kombi. Ein Blick auf seine Uhr sagt ihm, dass es kurz vor zwölf ist. „Marx, Sie bleiben hier und reden mit dem Rentner, der die Leiche entdeckt hat. Und vielleicht hat ja noch jemand aus dem Wandervolk etwas bemerkt.“ Er sucht Sentas Regenbogenhaare.„Sitzt oben vor der Kalmithütte, Chef. Mit noch ein paar anderen Wandergesellen. Ein Kollege ist bei ihm.“„Sie haben es gehört Marx. Sie koordinieren die Absperrungen. Wenn jemand was will, sind Sie der Ansprechpartner.“ Während er sich umdreht, nimmt er verdutzt wahr, dass sein Oberkommissar auf einmal feste Wanderschuhe an den Füßen hat. „Hans, seid ihr soweit? Dann lass uns runtergehen.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, geht er zwischen den beiden Bullis hindurch zum Rande des Parkplatzes. Vor einem Uniformierten, der den Zugang zu dem mit rot-weißem Flatterband abgesperrten Wanderweg sichert, bleibt er stehen und wartet auf die anderen.Die Gruppe steigt unter Sentas Führung in einen schmalen Pfad ein, der eine ganze Weile mit sanftem Gefälle durch hohen Mischwald mit Esskastanien, Eichen und Kiefern führt. Der Wald ist offen, außer Heidelbeersträuchern und vereinzelten Büschen gibt es kaum Unterholz. Durch kleine Lücken in den Baumwipfeln dringen Sonnenstrahlen und überziehen den Waldboden mit kleinen, goldenen Lichtpfützen.Nach einer knappen halben Stunde tauchen rechts über ihnen Sandsteinfelsen auf, die immer mächtiger werden. Oben auf dem Bergkamm türmen sich auf der Länge von einigen Hundert Metern beeindruckende Felsenkolosse. Beck hat die kleine Wanderung durch das Felsenmeer schon oft gemacht. Meist allein, um seine Gedanken zu ordnen. Der Pfad steigt wieder leicht an. Der würzige Duft von Kiefernharz und von der Sonne aufgeheiztem hellen Sand erinnert ihn an Waldabenteuer seiner Kindheit.Sentas Stimme holt ihn in die Gegenwart zurück. „Da vorne ist es Chef.“ Der linke Rand des Pfades ist über etwa zwanzig Meter mit einem rot-weißen Flatterband gesichert, hinter dem es steil nach unten geht. Rechts ragt fast senkrecht eine beeindruckende Felswand in die Höhe, an der hoch oben Spalte und Durchlässe zu erkennen sind. Senta deutet nach unten. „Wir müssen da runter. Ist echt ätzend.“Während sich die Kriminaltechniker ihre Schutzkleidung überziehen, schaut sich Beck nach Hinweisen um, die mit der Leiche in Zusammenhang stehen könnten. In dem gleichmäßigen Grün und Braun, das nach unten hin immer dusterer wird, kann er nur schwer so etwas wie einen Grund erkennen. Der gegenüberliegende Hang ist vielleicht fünfzig Meter entfernt, schätzt er. Nach unten zwanzig oder mehr. „Hans. Ihr geht vor, bevor ich mir wieder euer Gejammer anhören muss. Und vielleicht sollte auch jemand dort hinauf.“ Er deutet zu einer großen Felsspalte hoch über ihnen. „Nicht unwahrscheinlich, dass die Leiche von dort oben gekommen ist.“Augenrollend schickt Gauweiler seinen jungen Kollegen Wurster, den Beck als etwas überengagiert in Erinnerung hat, zum Felsenkamm hoch und macht sich mit Müller an den steilen Abstieg. Das wadenhohe, dicht verwachsene Heidelbeergestrüpp bringt die Männer immer wieder ins Straucheln. Derbe Flüche sind zu hören.Beck schickt Senta hinter Wurster her zum Kamm hoch. Dann folgt er den Technikern nach unten. Kaum hat er den ersten Schritt gemacht, hört er ein ärgerliches Zischen von Gauweiler, der sich einige Meter unter ihm von Stamm zu Stamm hangelt. Er solle verdammt noch mal ein paar Meter weiter links in ihrer Spur bleiben. Ob das denn so schwer sei.Je weiter sie nach unten kommen, umso intensiver riecht es nach verrottendem Laub und Pilzen. Schon auf halber Höhe kann er die schmale Gestalt von Dr. Stein sehen. Kaum sind sie unten angelangt, packt der Rechtsmediziner seine Tasche und richtet sich auf. „Was können Sie mir sagen, Doktor?“ Beck will dem Rechtsmediziner entgegengehen, wird aber von Gauweiler gestoppt.„Helm, du bleibst da stehen, bis ich dir Bescheid gebe. Du kennst das doch.“ Er nickt dem Mediziner zu. „Hallo Dr. Stein.Nachdem sich Beck kurz orientiert hat, erkennt er wenige Schritte vor sich ein Bündel pechschwarzer Haare im niedrigen Heidelbeergestrüpp, darunter rotes Fleisch. Gänsehaut kriecht ihm über Nacken und Arme. Der Gerichtsmediziner sieht Becks Blick und nickt. „Hallo Beck. Zwei Schüsse in den Oberkörper, einer davon tödlich. Junger Mann, keine dreißig. Ich schätze mal, er liegt da seit gestern Nachmittag. Zu den Verstümmelungen, die Sie gleich sehen werden, ist nicht viel zu sagen. Die erklären sich von selbst. Alles Weitere dann morgen früh irgendwann. Ich melde mich.“„Danke Doktor.“ Beck und Stein kennen sich schon einige Jahre und er weiß, dass er jetzt nicht mehr erfahren wird.Während sich Stein an dem Stamm einer jungen Esskastanie den ersten Meter des Hangs hochzieht, wendet sich Beck wieder Gauweiler zu, der dabei ist, die Leiche und deren nähere Umgebung aus Dutzenden verschiedener Perspektiven zu fotografieren. Es dauert eine Weile, bis er sich auf Nahaufnahmen der Verletzungen und der Position von Armen und Beinen konzentriert. Bevor er mit der Untersuchung der Leiche beginnt, macht er Aufnahmen von dem Hang, über den der Tote mutmaßlich nach unten geschafft worden war. Hier in der Natur kommt Beck die aufdringliche Helligkeit der Blitzlichter unanständig vor. Während der Kriminaltechniker fotografiert, sucht Müller akribisch die nähere Umgebung ab. Beck weiß, dass das noch eine ganze Weile dauern kann. Er schaut seinen Kollegen zu und versucht zu erfassen, was das hier bedeuten könnte.„Wolltest du nicht mal mit zum Training kommen, Helm?“Beck schreckt aus seinen Gedanken hoch. Irritiert schaut er auf den breiten Rücken Gauweilers. „Was? Was redest du da?“ „Nach Mutterstadt. Du wolltest doch immer mal mit zum Krafttraining.“Verständnislos schüttelt Beck den Kopf. Vorsichtig befreien die beiden Erkennungsdienstler den Toten von Kieferzweigen und altem Laub. Entweder hat der Mörder nur sehr wenig Zeit gehabt, oder er hat ganz auf den Schutz der Enge und Tiefe dieser Bergfalte vertraut, denkt er. Er ärgert sich ein wenig, dass er direkt mit nach unten gekommen ist und nun tatenlos hier rumstehen muss. Vorsichtig will er einen Schritt zur Leiche machen. Ein scharfer Blick des Kriminaltechnikers, der konzentriert ein für Außenstehende nicht erkennbares Programm abarbeitet, lässt ihn innehalten. Entschuldigend hebt er die Hände. Sieht man von dem vielen Blut und dem völlig zerstörten Gesicht ab, liegt der Tote friedlich auf dem Rücken. Mit nacktem Oberkörper und bloßen Füßen, die Beine parallel beieinander, die Hände über dem blutigen Schritt gefaltet, wie zur Totenwache aufgebahrt. Langsam umrundet Gauweiler die Leiche, dabei bleibt er immer wieder in konzentrierter Beobachtung vertieft stehen. Ruhig erklärt er seinem Assistenten, der sorgfältig jeden Kommentar und jede Bemerkung notiert, was er sieht. Dann geht er unter geräuschvollem Schnaufen auf der linken Seite des Toten vorsichtig in die Hocke.„Ein junger Mann. In den Zwanzigern schätze ich. War bis vor Kurzem noch bei guter Gesundheit und guter Kondition. Hat wohl regelmäßig Sport getrieben. Siehst du die seltsamen Zeichen auf seiner Brust? Sieht aus wie mit einem scharfen Messer eingeschnitten. Irgendetwas Arabisches, könnte auch hebräisch sein. Post mortem zugefügt.“„Wie lange ist er schon tot?“Gauweiler sieht kurz zu Beck und deutet auf die fehlenden Fingerkuppen an beiden Händen. „Schau dir mal die Finger an, Helm. Da will uns jemand die Arbeit schwer machen.“ Gauweiler ist jetzt bei der roten Masse, die bis vor Kurzem das Gesicht eines jungen Mannes gewesen war.„Der Täter hat einen großen Stein und ein scharfes Messer mit starker Klinge benutzt. Sämtliche Zähne sind ausgebrochen, die Stirnbeinknochen über den Augen sowie Kinn- und Jochbeinknochen sind zertrümmert. Die Nase wurde mit einem scharfen Messer abgetrennt. Auch wenn das alles sehr nach Wut und Raserei aussieht, hat der Täter meiner Meinung nach sehr zielstrebig gehandelt.“ Gauweiler tastet mit einem Stäbchen aus seinem Koffer vorsichtig in dem blutigen Loch herum, das einmal der Mund gewesen sein musste. „Heiliger Strohsack! Da meint man schon alles gesehen zu haben. Komm mal kurz her, Helm!“ Vorsichtig macht Beck zwei Schritte und schaut über Gauweilers Schulter in das zerstörte Gesicht des Mannes. „Scheiße Mann!“ Angeekelt schreckt er zurück. „Ist es das, was ich denke?“ Um nicht im Weg zu stehen, zieht er sich wieder auf seinen zugewiesenen Platz zurück.„Ja. Dem armen Kerl hat man seinen Penis abgeschnitten und in den Mund gestopft. Da war er aber schon tot.“„Was ist das denn für eine Scheiße!“, entfährt es Beck. „Russenmafia in der Pfalz. Das gibt‘s doch nicht.“„Wenn es dich beruhigt, die Schriftzeichen sind definitiv nicht kyrillisch. Müller, komm mal her. Die Hosen müssen runter.“ Zu zweit ziehen sie dem Toten die Hosen aus. Keine Unterhose, der Schritt voller Blut. Vorsichtig drehen sie den Körper auf die Seite. Gauweilers Augen bleiben bei der Rückseite der Leiche, die er akribisch und mit viel Zeit untersucht. Nachdem sie mit der gleichen Aufmerksamkeit auch die Vorderseite des Toten begutachtet und fotografiert haben, ziehen sie ihm die Hosen wieder über die Beine.„Gestorben ist er eindeutig an den beiden Schusswunden im Brustbereich, wie Stein schon sagte. Wahrscheinlich hat ihm gleich die erste Kugel den Herzmuskel zerfetzt. Erschossen wurde er irgendwo anders. Viel zu wenig Blut hier.“„Wie lange ist er tot?“, wiederholt Beck seine Frage.„Zwischen vierundzwanzig und sechsunddreißig Stunden. Ist aber nur eine Schätzung. Genaueres erfährst du nach der Obduktion.“ Gauweiler bringt seine hundert Kilo Muskelmasse in eine aufrechte Haltung und stellt sich neben Beck, der mit versteinertem Gesicht den toten Mann mustert. „Der kann dir keine Fragen mehr beantworten, Helm. Deine Leute sollten Ausschau nach den Zähnen halten. Die könnten uns weiterbringen. Ansonsten sind wir hier unten erst mal durch. Keine verwertbaren Spuren. Müller findet normalerweise sogar die berühmte Nadel im Heuhaufen. Das Laub ist nach diesem Wahnsinnssommer trocken wie Papier. Es reicht schon das kleinste Lüftchen, um alles aufzuwirbeln. Die heftigen Böen gestern Abend, bei denen wir alle auf das lange ersehnte Gewitter gehofft haben, haben wahrscheinlich alle Spuren verwischt. Wir schauen uns oben noch genauer um. Von irgendwo her muss er ja gekommen sein.“Beck nickt kurz, macht zwei behutsame Schritte und steht neben dem Toten. Hinter sich hört er den schweren Atem von Gauweiler, der sich leise fluchend hinter Müller den Hang hinaufarbeitet. Er sieht das zertrümmerte Gesicht, die gefalteten blutigen Hände über dem Schritt, die nackten Füße. Fehlen nur noch die Wundmale auf den Fußrücken, denkt er. Das ist ihm alles zu schlicht. Will ihn da jemand mit billigen Tricks in die falsche Richtung locken? Er spürt eine leichte Kränkung. Wieder auf dem Wanderpfad angekommen, beobachtet Beck einen Moment Gauweiler und Müller dabei, wie sie konzentriert jeden Baum und jeden Strauch nach Spuren absuchen. Becks Blick wandert über die Felsen nach oben. Fünfzehn, zwanzig Meter hoch, schätzt er. Inzwischen ist es fast drei Uhr, und die Sonne lässt einige der höchsten Stellen des Sandsteins rot aufleuchten. „Hallo! Hier rauf, Chef!“Oben aus dem breiten Spalt, sieht er einen zierlichen Arm mit einer schwarzen Lederjacke winken.„Hier rauf, Chef! Und am besten bringen Sie den obersten Spurensicherer gleich mit.“„Madam wird sich noch etwas gedulden müssen.“ Gauweiler hat das Rufen mitbekommen. „Und bleibt verdammt noch mal von den Spuren weg. Haltet euch einfach an die Anweisungen von Wurster, bis ich nach oben komme.“ Sofort verschwinden Arm und Lederjacke. Beck wirft Gauweiler einen scharfen Blick zu, der ist aber schon wieder mit den Bäumen und dem Heidelbeergestrüpp beschäftigt. In Gedanken bei dem toten jungen Mann macht er sich zügig Richtung Hütte auf den Weg, um von dort die Abzweigung zum Felsenkamm zu nehmen. An der Schutzhütte schreckt er einen jungen Uniformierten hoch, der hastig seine Zigarette austritt und Beck ungefragt den Weg hinauf zum Kamm weist. Im Vorbeieilen schenkt er dem Polizisten ein kurzes Nicken. Zufrieden nimmt er wahr, dass alle Wanderwege, die auf die Hütte treffen, gesperrt sind. Schnell steigt er ein kurzes, steiles Stück des immer felsiger werdenden Pfades hoch. Die Brocken werden jetzt deutlich größer. Dann verschwindet der Wanderweg zwischen meterhohen Felsblöcken und schlängelt sich weiter durch immer höher aufragende Sandsteinkolosse. Die Felsen rücken mehr und mehr zusammen, bis der Pfad gerade mal Schulterbreite hat. Urplötzlich steht Senta vor ihm. Erschrocken machte er einen kurzen Schritt nach hinten und stößt sich den Kopf an der Kante eines Felsens.„Musst du mich so erschrecken?“ „Sorry Chef. Ich wollte Ihnen bloß mal demonstrieren, wie leicht man hier jemanden überraschen kann.“„Ist dir sehr überzeugend gelungen.“ Mit schmerzverzerrtem Gesicht reibt sich Beck den Hinterkopf.Fast einen halben Meter über Sentas Kopf taucht das Gesicht eines ihm bekannten jungen Mannes mit tiefschwarzem, schulterlangem Haar und kurz gehaltenem Vollbart auf. „Hier ist es passiert, Herr Hauptkommissar. Ich kann es Ihnen zeigen.“„Was genau ist hier passiert, Kollege?“ Wie war gleich noch der Name von Gauweilers zweitem Mann?„Na ja, ich war nicht dabei, Herr Hauptkommissar.“ Ein Anflug von Ärger trübt Becks Gesicht.„Das ist Wurster vom ED. Er hat Spuren gefunden und eine Theorie dazu. Kommen Sie. Schauen Sie selbst.“ Senta steigt ein paar Felsvorsprünge hoch, damit Beck an ihr vorbeikommt und Wurster folgen kann.Das wird Gauweiler überhaupt nicht gefallen, denkt Beck, während er vorsichtig den Kopf in die Richtung dreht, in der er Senta vermutet. „Kannst du schnell mal nach unten und Gauweiler informieren. Entscheidende Geheimnisse löst er lieber selbst.“Er folgt Wurster zwei enge Windungen weiter, dann treten die Felsen auf vielleicht drei Metern so weit auseinander, dass sich ein kleiner Raum bildet, in dem zwei Menschen bequem nebeneinanderstehen können. Der Kriminaltechniker steht vor einer übermannshohen Felsspalte, die ins Leere geht.„Es war eine Sache von Minuten. Kein Kampf. Der Täter hat dem Opfer hier aufgelauert, hat zweimal geschossen und den Leichnam hier hinuntergestoßen.“ Als Beck nicht reagiert, redet er weiter. „Wenn Sie mich fragen, war das alles nicht geplant. Die Hektik der Aktion und die riskante Beseitigung der Leiche deuten eher auf eine spontane Tat hin. Und wer sucht sich schon einen beliebten Wanderweg für einen Mord aus?“ Becks suchender Blick bestärkt Wurster darin, seine Theorie weiter auszuführen. „Der Täter hat die Leiche unten in dem Trockental versteckt, ist wieder hochgestiegen, hat das Blut so gut es geht aufgewischt und die Stelle mit Blättern und Kiefernadeln bedeckt.“ Jetzt erst erkennt Beck eine von Laub verdeckte dunkle Stelle auf dem Felsboden. Als er aufsieht, schaut Wurster erwartungsvoll zu ihm herüber.„Sie haben doch noch was, Wurster. Oder? Raus damit.“ „Ein paar Meter weiter habe ich Fußspuren gefunden. Ich habe alles fotografiert, keine Angst.“ Wurster zeigt demonstrativ seine Kamera und tritt einen großen Schritt von der Felskante zurück. „Es sind Profilabdrücke von Springerstiefeln, die unterscheiden sich deutlich von den Mustern, die Wanderstiefel hinterlassen.“„Sie haben Profilabdrücke auf diesen Felsen gefunden, Müller? Jetzt werden Sie mir aber unheimlich.“„Ich heiße Wurster, Herr Hauptkommissar. Müller ist unten beim Chef.“ „In Ordnung, Wurster. Also wie ist das jetzt mit den Profilabdrücken?“„Dort, wo der Pfad wieder enger wird“, Wurster weist auf die Stelle, an der der Weg zwischen den meterhohen Felsen verschwindet, „hat sich an verschiedenen Stellen eine ganz dünne Erdschicht auf dem Sandstein gebildet, wie kleine Pfützen. Kein vollständiger Abdruck, aber genug, um ein Profil zu erkennen.“Vorsichtig durchquert Wurster die Felsenkammer, wobei er Beck genau vorgibt, wohin der seine Füße setzen soll. Auf Wursters Weisung bleibt Beck an der Verengung stehen. Zwei Armlängen vor ihm zeigt Wurster auf den felsigen Boden. Tatsächlich ist der Fels neben Kiefernadeln und Laub auch mit ein wenig Erde bedeckt. Mehr kann er allerdings nicht erkennen. Schon gar keinen Schuhabdruck. Die Stelle ist nicht viel größer als seine Fischpfanne. Erst als Wurster, der jetzt auf seinen Hacken sitzt, die Umrisse der Spur mit einem Kugelschreiber eine Handbreit über dem Boden nachzeichnet, beginnt er zu sehen, wovon der Kriminaltechniker redet.„Gute Arbeit, Wurster. Aber jetzt sollten wir auf Ihren Chef warten. Der sieht es gar nicht so gerne, wenn andere vor ihm die Geheimnisse lüften.“
3
September 1944Sorgfältig zog er die schweren Vorhänge zu. Kein Licht sollte nach draußen dringen und verraten, dass das Zimmer bewohnt war. Zurück an dem kleinen Tisch, auf dem die Flasche Pinot Noir auf ihn wartete, schaltete er die Stehlampe an. Den Wein hatte er vor einer guten halben Stunde von einer Bauersfrau geschenkt bekommen. Es war jetzt über eine Woche her, seit er sich in dem kleinen, etwas versteckt gelegenen Gasthof in der Nähe des Col du Hantz einquartiert hatte. Während er die Flasche öffnete und Wein in ein Glas goss, kam ihm eine der Geschichten in den Sinn, die ihm die Bauersleute vor wenigen Stunden in der großen Wohnküche ihres Hauses am Ortsrand von La Petite-Fosse erzählt hatten. Bei einem Teller Suppe berichteten die alten Leute in einer Mischung aus Wut und Verzweiflung, wie zwei Wochen zuvor ein Gestapo-Kommando in den Laden des Weinhändlerehepaares Schmitt eingedrungen sei und beide unter der Anklage des Hochverrates verhaftet habe. Man habe ihnen vorgeworfen, sie hätten Wein an Maquis-Leute verkauft. Eine Woche nach der Verhaftung wurde von der Gestapo die Information lanciert, dass beide nach Dachau deportiert worden seien. Da hätte man sie auch gleich auf dem Dorfplatz aufhängen und zur Schau stellen können, meinte der Bauer. Etwas in ihm rebellierte. Es war das Geschäft der alten Leute, Wein zu verkaufen, und sie verkauften täglich Wein, seit über dreißig Jahren. Sie verkauften Wein an Bekannte genauso wie sie wildfremde Kunden berieten und belieferten. Woran erkannte man einen Maquis-Rebellen? Er spürte eine leichte Übelkeit in sich aufsteigen. Nachdem er einen weiteren Schluck Wein genommen hatte, löschte er das Licht. Mit dem gefüllten Glas in der Hand ging er die wenigen Schritte zum Fenster. Vorsichtig schob er eine Hälfte des Vorhangs beiseite und schaute in die mondhelle Nacht hinaus. Hier in den Bergen kam die Dunkelheit viel schneller als in der Rheinebene. Der Gasthof lag im Wald, etwas abseits von der Passstraße. Aus dem Haus waren keinerlei Geräusche zu hören. Wie jeden Abend waren die Wirtsleute früh zu Bett gegangen. Auch der Wald, der das Gasthofgelände umschloss, verbarg sich in tiefem Schweigen. Hin und wieder wehte ein Tierlaut aus dem Stallgebäude herüber. Nichts war zu spüren oder zu hören von dem Morden und Schlachten, das um ihn herum auf der ganzen Welt tobte. Trotz der Propaganda-Arbeit der Wochenschau und der Androhung von martialischen Strafen für die Weitergabe sogenannter „Feindpropaganda“ war das überraschend schnelle Vorrücken der feindlichen Truppen, die vor drei Monaten in der Normandie und vor gerade mal einem Monat bei Nizza gelandet waren, weitgehend bekannt. Es verging kein Tag, an dem er nicht an seine Mutter dachte, die er jetzt fast ein Jahr lang nicht gesehen hatte. Am liebsten würde er seine Robe mitsamt den letzten vier Jahren seines Lebens irgendwo im Wald vergraben und einfach zu ihr fahren. Kaysersberg war keine fünfzig Kilometer entfernt. Aber schon das laute Nachdenken darüber würde ihr Leben und damit auch das seine in höchste Gefahr bringen. Ein leises, vorsichtiges Klopfen an der Tür schreckte ihn aus seinen Grübeleien. Ohne zu überlegen, zog er den Vorhang zu.Schnell war er bei der Zimmertür und räusperte sich leise. „Wer ist da?“„Herr Pfarrer, sind Sie das?“ Das tiefe Flüstern des Mannes klang aufgeregt und ängstlich. „Wir brauchen Ihre Hilfe.“Er drehte den Schlüssel im Schloss und öffnete vorsichtig die Zimmertür. Im fahlen Licht, das durch ein Fenster in den Flur fiel, erkannte er einen der alten Bauern, mit denen er vor wenigen Stunden noch zusammengesessen hatte. Nach einem schnellen Blick die Treppe hinunter, forderte er den Mann auf einzutreten.Der alte Mann gehorchte ihm nur widerwillig. Nachdem die Tür wieder geschlossen war, schaltete er die Deckenlampe an. Beide Männer kniffen die Augen vor der plötzlichen Helligkeit zusammen. Als er ihm einen der beiden Stühle bei dem kleinen Tisch anbot, schüttelte der Alte heftig seinen großen Kopf.„Was ist denn passiert? So reden Sie doch, Mann!“Sein nächtlicher Besucher suchte händeringend nach Worten. „Sie müssen mir vertrauen, Herr Pfarrer. Jemand braucht die Hilfe eines Geistlichen. Sie müssen mitkommen.“ Der Alte sah ihn bittend an.Die klügste Reaktion wäre gewesen, sich wie die meisten Menschen in der Gegend hilflos hinter der großen Angst vor den Deutschen zu verstecken. Aber vielleicht war das jetzt die Chance, auf die er wartete. Um den Anschein zu wahren, musterte er einen langen Moment seine Schuhe. Dann gab er sich demonstrativ einen Ruck und blickte dem Alten fest in die Augen. „Warten Sie, ich nehme nur noch meinen Mantel.“





























