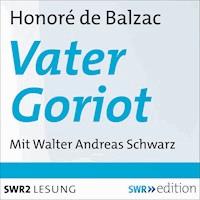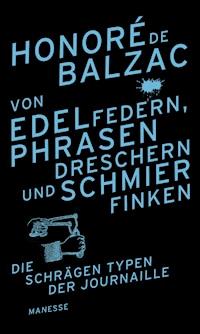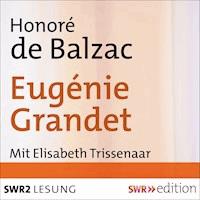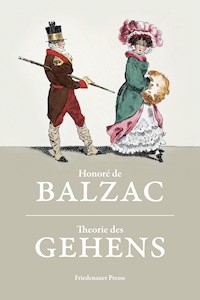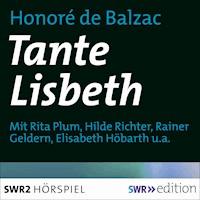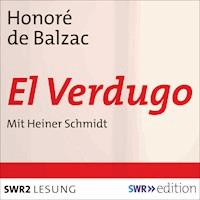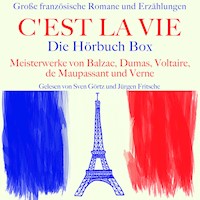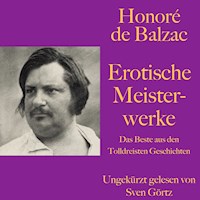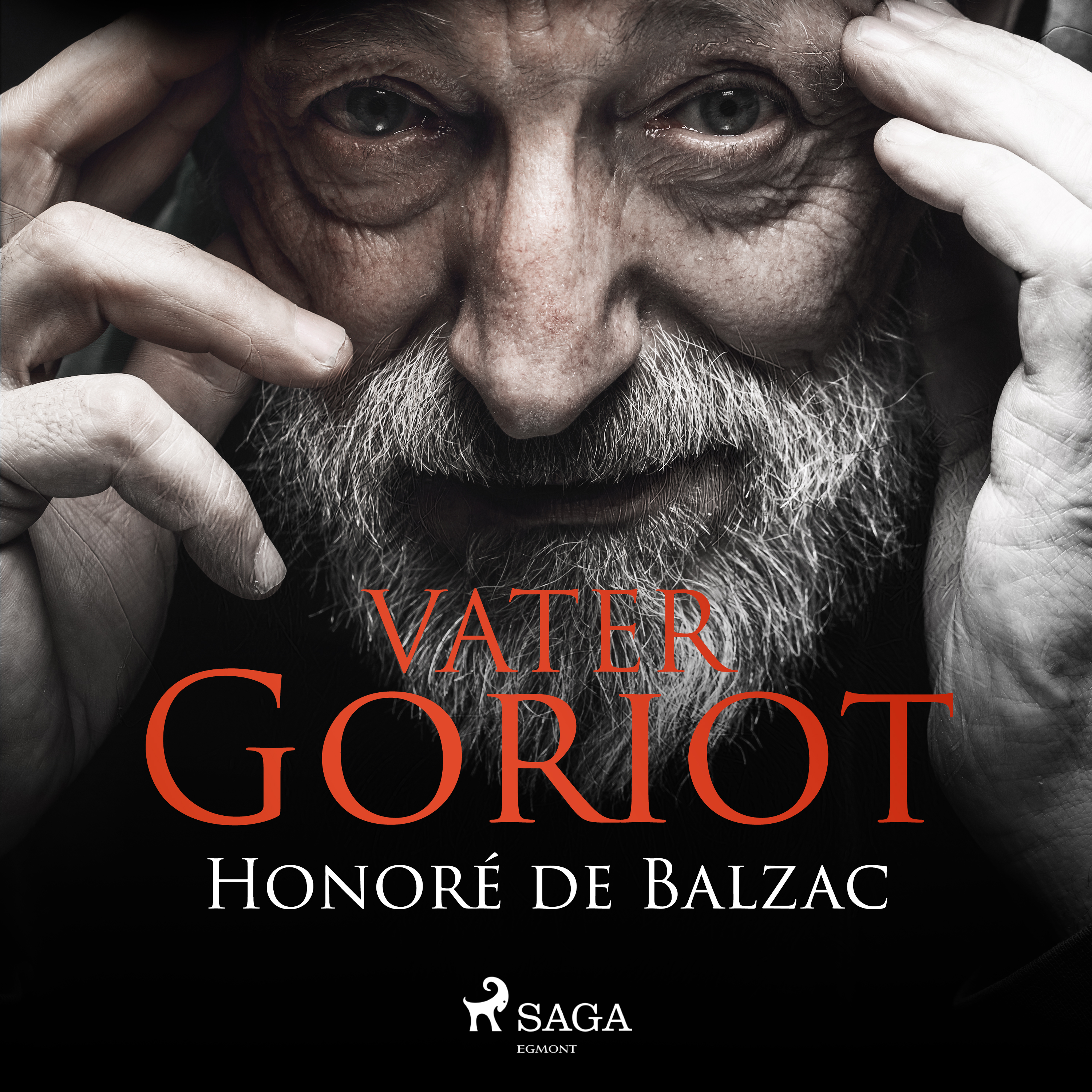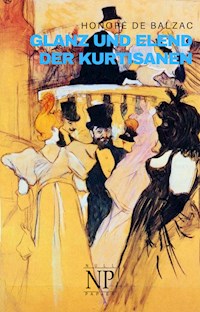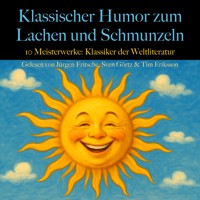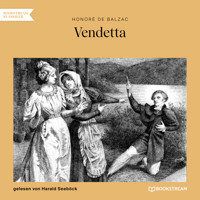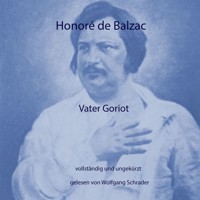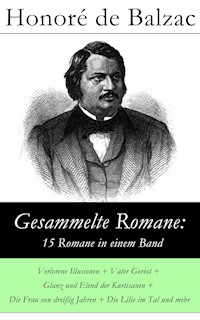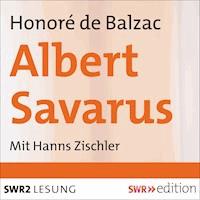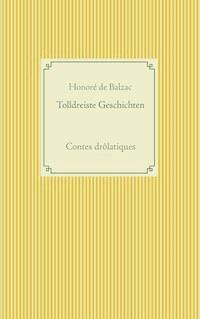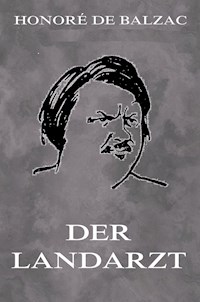
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Arzt Dr. Benassis flieht, nachdem er einen schwerwiegenden Fehler begangen hat, aus Paris aufs Land. Aber all sein Einsatz dort kann nicht sein Gewissen beruhigen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Landarzt
Honoré de Balzac
Inhalt:
Honoré de Balzac – Biografie und Bibliografie
Der Landarzt
I - Das Land und der Mensch
II - Quer durch Felder
III - Der Napoleon des Volkes
IV - Die Beichte des Landarztes
V - Elegien
Der Landarzt, Honoré de Balzac
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606046
www.jazzybee-verlag.de
Honoré de Balzac – Biografie und Bibliografie
Franz. Romandichter, geb. 20. Mai 1799 in Tours, gest. 18. Aug. 1850 in Paris, übernahm, da seine ersten Romane, die er unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte (30 Bde.), durchaus nicht beachtet wurden, eine Buchdruckerei, die er aber infolge schlechter Geschäfte bald wieder aufgeben mußte, kehrte dann zur Literatur zurück und schwang sich mit dem Roman »Le dernier Chouan, ou la Bretagne en 1800« (1829, 4 Bde.), den er unter seinem eignen Namen erscheinen ließ, mit einemmal zur Berühmtheit des Tages empor. Von nun an erschienen Schlag auf Schlag eine Unmasse von Romanen, in denen er die allmählich entstandene Idee, alle Seiten des menschlichen Lebens darzustellen, zu verwirklichen suchte.Bis zu einem gewissen Grad ist ihm dies gelungen; in der »Comédie humaine«, wie er selbst die Gesamtheit seiner Schriften bezeichnete, vereinigte er: »Scènes de la vie privée« (im ganzen 27 Werke); »Scènes de la vie de province« (»Eugénie Grandet« etc.); »Scènes de la vie parisienne« (»La dernière incarnation de Vautrin«, »Le père Goriot«, »Grandeur et décadence de César Birotteau«, »La cousine Bette«); »Scènes de la vie politique«; »Scènes de la vie militaire«; »Scènes de la vie de campagne«; »Etudes philosophiques« (»La peau de chagrin«, »Louis Lambert«); »Études analytiques« (»La physiologie du mariage«).Dazu kommen noch einige Dramen, die aber keinen Beifall fanden, und einige Komödien, von denen »Mercadet, ou le faiseur« (1851) sehr gefiel. Sein letztes Werk, der Roman »Les parents pauvres«, ist auch wohl sein reifstes. Balzacs Romane zeigen eine vorzügliche Schilderung des bürgerlichen Lebens, dem er den Glanz des Reichtums und die eleganten Formen und hochtönenden Namen der Aristokratie andichtet, ohne daß darum seine Personen in Manier und Gesittung ihre Parvenunatur verleugnen. Deshalb fällt auch Balzacs Erfolg mit dem Bürgerkönigtum zusammen. Mit der Julirevolution ging sein Stern auf, in der Februarrevolution, die den vierten Stand zur Herrschaft brachte, erblich er. Eine andre, wesentliche Stütze seines Ruhmes hatte er in der Frauenwelt gefunden, deren Herz er gewann durch »La femme de trente ans« (1831). Seinen Erfolg in Frankreich übertraf bei weitem der in Europa; überall wurde B. gelesen, man kopierte das Leben seiner Helden und Heldinnen und möblierte sich á la B. In seinen »Contes drolatiques« (30 Erzählungen im Stile Rabelais'), der »Physiologie du mariage« etc. ist er dem nacktesten Realismus verfallen, und mit Recht nennen ihn die Zola und Genossen ihren Herrn und Meister. Wenige Schriftsteller haben es verstanden, so treu die Sitten der Zeit und des Landes zu schildern, so tief in die Herzen der Menschen einzudringen und das Beobachtete zu einem lebendigen, überraschend wahren Bilde zu vereinigen. Aber seine Schilderungen sind jedes idealen Elements bar, die letzten Gründe menschlicher Handlungen führt er auf die Geldsucht und den gemeinsten Egoismus zurück, besonders seine Schilderungen des weiblichen Herzens sind oft von empörendem Naturalismus. Dazu kommen häufig große Flüchtigkeit in der Anordnung des Stoffes, Geschmacklosigkeit im Ausdruck und viele Mängel im Stil. Balzacs Werke erscheinen in einzelnen Ausgaben noch jedes Jahr und sind auch mehrmals gesammelt worden, z. B. 1856–59, 45 Bde., 1869–75, 25 Bde. (der letzte enthält Balzacs Briefwechsel von 1819–50), 1899 ff. (noch im Erscheinen); eine Ergänzung bilden die »Histoire des œuvres de H. de B.« von Lovenjoul (1879, 2.Aufl. 1886) und dessen »Études balzaciennes« (1895). Vgl. Laura Surville (Balzacs Schwester), B., sa vie et ses œuvres (1858); Th. Gautier, Honoré de B. (1859); de Lamartine, B. et ses œuvres (1866); Champfleury, Documents pour servir à la biographie de B. (1876); E. Zola, Über B. (in »Nord und Süd«, April 1880); H. Favre, La Franceen éveil. B. et le temps présent (1887); Gabr. Ferry (Bellemarre d. jüng.), B. et ses amies (1888); Barrière, L'œuvre de B. (1890); Lemer, B., sa vie, son œuvre (1892); Wormeley, Life of B. (Boston 1892); Lie, Honoré de B. (Kopenh. 1893); Cerfberr und Christophe, Répertoire de la Comédie humaine de B. (1893); Flat, Essais sur B. (1893–95, 2 Bde.); Biré, Honoré de B. (1897).Balzacs Büste ist im Foyer des Théâtre-Français aufgestellt; ein Denkmal (von Fournier) ist ihm in Tours errichtet.
Der Landarzt
I - Das Land und der Mensch
An einem schönen Frühlingsmorgen des Jahres 1829 verfolgte ein etwa fünfzigjähriger Mann zu Pferde einen Gebirgsweg, der nach einem großen, bei der Grande-Chartreuse gelegenen Marktflecken führt. Dieser Marktflecken ist der Hauptort eines volkreichen Kreises, der von einem langen Tal gebildet wird. Ein reißender Bergstrom, dessen steiniges Bett häufig trocken ist, nun aber infolge der Schneeschmelze gefüllt war, benetzt das Tal, das von zwei parallellaufenden Höhenzügen, die auf allen Seiten von den Gipfeln Savoyens und des Dauphiné beherrscht werden, eingeengt wird. Obwohl die zwischen der Kette der beiden Mauriennes liegenden Landstriche sich ähnlich sehen, zeigt der Bezirk, durch welchen der Fremde reiste, Geländeformationen und Nebenlichter, wie der Maler sagt, die man anderswo vergeblich suchen würde. Bald zeigt das plötzlich breiter werdende Tal einen unregelmäßigen Rasenteppich von jenem Grün, das die beständige von den Bergen stammende Bewässerung zu allen Jahreszeiten so frisch und für das Auge so wohltuend erhält. Bald zeigt eine Schneidemühle ihre bescheidenen, malerisch hingestellten Gebäude, ihren Vorrat an langen, geschälten Fichtenstämmen und ihren Wasserlauf, der von dem Wildbach abgeleitet und durch große, grob ausgehöhlte Holzröhren geführt wird, durch deren Risse ein Netz von Wasserstrahlen entweicht. Hier und da erwecken strohgedeckte Hütten, umgeben von Gärten voll blütenbedeckter Obstbäume, die Gedanken, die eine arbeitsame Armut einflößt. Weiterhin kündigen Häuser mit roten Dächern, die aus flachen, runden und fischschuppenähnlichen Ziegeln zusammengesetzt sind, anhaltender Arbeit verdankte Wohlhabenheit an. Endlich sieht man über jeder Türe den aufgehängten Korb, in welchem Käse trocknen. Ueberall sind die Tür- und Fensteröffnungen und Zäune durch Weinstöcke belebt, die, wie in Italien, an kleinen Ulmen emporwachsen, deren Laub man dem Vieh zu fressen gibt. Durch eine Laune der Natur sind die Berge an manchen Stellen so nahe aneinandergerückt, daß es dort weder Gebäude noch Felder, noch Strohhütten mehr gibt. Nur durch den Wildbach getrennt, der in Kaskaden dahinbraust, erheben sich die beiden hohen, mit schwarznadligen Fichten und hundert Fuß hoch aufstrebenden Buchen bedeckten Granitmauern. All diese Bäume sind kerzengerade, durch Moosflecken seltsam gefärbt, an Laub verschieden und bilden prachtvolle Säulenhallen, die oberhalb und unterhalb des Weges von formlosen Erdbeerbaum-, Schneeball-, Buchsbaum- und Rotdornhecken eingefaßt werden. Die starken Düfte dieser Sträucher vermischen sich mit den herben Gerüchen der Gebirgsnatur und den durchdringenden Ausdünstungen junger Lärchen-, Pappel- und harziger Fichtentriebe. Einige Wolken zogen zwischen den Felsen, verschleierten und enthüllten abwechselnd die graufarbigen Spitzen, die häufig ebenso dunstig waren wie die Wetterwolken, deren weiche Flocken sich dort zerteilten. Jeden Augenblick veränderte das Land sein Gesicht und der Himmel sein Licht; die Berge wechselten ihre Farben, die Gießbäche ihre Schattierungen und die Täler ihre Formen: vervielfachte Bilder, deren unerwartete Gegensätze, sei es ein durch die Baumstämme fallender Sonnenstrahl, sei es eine natürliche Lichtung oder einige Geröllhalden inmitten des Schweigens, in der Jahreszeit, wo alles jung ist, wo die Sonne am klaren Himmel flammt, einen köstlichen Anblick boten. Kurz, es war ein schönes Land, es war Frankreich!
Der hochgewachsene Reisende war ganz in blaues Tuch gekleidet, das ebenso sorgfältig gebürstet war, wie es allmorgendlich das glatte Fell seines Pferdes sein mußte, auf welchem er gerade und festgewachsen wie ein alter Kavallerieoffizier saß. Wenn seine schwarze Krawatte und seine Wildlederhandschuhe, wenn die Pistolen, die seine Halfter füllten, und der auf der Kruppe seines Pferdes sorgsam befestigte Mantelsack nicht schon den Militär angekündigt hätten, so würden sein braunes, pockennarbiges, aber regelmäßiges und augenscheinliche Sorglosigkeit verratendes Gesicht, seine entschiedenen Bewegungen, die Sicherheit seines Blicks, seine Kopfhaltung, kurz alles, jene Regimentsgewohnheiten angezeigt haben, die ein Soldat niemals, selbst wenn er ins Privatleben zurückgekehrt ist, ablegen kann. Jeder andere würde sich über die Schönheit dieser Alpennatur, die so strahlend ist, wo sie mit den großen Becken Frankreichs verschmilzt, entzückt haben, der Offizier aber, der zweifelsohne die Länder durcheilt hatte, in welche die französischen Armeen durch die kaiserlichen Kriege geführt wurden, genoß diese Landschaft, ohne indes durch die Mannigfaltigkeit ihrer wechselnden Bilder überrascht zu erscheinen. Erstaunen ist ein Gefühl, das Napoleon in der Seele seiner Soldaten zerstört zu haben scheint: so ist denn auch die Ruhe des Antlitzes ein sicheres Zeichen, woran ein Beobachter Männer erkennen kann, die ehedem unter den vergänglichen, aber unvergeßlichen Adlern des großen Kaisers eingereiht gewesen sind. Dieser Mann war tatsächlich einer der jetzt ziemlich seltenen Militärs, welche die Kugel verschont hat, obwohl sie sich auf allen Schlachtfeldern, wo Napoleon befehligte, geschlagen haben. Sein Leben hatte nichts Ungewöhnliches an sich. Er hatte sich als einfacher und treuer Soldat wacker gehalten, war, ob er seinem Herrn nahe oder fern, seiner Pflicht bei Nacht wie bei Tag nachgekommen, hatte nie einen zwecklosen Säbelhieb getan, war aber auch nicht fähig gewesen, einen zuviel auszuteilen. Wenn er in seinem Knopfloch die den Offizieren der Ehrenlegion gebührende Rosette trug, so geschah das, weil sein Regiment ihn einstimmig nach der Schlacht an der Moskwa als den Würdigsten bezeichnet hatte, der sie an diesem großen Tage erhalten sollte. Er gehörte zu der Zahl jener anscheinend kühlen und schüchternen Männer, die immer in Frieden mit sich leben, deren Gewissen allein durch den Gedanken erregt wird, ein Gesuch, welcher Art es auch sein möge, betreiben zu sollen, und deren Beförderung nach den langsamen Gesetzen des Dienstalters erfolgt. Obschon er 1802 Unterleutnant geworden, war er trotz seines grauen Schnurrbarts 1829 erst Eskadronchef; sein Leben war jedoch so untadelig, daß sich ihm kein Mann aus der Armee, und wäre er auch General, näherte, ohne ein Gefühl unwillkürlichen Respektes zu empfinden; ein unbestrittener Vorzug, den seine Vorgesetzten ihm vielleicht nicht verziehen. Zum Lohne dafür zollten die einfachen Soldaten ihm alle ein weniges von jenem Gefühl, das Kinder für eine gute Mutter hegen; denn ihnen gegenüber wußte er duldsam und streng zugleich zu sein. Ehedem war er ja Soldat wie sie gewesen und kannte die traurigen Freuden und die freudigen Miseren, die verzeihlichen oder strafbaren Verstöße der Soldaten, die er stets seine Kinder nannte, und die er im Felde gern Lebensmittel oder Futter bei den Bürgern auftreiben ließ. Was seine intime Geschichte anlangte, so war sie in tiefstes Dunkel gehüllt. Wie fast alle Militärs jener Epoche hatte er die Welt nur durch den Kanonenrauch oder während der so seltenen Friedensmomente inmitten des vom Kaiser unterhaltenen europäischen Ringens gesehen. Hatte er ans Heiraten gedacht oder nicht? Die Frage blieb unentschieden. Obwohl niemand bezweifelte, daß der Major Genestas, als er so von Stadt zu Stadt, von Landschaft zu Landschaft zog und den von den Regimentern und für sie gegebenen Festen beiwohnte, Frauengunst genossen habe, hatte doch niemand die geringste Gewißheit darüber. Ohne prüde zu sein, ohne eine Lustpartie auszuschlagen, ohne die militärischen Sitten zu verletzen, schwieg er sich aus oder antwortete mit einem Gelächter, wenn er nach seinen Liebschaften gefragt wurde. Auf die Worte: »Und Sie, lieber Major?«, die von einem Offizier beim Trinken an ihn gerichtet wurden, erwiderte er:
»Trinken wir, meine Herren!«
Als eine Art Ritter ohne Furcht und Tadel, ohne damit zu prunken, zeigte Monsieur Pierre-Joseph Genestas weder etwas Poetisches noch Romantisches an sich, so durchschnittlich erschien er. Sein Gehaben war das eines reichen Mannes. Obwohl sein Vermögen nur in seinem Sold bestand und sein Abschied mit Pension seine ganze Zukunft war, hatte der Eskadronschef, den alten, mit allen Wassern gewaschenen Handelswölfen gleich, denen Rückschläge eine Erfahrung, die an Eigensinn grenzt, verliehen haben, immer den Sold für zwei Jahre als Rücklage und gab seine Bezüge niemals ganz aus. Er war so wenig Spieler, daß er seine Stiefel beschaute, wenn man in Gesellschaft einen Ersatzspieler oder beim Écarté einen Einsatzzuschuß verlangte. Wenn er sich nichts Außergewöhnliches erlaubte, fehlte ihm doch nichts, dessen er bedurfte. Länger als bei jedem anderen Regimentsoffiziere hielten seine Uniformen infolge der Sorgfalt, die ein bescheidenes Einkommen erzeugt, und die bei ihm eine ganz mechanische Gewohnheit geworden war. Vielleicht würde man ihn für geizig gehalten haben ohne die wundervolle Uneigennützigkeit, ohne die brüderliche Gefälligkeit, mit der er irgendeinem durchs Kartenspiel oder eine andere Narrheit zugrunde gerichteten Leichtfuß seine Börse öffnete. Er schien früher bedeutende Summen beim Spiel verloren zu haben, soviel Zartgefühl zeigte er beim Erweisen einer Gefälligkeit. Er hielt sich nicht für berechtigt, die Handlungen seines Schuldners zu kontrollieren und sprach nie von seiner Schuld. Als ein Kind der Truppe und alleinstehend wie er war, hatte er die Armee zu seinem Vaterlande und sein Regiment zu seiner Familie gemacht. Auch forschte man selten dem Grunde seiner soliden Sparsamkeit nach; man begnügte sich damit, sie dem recht natürlichen Verlangen, die Früchte seines Wohlstandes für seine alten Tage zu vermehren, zuzuschreiben. Sein Ehrgeiz bestand vermutlich darin, sich, wenn er Oberstleutnant der Kavallerie geworden, mit seiner Pension und den Oberstenepauletten irgendwohin aufs Land zurückzuziehen. Wenn junge Offiziere nach dem Manöver über Genestas plauderten, ordneten sie ihn in die Klasse jener Menschen ein, die auf dem Gymnasium den Ehrenpreis erlangt haben und während ihres Lebens sorgfältig, brav, leidenschaftslos, nützlich und fade wie Weißbrot bleiben; ernsthafte Leute aber beurteilten ihn recht anders. Oft entschlüpften diesem Manne irgendein Blick, ein sinnvoller Ausspruch, wie es das Wort des Menschenscheuen ist, und zeugten von Seelenstürmen in ihm. Wenn man seine ruhige Stirn genau prüfte, verriet sie die Macht, den Leidenschaften Schweigen zu gebieten und sie in den Grund seines Herzens zurückzudrängen, eine teuer durch die Gewöhnung an Gefahren und die unvorhergesehenen Unglücksfälle des Krieges erkaufte Macht. Der Sohn eines Pairs von Frankreich, der neu ins Regiment gekommen war, hatte eines Tages, als man über Genestas sprach, gesagt, daß er sicherlich der gewissenhafteste Priester oder der ehrenwerteste der Krämer geworden wäre: »Fügen Sie hinzu: der am wenigsten dem Marquis den Hof macht,« antwortete er, ihn mit den Blicken messend, dem jungen Gecken, der glaubte, von seinem Vorgesetzten nicht gehört worden zu sein.
Die Zuhörer brachen in ein Gelächter aus: des Leutnants Vater schmeichelte allen einflußreichen Leuten, und war als elastischer Mann gewohnt, bei allen Revolutionen wieder obenauf zu kommen; und der Sohn artete dem Vater nach.
In den französischen Armeen haben sich mehrere solcher Charaktere gefunden, die gelegentlich recht eigentlich groß waren, nach der Schlacht aber wieder einfach wurden, die sich nicht um Ruhm kümmerten und die Gefahr vergaßen; man ist ihnen vielleicht öfters begegnet, als es die Fehler unserer Natur anzunehmen erlauben. Indessen würde man sich außerordentlich täuschen, wenn man glaubte, daß Genestas vollkommen gewesen sei. Mißtrauisch, zu heftigen Zornausbrüchen neigend, hartnäckig in den Diskussionen, vor allem rechthaberisch, wenn er unrecht hatte, steckte er voller nationaler Vorurteile. Aus seinem Soldatenleben hatte er eine Vorliebe für den guten Wein beibehalten. Wenn er ein Festmahl mit dem ganzen Dekorum seines Ranges verließ, erschien er ernst, nachdenklich und wollte dann niemanden in seine heimlichen Gedanken einweihen. Kurz, er kannte die Sitten der Welt und die Gesetze der Höflichkeit, eine Art Instruktion, die er mit militärischer Strenge wahrte, sehr wohl. Wenn er auch natürlichen und erworbenen Geist besaß, wenn er sich auf Taktik, Manöver, die Theorie der Fechtkunst zu Pferde und die schwierigen Fragen der Tierheilkunde verstand, so lagen seine Studien doch sehr im argen. Er wußte, aber sehr unklar, daß Cäsar ein römischer Konsul oder Kaiser, Alexander ein Grieche oder Mazedonier gewesen war; den Ursprung oder den Rang des einen oder des andern hätte er ohne Diskussion zugegeben. Auch wurde er bei wissenschaftlichen oder historischen Unterhaltungen ernst und begnügte sich damit, sich mit kleinen billigenden Kopfneigungen wie ein tiefgründiger Mensch, der beim Pyrrhonismus angelangt ist, daran zu beteiligen. Als Napoleon am 13. Mai 1809 in dem Bulletin, welches sich an die große Armee, die Herrin von Wien, wendete, von Schönbrunn aus schrieb, »daß die österreichischen Fürsten wie Medea ihre Kinder mit ihren eigenen Händen erwürgt hätten«, wollte der eben zum Hauptmann ernannte Genestas die Würde seines Ranges durch die Frage, wer Medea sei, nicht bloßstellen. Er verließ sich darin auf Napoleons Genie, da er gewiß war, daß der Kaiser der großen Armee und dem Hause Oesterreich nur offizielle Dinge sagen dürfe; er dachte, Medea sei eine Erzherzogin von zweideutiger Aufführung. Da die Sache indes das Militärhandwerk betreffen konnte, war er nichtsdestoweniger der Medea des Bulletins wegen unruhig bis zu dem Tage, wo Mademoiselle Raucourt die Medea wiederholt in den Spielplan aufnehmen ließ. Nachdem der Hauptmann die Anzeige gelesen hatte, unterließ er es nicht, sich abends ins Théâtre Français zu begeben, um die berühmte Schauspielerin in dieser mythologischen Rolle zu sehen, über die er sich bei seinen Nachbarn erkundigte. Ein Mann indessen, der als simpler Soldat genug Energie besessen hatte, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen, mußte einsehen, daß er sich als Hauptmann zu bilden habe. So las er denn seit der Zeit mit Eifer Romane und neue Bücher, die ihm eine Halbbildung verschafften, aus welcher er ziemlichen Vorteil zog. In seiner Dankbarkeit seinen Lehrern gegenüber ging er so weit, Pigault-Lebrun in Schutz zu nehmen und behauptete, er finde ihn lehrreich und oft tief.
Dieser Offizier, den seine erworbene Klugheit keinen nutzlosen Schritt tun ließ, hatte Grenoble verlassen und begab sich nach der Grande-Chartreuse, nachdem er am Vorabend von seinem Oberst einen achttägigen Urlaub erhalten. Er rechnete damit, keinen langen Weg zurückzulegen, doch von Meile zu Meile von den lügenhaften Aussagen der Bauern, die er befragte, getäuscht, hielt er es für richtig, sich auf nichts weiter einzulassen, ehe er seinen Magen nicht gestärkt habe. Obwohl er wenig Aussicht hatte, zu einer Zeit, wo jeder auf den Feldern zu tun hat, eine Hausfrau daheim anzutreffen, machte er vor einigen Hütten halt, die an einen gemeinsamen Hofraum grenzten, indem sie ein ziemlich ungestaltes Viereck beschrieben, das all und jedem zugänglich war. Der Boden dieses gemeinsamen Territoriums war fest und gut gekehrt, wurde aber durch Düngergruben unterbrochen. Rosensträucher, Efeu und hohe Stauden wucherten an den rissigen Mauern hoch. Am Eingang des Weges stand ein elender Johannisbeerstrauch, auf dem Lumpen trockneten. Der erste Bewohner, dem Genestas begegnete, war ein sich in einem Strohhaufen wälzendes Schwein, das beim Geräusch der Pferdetritte grunzte, den Kopf aufhob und einen großen schwarzen Kater fliehen machte. Eine junge Bäuerin mit einem Grasbündel auf dem Kopfe zeigte sich plötzlich; ihr folgten in einiger Entfernung vier kleine Jungen in Lumpen, aber kecke, vorlaute, hübsche Schelme mit dreisten Augen, brauner Hautfarbe, wahre Teufel, die Engeln glichen. Die Sonne strahlte und verlieh der Luft, den Hütten, den Dunghaufen und dem zerzausten Trupp etwas seltsam Reines. Der Soldat fragte, ob es möglich sei, ein Glas Milch zu bekommen. Statt jeder Antwort stieß das Mädchen einen rauhen Schrei aus. Eine alte Frau erschien plötzlich auf der Schwelle einer Hütte, und die junge Bäuerin ging in einen Stall, nachdem sie mit einer Handbewegung auf die Alte hingewiesen hatte, auf welche Genestas zuritt, nicht ohne sein Pferd im Zaum zu halten, um die Kinder nicht zu verletzen, welche ihm bereits zwischen den Beinen herumliefen. Er wiederholte seine Bitte, die zu erfüllen die gute Frau sich rundweg weigerte. Sie wolle, sagte sie, die Sahne von den zum Buttermachen bestimmten Milchtöpfen nicht wegnehmen. Der Offizier antwortete auf diesen Einwurf mit dem Versprechen, den Schaden gut bezahlen zu wollen; befestigte sein Pferd an dem Pfosten einer Türe und trat in die Hütte ein. Die vier Kinder, welche der Frau gehörten, schienen alle im gleichen Alter zu stehen, ein seltsamer Umstand, der den Major überraschte. Die Alte hatte noch ein fünftes, fast an ihrem Rocke hängen, das schwach, bleich und kränklich war und zweifelsohne der größten Sorgfalt bedurfte; demgemäß war es der Liebling, der Benjamin.
Genestas setzte sich in den Winkel eines hohen, feuerlosen Kamins, über dessen Mantel er eine bunte Gipsmadonna mit dem Jesuskinde im Arme erblickte. Ein erhabenes Zeichen! Der Erdboden diente dem Hause als Dielung. Mit der Länge der Zeit war der anfänglich geebnete Boden höckerig geworden und zeigte, wiewohl er sauber war, im großen die Unebenheiten einer Orangenschale. Im Kamin waren ein Holzschuh voll Salz, eine Bratpfanne und ein Kochkessel aufgehängt. Der Hintergrund des Raumes wurde von einem Himmelbett, das mit einem ausgezackten Kranze geschmückt war, ausgefüllt. Dann gab es da und dort dreifüßige Schemel, die aus Stäben hergestellt worden waren, die man an einem einfachen Fichtenbrett befestigt hatte, eine Brotlade, einen großen Holzlöffel zum Wasserschöpfen, einen Eimer und Milchtöpfe, ein Spinnrad auf der Lade, einige Käsehürden, schwarze Mauern, eine wurmstichige Tür mit einem leichtvergitterten Impost; das waren die Dekoration und der Hausrat dieser armseligen Wohnung.
Jetzt gab es ein Drama, dem der Offizier, der sich damit unterhielt, den Boden mit seiner Reitpeitsche zu klopfen, beiwohnte, ohne zu ahnen, daß sich da ein Drama entrollen würde. Als das alte Weib, von ihrem schorfigen Benjamin gefolgt, durch eine in ihre Milchkammer führende Tür verschwunden war, begannen die vier Kinder, nachdem sie den Soldaten genugsam gemustert hatten, sich des Schweines zu entledigen. Das Tier, mit dem sie gewöhnlich spielten, war auf die Türschwelle gekommen; die Bamsen fielen so kräftig darüber her und verabfolgten ihm so kräftige Ohrfeigen, daß es sich zum sofortigen Rückzuge genötigt sah. Als der Feind einmal draußen war, griffen die Kinder eine Tür an, deren Klinke, ihren Anstrengungen nachgebend, aus der abgenutzten Schließklappe, die sie festhielt, heraussprang; dann stürzten sie sich in eine Art Obstkeller, wo der Major, den diese Szene belustigte, sie bald damit beschäftigt sah, Dörrpflaumen zu benagen. In diesem Augenblick kam die Alte mit ihrem Pergamentgesicht und ihren schmutzigen Lumpen wieder herein, in der Hand einen Milchtopf für ihren Gast haltend.
»Hah, die Taugenichtse!« sagte sie.
Sie ging zu den Kindern, packte jedes von ihnen beim Arm und warf sie, aber ohne ihnen ihre Pflaumen zu nehmen, ins Zimmer und verschloß sorgsam die Türe zu dem Speicher des Ueberflusses.
»Ei, ei, meine Lieblinge, seid doch vernünftig. – Wenn man nicht acht auf sie gäbe, würden sie den Pflaumenhaufen aufessen, die Tollköpfe!« sagte sie, Genestas anblickend.
Dann setzte sie sich auf einen Schemel, nahm den Grindigen zwischen ihre Beine und hub an, ihn zu säubern, indem sie ihm den Kopf mit weiblicher Geschicklichkeit und mütterlicher Sorgfalt wusch. Die vier kleinen Diebe standen teils herum, teils lehnten sie am Bett oder an der Lade; alle wären sie rotznasig und schmutzig, fühlten sich indessen recht wohl und kauten ohne ein Wort zu sagen, den Fremden aber mit verschlossener und mißtrauischer Miene betrachtend, an ihren Pflaumen.
»Sind das Ihre Kinder?« fragte der Soldat die Alte.
»Entschuldigen Sie, mein Herr, es sind Ziehkinder; für jedes von ihnen gibt man mir drei Franken monatlich und ein Pfund Seife.«
»Aber, meine gute Frau, sie müssen Sie doch zweimal mehr kosten!«
»Genau dasselbe sagt Monsieur Benassis, mein Herr; doch wenn andere die Kinder zum nämlichen Preise nehmen, muß man wohl damit zufrieden sein. Niemand will Kinder haben! Obendrein hat man noch Kirche und Staat nötig, um sie zu bekommen. Wenn wir ihnen unsere Milch umsonst geben könnten, würden sie uns nicht viel kosten. Uebrigens, mein Herr, drei Franken, das sind eine schöne Summe. Das sind fünfzehn gefundene Franken, ohne die fünf Pfund Seife. Wie viel Kraft muß man in unseren Bezirken doch verausgaben, um zehn Sous täglich zu verdienen!«
»Sie haben also Land, das Ihnen gehört?« fragte der Major.
»Nein, mein Herr. Ich hatte welches, als mein Mann noch lebte; doch nach seinem Tode bin ich so unglücklich gewesen, daß ich mich gezwungen sah, es zu verkaufen.«
»Nun,« fuhr Genestas fort, »wie können Sie ohne Schulden bis zum Jahresende kommen, wenn Sie den Beruf ausüben, Kinder für zwei Sous täglich zu nähren, sauber zu halten und zu erziehen.«
»Aber,« erwiderte sie, indem sie fortfuhr, ihren grindigen Kleinen zu säubern, »wir halten auch nicht ohne Schulden bis Sylvester aus, mein lieber Herr! Was wollen Sie? Der liebe Gott hilft. Ich habe zwei Kühe, dann stoppeln wir, meine Tochter und ich, während der Ernte. Im Winter gehen wir ins Holz und schließlich spinnen wir abends. Ach, es wird ja nicht immer ein Winter wie der letzte sein! Dem Müller schulde ich fünfundsiebzig Franken für Mehl. Glücklicherweise ist's Monsieur Benassis' Müller ... Monsieur Benassis ist ein Freund der Armen! Noch niemals hat er seine Forderungen, von wem es auch sein möge, eingetrieben, da wird er nicht mit uns anfangen. Ueberdies hat unsere Kuh ein Kalb, das wird uns immerhin ein bißchen von unseren Schulden frei machen.«
Die vier Waisenkinder, für die aller menschlicher Schutz sich in der Zuneigung dieser alten Bäuerin zusammenfaßte, waren mit ihren Pflaumen fertig geworden. Sie benutzten die Aufmerksamkeit, mit der ihre Mutter den Offizier beim Sprechen ansah, und vereinigten sich in geschlossener Reihe, um nochmals die Klinke der Tür, die sie von dem schönen Pflaumenhaufen trennte, aufzusprengen. Sie machten's dabei nicht wie die französischen Soldaten beim Angriff, sondern schweigend wie die Deutschen, von ihrer naiven und brutalen Naschhaftigkeit getrieben.
»Ach! die kleinen Schelme! Wollt ihr wohl aufhören?«
Die Alte stand auf, griff den kräftigsten der viere, versetzte ihm einen leichten Klaps auf den Hintern und warf ihn hinaus; er weinte nicht, die anderen zeigten sich ganz verdutzt.
»Sie machen Ihnen viel zu schaffen ...«
»0 nein, mein Herr; aber sie riechen meine Pflaumen, die Lieblinge. Wenn ich sie einen Augenblick allein ließe, würden sie sich den Magen verderben.«
»Sie haben sie lieb?«
Bei dieser Frage hob die Alte den Kopf, sah den Soldaten mit leise spöttischer Miene an und antwortete: »Ob ich sie liebe! Ich habe ihrer drei bereits zurückgegeben,« fügte sie seufzend hinzu, »ich behalte sie nur bis zum sechsten Lebensjahre.«
»Aber wo ist denn das Ihrige?«
»Ich hab' es verloren.«
»Wie alt sind Sie denn?« fragte Genestas, um die Wirkung seiner vorhergehenden Frage abzuschwächen.
»Achtunddreißig Jahre, mein Herr. Am nächsten Johannistage sinds zwei Jahre, daß mein Mann gestorben ist.«
Sie zog den kleinen kränklichen Jungen, der ihr durch einen blassen und zärtlichen Blick zu danken schien, vollends an.
»Welch ein Leben voller Entsagung und Arbeit!« dachte der Reiter.
Unter diesem Dache, welches des Stalles würdig war, worin Jesus Christus geboren wurde, vollzogen sich froh und ohne Dünkel die schwierigsten Pflichten der Mutterschaft. Welche in tiefster Vergessenheit begrabene Herzen! Welch ein Reichtum und welche Armut! Die Soldaten wissen besser als andere Menschen das Großartige der Erhabenheit in Holzschuhen, des Evangeliums in Lumpen zu schätzen. Anderswo findet man die Bibel, den bildergeschmückten, schön eingebunden mit Goldschnitt gezierten Text; dort aber herrschte sicherlich der Geist der Bibel. Unmöglich wäre es gewesen, nicht an irgendeine fromme Absicht des Himmels zu glauben, wenn man diese Frau sah, die Mutter geworden war, wie Jesus Christus Mensch geworden ist, die stoppelte, litt, sich für verlassene Kinder in Schulden stürzte und sich in ihren Rechnungen betrog, ohne erkennen zu wollen, daß sie sich zugrunde richtete, um Mutter zu sein. Beim Anblick dieser Frau mußte man notgedrungen irgendwelche geheime Wechselbeziehungen zwischen den Guten hienieden und den geistigen Wesen über uns annehmen; so blickte sie denn der Major Genestas an und schüttelte den Kopf.
»Ist Monsieur Benassis ein guter Arzt?« fragte er endlich.
»Ich weiß es nicht, mein lieber Herr, aber er heilt die Armen umsonst.«
»Es scheint,« fuhr er, mit sich selber sprechend, fort, »daß dieser Mann entschieden ein Mann ist!«
»0 ja, mein Herr, und ein braver Mann dazu! ... Auch gibt's nicht viele Leute hier, die ihn nicht morgens und abends in ihr Gebet einschließen!«
»Das ist für Sie, Mutter,« sagte der Soldat, indem er ihr einige Geldstücke gab. »Und das für die Kinder,« fuhr er, einen Taler hinzulegend, fort. – »Hab' ich's noch weit bis zu Monsieur Benassis?« fragte er, als er wieder zu Pferde saß.
»Oh, nein, mein lieber Herr, höchstens eine kleine Meile.«
In der Ueberzeugung, daß er noch zwei Meilen zurückzulegen habe, ritt der Major fort. Nichtsdestoweniger erblickte er bald durch einige Bäume hindurch eine erste Häusergruppe, dann endlich die Dächer des Fleckens, der sich um einen Glockenturm mit kegelförmiger Spitze sammelt, dessen Schieferplatten an den Ecken des Gebälks durch in der Sonne glänzende Weißblechstreifen festgehalten werden. Dies originell wirkende Dach kündigt die Grenzen Savoyens an, wo es gebräuchlich ist. An dieser Stelle ist das Tal breit. Mehrere anmutig in der kleinen Ebene oder längs des Wildbachs gelegene Häuser beleben das gut angebaute, von allen Seiten durch die Berge verschanzte Land, das scheinbar keinen Ausgang hat. Einige Schritte vor diesem, auf der Mitte des Abhanges nach Süden liegenden Flecken hielt Genestas sein Pferd unter einer Ulmenallee vor einer Schar Kinder an und fragte sie nach Monsieur Benassis' Hause. Die Kinder sahen zuerst einander an und prüften den Fremden mit der Miene, mit der sie alles, was sich ihren Augen zum ersten Male bietet, betrachten: so viele Gesichter, so viele Schattierungen der Neugierde und soviel verschiedene Gedanken. Dann wiederholte der keckste, der munterste der Bande, ein kleiner Junge mit lebhaften Augen, nackten und schmutzigen Füßen, nach der Gewohnheit der Kinder:
»Monsieur Benassis' Haus, mein Herr?«
Und fügte hinzu:
»Ich will Sie hinbringen.«
Er ging vor dem Pferde her, ebensosehr, um eine gewisse Art Wichtigkeit zu gewinnen, wenn er einen Fremdling begleitete, wie aus kindlicher Gefälligkeit, oder um dem gebieterischen Bedürfnis nach Bewegung zu gehorchen, das in diesem Alter Seele und Leib beherrscht. Der Offizier verfolgte die Hauptstraße des Fleckens ihrer ganzen Länge nach, eine steinige, krumme Straße, welche von Häusern eingerahmt wurde, die nach dem Gutdünken der Besitzer erbaut worden waren. Da ragt ein Backofen mitten in den öffentlichen Weg hinein; dort zeigt sich ein Giebel im Profil und versperrt ihn teilweise; dann durchquert ihn ein aus den Bergen kommender Bach mit seinen Rinnsalen. Genestas bemerkte mehrere Dächer mit schwarzen Schindeln, mehr noch aus Stroh, einige aus Ziegeln, sieben oder acht aus Schiefer, zweifelsohne die des Pfarrers, des Friedensrichters und die der Bourgeois des Orts. Es war die ganze Nachlässigkeit eines Dorfes, jenseits dessen die Erde aufhören, das mit nichts zusammenhängen und an nichts grenzen mußte; seine Bewohner schienen ein und dieselbe Familie außerhalb der sozialen Bewegung zu bilden und hingen damit nur durch den Steuereinnehmer oder durch unmerkliche Verzweigungen zusammen. Als Genestas einige Schritte weitergekommen war, sah er auf der Höhe des Berges eine breite Straße, die das Dorf beherrscht. Zweifelsohne gab es ein altes und ein neues Dorf. Tatsächlich konnte der Major bei einer schmalen Durchsicht und an einer Stelle, wo er den Schritt seines Pferdes mäßigte, leicht eine Anzahl gut gebauter Häuser entdecken, deren neue Dächer dem alten Dorf einen freundlicheren Anstrich verliehen. In diesen neuen Behausungen, die eine Allee von jungen Bäumen kränzt, hörte er die beschäftigten Arbeitern eigentümlichen Gesänge, das Summen einiger Werkstätten, das Knirschen der Feilen, das Klopfen der Hämmer, die unbestimmten Geräusche mehrerer Industrien. Er bemerkte den spärlichen Rauch der Küchenschornsteine und die stärkeren Rauchwolken der Essen des Stellmachers, des Schlossers und des Hufschmieds. Am äußersten Ende des Dorfes, wohin sein Führer ihn leitete, erblickte Genestas endlich zerstreute Meiereien, sehr gepflegte Felder, sachkundig angelegte Anpflanzungen und etwas wie einen kleinen Winkel der Brie in einer weiten Geländefalte verloren, deren Existenz zwischen dem Flecken und den Bergen, die das Land abschlossen, er auf den ersten Blick nicht vermutet hätte.
Bald blieb das Kind stehen.
»Das ist die Türe ›seines‹ Hauses,« sagte es.
Der Offizier stieg vom Pferde und schlang den Zügel um seinen Arm; dann zog er, da er dachte, daß jede Bemühung ihren Lohn verdient, einige Sous aus seiner kleinen Hosentasche und bot sie dem Kinde, das sie mit erstaunter Miene nahm, die Augen weit aufriß, nicht dankte und stehenblieb, um zu sehen, was sich weiter begeben würde.
In diesem Orte ist die Zivilisation wenig vorgeschritten, herrschen die Pflichten der Arbeit in voller Kraft und ist die Bettelei noch unbekannt, dachte Genestas.
Mehr neugierig als interessiert lehnte sich der kleine Führer des Militärs an eine brusthohe Mauer, die dazu diente, den Hof des Hauses abzuschließen, und in der an zwei Torpfeilern eine Pforte aus geschwärztem Holz angebracht war. Diese, in ihrem unteren Teile massive und einstmals graugestrichene Tür wurde durch gelbe lanzenförmig zugespitzte Latten abgeschlossen. Diese Zierate, deren Farbe verblichen war, bildeten in der Höhe eines jeden Türflügels einen Halbmond und vereinigten sich, wenn die Tür geschlossen war, zu einem großen Pinienapfel. Dies von den Würmern zernagte, von dem Sammet dunklen Mooses fleckige Tor war durch die abwechselnde Einwirkung der Sonne und des Regens fast zerstört. Von einigen Aloepflanzen und, wo es der Zufall wollte, wuchernden Mauerkräutern überragt, verbergen die Pfeiler die Stämme zweier im Hofe gepflanzter, dornenloser Akazien, deren grüne Laubkronen sich in Puderquastenform erhoben. Der Zustand dieses Portals verriet eine Sorglosigkeit des Besitzers, die dem Offiziere zu mißfallen schien; er runzelte die Augenbrauen wie ein Mann, der notgedrungen auf irgendeine Illusion verzichten muß. Wir sind gewohnt, andere Leute nach uns zu beurteilen, und wenn wir sie auch gerne von unseren Fehlern freisprechen, verurteilen wir sie doch streng, weil sie unsere guten Eigenschaften nicht besitzen. Wenn der Major wünschte, daß Monsieur Benassis ein sorgsamer oder methodischer Mann sei, kündigte seine Haustüre wahrlich eine vollkommene Gleichgültigkeit dem Eigentum gegenüber an. Ein auf häusliche Oekonomie haltender Soldat, wie Genestas einer war, mußte nach dem Portal sofort auf das Leben und den Charakter des Unbekannten schließen: was er trotz seiner Umsicht auch durchaus nicht unterließ. Die Tür war halboffen, eine weitere Sorglosigkeit! Im Vertrauen auf diese ländliche Unbekümmertheit ging der Offizier ohne weiteres in den Hof, band sein Pferd an die Stäbe des Gitterwerks, und während er den Zügel festknotete, drang ein Wiehern aus einem Stall, nach welchem das Pferd und der Reiter unwillkürlich die Augen wandten; ein alter Diener öffnete die Türe und zeigte seinen Kopf, der mit einer dortzulande üblichen roten Leinenmütze bedeckt war, die vollkommen der phrygischen Mütze gleicht, mit der die Freiheit geschmückt ist. Da es dort Platz für mehrere Pferde gab, bot der Biedermann, nachdem er Genestas gefragt hatte, ob er Monsieur Benassis zu besuchen komme, ihm für sein Pferd die Gastfreundschaft des Stalles an, indem er das Tier, welches sehr schön war, voll Zärtlichkeit und Bewunderung betrachtete. Der Major folgte seinem Pferde, um zu sehen, wo es aufgehoben werden sollte. Der Stall war sauber, Streu gab es genug, und Benassis' beide Pferde hatten jenes glückliche Aussehen, das unter allen Pferden ein Pfarrerspferd herauserkennen läßt. Eine Magd, die aus dem Hausinnern auf die Freitreppe hinausgetreten war, schien pflichtgemäß auf die Fragen des Fremdlings zu warten, dem der Stallknecht bereits mitgeteilt hatte, daß Monsieur Benassis ausgegangen sei.
»Unser Herr ist nach der Kornmühle gegangen,« sagte er. »Wenn Sie ihn dort treffen wollen, brauchen Sie nur dem Pfad nachzugehen, der durch die Wiese führt, die Mühle liegt an ihrem Ende.«
Genestas wollte lieber das Land sehen als wer weiß wie lang auf Benassis' Rückkehr zu warten und schlug den Weg nach der Kornmühle ein. Als er die unregelmäßige Linie, die der Flecken auf dem Bergabhange beschreibt, überschritten hatte, erblickte er das Tal, die Mühle und eine der reizvollsten Landschaften, die er noch je gesehen.
Durch den Fuß der Berge gestaut, bildet der Fluß einen kleinen See, über dem sich die Bergzacken stufenweise erheben, indem sie ihre zahlreichen Täler durch die verschiedenen Farben des Lichts oder durch die mehr oder minder lebhafte Reinheit ihrer Grate, die alle mit finsteren Tannen bestanden sind, erraten lassen. Die erst kürzlich an dem Fall des Wildbachs in den kleinen See erbaute Mühle besitzt den Reiz eines alleinstehenden Hauses, das sich mitten in den Gewässern zwischen den Wipfeln mehrerer wasserliebenden Bäume verbirgt. Auf der anderen Flußseite, am Fuße eines an seinen Gipfeln durch die roten Strahlen der untergehenden Sonne in diesem Augenblick schwach erleuchteten Berges sah Genestas ein Dutzend verlassener Strohhütten ohne Türen und Fenster. Ihre beschädigten Dächer ließen ziemlich große Löcher sehen; die Ländereien ringsherum bildeten vollkommen bestellte und angesäte Felder, ihre ehemaligen, in Wiesen umgewandelten Gärten wurden durch Wasserläufe benetzt, die mit ebensoviel Kunst angelegt worden waren wie im Limousin. Der Major blieb unwillkürlich stehen, um die Trümmer dieses Dorfes zu betrachten.
Warum sehen Menschen alle, selbst die bescheidensten Ruinen nicht ohne eine tiefe Bewegung an? Zweifelsohne sind sie für sie das Bild des Unglücks, dessen Last von ihnen so verschieden empfunden wird. Die Friedhöfe lassen an den Tod denken, ein aufgegebenes Dorf läßt an die Mühen des Lebens denken; der Tod ist ein vorhergesehenes Unglück, die Mühen des Lebens sind unendlich. Ist das Unendliche nicht das Geheimnis der großen Melancholien?
Der Offizier hatte die steinige Mühlenstraße erreicht, ohne daß er sich die Preisgabe des Dorfs hätte erklären können; er fragte einen auf den Getreidesäcken vor der Haustüre sitzenden Müllerburschen nach Monsieur Benassis.
»Monsieur Benassis ist dorthin gegangen,« sagte der Müller, nach einer der zerstörten Hütten zeigend.
»Das Dorf ist wohl abgebrannt?« fragte der Major.
»Nein, mein Herr.«
»Warum sieht es denn so aus?« fragte Genestas.
»Ah! warum?« antwortete, achselzuckend und ins Haus hineingehend der Müller, Monsieur Benassis wird's Ihnen sagen.« Der Offizier ging über eine Art Brücke, die man aus großen Steinen hergestellt hatte, zwischen denen der Wildbach strömte, und kam bald zu dem bezeichneten Hause. Das Strohdach dieser Behausung war noch ganz, mit Moos bedeckt, aber ohne Löcher, und die Verschlüsse schienen in gutem Zustande zu sein. Beim Hineingehen sah Genestas Feuer im Kamin, in dessen Winkel eine alte Frau vor einem auf einem Stuhle sitzenden Kranken kniete, während ein mit dem Gesichte nach dem Feuer gewandter Mann daneben stand. Das Innere des Hauses bildete ein einziges, durch ein elendes mit Leinwand verhängtes Fenster erhelltes Zimmer. Der Boden bestand aus festgestampfter Erde. Der Stuhl, ein Tisch und eine schlechte Matratze bildeten den gesamten Hausrat. Niemals hatte der Major etwas so Einfaches noch so Kahles gesehen, nicht einmal in Rußland, wo die Hütten der Muschiks Höhlen gleichen. Hier legte nichts von den Dingen des Lebens Zeugnis ab, es befand sich dort nicht einmal das geringste für die Zubereitung der einfachsten Nahrung notwendige Gerät. Man hätte die Behausung für eine Hundehütte ohne Futternapf halten können. Wenn dort nicht die elende Matratze gelegen, ein langer, grober Leinwandkittel an einem Nagel gehangen und mit Stroh ausgelegte Holzschuhe des Kranken gestanden hätten, die einzigen Kleidungsstücke, wäre einem diese Hütte ebenso verlassen wie die anderen vorgekommen. Die kniende Frau, eine sehr betagte Bäuerin, bemühte sich des Kranken Füße in einen Kübel, der mit einem braunen Wasser angefüllt war, zu halten. Als er einen Schritt hörte, den das Geräusch der Sporen für die an den monotonen Gang der Landleute gewöhnten Ohren ungewöhnlich machte, wandte der Mann sich nach Genestas um, indem er eine gewisse Ueberraschung bekundete, die von der Alten geteilt wurde.
»Ich habe nicht nötig,« sagte der Soldat, »zu fragen, ob Sie Monsieur Benassis sind. Einem Fremden, der ungeduldig ist, Sie zu sehen, werden Sie verzeihen, mein Herr, daß er gekommen ist, Sie auf Ihrem Schlachtfelde zu suchen, statt Sie bei sich zu Hause zu erwarten. Lassen Sie sich nicht stören, gehen Sie Ihrem Berufe nach. Wenn Sie fertig sind, will ich Ihnen den Grund meines Besuches anzeigen.«
Genestas lehnte sich an den Rand des Tisches und bewahrte Schweigen. Das Feuer verbreitete in der Hütte eine lebhaftere Helligkeit als die der Sonne, deren durch die Bergwipfel gebrochenen Strahlen niemals in diesen Teil des Tales gelangen können. Beim Lichte dieses Feuers, das durch einige harzige Fichtenzweige, die eine leuchtende Flamme abgaben, unterhalten wurde, betrachtete der Soldat das Gesicht des Mannes, den ein heimliches Interesse ihn aufzusuchen, zu studieren und genau kennenzulernen zwang. Monsieur Benassis, der Bezirksarzt, verharrte mit gekreuzten Armen, hörte Genestas kühl an, erwiderte seinen Gruß und wandte sich wieder dem Kranken zu, ohne sich für den Gegenstand einer so ernstlichen Prüfung, wie es die des Militärs war, zu halten.
Benassis zeigte eine Durchschnittsfigur, aber mit breiten Schultern und breitem Brustkasten. Ein weiter, bis zum Halse zugeknöpfter grüner Ueberrock hinderte den Offizier, die so charakteristischen Einzelheiten dieser Persönlichkeit oder ihrer Haltung zu bemerken; der Schatten und die Unbeweglichkeit aber, in welcher der Körper verharrte, sorgten dafür, das in diesem Augenblick durch einen Reflex der Flammen stark erhellte Gesicht hervortreten zu lassen. Das Gesicht dieses Mannes ähnelte dem eines Satyrs: die nämliche leicht geschweifte Stirn, die aber voll mehr oder minder bezeichnender Erhebungen war; die nämliche, an der Spitze geistreich gespaltene Stülpnase; die nämlichen, hervortretenden Backenknochen. Der Mund war geschwungen, die Lippen waren dick und rot. Das Kinn trat unvermittelt hervor. Die braunen Augen, durch einen lebhaften Blick, dem die perlmutterschimmernde Farbe des Weißen darin einen hohen Glanz verlieh, beseelt, sprachen von ertöteten Leidenschaften. Die einstmals schwarzen und jetzt grauen Haare, die tiefen Falten seines Gesichts und seine bereits weißen buschigen Augenbrauen, seine dick und äderig gewordene Nase, seine gelbe und durch rote Flecke marmorierte Hautfarbe, alles kündigte bei ihm den Fünfziger und die harte Arbeit seines Berufes an. Der Offizier konnte den Umfang des augenblicklich mit einer Mütze bedeckten Kopfes nur mutmaßen, doch obwohl er unter dieser Hülle verborgen war, schien er ihm einer jener, sprichwörtlich »Quadratschädel« genannten Köpfe zu sein. Durch die Verbindung, in der er mit jenen Männern voller Energie gestanden hatte, die Napoleon an sich zog, gewöhnt, die Züge der zu großen Dingen bestimmten Menschen zu unterscheiden, erriet Genestas ein Geheimnis in diesem ihm unbekannten Leben und sagte sich, als er das ungewöhnliche Gesicht erblickte:
Durch welchen Zufall ist er Landarzt geblieben?
Nachdem er die Physiognomie genau betrachtet hatte, die trotz ihrer Analogien mit anderen menschlichen Gesichtern eine geheime Existenz verriet, die mit all den scheinbaren Gewöhnlichkeiten nicht im Einklang stand, teilte er notwendigerweise die Aufmerksamkeit, die der Arzt dem Kranken widmete; und der Anblick dieses Kranken veränderte den Gang seiner Ueberlegungen vollkommen.
Trotz der unzähligen Bilder seines Militärlebens fühlte der alte Reiter eine von Entsetzen begleitete Regung der Ueberraschung, als er ein menschliches Antlitz gewahrte, auf welchem offenbar niemals der Gedanke geglänzt hatte; ein fahles Gesicht, auf dem sich das Leiden naiv und schweigsam ausdrückte, wie auf dem Antlitz eines Kindes, das noch nicht zu sprechen weiß und nicht mehr schreien kann, kurz das ganz tierische Gesicht eines alten sterbenden Kretinen. Der Kretine war die einzige Abart des menschlichen Geschlechts, die der Eskadronschef noch nicht gesehen hatte. Wer hätte beim Anblick einer Stirn, deren Haut eine dicke runde Falte bildete, zweier Augen, die denen eines gekochten Fisches glichen, eines, mit kurzen verkümmerten Haaren, denen die Nahrung fehlte, bedeckten Schädels – eines ganz eingedrückten und der Sinnnesorgane völlig entbehrenden Schädels – nicht wie Genestas ein Gefühl unfreiwilligen Abscheus vor einem Geschöpf empfunden, welches weder die Reize des Tieres noch die Vorzüge des Menschen aufwies, das niemals weder Vernunft noch Instinkt besessen, niemals eine Art von Sprache weder verstanden noch gesprochen hatte? Indem man dies arme Wesen am Ende einer Laufbahn, die kein Leben war, ankommen sah, schien es schwierig zu sein, ihm ein Bedauern entgegenzubringen. Die alte Frau indessen betrachtete es mit einer rührenden Unruhe und fuhr mit ihren Händen über den Teil der Beine, die das heiße Wasser nicht benetzt hatte, mit ebensoviel Zuneigung, wie wenn es ihr Ehemann gewesen wäre. Benassis selber nahm, nachdem er dies tote Antlitz und die lichtlosen Augen betrachtet hatte, sanft behutsam des Kretinen Hand und fühlte ihm den Puls.
»Das Bad wirkt nicht,« sagte er, den Kopf schüttelnd, »legen wir ihn wieder ins Bett!«
Er hob selber diese Fleischmasse empor und trug sie auf die elende Matratze, von wo er sie zweifelsohne hergeholt hatte, streckte sie dort sorgsam aus, indem er die fast kalten Beine geradebog und Hand und Kopf mit der Sorgfalt bettete, die eine Mutter ihrem Kinde angedeihen lassen mag.
»Gewiß, er wird sterben,« fügte Benassis hinzu, der am Bettrande aufrecht stehenblieb.
Die Hände in die Hüften gestützt, sah die alte Frau den Sterbenden an und ließ einige Tränen rinnen. Genestas selbst blieb schweigsam, ohne sich erklären zu können, warum der Tod eines so wenig anziehenden Wesens solch einen Eindruck auf ihn machte. Instinktiv teilte er schon das grenzenlose Mitleid, das diese unglücklichen Geschöpfe in den der Sonne beraubten Tälern, wohin die Natur sie geworfen hat, einflößen. Rührt dieses Gefühl, das bei den Familien, denen die Kretins angehören, in religiösen Aberglauben entartet ist, nicht von der schönsten der christlichen Tugenden, der Barmherzigkeit her, und von dem für die soziale Ordnung so überaus nützlichen Glauben, dem Gedanken an zukünftige Belohnungen, dem einzigen, der uns unsere Unglücksfälle ertragen läßt? Die Hoffnung, die ewige Glückseligkeit zu verdienen, hilft den Eltern dieser armen Wesen und denen, welche um sie herum leben, die Sorgen der Mütterlichkeit und ihres erhabenen Schutzes auszuüben, den man einer untätigen Kreatur, die ihn anfangs nicht begreift und ihn späterhin vergißt, fortgesetzt angedeihen läßt. Eine wunderbare Religion! Sie hat den Beistand einer blinden Wohltat neben ein blindes Unglück gestellt. Da, wo es Kretinen gibt, glaubt die Bevölkerung, daß die Gegenwart eines Wesens dieser Art glückbringend für die Familie sei. Dieser Glaube dient dazu, ein Leben angenehm zu machen, das inmitten der Städte zu den Härten einer falschen Philanthropie und einer Hospitaldisziplin verdammt sein würde. Im oberen Iseretale, wo sie sehr häufig sind, leben die Kretinen mit den Herden, die zu hüten man sie abgerichtet hat, im Freien. Wenigstens sind sie frei und werden respektiert, wie es das Unglück sein muß.
Seit einem Augenblick läutete die ferne Dorfglocke in regelmäßigen Intervallen, um den Gläubigen den Tod eines von ihnen mitzuteilen. Den Raum durcheilend, gelangte dieser religiöse Gedanke abgeschwächt zu der Hütte, wo er eine sanfte Schwermut verbreitete. Zahlreiche Schritte ließen sich auf dem Wege vernehmen und kündigten das Nahen einer Menge, aber einer schweigenden Menge an. Dann fiel plötzlich detonierender Kirchengesang ein und erweckte jene wirren Gedanken, die sich der ungläubigsten Seelen bemächtigen und sie zwingen, sich den ergreifenden Harmonien der menschlichen Stimme zu überlassen. Die Kirche kam diesem Geschöpf, das sie nicht kannte, zu Hilfe. Der Pfarrer, dem ein von einem Chorknaben gehaltenes Kreuz vorangetragen wurde, erschien im Gefolge des den Weihwasserkessel haltenden Sakristans und von etwa fünfzig Frauen, Greisen und Kindern, die alle gekommen waren, um ihre Gebete mit denen der Kirche zu vereinigen. Der Arzt und der Militär blickten sich schweigend an und zogen sich in einen Winkel zurück, um der Menge Platz zu machen, die in und außerhalb der Hütte niederkniete. Während der trostreichen Zeremonie der letzten Wegzehrung, die für jenes Wesen begangen wurde, das niemals gesündigt hatte, dem aber die Christenwelt Lebewohl sagte, zeigten die meisten dieser groben Gesichter aufrichtige Rührung. Einige Tränen rannen über rauhe, durch die Sonne rissig gewordene und von den Arbeiten in freier Luft gebräunte Backen. Dieses Gefühl freiwilliger Verwandtschaft war ganz schlicht. Niemanden gab es in der Gemeinde, der dies arme Wesen nicht beklagt, der ihm nicht sein tägliches Brot gereicht hätte; war ihm nicht ein Vater in jedem kleinen Jungen, in dem lustigsten kleinen Mädchen nicht eine Mutter begegnet?
»Er ist gestorben,« sagte der Pfarrer.
Dies Wort erregte die aufrichtigste Bestürzung. Die Kerzen wurden angezündet. Mehrere Leute wollten die Nacht über bei dem Leichnam wachen. Benassis und der Soldat gingen fort. An der Türe hielten einige Bauern den Arzt an, um ihm zu sagen:
»Ach, Herr Bürgermeister, wenn Sie ihn nicht gerettet haben, wollte Gott ihn zweifelsohne zu sich rufen!«
»Ich hab' mein Bestes getan, liebe Kinder,« antwortete der Doktor. – »Sie können sich nicht vorstellen, mein Herr,« sagte er zu Genestas, als sie einige Schritte hinter dem verlassenen Dorfe standen, dessen letzter Bewohner eben gestorben war, »wieviel wirklichen Trost für mich das Wort dieser Bauern birgt. Vor etwa zehn Jahren wäre ich in diesem heute verlassenen, damals aber von dreißig Familien bewohnten Dorfe beinahe gesteinigt worden.«
Genestas legte eine so sichtliche Frage in den Ausdruck seiner Züge und seiner Haltung, daß der Arzt ihm im Weiterschreiten die durch diese Andeutung angekündigte Geschichte erzählte.
»Als ich mich hier niederließ, mein Herr, fand ich in diesem Teile des Bezirks ein Dutzend Kretinen vor,« sagte der Arzt sich umwendend, um dem Offizier die zerstörten Häuser zu zeigen. »Die Lage dieses Weilers in einem Talgrunde ohne Luftzug, an einem Wildbach, dessen Gewässer aus geschmolzenen Schneemengen herrühren, unzugänglich für die Sonne, die nur die Gebirgsgipfel bestrahlt, begünstigt die Verbreitung dieser gräßlichen Krankheit. Die Gesetze verbieten die Paarung dieser Unglücklichen nicht, die hier durch einen Aberglauben begünstigt werden, dessen Macht mir unbekannt war und den ich anfangs verdammt, später aber bewundert habe. Der Kretinismus würde sich also von dieser Stelle aus bis ins Tal verbreitet haben. Hieß es nicht dem Lande einen großen Dienst erweisen, wenn man dieser physischen und intellektuellen Seuche Einhalt gebot? Trotz seiner Dringlichkeit konnte diese Wohltat dem, der ihre Verwirklichung auf sich nahm, das Leben kosten. Hier mußte man, wie in den anderen sozialen Sphären, zur Vollbringung des Guten keine Interessen, sondern, was viel gefährlicher ist, in Aberglauben verwandelte religiöse Gedanken, die unzerstörbarste Form menschlicher Vorstellungen verletzen. Vor nichts schreckte ich zurück. Zuerst bewarb ich mich um den Bürgermeisterposten und erhielt ihn; dann, nachdem ich die mündliche Billigung des Präfekten erlangt hatte, ließ ich nächtlicherweile einige dieser unglücklichen Kreaturen für Geld und gute Worte nach Aiguebelle in Savoyen schaffen, wo es ihrer sehr viele gibt und wo sie sehr gut behandelt werden sollten. Sobald dieser Humanitätsakt bekannt geworden war, ward ich der ganzen Bevölkerung zum Abscheu. Der Pfarrer predigte gegen mich. Obwohl ich mir alle Mühe gab, den klügsten Köpfen des Fleckens auseinanderzusetzen, wie wichtig die Austreibung dieser Kretinen sei, obwohl ich die Kranken des Landes umsonst behandelte, schoß man in einem Waldwinkel mit der Büchse auf mich. Ich suchte den Bischof von Grenoble auf und bat ihn um einen Pfarrerwechsel. Monseigneur besaß die große Güte, mir die Wahl eines Priesters einzuräumen, der meinem Vorhaben Hilfe angedeihen lassen möchte, und ich hatte das Glück, einem jener Wesen zu begegnen, die vom Himmel herabgefallen zu sein scheinen. Ich setzte mein Unternehmen fort. Nachdem ich die Gemüter bearbeitet hatte, deportierte ich nächtlicherweile sechs andere Kretinen. Bei diesem zweiten Versuch hatte ich einige mir verpflichtete Leute und die Ratsglieder der Gemeinde zu Verteidigern, deren Habgier ich interessierte, indem ich ihnen bewies, wie kostspielig der Unterhalt dieser armen Wesen sei, und wie vorteilhaft es für den Flecken sein werde, die von jenen ohne Rechtstitel besessenen Grundstücke in Gemeindeländereien zu verwandeln, woran es dem Flecken fehlte. Die Reichen hatte ich für mich; die Armen, die alten Frauen, die Kinder und einige Starrköpfe aber blieben mir feindlich gesinnt. Unglücklicherweise konnte meine letzte Entführung nicht ganz vollzogen werden. Der Kretine, den Sie eben gesehen haben, war nicht nach Hause zurückgekehrt, hatte nicht ausgehoben werden können und fand sich andern Morgens als einziger seiner Art im Dorfe ein, wo noch einige Familien wohnten, deren beinahe schwachsinnige