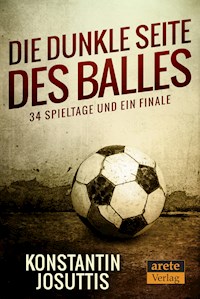Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arete Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Luxusdampfer Conte Verde sticht am 21. Juni 1930 in Genua in See. Mit an Bord sind Fußballer und Funktionäre, die zur ersten Fußball-Weltmeisterschaft nach Montevideo, die Hauptstadt von Uruguay, reisen. Die aufgeregte Vorfreude der Reisenden wird bald durch einen Todesfall getrübt. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, ist erst der Anfang einer Reihe besorgniserregender Vorfälle. Wird der ungarische FIFA-Vizepräsident Moritz Fischer der Identität des Mörders auf die Schliche kommen? Immerhin unterstützt ihn Jean Conan Doyle, Tochter des berühmten Autors der Sherlock Holmes-Kriminalromane. Und dann ist da noch eine mysteriöse Schönheit aus Uruguay, die mehrere Rollen zu spielen scheint. Während das ungleiche Trio versucht, weitere Mordfälle zu verhindern, ahnt niemand, dass die Schiffspassage der Conte Verde langsam, aber sicher in einer Katastrophe zu enden droht. "Der letzte Ball" verbindet spielerisch historische Fakten mit einer Reihe von spannenden, unvorhersehbaren Ereignissen und lässt eine Zeit wieder auferstehen, in der die Anreise zu einer Fußball-Weltmeisterschaft ebenso glanzvoll wie beschwerlich war und voller Gefahren steckte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die Familien Weiss und Josuttis, die nach dem Krieg aus Ostpreußen nach Deutschland geflohen sind und hier ein neues Zuhause gefunden haben, in dem ich das Privileg hatte, in Frieden und Freiheit aufzuwachsen.
Konstantin Josuttis
Der letzte Ball
Was 1930 auf der Conte Verde wirklich geschah
Ein Kriminalroman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
1. Auflage
© 2021 Arete Verlag Christian Becker, Hildesheim
www.arete-verlag.de
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Dies gilt auch und insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verfilmungen und die Einspeicherung sowie Datenvorhaltung in elektronischen und digitalen Systemen.
Umschlaggestaltung: Composizione Katrin Rampp, Kempten
Titelfoto: akg-images/De Agostini/Foto Studio Leoni
ISBN Buch: 978-3-96423-074-4
ISBN E-Book: 978-3-96423-075-1
Inhalt
Dramatis Personae
Prolog
18. Juni 1930 – Genua
1. Tag, 19. Juni 1930 – Fischer
2. Tag, 20. Juni 1930 – Smeralda
3. Tag, 21. Juni 1930 – Fischer
4. Tag, 22. Juni 1930 – Billy
5. Tag, 23. Juni 1930 – Moritz
6. Tag, 24. Juni 1930 – Smeralda
7. Tag, 25. Juni 1930 – Jean
8. Tag, 26. Juni 1930 – Moritz
9. Tag, 27. Juni 1930 – Jean
10. Tag, 28. Juni – Smeralda
11. Tag, 29. Juni – Moritz
12. Tag, 30. Juni – Jean
13. Tag, 1. Juli – Smeralda
14. Tag, 2. Juli – Moritz
15. Tag, 3. Juli – Jean
16. Tag, 4. Juli – Finale
Nachwort
Literatur
Danksagung
Dramatis Personae
FIFA
Jules Rimet, FIFA-Präsident
Annette, seine Tochter
Moritz Fischer, Vizepräsident
Jean Langenus, Referee
Henri Christophe, Referee
Thomas Balway, Referee
Henry Delauney, Committee Member
Konferenz der Organisation für interplanetarischen Frieden und Handel
Jean Doyle
Bojan Tarnoff
Madita Jörgensen
Herr Kramer
Herr Fietjestohl
Oberst von Woselitz
Harry Braithwaite (Jeremy Poulston)
Brittany Carlisle
Schiffsbesatzung
Amedeo Pinceti, Kapitän
Piero Calamai, Commandante in secondo, zweiter Kapitän
Abbad, libyscher Steward
Bruto Cavesi, Erster Offizier
Giovanni Giotta, Crewmitglied
Pupo, Maschinist
Trampolini, Maschinist
Dr. Bartoli, Schiffsarzt
Fußballer (eine Auswahl)
Rumänien: Iosif Czako, Alfred Eisenbeisser, Rudolf Steiner, Emerich Vogl, Adalbert Desu, Nicolae Kovacs, Constantin Stanciu, Rudolf Wetzer
Belgien: Bernard Voorhoof, Pierre Braine, Henri de Deken
Frankreich: Lucien Laurent, Marcel Langiller, Raoul Cadron (Übungsleiter)
Brasilien: João Coelho Neto, genannt Preguinho
Sonstige:
Edmund Lowe, Schauspieler
Lilyan Tashman, Schauspielerin, seine Frau
Smeralda Acuña Cortazar, zwielichtige Gestalt
Fjodor Iwanowitsch Schaljapin, Tenor
Marthe Nespoulous, Sopran
Andrea Manza, Faschist
Gunter Velg, deutscher Zahnarzt
Opfer:
Gheorghe Moldoveanu – Rumänien
Trampolini – Maschinist
Hugues Brasson – Frankreich
Tepp van Gertnick – Belgien
Damian Stanciu – Rumänien
Just Azincourt – Schiedsrichter Frankreich
Ignacio Callejo Palmeiro Del Campo – Brasilien
„Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, Ihnen zu erklären, dass dieses Schiff in vielerlei Hinsicht außerordentlich und letztendlich einzigartig ist.“ (Alessandro Baricco, Novecento)
PROLOG
Amsterdam, Olympiastadion
Die Amsterdamer Luft war kalt an diesem Sonntagnachmittag, aber Hans sah das als Vorteil an gegen die Urus, die sich bis zu diesem Viertelfinale immerhin gar nicht so schlecht geschlagen hatten, obwohl sie fußballerisch absolut hinterwäldlerisch agierten. Nerz hatte sie noch einmal auf die deutschen Tugenden eingeschworen, Kraft und Stärke, um diese wuseligen Kuhhirten zu besiegen. Das Problem war nur, dass die Deutschen nach dem Anpfiff kaum etwas vom Ball zu sehen bekamen. Die Urus liefen schneller und wenn Hans den Gegner stellen wollte, das ausholende Schussbein parat, dann war der Ball schon wieder bei einem Mitspieler. Als sie endlich einen vielversprechenden Angriff spielten und Hans den Ball auf halbrechter Position annehmen wollte, bekam er auf einmal einen Stoß von hinten, sodass er vornüber fiel. Er stand auf und schubste den grinsenden Gegenspieler seinerseits zu Boden. Der Schiedsrichter, ein Ägypter, gab ihm Gelb. Hans reklamierte und wies auf das vorherige Foul hin, doch fand er, alleine schon deshalb, weil der Ägypter ihn nicht verstand, kein Gehör.
Dann aber erreichte ihn erneut eine Flanke von Hoffmann, die er locker erlaufen konnte und danach würde er freien Zugang zum Tor haben. Hans zog am Gegenspieler vorbei, merkte aber plötzlich, dass er nicht vom Fleck kam. Der andere hielt ihn an den Hüften, die zugegebenermaßen durch ihre Breite auch ein gutes Ziel waren, fest. Wieder blickte Hans auf den Schiedsrichter, der aber keine Anstalten machte, das Spiel zu unterbrechen. Der gegnerische Verteidiger grinste ihn an. Hans stützte seine Arme auf die Knie und holte Luft. Er bekam nicht mit, wie die Urus das Tor erzielten, aber nun wurde ihm zum ersten Mal bewusst, dass der Einzug ins Halbfinale des olympischen Turniers gefährdet war. Er hetzte zur Mittellinie und flüsterte Hoffmann ins Ohr, dass er den Ball direkt in die Spitze spielen sollte. Er würde sofort loslaufen.
Der Plan schien zu klappen. Die gegnerische Mannschaft war nach dem Torjubel zu verdutzt, um zu bemerken, wie Hans auf das Tor zulief, den Ball am Fuß. Er sah in die zusammengekniffenen Augen des Torhüters und holte aus. Das nächste, an das er sich erinnern konnte, war, dass er auf dem Boden lag. Sein Schienbein schmerzte. Neben ihm lag ein Verteidiger, der sich ebenfalls das Bein hielt und laut stöhnte. Das war, so wusste Hans, unsinnig, denn der Mann hatte ihn ja mit den Stollen gegen das Standbein getreten. Noch während der andere den Kopf hin und herschwenkte, jaulend, blickte er Hans dabei immer wieder grinsend an. Der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für die Urus. Hans stand auf und bot dem anderen die Hand, um ihm hochzuhelfen. Dieser spuckte in seine eigene Hand und ergriff dann die ihm angebotene. Hans ließ fassungslos los. Dann ging er auf den Mann zu und trat ihm in den Bauch.
Als die Südamerikaner das Spiel mit 4:1 gewonnen hatten, saß Hans schon in der Umkleidekabine, im Anzug und mit frisch gekämmtem Seitenscheitel. Er wusste, es würde sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft sein. Er kannte diesen durchdringenden Blick von Nerz, dem Trainer. Und er wusste auch, dass er mit seinem Platzverweis schuld war, dass sie verloren hatten. Ohne seinen Ausraster hätten die deutschen Tugenden das unqualifizierte Spiel der Urus auseinandergenommen.
18. Juni 1930 – Genua
Der Mann mit dem hohen Stehkragen blickte hinunter auf die noch halb verschlafen im Dunkel liegende Bucht. Er war die ganze Nacht wach gewesen, beim ersten Dämmerlicht aufgestanden und hatte beobachtet, wie sich die Konturen des Stahlmonsters langsam vom Hintergrund des Mittelmeers abhoben. Das Schiff sah aus, als würde es gleich die zu klein wirkende Bucht von Genua auffressen. Es war, als hätte ein kleines Kind ein Bild gemalt, auf dem ein viel zu großes Boot in einem viel zu kleinen Hafen lag. Er zündete sich seine erste Zigarette des Morgens an und wie auf ein Zeichen erwachte auch das Monster zum Leben: Lichter gingen an der dem Festland zugewandten Seite an und dann leuchtete auch die lange Glühbirnenkette, die über die gesamte Länge des Schiffs reichte.
Der Mann ging vom kleinen Balkon in sein kleines Zimmer und holte seine Fahrkarte, die ihn als Gast erster Klasse auszeichnete. Er entfaltete das wertvolle Schriftstück, das ihm die Passage nach Montevideo gewähren sollte, und strich es liebevoll glatt. Dann blickte er wieder hinaus auf die sich langsam rötende Bucht. Das Monster gab einen lauten, dumpfen Ton von sich, der das gesamte Umland erzittern ließ. Der Hafen erwachte. Der Mann setzte sich, rauchte noch drei weitere Zigaretten und beobachtete, wie das Treiben langsam seinen Lauf nahm.
Mit kalten Augen schaute er auf die SS Conte Verde und sah, wie Menschen Ameisen gleich Pakete, Koffer und Kisten mit Vorräten die Gangway hinaufschleppten. Ein Lächeln umspielte das in die Dunkelheit starrende Gesicht, ein gefrorenes, grausames Lächeln.
1. Tag, 19. Juni 1930 – Fischer
1.
Die Hitze war schier unerträglich, bereits jetzt am Morgen, als er keuchend und schwitzend durch die engen Gassen Genuas streifte und den trotz des spärlichen Inhalts doch extrem schweren Koffer hinter sich herzog. Er hatte nur leichte Hemden eingepackt und natürlich die obligatorischen Anzüge für die offiziellen Anlässe bei der ersten Weltmeisterschaft, aber dennoch war ein Koffer nun einmal ein Koffer und sollte eigentlich vom Hotelfachpersonal zum Hafen getragen werden. Doch der Hotelbesitzer hatte Moritz Fischer freundlich mit einem mitleiderregenden Lächeln darauf hingewiesen, dass seine Söhne leider schon unterwegs seien, und er, armer, alter Mann, der er sei, daher höchstselbst diesen Kasten tragen müsse. Das hatte er dann auch bis um die nächste Straßenecke getan, sich dann wehleidig den Rücken gehalten und die andere Hand aufgehalten, um ein Trinkgeld zu erbitten, welches Fischer ihm aus einem völlig unsinnigen Reflex heraus auch noch gegeben hatte.
Es gibt, so dachte sich Moritz Fischer, seines Zeichens Vizepräsident der Weltfußballorganisation, zwei Arten von Müdigkeit: eine wohlig angenehme, die einen nach einem ausgiebigen Mahl befällt wie eine warme, weiche Decke, und eine unangenehm schwitzig schweißtreibende, die von einem zehrt, als wäre man ein alter Lastenesel. Leider war er jetzt schon am Morgen von einer Müdigkeit erfasst, die von der zweiten Kategorie war.
Nun stand er hier, im schattigen Dunkel der engen Gasse, nahm den oberen Henkel des mannshohen Gepäckteils und zog. Da er den Koffer hinter sich her hievte, bemerkte er nur an der Wärme, die sich auf seinem Kopf ausbreitete, dass er an einer breiteren Straße stehen musste und von keiner schattigen Häuserwand geschützt wurde. Als er sich umdrehte, blickte er auf eine Kirche, die in schwarz-weißen Streifen vor ihm thronte, und davor einen Platz, der mit allerlei Menschen gefüllt war. Er sah Marktleute, die ihre Waren ausfuhren, Schulkinder mit kurzen Hosen und hochgezogenen Strümpfen, Justiziare mit pomadierten Haaren, die aussahen, als seien sie zu schwarzen Nudeln verklebt, Reisende, die ziellos, aber staunend durch die Gassen irrten, und eine Gruppe zackig in schwarzen Hemden gekleideter junger Menschen, die den Platz durchschnitten wie ein scharfes Messer. Er blickte ihnen nach. Sie sahen sehr zielstrebig aus, als hätten sie ein Versprechen erhalten oder müssten eins einlösen oder vielleicht beides. Ein älterer Mann, der neben ihm stand und den er vorher noch nicht bemerkt hatte, spuckte neben ihm auf den Boden aus.
„Was sind das für Leute?“, fragte Fischer, der Italienisch beherrschte, sowie acht weitere Sprachen, was der Hauptgrund dafür war, dass Jules Rimet ihn als Vize der FIFA mitgenommen hatte anstelle von Seeldrayers, der der eigentliche Inhaber dieses Postens war. „Camicie nera – Il Milizia Volontaria per la Sucurezza Nationale.“
Fischer begann zu verstehen. „Faschisten“, sagte er und nickte. Er hatte schon von diesen Schwarzhemden gehört. Sie versprachen Besserung für alle. Das klang eigentlich ganz gut, fand er. Der Mann neben ihm, der der Gruppe, die soeben in einer dunklen Gasse verschwunden war, grimmig hinterherschaute, schien das anders zu sehen.
„Tolle Ideen sind nur so lange gut, bis ihre Vollstrecker über ihren Größenwahn stolpern“, sagte dieser und kratze sich dabei sein unrasiertes Kinn. „Na, die haben auf jeden Fall Großes vor“, sagte Fischer zu seinem Nebenmann, der ein weiteres Mal auf den Boden spuckte, seinen Karren mit Kohlköpfen aufnahm und vor sich herschob und „Vero, vero“ vor sich hinbrabbelte.
Fischer blickte sich um. Hier musste es doch irgendwen geben, der ihm mit seinem Koffer helfen konnte, dachte er verzweifelt. Aber niemand fand sich. So zog er das turmhohe Gepäck weiter an der Ehrfurcht gebietenden Steintreppe vorbei, an deren zwei Seiten ihn zwei Steinlöwen durchdringend anzusehen schienen. Nun, da er den Platz halb überquert hatte, sah er auf den Hafen und auf das riesige Schiff, das dort lag. Es war so groß, dass es wie ein schlafendes Krokodil wirkte, das sich in einem Flussausläufer auf die Lauer gelegt hat. Immerhin hatte er nun sein Ziel vor Augen. Er musste es nur erreichen. Zwei in schicken Fracks gekleidete Carabinieri mit überdimensionierten Hüten schritten die Straße ab und hielten an dem ein oder anderen Stand an und diskutierten die Qualität der dargebotenen Ware.
Ein Stück die Straße abwärts sah Fischer eine Gruppe von jungen Männern lachend vor einem Laden stehen. Sie hatten alle dunkelblaue Anzüge an und trugen dazu Baskenmützen, auf die ein Abzeichen gestickt worden war. Im Näherkommen erkannte Fischer das rumänische Wappen: ein Adler, auf dessen Brust die rumänischen Provinzen dargestellt waren – Walachei, Moldau, Siebenbürgen, Banat und Dobrudscha. Die Männer schienen sich über den Anblick des Mannes, der offensichtlich mit seinem Koffer zu kämpfen hatte, zu amüsieren. Dann aber löste sich einer aus der Gruppe und kam mit einem gewinnenden Lächeln auf Fischer zu. Er versuchte, ihm in gebrochenem Italienisch Hilfe anzubieten.
„Sie können gerne in Ihrer eigenen Sprache mit mir reden“, sagte Fischer, sich die Stirn mit einem Taschentuch abwischend. „Rumänisch, nehme ich an. Oder Ungarisch? Oder Deutsch?“ Die Miene des jungen Mannes im Anzug hellte sich auf. Er fuhr sich mit der Hand durch die dunklen, kurzen Haare und reichte sie dann Fischer. „Deutsch ist wunderbar. Ich heiße Alfred Eisenbeisser. Aber Sie können mich auch gerne Fredi nennen.“ „Donauschwabe?“, fragte Fischer. Eisenbeissers Augenbrauen schoben sich in die Höhe. „Woher wissen Sie?“ Fischer deutete auf die hinter ihm gaffende Menge, die nun nicht mehr belustigt, sondern eher interessiert schien. „Nun, Sie sind eine Gruppe von Menschen, die entweder Rumänisch, Deutsch oder Ungarisch spricht. Und Sie alle haben das Wappen Ihres Landes an ihrem Jackett. Daher gehe ich davon aus, dass ich es mit der rumänischen Fußballnationalmannschaft zu tun habe, nicht wahr?“
Eisenbeissers Lächeln wurde noch breiter. „In der Tat. Wir sind gestern hier mit dem Zug angekommen. Das war eine lange Tortur sage ich Ihnen. Vier Tage waren wir unterwegs. Holzklasse. Aber nun haben wir das gesparte Geld in ein paar schicke italienische Anzüge gesteckt. Kennen Sie sich etwa aus mit Fußball?“ Jetzt war es an Fischer, entsprechend zu lächeln. „Entschuldigen Sie. Ich hätte mich ebenfalls vorstellen müssen. Moritz Fischer. FIFA-Delegierter. Wir reisen zusammen.“
Sofort bildete sich eine Traube von Spielern um Fischer und einzeln stellten sich die jungen Männer vor, als allererster ein hochgewachsener junger Mann mit ernstem, kantigem Gesicht, der Kapitän der Mannschaft: „Rudolf Wetzer, angenehm.“ Fischer grüßte artig 23-mal zurück, bis er den immer noch grinsenden Eisenbeisser fragte, warum sie sich denn so dicke Wollanzüge hätten schneidern lassen und ob sie denn schon einmal für den Winter in den Karpaten hatten vorsorgen wollen. Eisenbeisser schaute Fischer einen Moment lang verunsichert an, dann lachte er.
„Sie nehmen mich auf den Arm, Herr Fischer, nicht wahr? Es wird, so habe ich gehört, verdammt kalt werden dort unten.“
Nun war es an Fischer, verunsichert zu lächeln. Er vermutete, dass der Rumäne geografisch nicht so versiert war und beließ es bei einem Nicken.
2.
Der restliche Weg war für Fischer kein Problem mehr. Willig stürzte sich die Traube der jungen Männer auf seinen Koffer, nachdem sich jeder einzeln bei ihm vorgestellt hatte, und schob diesen fröhlich zum Hafen, über die breite Mole und dann sogar die steile Gangway hinauf. Das Schiff hatte nicht nur aus der Entfernung pompös gewirkt. Als Fischer davorstand und auf die schwarz glänzende Hülle sah, hatte er allerdings nicht mehr die Vorstellung eines Monsters, eher war er fasziniert, dass diese riesige Maschine, von Menschenhand gebaut, tausende von Passagieren über den Ozean transportieren konnte. Die weißen Lettern „Conte Verde“ strahlten am Bug, als seien sie gerade noch frisch gewaschen worden. Der untere Teil des gewaltigen Schiffskörpers glänzte ölig in Schwarz, ab dem Deck war das Schiff in Weiß gehalten. Fischer blickte auf die riesigen Reihen von Stahl, die sich aufeinanderstapelten und endlich wurde ihm klar, woran das Schiff ihn erinnerte: an eine Stadt.
Er erinnerte sich dunkel an einen Film, den er vor drei Jahren gesehen hatte, damals noch auf Zwischenstation in Deutschland, der Film hieß „Metropolis“ – eine düstere Zukunftsvision von Maschinenwesen, die in einer überdimensionierten Großstadt lebten. Das absonderliche Werk hatte Fischer damals verstört und ihn diese bedrohliche Vision schon am Abend über ein bis vier Gläsern Cognac vergessen lassen, aber nun war die Erinnerung wieder wachgeküsst worden. Die Darstellung der unheimlichen Maschinenwelt ähnelte dem schwimmenden Monument, das vor ihm im Wasser lag. Auch die akkurat gekleideten Schiffsoffiziere, die hinter einem behelfsmäßig aufgebauten Tisch standen und die Tickets kontrollierten, kündeten eine neue Zeit an, eine Zeit der Ordnung, der Technik und er hatte das Gefühl, dass er sich nun wie Laich in einem Fischteich würde entspannen können – orientierungslos aber behütet.
Er hatte sich bei der rumänischen Mannschaft freundlich bedankt und den jungen Männern viel Glück gewünscht, mit dem Hinweis darauf, dass er sich noch ein wenig den Hafen anschauen wollte. Das war gelogen, aber er wollte nicht wie ein alter Mann wirken, neben den jungen, in ihrem Saft stehenden Sportlern, die die Rampe hinauf hüpften wie Hasen. Ein Steward nahm sich seines Koffers an, nachdem Fischer die Kontrolle passiert hatte und so trottete er gemütlich den Holzsteg hinauf, hielt sich immer wieder am gespannten Hanfseil fest und blickte zurück auf die Stadt, die zum Leben erwachte.
Erst jetzt sah er, dass es noch eine zweite Schlange gab, die den Menschenstrom in das Schiff formte. Am Bug des Schiffes gab es eine Planke, die über eine schwarze, geöffnete Tür in den unteren Teil des Schiffes führte. Die Planke war nicht weiß und glänzend, sondern schien eher einer riesigen Holztafel zu ähneln, auf der ein Strom von ärmlicher gekleideten Menschen den Gang in den Bauch des Monsters antrat. Diese Menschen hatten Mäntel an, trugen Taschen und Koffer. Es waren zumeist jüngere Menschen, manchmal ganze Familien, doch auch aus der Entfernung konnte Fischer sehen, dass ihre Augen nicht den Glanz des Abenteuerlichen ausstrahlten, der die Reisenden der ersten Klasse vereinte. Fischer bekam seltsamerweise ein schlechtes Gewissen, als er diese Menschen sah, die unter anderen Umständen als er die Überfahrt antraten. Er wusste, dass er es hier mit den Opfern der durch die Weltwirtschaftskrise ausgelösten Armut zu tun hatte. Diese Menschen gingen nicht nach Übersee, um sich den Freuden eines Spiels hinzugeben, sondern um ein neues, besseres Leben zu beginnen. Er drehte sich wieder dem Aufgang auf das Schiff zu.
Moritz Fischer war gespannt auf diese Reise, die ihn zur allerersten Weltmeisterschaft im Fußball führen würde, fürchtete aber gleichzeitig die Weiten des Meeres, die ihn erwarteten. Zwei Wochen würden sie sich auf diesem unheimlichen Wesen aufhalten, bevor sie in Uruguay erwartet wurden, und Fischer hoffte, dass er genügend Zeit haben würde, um auf Deck zu liegen und seiner Lieblingslektüre zu frönen: Sherlock-Holmes-Geschichten. Seitdem er in London für British Railways gearbeitet hatte, hatte er sich in den Detektiv aus der Baker Street verliebt, der so einen starken Kontrast zu ihm darzustellen schien: Er selbst war kein Meister glasklarer logischer Rückschlüsse, sondern eher ein Liebhaber guten Essens und netter Gesellschaft. Diese Eigenschaften waren es auch, die ihn im Weltverband so weit hatten aufsteigen lassen. Nicht nur war er wortgewandt in der eigenen und versiert in acht fremden Sprachen, er besaß die Fähigkeit, mit Menschen jeden Schlages ins Gespräch zu kommen, sie für sich zu gewinnen, zu umgarnen und ihnen sogar schon nach kurzer Zeit das Gefühl zu geben, dass sie freundschaftlich mit ihm verbunden seien. Er war ein Genießer, und im Gegensatz zu den meisten seiner Art schätzte er die Gesellschaft anderer ebenso wie einen guten Wein oder ein gutes Essen. Es hatte also von Seiten Rimets nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht, um ihn zum Mitkommen nach Südamerika zu überreden. Fischer wusste, dass er das Bindeglied zwischen den Funktionären aus Uruguay und der Spitze der FIFA sein würde und er freute sich ebenso auf die Gespräche auf Spanisch mit den Männern des ansässigen Fußballverbandes wie auf das von Rimet als ausgezeichnet beschriebene kulinarische Erlebnis auf dem Schiff. Fischer sah schon Pfifferlingssteaks und in Rotwein gebratene Wachtelschenkel vor sich, bis ihm klar wurde, dass er sich nun direkt vorm Schlund des Schiffes befand. Zwei schwarze Türen waren aus dem Inneren herausgeklappt worden und Fischer hatte das Gefühl der Unausweichlichkeit, als er einen Schritt über den letzten Teil der Gangway tat, wobei er bemerkte, dass sich in einem kleinen Schlitz zwischen Planke und Schiff das glitzernde Wasser erblicken ließ, das beängstigend weit entfernt schien. Schluckend trat er über die Schwelle und fühlte sich von einem biblischen Tier verspeist, wobei er sich selbst nicht ganz klar darüber war, ob dies nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Schnell dachte er an weitere Köstlichkeiten, die die Kombüse des Dampfers hervorbringen würde: Einen in Armagnac flambierten Ochsenrücken mit Kohl, eine Tarte mit frühen Kartoffeln und feinem italienischem Käse – der erste Anflug von Angst war auf gutem Wege, bekämpft zu werden.
„Signor Fischer?“ Eine hohe, sympathische Stimme riss ihn aus seinen Vorstellungen. Er drehte sich um und sah einem hoch gewachsenen, dürren Maat in die großen Augen. Der Mann stellte sich mit einer tiefen Verbeugung vor und bot sich an, Fischer zu seiner Kabine zu führen. Fischer nahm dankend an und trippelte sofort den militärisch akkuraten Schritten seines Führers hinterher. Der Raum, in den sie getreten waren, wirkte auf den ersten Blick imposant. Der Fußboden und die Wände waren mit glänzendem Holz getäfelt, wobei die Wände immer wieder mit Stuckmustern und putzigen Putten verziert waren. Während sich Fischer das Innere des Wals, in den er eingestiegen war, dunkel vorgestellt hatte, stellte er nun fest, dass auf den oberen Decks größere Fenster in die Außenwände eingebracht waren, sodass die italienische Sonne sich ihren Weg mühelos zu den luxuriösen Reizen des Dampfers bahnen konnte. Fischer und der Maat passierten einen Empfangsschalter in dem großen Vorraum, den sie betreten hatten, und bogen nach links in einen etwas kleineren Gang ein, der nun seinerseits von in die Wände eingelassenen Lüsterlampen erleuchtet wurde. Dann bogen sie wieder nach rechts ab, bis sie an einer Mahagoniholztür ankamen, die der Maat behände aufschloss und mit einer Verbeugung Fischer den Weg hinein wies, wo zu dessen Überraschung bereits sein Koffer und daneben ein breit grinsender Matrose standen. Fischer bestaunte die Größe des Raumes, der über einen massiven Holzschrank, einen Tisch und zwei mit hohen, sich nach außen stülpenden Lehnen und mit Leder bezogene Stühle verfügte. Direkt gegenüber fand sich eine Chaiselongue, die zu einem Nickerchen einlud, doch Fischer wurde vom grinsenden Matrosen noch in das Nebenzimmer zur Linken geführt, in dem sich sein Bett und ein weiterer Schrank befanden. Erst jetzt fiel Fischer auf, dass er keine Schritte mehr vernommen hatte, weder die eigenen, noch die des anderen Mannes. Der Grund war ein dick gewebter Wollteppich mit orientalischem Muster, der jegliches Klappern oder Knarren von Schuhabsätzen oder Kofferrädern verschluckte. Fischer ging wieder in sein Wohnzimmer. Als er sich umdrehte, um aus dem Fenster hinaus auf die Stadt zu schauen, bemerkte er, dass der Matrose immer noch lächelnd in seiner Kabine stand. „Scusi“, sagte er daraufhin eilig, kramte in seiner Jackentasche nach ein paar Lira und schüttete diese dem erfreuten Mann in die ausgestreckte Hand. Erst als der Kerl wieder leise, aber doch mit einer triumphierenden Note, die Tür hinter sich verschlossen hatte, wurde Fischer klar, dass er unsinnig viel Geld in die Hand des Kofferträgers gedrückt hatte. Er huschte zur Tür, blickte hinaus auf den Gang und rief dem Mann hinterher, der sich, immer noch grinsend, umdrehte. „Ich, ähh …“ Ein Mann in einem Mantel mit Hermelinkragen stolzierte mit seiner mit Juwelen behängten Frau das blitzblanke Deck herab. Auf einmal war Fischer sein Protest peinlich und so bestellte er schlicht einen Cognac.
3.
Das Nickerchen war wohltuend gewesen, wenn auch unnötig. Er hatte eigentlich an Deck gehen und sich die Stadt noch einmal von der Seeseite anschauen wollen, war aber dann über dem Cognac ein wenig weggedöst. Dieser Ohrensessel lud aber auch geradezu dazu ein, die Sorgen des Alltags gegen einen sanften Schlummer der Vergessenheit einzutauschen. Dazu hatte ihn ein gedämpftes Brummen in den Schlaf versetzt, ein Brummen, das noch immer zu vernehmen war, und es schien ihm, als würde der Boden unter ihm vibrieren. Er tat dieses Gefühl der ihn stetig umgebenden, zittrigen Bewegung als Einbildung ab, als Überbleibsel seines wohltuenden Schlafes. Nun schloss er seine Kabine von außen ab, um erst einmal das Schiff zu erkunden. Ein kleiner Aperitif später an der Bar konnte nicht schaden und dann hätte er immer noch genügend Zeit, um sich vor dem Ablegen die Genoveser Bucht anzusehen.
Er ging den Gang hinab und beschloss, einfach seiner Lust und Laune zu folgen. Daher ging er nach rechts und fand hinter züchtig von roten Kordeln zurückgehaltenen Samtvorhängen einen Raum, der ihn an die Speisesäle der luxuriösesten Restaurants, in denen er mit Rimet diniert hatte, erinnerte. Säulen verzierten die hohen Wände, der Boden war wieder mit orientalischen Teppichen belegt, die Decke war mit einer Himmelsszene bemalt, in der kleine Engelchen frohlockend umherflatterten und in römischen Gewändern gekleidete Damen und Herren auf Diwanen Trauben verspeisten. Ein Ober deckte die Tische ein und verbeugte sich artig, als er Fischer hineintreten sah. In der Mitte des Saales führte eine breite Marmortreppe auf das nächste Deck hinauf und wie in Trance stieg Fischer nach oben, um festzustellen, dass das nächste Stockwerk mit demselben Pomp ausgestattet war, allerdings hier in diesem oberen Speisesaal die Farbe Grün vorherrschte. Die Tische waren in noch breiteren Abständen verteilt und die jeweiligen Außenwände wurden von einem Kamin verdeckt. Über dem Kamin auf der linken Seite prunkte ein wuchtiges Ölgemälde, welches einen stolzen Reiter in einer wilden Regennacht darstellte. Unter dem goldenen Rahmen befand sich ein Messingschild, auf dem der Name des Mannes stand: Conte Verde – der grüne Graf. Dies war offensichtlich der Saal für die besonders ehrenwerten Gäste, dachte sich Fischer und durchquerte den Raum, um an eine Treppe zu gelangen, die nach ein paar wenigen Stufen in einen weiteren Saal führte. Hier herrschten dezente, matte Farben vor, die schweren Wollteppiche, die auf dem blanken Parkett lagen, waren beige und an der Pforte, wieder hinter einem Vorhang, stand ein Steinengelchen, das eine Harfe spielte. Fischer befand sich im Musiksaal. Ein paar wenige Sitzecken standen an den Außenwänden des großen Saales, an dessen Ende, vor einem roten Vorhang, auf einer Bühne ein großer, schwarz glänzender Flügel prunkte. Am Boden der Bühne, auf Augenhöhe des Zuschauers, stand eine kleine Staffelei, in die ein Foto eines imposanten Mannes eingespannt war. Beim Näherkommen sah Fischer, dass das Plakat die kommenden Abende bewarb, an denen Fjodor Iwanowitsch Schaljapin seine Sangeskünste zum Besten geben sollte. Etwas kleiner darunter fand man noch den Namen von Marthe Nespoulos, ebenfalls eine Opernsängerin. Fischers anfängliche Sorge, dass die 16 Tage der Überfahrt ihm aufs Gemüt schlagen könnten, löste sich nach und nach in Luft auf. Er ging langsam, wie verzaubert, zurück in den Speisesaal, von dort aus wieder deckab in den ersten Speisesaal, den er durchquert hatte. Ihn überkam das Gefühl, dass er nun das ganze Schiff für sich entdecken wollte, wie ein Marco Polo, noch bevor die breite Masse auf das Schiff strömen würde. Beflügelt vom eigenen Unternehmungsgeist verließ er den Saal durch eine der hinteren Türen. Er musste sich, auch das stand auf seiner Agenda, noch unbedingt merken, was an Bord Backbord und was Steuerbord genannt wurde. Für ihn gab es zunächst nur rechts und links, aber bevor er zu lange über die Problematik sinnieren konnte, befand er sich in einem weiteren Flur, der Badezimmer für Damen anzeigte, die er fluchtartig mit einer Treppe nach unten zu umgehen versuchte.
Urplötzlich und unvermittelt überkam ihn eine seltsame Angst, nicht fassbar zunächst, eher wie ein Klumpen in der Magengegend, aber trotz des ihn umgebenen Pomps hatte er das Gefühl, von der samtigen Haut der Wände und Teppiche berührt und im Bauch des Wals erdrückt zu werden. Er musste wieder hoch, und zwar schnell. Er stürzte über die in der Mitte des Schiffes liegende Treppe zwei Stockwerke hoch, bis er, vorbei an weiteren Kabinen der ersten Klasse, eine Tür fand, hinter der ihm milchiges Tageslicht entgegenleuchtete. Dann stürzte er an die Reling und blickte hinaus aufs Mittelmeer, das in beruhigender Beständigkeit vor ihm schaukelte und gleichzeitig absolute Ruhe ausstrahlte. Er atmete tief durch und wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn. Die Schiffsbesichtigung musste verschoben werden, das war ihm klar. So machte er sich auf den Weg zu seiner Kabine, diesmal allerdings an der Reling entlang, bis er am Bug eine Treppe nach unten fand, die ihn auf sein Deck führte. Schnell wollte er noch einen Blick auf die Genoveser Küste werfen, fand aber zu seiner anfänglichen Beunruhigung auf der anderen Seite (war es die Backbord- oder Steuerbordseite?) ebenfalls nur Meer vor sich. Erst jetzt wurde ihm klar, was es mit dem durchdringenden Brummen, das ihn seit dem Aufwachen begleitet hatte, auf sich hatte: Das Schiff hatte abgelegt. Er fühlte sich ein wenig betrogen, dabei allerdings auch schuldbewusst, so als ob er vorzeitig ejakuliert hätte. Es schien ihm, als habe er einen essentiellen Teil der vor ihm liegenden Reise verpasst. Aber Fischer wäre nicht Fischer, wenn er den Ärger über die verpasste Abfahrt nicht kurz und schnell abschütteln konnte. Er nahm einen tiefen Luftzug, mit dem er seine Lungen mit einer Prise Meersalz füllte und ging wieder ins Schiffsinnere. Dort angekommen sah er eine Familie an einer Treppe stehen. Trotz der sommerlichen Temperaturen hatten Mann, Frau und Kinder Mäntel an und ihre Blicke schienen leer und ausgemergelt. „Emigrati“ stand auf einem schlichten Metallschild, das über der Tür, durch die die Menschen stiegen, hing. Schnell marschierte Fischer in die entgegengesetzte Richtung, um zu seiner Kabine zu gelangen. Er hatte einen Plan, seiner seltsamen Stimmung Herr zu werden. Den Gang hinablaufend kam er an weiteren Gängen vorbei, lief nun entschlossen zu seiner erdachten Rettung, als er, nachdem er einen Quergang passiert hatte, plötzlich innehielt und sich langsam umdrehte. Vorsichtig schob er seinen Kopf um die Ecke. Er schluckte. Hielt den Atem still.
Moritz Fischer war in einem fürchterlichen Konflikt gefangen. Er wollte sich die Schweißtropfen, keineswegs durch körperliche Anstrengungen verursacht, vom Gesicht wischen, müsste dazu aber in sein Revers greifen, was ihn dazu bewegen würde, sich zu bewegen. Das aber wäre möglicherweise fatal, da es zu unerwünschten Geräuschen führen könnte. Das Bild, das sich vor ihm auftat, wollte er keinesfalls durch eine unbedachte Bewegung zerstören. Im Gegenteil, er wollte diesen Moment trotz seiner Unerfülltheit festhalten und sich das Gemälde, das sich vor ihm auftat, an die Wände seiner Erinnerung hängen. Eine recht junge Dame hatte sich einen der mit gold-rotem Samt bezogenen Stühle an die Gangwand gestellt und nestelte an einem Belüftungsschacht herum. Dabei stand eines ihrer Beine so weit ab, dass Fischer, und das war es, was ihm die Schweißausbrüche bereitet hatte, ihren perfekt geformten Unterschenkel sehen konnte, oder besser gesagt, ihre weißen Strümpfe, ja sogar die Strumpfbänder, die diese hielten. Er hatte das Gefühl, er müsse zu diesen Strümpfen gehen, sie zärtlich berühren, sie streicheln und küssen, zart wie ein Hühnerschenkel taten sie sich vor ihm auf. Auf der anderen Seite wollte er keinesfalls diesen Blick loslassen müssen, der ihm solch wunderbare Gefühle bereitete. Und daher stand er noch eine geschlagene Minute an der Ecke des Ganges und starrte auf die Dame, die irgendetwas an eben jener Belüftung zu suchen schien. Endlich war der Zauber gebrochen – sie quiekte (so wunderbar unschuldig aber, dass Fischer noch mehr Selbstdisziplin aufbringen musste, um sie nicht an sich zu reißen, obwohl er noch nicht einmal ihr Gesicht gesehen hatte) und stieg vom Stuhl herab, wobei sie sich umdrehte und etwas verwundert Fischers Kopf um die Ecke lugen sah. Dieser wiederum war sprachlos. Das Geschöpf, das für ihn vorher nur aus einem Unterschenkel bestanden hatte, welchen er zugegebenermaßen zwar vergöttert, aber in keinster Weise in einen Zusammenhang mit einem menschlichen Wesen gebracht hatte, war auf einmal auf der Evolutionsleiter ein paar Stufen nach oben geklettert für ihn. Er hatte es ohne Zweifel mit einem Engel zu tun. Die Dame, die ihn anblickte, hatte lockiges, goldenes Haar, dünne, zerbrechliche weiße Haut, volle, tiefrote Lippen und die schwärzesten Augen, die er jemals gesehen hatte. Sie trug eine weiße Bluse, die an den Ärmeln weit geschnitten war, die es allerdings nicht vermochte, ihren üppigen Busen zu tarnen, der sich gegen den ächzenden Stoff drückte, als sie den Stuhl herabstieg. Dazu trug sie einen schwarzen, knielangen Rock, der Fischer in Ansätzen träumen ließ. Dennoch bemerkte er wohlgefällig ihre ausladenden Hüften. Als er sie mit eingefrorenem Blick ansah, fing sie an zu lächeln und sagte: „Oh.“ Fischer, momentan seiner sprachlichen Fertigkeiten beraubt, wiederholte: „Oh.“ Die Dame, sie mochte Mitte Zwanzig sein, lachte und stellte somit ihre perfekten weißen Zähne zur Schau. Sie deutete zum Schacht und erklärte: „La Chiave.“ Fischer schluckte. Sie schaute ihn erwartungsvoll an und erzählte ihm dann in gebrochenem Italienisch etwas von Zimmer und Schlüssel. Verzweifelt versuchte Fischer herauszufinden, was er tun sollte. Als er ihr antwortete, kam ein Gemisch aus Ungarisch, Italienisch, Spanisch und Englisch heraus: „I kulcs no cammere.“ Sie fing an zu lachen, lauthals. Als sie ihn erneut ansprach, stellte sich heraus, dass sie Spanisch sprach und endlich legte sich der Nebel, der sich über Fischers Hirn verdichtet hatte. Er bot ihr an, ihr zu helfen, immer noch unsicher, immer noch um die Ecke blickend, bis schließlich ein Steward den Gang entlanggetrabt kam und der Dame die Zimmertür öffnete.
„Mein Name ist Smeralda“, hauchte sie ihm noch zu, bevor sie sich zur Tür wandte. „Smeralda Acuna Cortazar“. Und mit diesem, von glockenheller Stimme vorgetragenen Namen hüpfte er jubilierend in sein eigenes Zimmer, das nur ein paar Schritte den Gang hinab lag, bevor ihm klar wurde, dass er vollkommen vergessen hatte, sich ihr selbst vorzustellen.
4.
Fischer hatte versucht, seiner Mutter zu schreiben, war jedoch nur bis zu einer liebevollen Anrede gekommen. Nach der Begegnung mit der unglaublich anziehenden Schönen hatte er ein seltsam schlechtes Gewissen gehabt und sich an den Mahagonitisch seiner Kajüte gesetzt. Unzufrieden wedelte er das Papier durch die Luft, damit die Tinte der zwei Wörter trocknete, legte den angefangenen Brief nieder und machte sich auf den Weg.
Der Dinnersaal war halb gefüllt. Moritz war zunächst in den Saal auf seinem Stockwerk gegangen, doch ein freundlicher älterer Steward nahm sich unauffällig seiner an und führte ihn, ohne große Worte zu verlieren, eine Etage nach oben. Zunächst war Fischer gar nicht klar, weshalb dieser Saal eine ganz andere Atmosphäre ausstrahlte als der untere. Dann fiel ihm das Licht auf. Der Saal funkelte in den verschiedensten Farben. Goldene Töne gingen über in satte grüne, welche wiederum von aquamarinem Glitzern abgelöst wurden. Fischers Blick ging an die Decke des Saales. Ein gewaltiger Glaspavillon krönte die majestätischen Säulen, die den Raum umrandeten. Jetzt sah er, dass das Mosaik der zusammengesetzten Glasstücke dasselbe Bild darstellte, das er schon über dem Kamin gesehen hatte: einen Ritter, dessen Pferd sich im Regen aufbäumte. Die untergehende Sonne schoss ihre Strahlen in einem solchen Winkel durch die gefärbten Gläser, dass die bunten Facetten sich auf den Wänden, den Tischen und Stühlen auf zauberhafte Weise spiegelten und der grüne Graf, seiner ursprünglichen Form beraubt, durch den ganzen Saal ritt.
Erst als er ein Hüsteln vernahm, drehte sich Fischer wieder dem Steward zu, der geduldig neben ihm stand und darauf wartete, den Gast an seinen Tisch zu geleiten. Erst jetzt nahm Fischer den Mann richtig wahr: Er hatte ein dunkles Gesicht, das von einem glatten, schwarzen Schnurrbart sauber in zwei Hälften geteilt wurde. Die Augen blitzten ihn schwarz an, die Nase war gerade und groß und der Mund war von einem matten Rot, das nur südländische Menschen auszeichnete. Der Mann hob seinen weißen Arm in einer zarten, schüchternen Geste, um den Gast zu einem der Tische zu geleiten.
„Signore.“
Aus irgendeinem Grunde mochte Fischer ihn auf Anhieb, spürte eine Zuneigung, die er in all den Jahren, in denen er sie zu den unterschiedlichsten Menschen in seinem Inneren grummeln hören konnte, nie hatte erklären können, die aber nichtsdestoweniger vorhanden war. Eine der Eigenschaften Fischers, die ihn dazu befähigt hatten, als Vermittler für die erste Weltmeisterschaft auf Reise zu gehen, war seine Fähigkeit, Verbindung zu Fremden herzustellen.
„Sie sind kein Italiener?“, fragte er den Steward, als sie gemeinsam auf den mit weißer Tischdecke eingedeckten Tisch zugingen. Als er keine Antwort vernahm, sah er den Mann milde lächeln.
„Ich komme aus Libyen.“
„Ihr Italienisch ist ausgezeichnet.“
Wieder nickte der Mann nur, ob aus Bescheidenheit oder aus anderen Gründen, vermochte Fischer nicht zu erraten. Der Tisch, an dem er nun saß, war groß und rund. Er hatte Platz für fünf weitere Gäste. Ihm gegenüber saß ein hochgewachsener Herr, der deshalb auffiel, weil er eine Augenklappe über dem rechten Auge trug. Er hatte sauber nach hinten geschniegelte, schwarze Haare und einen Bart, dessen besonderes Merkmal die geschwungenen Enden des Schnurrbarts waren. Wie Fischer trug er ein Dinnerjacket, dazu ein weißes Hemd und eine Fliege. Der Mann stand auf und verbeugte sich knapp. „Bojan Tarnoff“, stellte er sich vor. Fischer verbeugte sich ebenfalls und grüßte zurück. Sie setzten sich und nachdem der libysche Ober ihnen roten Wein aus dem Burgund eingeschenkt und Fischer die Nationalität des Mannes herausgefunden hatte, prosteten sie sich mit einem kräftigen „sa znakómstwa“ zu.
Nach kurzer Zeit kam man darauf zu sprechen, was einen auf die Reise auf dem Schiff geführt habe. Fischer erklärte mit der Zurückhaltung eines Bohemians, dass er lediglich zu einem Sportfest in Südamerika eingeladen worden wäre, was den Russen dazu veranlasste, in ausgeschmückter Ausführlichkeit von seiner Mission zu erzählen. Tarnoffs Blick war dabei so intensiv und durchdringend, dass Fischer ganz froh darüber war, dass der Mann eine Augenklappe trug. Zwei Exemplare des Auges, das sich auf ihn heftete, wären schwer erträglich.
„Härr, Fischärr. Sie wissen nicht, was uns alle hiär zusammentreibt. Äs ist aine Sache von außärgewöhnlischär Dringlichkait.“
Fischer nickte demütig und von der kaum verhohlenen Eitelkeit des Mannes fasziniert.
„Äs ist nur aine Fraage där Zait, bis äs zum Zusahmenträffän kommän wird.“
„Zusammentreffen?“
„Där Kulturän.“
„Ahh.“ Fischer tat so, als verstünde er sein Gegenüber.
„Där Kontakt ist noch nicht härgestäält, abär es wird noch in diesäm Jahrzeähnt dazu kommän. Und dann müssän wir vorberaitet sain.“
Wieder nickte Fischer.
„Äs gibt verschiedenste Belegä für außerirdische Kontaktaufnahme. Wir sollten also gewappnät sain.“
„Außerirdisch? Sie meinen wahrscheinlich …“ Ja, was meinte der Mann?
„Außerirdisch. Genau. Himmälssignale. Lichtzaichen. Inskriptionän. Äs gibt einen Haufen Belegä, abär die Wissenschaft schaut immer noch wääg. Unsärä Gesellschaft wird das Zaitalter där Kommunikation ainlaitän.“
„Ihre Gesellschaft.“
Tarnoff zückte eine Karte aus seinem Revers. In weißer, geschwungener Schrift las Fischer: „Gesellschaft für interplanetarischen Frieden und Handel“. Fischer war augenblicklich so verlegen, dass er sich veranlasst sah, dem ihm gegenübersitzenden Mann zuzustimmen, so unsinnig schien ihm die Angelegenheit, der dieser sich verschrieben hatte. Er stammelte etwas von „vorausschauend“ und „weise“, wurde rot, brabbelte weitere Unsinnigkeiten vor sich hin und wurde letztendlich durch das Eintreffen der anderen Tischgäste von seinem Dilemma befreit.
Zu Fischers Erstaunen nahm der Kapitän des Schiffes Platz, ein junger, forscher Mann mit einer energisch wirkenden Stirn und einem Habitus, der auf unbestechliche Zielstrebigkeit hindeutete. Sein Gruß war kurz und militärisch: „Amedeo Pinceti“. Ohne die Hand in einem kräftigen Griff loszulassen, stellte der Kapitän noch seinen ersten Offizier vor, einen gewissen Bruto Cavesi, der trotz seines eher jugendlichen Alters nur wenige Haare auf dem Kopf hatte, die er allerdings kunstvoll mit Haarwichse von steuerbord nach backbord (oder umgekehrt?) gelegt hatte. Der Mann hatte ein etwas unangenehm breites Grinsen, das er anscheinend, selbst wenn er es gewollt hätte, nicht ablegen konnte.
Nachdem man sich (auf Italienisch) begrüßt hatte, bemerkte Fischer, dass er seine normale Fähigkeit, mit anderen Menschen auf angenehme Art und Weise Belanglosigkeiten auszutauschen, kurzzeitig verloren hatte. Er fühlte sich verwirrt, benebelt und fragte sich, woran das wohl liegen konnte, als er die momentane geistige Ermattung an dem Duft festmachte, der ihn betörte. Es duftete in der Tat nach Rosen. Und noch bevor er sich umdrehen konnte, spürte er eine zartgliedrige Hand auf seiner Schulter, die einmal kurz, aber kräftig, als wolle sie eine Begabung konstatieren, zudrückte. Fischer wusste sofort, wer neben ihm stand. Der Kapitän stand auf und rief erfreut: „Ahh, Signorina Cortazar. Bitte setzen Sie sich doch.“ Fischer schluckte. Er wusste, dass er verloren war. Die Person, die sich in den für sie vom ersten Offizier nach hinten gezogenen Stuhl setzte, löste in ihm gleichzeitig Panik und vollkommene Erfüllung aus. Nachdem er sich hustend und stotternd vorgestellt hatte, was, wie er sich vollkommen sicher war, die anderen Herren am Tisch zu einem genüsslichen Lächeln veranlasste, schaute sie ihn mit halbgeschlossenen Lidern an und nickte ihm kurz zu. Fischer bildete sich ein, dass er in diesem Moment ihre Gedanken lesen konnte: „Aber das weiß ich doch, du Dummerchen. Wir kennen uns doch schon.“ Bevor er sich aber weiter in die Auswüchse seiner Anbetung hineinsteigern konnte, wurde er erneut durch den Kapitän gerettet. „Der letzte in unserer Runde. Willkommen, Herr Eisenbeisser.“ Fischer war durchaus erfreut, jemanden am Tisch zu haben, mit dem er sich, was Kommunikation anging, auf sicherem Gebiet bewegen konnte. Der Saal hatte sich inzwischen allgemein gefüllt und die ersten Gläser klirrten.
„Meine lieben Gäste“, so hob Pinceti an, „Lassen Sie mich Sie begrüßen und Ihnen an Bord eine wunderbare Zeit wünschen. Falls Sie sich wundern – als Kapitän dieses Schiffes geselle ich mich gerne zu meinen Passagieren, in abwechselnder Reihenfolge selbstverständlich. Sollten Sie also irgendwelche Fragen an mich haben, zögern Sie bitte nicht, mir umgehend zu sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ich möchte betonen, dass …“ Das plötzliche Innehalten des Schiffsführers ließ auch seine Zuhörer für einen kurzen Moment erstarren. Der Tisch schaute den Kapitän gebannt an, welcher wiederum seinen Blick an die Wand heftete. Sein Gesichtsausdruck hatte eine unschöne Härte angenommen. Alle blickten dorthin, worauf sein Blick gerichtet war: An der Wand hing ein Bildnis Mussolinis, der Kopf mit Tarbusch. Der Duce sah durchaus wohlwollend aus.
Bewegungslos zischte der Kapitän: „Wer hat dieses Bild dort aufgehängt?“ Cavesi schnellte hinauf wie ein braver Schüler und sagte, immer noch grinsend: „Ich, Herr Kapitän. Unser Duce.“ Damit deutete er auf das Bild. Mittlerweile schauten auch die Gäste von den Nachbartischen herüber. „Dort“, sagte der Kapitän sehr langsam, „hängt das Portrait unseres wahren Herrschers“, und nun donnerte jedes einzelne Wort wie eine Kanonenkugel: „Il Principe Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia, Principe Ereditario d’Italia.“ Zum ersten und einzigen Male sah Fischer, wie das Lächeln im Gesicht des Offiziers gefror.
„Mit Verlaub, Capitano, aber Herrscher ist unser allseits geliebter Führer, der Duce.“ Nun drehte sich zum ersten Male das Gesicht des Kapitäns zu seinem Untergebenen. „Auf diesem Schiff bestimme immer noch ich, wer oder was an den Wänden hängt. Sie hängen dieses Bild von der Wand, Cavesi! Jetzt! Sofort!“
Cavesi blickte seinem Vorgesetzten nur einen kurzen Augenblick ungläubig in die Augen, dann nahmen seine Gesichtskonturen einen verhärteten Ausdruck an, er stand auf und trottete zur Wand, hob langsam, fast zärtlich seine Hände, um das ihm wertvolle Gemälde abzunehmen. Er war sich einen kurzen Augenblick unsicher, wohin er die Reliquie bringen sollte, blickte an den Tisch, wo ihm Pinceti mit einer Kopfbewegung den Weg nach draußen wies. Ohne sich die Demütigung anmerken zu lassen, trabte der Offizier zum Treppenaufgang, kam geraden Schrittes zurück und setzte sich an den Tisch.
Nachdem sie das Schauspiel schweigend beobachtet hatten, führten die anderen Gäste im Saal ihrerseits ihre Gespräche fort. Um die Stimmung etwas aufzuheitern, sagte Fischer: „Nun, die Welt befindet sich im Wandel. Bolschewisten oder Faschisten. Alle scheinen gute Ideen zu haben, wie der Alltag einer modernen Welt aussehen könnte.“
Pinceti schnaubte verächtlich. Nun meldete sich Eisenbeisser zu Wort: „Ich für meinen Teil muss dem Kapitän zustimmen. Monarchie hat noch nicht ausgedient. Schließlich haben meine Mitreisenden und ich es unserem König zu verdanken, dass wir diese Reise antreten können.“ Fischer wusste, was der Mannschaftskapitän der Rumänen meinte. Er beneidete Eisenbeisser um dessen Fähigkeit, die Wogen zu glätten, ohne jemanden dabei zu verurteilen. „Unsere Majestät, Carol der Zweite, ist seines Zeichens selbst ein großer Fan des Fußballsports. Daher hat er persönlich dafür gesorgt, dass die rumänische Mannschaft an der ersten Weltmeisterschaft teilnehmen kann.“
Cavesi hustete fast dazwischen, offensichtlich nicht in der Lage, sich zurückzuhalten: „Nachdem er gerade aus dem Exil zurückgekehrt ist, weil er sich mit einer jüdischen Metze verlustiert hat.“
Pincetis Gesicht wurde kalkweiß. Doch sein Offizier war noch nicht fertig.
„Jetzt unterwandert der Jude schon die Monarchie. Ist doch unglaublich …“
Pinceti stand auf und legte dabei seine Serviette auf den Tisch.
„Cavesi, was erlauben Sie sich?“
„Selbst auf diesem Schiff hier fuhr diese Negerin mit und hat den Herren die Köpfe verdreht.“
„Wenn ich mich recht erinnere, Cavesi, waren Sie der erste, der Josephine Baker bei jeder Gelegenheit hinterhergestarrt hat. Aber das nur am Rande. Sie verlassen diesen Tisch.“ Die Stimme des Kapitäns, sonst in seiner Ruhe auf natürliche Weise autoritär, hatte nun eine bedrohliche Lautstärke angenommen, die Intensität eines Schiffshorns, das das unerbittliche Kommen des Stärkeren ankündigte.
„Stimmt doch …“, setzte Cavesi kleinlaut nach, stand dann aber auf.
„Ab heute werden Sie Ihre Mahlzeiten in der Kombüse einnehmen.“
Der Offizier schien sichtlich getroffen zu sein, seine Augenbrauen zogen sich für einen kurzen Moment zusammen und offenbarten den Anflug von Aufruhr, es war aber nur ein kurzer Ausrutscher, dann ging der Mann mit breiten Schritten aus dem Saal. Es dauerte eine Weile, bis an den anderen Tischen wieder das Klirren von Besteck auf Tellern zu hören war und das erste leise Flüstern das erneute Aufnehmen von Konversation ankündigte.
„Ich bitte diesen unschönen Zwischenfall zu entschuldigen, meine lieben Gäste. Der schwarze Schürhaken des Faschismus reicht weit, aber ich versuche, so es geht, auf meinem Schiff Tradition als Wert zu erhalten.“ Damit setzte er sich wieder.
Smeralda Acuna Cortazar wandte sich mit einem bezaubernden Blick dem Rumänen zu, als sei nichts geschehen.
„Ich liebe Fußball, wissen Sie? Diese mannhafte Art der körperlichen Ertüchtigung. Das Messen der Kräfte auf eine spielerische und doch kämpferische Art …“
„Unnötig“, befand Bojan Tarnoff. „Die Wält hat dringändärä Problämä.“
Da noch niemand außer Fischer wusste, welche genauen Schwierigkeiten den Mann beschäftigten, wandten sich die anderen nun dem Russen zu. Erst nachdem dieser seine Ideen ausgeführt hatte, bemerkte Fischer – wie er sich eingestehen musste, mit einiger Zufriedenheit – dass die anderen die Ideen, die die Organisation für interplanetarischen Handel und Frieden vertrat, genauso absonderlich fanden wie er. Immerhin schaffte es Eisenbeisser sein Interesse derart zu heucheln, dass es nicht aufgesetzt klang und dennoch das Thema beendete. „Faszinierend, muss ich sagen. Sie haben Recht, Herr Tarnoff. Wer von uns kann schon ausschließen, dass sich da draußen anderes Leben befindet? Wie lange ist es her, dass wir den Kontinent, den wir nun mit diesem Schiff besuchen werden, Amerika, erst entdeckt haben? Dreihundert Jahre? Und nun findet dort dieses Fest für alle Nationen statt, das, wie Sie vielleicht nicht wissen, meine Damen und Herren, von unserem lieben Herrn Fischer hier ins Leben gerufen wurde.“ Nun wandte sich die blonde Schönheit, die ihr rüschenbesetztes, tief ausgeschnittenes Dekolleté dem Fußballer zugewandt hatte, in ihrer vollen Pracht ihrem rechten Sitznachbarn zu. „Sie, Herr Fischer?“ Fischer wurde rot, wurde aber vom Servieren der Suppe gerettet. Es gab eine Sahne-Crevetten-Consommé. Bescheiden wies Fischer das Lob mit dem Hinweis von sich, dass er nur ein ausführendes Organ wäre – nur ein Mitläufer. Danach löffelte die Gruppe schweigend ihre Suppe, als ob die Wucht der vorangegangenen Auseinandersetzung erst verspätet ein stilles Echo fand.
Mittlerweile war die strahlende Sonne draußen einer glühenden Dämmerung gewichen, sodass die Lichtfacetten ihren Ton verändert hatten und nun in einem sanften Leuchten die Gesichter der Anwesenden umspielten. Fischer fiel auf, dass der Ober auch den Platz, an dem Cavesi gesessen hatte, eingedeckt hatte und dort jetzt das Sahnehäubchen auf der Suppe langsam in seinen rosafarbenen Untergrund verfloss.
„Alle sprechen von der Macht des Volkes – aber es ist immer das Volk, das den Preis bezahlt“, nahm unerwartet und plötzlich Eisenbeisser das heikle Thema der Tagespolitik wieder auf. Niemand äußerte einen Einwand, als seien sie alle Verschwörer in einer unsicheren Umgebung. „Ich hoffe“, nahm Fischer das Thema auf, „dass Sie, Herr Kapitän, keinen Ärger bekommen werden.“ Wieder Schweigen. Ein steifes Stück gewalkter Seide drückte sich an Fischers Seite. Eine Hand berührte zart, vorsichtig und kurz die seine. Sein Herz schien stillzustehen. Er hatte die verrückte Idee, dass Smeralda ihn belohnte für sein Mitgefühl.
Die Konversation blieb den Abend über stockend. Eisenbeisser und er tauschten sich noch über moderne Fußballtaktiken aus – dass man statt mit fünf Stürmern nur mit vier spielen könne, um somit in der Verteidigung nicht so anfällig zu sein. Ansonsten beschränkte man sich auf den üblichen Austausch von Belanglosigkeiten. Pinceti schien abwesend zu sein, entschuldigte sich vor dem Dessert und verabschiedete sich in Richtung Deck. Als Fischer endlich seinen Grappa getrunken hatte und sich alleine am Tisch fand, sah er, bevor er sich zum Aufstehen wandte, ein kleines Zettelchen neben sich liegen, auf dem nur eine kurze Information zu finden war: „Zimmer 104“. Verwirrt stolperte er in seine Kajüte, zog sich aus, wusch sein Gesicht, zog sich seinen Pyjama an und legte sich in seine Koje. Von draußen kam immer noch ein Schimmer Sonnenuntergangs durch den Vorhang. Er wälzte sich hin und her. Nach einer halben Stunde stand er auf, zog sich seinen Bademantel an und marschierte den Gang hinab.
5.
Sie stand in der Tür, als hätte sie ihn erwartet. Während sie am Abend noch durch den Kontrast des unschuldig weißen Kostüms mit ihren roten Lippen auf Fischer Eindruck gemacht hatte, überzeugte nun die angedeutete Nacktheit ihres fülligen Körpers. Fischer schluckte. Er betrachtete das Negligé in schwarz unter dem lilafarbenen Nachthemd, das so eng auflag, dass man ihre Konturen nicht nur erahnen, sondern förmlich mit jedem Blick erschmecken konnte. Im Zusammenspiel mit ihren offenen blonden Haaren und ihrem engelsgleichen Gesicht, das nun eine teuflische Note um den Mundwinkel zu tragen schien, verkörperte sie das Sinnbild der Sünde.
Musste er etwas sagen? Sich rechtfertigen? Auf einmal kam er sich dumm vor, wie er vor ihr stand und in seinem Kopf kramte er fieberhaft nach einer Ausrede, warum er sie zur Nachtzeit besucht hatte – dass er keinen Waschlappen hätte (nein, das wäre zu anzüglich), dass er ihr noch eine gute Reise wünschen wolle (was für ein Quatsch), dass er noch einmal feststellen wollte, dass er ja nur der Vizepräsident sei, und das auch nur vorübergehend (klang auch lahm). Sie zog ihn am Revers seines Bademantels in ihre Kajüte und drückte ihm ihre feuchten Lippen auf seine. Dann öffnete sie mit ihrer Zunge fordernd seinen Mund und fiel in sein Reich ein wie Napoleon in Belgien. Bevor er sich versah, fand er sich seines Bademantels ledig und am Boden liegend wieder, während sie an den Knöpfen seiner Schlafanzughose nestelte. Ihre vollen Brüste baumelten vor seinem Gesicht wie eine Geburtstagstorte, die es anzuschneiden galt. Er berührte sie, was sie zu einem verzückten Quietschen veranlasste, und dann, bevor er sich versah, hatte sie ihn umfangen, ritt auf ihm, als überquerten sie den stürmischen Atlantik und nicht das seichte Mittelmeer, gurgelte, krächzte, schrie, und ihm schwanden die Sinne und er verlor sich in seinem und ihrem Körper bis zu einer taumelnden Ekstase, die in einer krallenden Umarmung endete. Er saugte noch ein wenig an ihrer pfirsichweichen Haut, sog ihren Rosenduft ein und fiel dann auf dem weichen Teppich in einen erfüllten Schlaf.
Er erwachte unter einer schweren Federdecke. Etwas kitzelte seine Brust, und als er immer noch müde und erfüllt an sich heruntersah, beobachtete er ihre schlankgliedrigen Finger, die seine Brustwarze umkreisten. Vorsichtig drehte er sich zu ihr, um feststellen zu können, ob er schlief oder ob sie vielleicht gar nicht sie war, sondern eine Katze, die ihren Weg an sein heimisches Bett gefunden hatte und ihn aus einem Traum erweckte. Doch er blickte nur in die schelmisch grinsenden Augen von Senorita Cortazar und bevor er sich versah, war ihre Hand in tiefere Regionen gewandert und flocht sich einen Weg durch sein Schamhaar. Er zog die Decke, die sie beide bedeckte, ein wenig nach unten, um ihren Körper besser sehen zu können und stürzte sich mit seinem Mund schon auf ihrem Hals, ihre Schultern und saugte sich den Weg herab, was erneut ermutigende Seufzer aus ihr hervorrief. Das zweite Mal war langsamer, vorsichtiger und er versuchte, mehr bei Bewusstsein zu bleiben, was schwierig war, da er immer wieder an den scheinbar unlösbaren Kontrast zwischen seiner eigenen massiven Körpergröße und ihrer weiblichen Eleganz erinnert wurde, sobald er den Genuss mit den Augen erfahren wollte. Fast sah er sich versucht, sie zu fragen, was denn eine Schönheit wie sie von ihm wollen könne, als sie seinen Namen keuchte und in einen Singsang aus spanischen Wörtern einstimmte. „Oh Moritz“, hauchte sie immer wieder zwischendurch, was ihm auf eine gewisse Art zumindest die Zweifel nahm, dass sie ihn verwechselt haben könnte.
Er schlief wohlig und warm, das Schiff schaukelte und eine Hand strich ihm sacht über den Rücken. Die zwei Male, in denen er kurz erwachte, wünschte er sich, die Zeit möge stehenbleiben und schlief lieber schnell wieder ein, damit er der Bedrohung des Aufwachens noch möglichst lang entkommen könne.
Irgendwann aber zwängte sich ein zarter Lichthauch durch die Vorhänge hindurch und kündigte den unvermeidlichen nächsten Tag an.
Vorsichtig setzte er sich auf, ohne sich umzusehen stand er auf und tastete sich nach vorne. Einen schattenhaften Umriss auf dem Boden erkannte er als seinen Morgenmantel. Er hob ihn auf und schlich zur Tür, wobei er mit einem Bein gegen eine Tischkante stieß. Er biss sich auf die Zunge und öffnete so leise wie möglich die Tür nach draußen. Auf dem Gang empfing ihn eine undurchdringliche Finsternis. Noch bevor er nachdenken konnte, hatte er die Tür hinter sich verschlossen und fluchte leise. Er wusste, wie er zu seiner Kabine zurückfinden konnte (links, rechts und nochmals rechts), aber er wollte nicht noch einmal eine unliebsame Bekanntschaft mit einer Wand oder einem ihn aus der Dunkelheit attackierendes Mobiliar machen. Also begab er sich auf alle Viere und kroch vorwärts. Wenn es einen Beobachter dieser seltsamen Szenerie gegeben hätte, so hätte er Moritz Fischer vielleicht für einen Bären gehalten, aber das keuchende und brummende Wesen, das sich durch die Gänge schlich, war niemand anderes als der FIFA-Vizepräsident. Seine Strategie hatte Erfolg: Ohne sich weiter zu verletzen, kam der Bär in seiner Höhle an, durchquerte sein Vorzimmer, mittlerweile wieder auf zwei Beinen, da das Bullauge die ersten Lichtstrahlen in die Kajüte durchließ, und kletterte auf sein eigenes, noch immer frisch riechendes Bett. Er starrte an die Decke und träumte mit offenen Augen den Traum noch einmal durch, den er diese Nacht erlebt hatte.
2. Tag, 20. Juni 1930 – Smeralda
1.
Sie hatte gemerkt, wie er aufgestanden war, sich heimlich angezogen und verstohlen die Kajüte verlassen hatte. Natürlich hatte sie es gemerkt. Die Fähigkeit, jede Bewegung und jedes damit verbundene Vorhaben des Bettpartners vorauszusehen, hatte sie erst so weit gebracht, wie sie jetzt war. Sie hatte sich diese Fähigkeit in einer harten Schule antrainiert. Danach, als er gegangen war, war sie kurz aufgestanden, hörte ihn zwischenzeitlich draußen auf dem Gang poltern und wusch sich. Sie schüttelte die Bettdecke aus, wobei ihr ein abgerauchter Stumpen einer Zigarre des großen Mannes, den er in der Tasche seines Bademantels gehabt haben musste, entgegengeflogen kam. Als sie hinter die Jalousien blickte, sah sie auf einen frischen Morgen. Ein paar vom Sonnenlicht noch nicht absorbierte Sterne funkelten noch auf der Wasseroberfläche. Sie seufzte und setzte sich an den Mahagonisekretär, in dem sie die Liste der Männer aufbewahrte.
Wie immer nach solch einer Nacht fragte sie sich, ob sie in ihrem Leben die richtigen Entscheidungen getroffen hatte, und wie immer kam sie zu dem trotzigen Entschluss, dass es so sei. Sie befand sich in einer Luxuskabine auf einem Luxusdampfer. In zwei Stunden würde sie sich einen Tee bringen lassen. Sie war, das war unbestritten, eine Schönheit. Sie war glücklich.
Und dann, wie immer, wenn sie innerlich so mit sich rang, schlich sich dieser andere Gedanke an: Aber sie war verloren. Nicht verdorben oder schmutzig, sondern verloren. Das Körperliche, bedrohlich nahe an ihrem Beruf prallte mittlerweile an ihr ab. Es war Teil des Opfers, das sie brachte, Teil der Arbeit und in wenigen Fällen war es zuweilen angenehm. Das, was ihr der Beruf allerdings genommen hatte, war mehr als nur ihre körperliche Unschuld. Sie rühmte sich mittlerweile, nachdem sie in etlichen Etablissements gearbeitet und sich langsam, aber sicher immer weiter in gesellschaftliche Schichten hochgearbeitet hatte, das Wesen des Menschen im Allgemeinen und des Mannes im Besonderen zu kennen. Und das war ernüchternd. Selbst die eloquentesten, bestgekleideten, ehrlichen, ernsthaften und prüdesten Exemplare dieser Gattung waren an einer Stelle verwundbar, hatten diese eine Schwäche, diesen Trieb, der im Zweifelsfall ihr ganzes Tun und Treiben bestimmte. Das war auf mitleiderregende Art erniedrigend für die Spezies Mann. Denn sie hatte ihren Vater so lange geliebt, bis er gestorben war und sie das kleine Dorf am Lago Rincon verlassen hatte. Und sie hatte an das geglaubt, was er ihr immer erzählt hatte, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes seien und im Grunde ihres Herzens gut. Aber wenn sie alle so anfällig waren – dann war der Grund ihres Herzens, so rein er auch sein mochte, verfärbt von einer milchig trüben Flüssigkeit, die sich in die Reinheit aller mischte. Nicht dass die Frauen besser wären. Smeralda hatte zwei Typen im Laufe ihres Lebens kennengelernt: Die, die mit allen Mitteln von der Schwäche des Mannes profitieren wollten (zu diesem Typ zählte sie sich selbst), und solche, die Männer für ihre Schwäche abgrundtief verachteten. Es gab natürlich auch welche, die eine Mischform mit Ausgiebigkeit praktizierten. Beide Positionen waren Variationen eines und desselben Gifts, das Desillusionierung hieß. Deshalb war sie verloren. Sie glaubte nicht mehr an das Gute im Menschen. Sie war verloren, weil eine Frau auf die Stärke des Mannes angewiesen war. Aber der Mann war als solcher schwach.
Smeralda strich mit ihrem rechten, schlanken und weißen Zeigefinger über das etwas vergilbte Foto Fischers, der sie anstrahlte. Im grünen Licht der sanft glimmenden Schreibtischlampe wirkte sein Konterfei etwas dicklicher als die Wangen, die sie vor Stunden noch in den Händen gehalten hatte. Von seiner ungestümen Art ließ sich schließen, dass er unverheiratet war, aber das hatte sie schon vorher gewusst. Er war das leichteste Ziel ihrer Arbeit gewesen. Die anderen, sie blätterte weiter, würden sich als schwieriger erweisen, aber keinesfalls – und das war Teil ihres Dilemmas – unmöglich. Auf seine Art war er unschuldig und süß gewesen und sie hatte ihn mit einem ernst gemeinten Kuss belohnt, woraufhin er schleunigst und laut schnarchend eingeschlafen war. Sie stieg, nachdem sie erst jetzt durch einen kurzen Schauder bemerkt hatte, wie kalt ihr war, in frische, seidene Unterwäsche und legte sich ins Bett zurück. Es ist ein gutes Leben, dachte sie sich dabei, ein gutes Leben.
2.
„Signora wünschen noch etwas?“
Smeralda winkte ab. Vor ihr tat sich ein wahres Potpourri kulinarischer Frühstückskunst auf. Sie hatte frische Melonen, gelbbraun gebackenen, duftenden Toast, eine überflüssig große Auswahl an Marmeladen (gelb, orange, rot, hellrot, braun, blau), vorgeschnittene Butterstückchen auf einem weißen Tellerchen, knusprig gebratenen Schinken, Tomaten, Gurkenscheiben, Brot, Salz, Pfeffer, Rührei, gekochtes Ei, gekochtes Wachtelei, eine Tasse Tee und daneben eine Kanne Kaffee (man kannte ihre Vorlieben offenbar bereits) und einen frisch gegrillten Fisch auf dem Tisch. Smeralda kannte sich nicht aus mit Fischen, aber dieser hier sah einladend aus, das verschwommene Auge schien milde zu blicken und der geöffnete Mund offenbarte so etwas wie Absolution. Sie aß langsam, blickte dabei immer wieder in den großen Saal, der ihr diese begehrte Ersatzbefriedigung bescherte. Die großen, orientalischen Teppiche, die üppigen Blumenbouquets, die Kronleuchter, die so zerbrechlich herabhingen, die weißen Säulen, die die Wände zierten, das fluoreszierende Licht, das durch die Glaskuppel in den Saal schien – all das war für sie Illusion genug, um sich innerlich zu entspannen.
Der Saal, in dem sie sich befand, war noch nicht gefüllt, es würden noch Passagiere an Bord kommen, wichtige Passagiere, Passagiere, um die sie sich kümmern würde müssen. Aber immerhin waren es ungefähr die Hälfte aller Menschen, die ihr Frühstück einnahm und über den Saal verteilt an ihren Tischen saß. Sicher waren einige Frühstücksgäste schon früher hier gewesen und wahrscheinlich würden auch noch einige kommen.