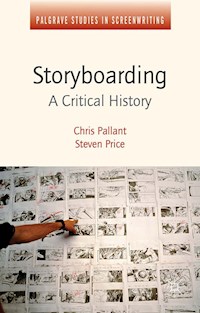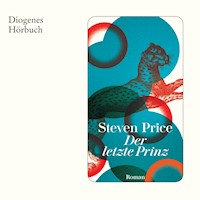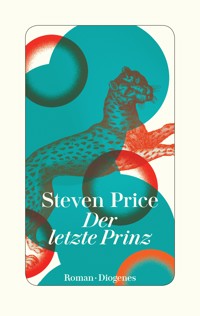
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sizilien, 1955: Giuseppe Tomasi ist der Letzte im Geschlecht der Lampedusa. Melancholisch streift er durch das staubige Palermo und ignoriert seine prekäre finanzielle Situation. Als bei ihm ein Lungenemphysem diagnostiziert wird, beschließt Tomasi, etwas Bleibendes zu schaffen. Der 59-Jährige schreibt den weltberühmten Roman ›Der Leopard‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Steven Price
Der letzte Prinz
Roman
Aus dem Englischen von Malte Krutzsch
Diogenes
Für Lorna Crozier
und in Erinnerung an Patrick Lane
Und im Schlaf weitet sich der Schlaf
wie ein zweiter unerträglicher Körper.
Valerio Magrelli
Annäherung an das Monster
Januar 1955
In seiner kleineren Bibliothek verwahrte er einen gebrochenen weißen Stein, wie ein Stück Koralle, den ein Zuckerhändler am Naturhafen von Lampedusa aufgelesen hatte. Nachmittags hielt er diesen Stein ins Sonnenlicht und ließ seine kantige, schwere Wahrheit auf sich wirken. Er war der Fürst dieser Insel, doch wie alle ihre Fürsten hatte er nie ihre Küste gesehen, nie einen Fuß auf sie gesetzt. Besuchern sagte er ironisch: Das ist eine Feuerinsel am Rand der Welt; wer könnte da leben? Er fügte nicht hinzu: In der Verbitterung einer großen Familie lebt man immer. Er präsentierte nicht den Stein und sagte: Das ist etwas Totes, und doch wird es mich überleben. Er war der Letzte seines Geschlechts, nach ihm kam nur noch Auslöschung.
Als er ein Junge war, hatte seine Gouvernante ihm erzählt, der Sand Siziliens stamme aus der Sahara, und das hatte er sein Leben lang weitergegeben, wenngleich er nicht wusste, ob es stimmte. Er stellte sich vor, wie der Sand in rot schimmernden Hitzeschleiern übers Meer geweht wurde, nordwärts getragen vom heißen Wind des Schirokko, der über die Insel Lampedusa hinwegstrich. Jeden Morgen nach dem Aufstehen ging er seine Terrasse an der Via Butera entlang, und seine Schritte, die sich im über Nacht herangewehten Sand abzeichneten, führten zu der niedrigen Steinmauer über dem Foro Italico, wo sie wie Geisterspuren endeten, denn dort blieb er stehen und schaute hinaus in den beginnenden Tag, weg von Sizilien und dem Meer des Südens dahinter und der fernen Feuerinsel seiner Ahnen.
Er mochte Palermo nicht mit seinen staubigen Pflastersteinstraßen, seinen Trümmern vom letzten Krieg. Obwohl ihm klar war, dass er hier in seiner Geburtsstadt sterben würde, empfand er keine Liebe zu ihr, sondern eine bittere Verlassenheit. Es gab größere Leidenschaften als die Liebe. Liebe war belanglos, kurzlebig, absurd menschlich. Er hatte England geliebt, Paris geliebt, schicksalsergeben seine Leidenszeit in österreichischer Gefangenschaft während des Weltkriegs geliebt, war per Eisenbahn und Kutsche nordwärts nach Lettland gereist und hatte die vorüberrollenden dunklen nordischen Waldweiten geliebt. Und doch war er immer wieder hierher zurückgekehrt, in eine ungeliebte Stadt, zu seiner Mutter, der Fürstinwitwe, als sie noch lebte, zu den historischen Straßen mit dem Namen seiner Familie, als sie tot war. Schon als Kind im Palazzo seines Vaters hatte er die tiefgelegene Stadt als teuflisch und glühend heiß empfunden. Ihr Staub wallte vom Meer herauf, während die Fähren aus Neapel mit den hitzebetäubten Menschen an Bord sich träge heranschoben. Das allein hatte sich nicht geändert. Jetzt, wo er alt war und in der Mitte eines neuen Jahrhunderts in einem heruntergekommenen Palazzo am Meeresrand lebte, beobachtete er von seinem Standort hoch über dem Hafen die sich leerenden weißen Decks, als suchte er jemanden, den er verloren hatte.
Noch in Pantoffeln und Morgenmantel stand er da, wischte Sandkörner von der Mauerkrone und rieb zerstreut die Finger aneinander, um so vielleicht das Unglück der Nacht zu vertreiben und in den Tag hineinzufinden.
Seit die Amerikaner über die Insel gefegt waren, wohnte er mit seiner Frau Alessandra in der einen Hälfte eines Palazzos im mittelalterlichen Viertel von Palermo, in der engen Via Butera, hinter verglasten Fenstern mit Blick aufs Meer. Fragte man ihn danach, antwortete er, es sei zwar sein Haus, aber nicht sein Zuhause. Sein wahres Zuhause stand mehrere Straßen entfernt hinter dicken Mauern in einem Haufen geborstenen Steins und windverwitterter Baureste, das Werk einer über den Atlantik beförderten Bombe, deren einziger Zweck darin lag, die Welt, wie sie einmal war, auszuradieren. Diese Bombe fiel im April 1943, und im selben Monat wurde das Anwesen seiner Frau in Stomersee im hohen Norden Lettlands von den Russen überrannt. Beide waren auf einen Schlag heimatlos und verwaist. Jetzt durchwanderte er die Straßen seiner Stadt als ein anderer Mensch, einer, den der Verlust des Gewesenen nicht befreite, sondern belastete. Denn er war auf einem Mahagonitisch in dem verlorengegangenen Palazzo in der Via di Lampedusa geboren worden und hatte seine ganze Kindheit hindurch bis ins Erwachsenenalter und auch noch zehn Jahre nach seiner Heirat allein in einem kleinen Bett dort im Zimmer seiner Geburt geschlafen, und er wusste nicht, was aus ihm werden sollte ohne Zugang zu diesem Raum.
Daran dachte er jetzt oft, wenn er allein im Frühlicht aufstand, sich eine Decke um die Schultern schlang und leise am Schlafzimmer seiner Frau vorbeiging. Seine Mutter war nach dem Waffenstillstand todkrank in diesen Palazzo zurückgekehrt und hatte ihr letztes Lebensjahr in den Trümmern verbracht. Seine Frau fühlte sich der alten Welt von Palermo nicht derart verbunden. Wenn Alessandra Wolff einen Raum betrat, schloss sich eine Tür und sperrte das Licht aus. Sie war Linguistin, Leserin von Literatur, die einzige Psychoanalytikerin Italiens und arbeitete bis spätabends mit den Patienten in ihrer Bibliothek, und er liebte sie wegen ihres Verstandes und ihrer geteilten Einsamkeit. Sie war die Tochter der Sängerin Alice Barbi, der letzten Muse des Komponisten Brahms, und als ihre Mutter sich wiederverheiratete, wurde sie die Stieftochter seines Onkels Pietro in London. Als sie sich kennenlernten, erinnerte er sich, hatte er kein Wort herausgebracht. Sagen Sie Licy zu mir, Cousin, verlangte sie gleich. Ihm gefielen ihr schwarzes Haar, ihre noch schwärzeren Augen und ihre breiten, starken Schultern, in denen die Kraft einer Bühnensopranistin lag. Schon als er sie vor dreißig Jahren in London zum ersten Mal zu Gesicht bekam und sie noch mit ihrem ersten Mann verheiratet war, hatte er sie für attraktiv und distanziert gehalten. Dass so viel Zeit vergangen war, verblüffte ihn. Er sah in ihr noch dieselbe Frau wie damals, älter als er, weltgewandter, eine Frau, die ihm auf der Straße immer ein paar Schritte vorausging und über ihre Schulter hinweg mit ihm redete, ohne sich umzudrehen, und deren strenge Anmut mit Arroganz verwechselt werden konnte. Dabei war so viel Zärtlichkeit in ihr. Und weil sie intelligent und nicht von klassischer Schönheit war, hatten ihre Ansichten es Männern oft unmöglich gemacht, ihre Gesellschaft zu ertragen, und das gefiel ihm auch an ihr.
An einem Morgen Ende Januar wurde er wegen der Ergebnisse eines Lungenfunktionstests zu seinem Arzt bestellt. Er war mit Schmerzen aufgewacht, hatte sein Bettzeug zerknüllt und war, als er die weichen weißen Füße auf den Boden schwang, über ein ihm neues Schwindelgefühl erschrocken, eine Kurzatmigkeit, als hätte sein Körper nun ernsthaft beschlossen, ihn im Stich zu lassen.
Diese Empfindung hatte sich gelegt, doch als er frühstücken gehen wollte, packten ihn an der Biegung der hohen Marmortreppe wieder die Schmerzen, und er krallte sich mit weißen Fingerknöcheln an das Geländer, die Porträts seiner Ahnen im Halbdunkel über sich, und zerrte keuchend am Knoten seiner Krawatte. War es nur Einbildung? Er legte zwei Finger ans Herz und atmete. Tatsächlich spürte er seit neuestem eine innere Unruhe, die er so nicht kannte. Beim Abendessen gestern hatte er seiner Frau nichts von dem Arzttermin gesagt, sondern nur still gelächelt und Licy gefragt, wann er so alt geworden sei.
Bäume sind alt, hatte sie ungerührt erwidert. Fürsten kommen in die Jahre.
Aber irgendetwas stimmte nicht mit ihm. An dem kleinen Tisch in der Diele rückte er seinen Hut zurecht und musterte nachdenklich das Gesicht im Spiegel. In seiner Brust stieg ein Schmerz auf und legte sich wieder.
Au, dachte er.
Und wehmütig strich er die Fältchen an seinen Augen glatt.
Er hatte die mittleren Jahre hinter sich gelassen, wie andere aus einem Zimmer gehen, einfach so, als könnte er jederzeit wieder zurück. Er war neunundfünfzig. Seit dem Waffenstillstand 1918 hatte er jede wache Stunde seines Lebens geraucht. Seine Augenfältchen verdankten sich einer Traurigkeit, einer Scheu, die schon aus seinen Kindheitsfotos sprach. Damals war er sich in Gesellschaft Erwachsener dumm vorgekommen, und das Gefühl kannte er nach wie vor. Mit seiner leisen Art und seiner Ironie hatte man ihn zeitlebens für einen guten Zuhörer gehalten, obwohl er das Spiel des Lichts immer schon interessanter fand als ihm anvertraute Misslichkeiten. Er liebte die Einsamkeit und gutes Essen und war seit seiner Rückkehr aus England in den 1930er-Jahren dick geworden, von Palermos Zuckergebäck dann noch dicker. Da er Autos nicht mochte, lief er am Stock durch sein Viertel, schwerfällig, vornübergebeugt, im schmerzenden Körper eines zwanzig Jahre älteren Mannes, immer ein oder zwei Bücher unter den Arm geklemmt. Er trug einen feschen kleinen Schnurrbart wie schon in seiner Jugend, das geölte Haar glatt nach hinten gekämmt, und stieg jeden Morgen in einen feinen blauen Anzug, der längst aus der Mode gekommen war. Seit über einem halben Jahrhundert las er unersättlich auf Italienisch, Französisch und Englisch. Il Mostro nannten ihn seine Cousins, weil er die Bücher so verschlang. Das Monster.
Er traf pünktlich um zehn in der Praxis ein, und Dr. Coniglio empfing ihn sofort. Etwas merkwürdig Steifes am Benehmen des Arztes beunruhigte ihn, so dass er sich auf schlechte Neuigkeiten gefasst machte. Er kannte Coniglio seit Jahren. Sie waren im gleichen Alter. Ein großer, eleganter Mann mit kräftigen Schultern, sauberem, gestärktem Kragen und unweigerlich hochgekrempelten Ärmeln. Er mochte ihn, die Herzlichkeit seiner Ansprache, die Klarheit seiner Züge, wie Sonnenschein auf dem Gehweg. Coniglio hatte auch seine Mutter am Ende ihres Lebens behandelt, als sie in den zerstörten Mauern des Palazzo Lampedusa im Sterben lag, hatte eigens dafür die lange Fahrt von Capo d’Orlando nach Palermo auf sich genommen. Bis zum Krieg war er der Hausarzt seiner Cousins, der Piccolos, gewesen, die er daheim in ihrer Villa Vina betreute, und erst in den letzten fünf Jahren hatte er die Praxis in Palermo eröffnet. Jetzt, wo er die neuen Praxisräume sah, fiel ihm ein, wie seine Mutter Coniglio immer angeschaut hatte, so kühl abschätzend aus zusammengekniffenen Augen. Auch sie hatte ihn als feinen Gentleman betrachtet. Auch sie hatte ihn nicht gern neben ihrem Sohn stehen sehen.
Er hielt sich zwar nicht für schüchtern, doch ergriff ihn eine gewisse Scheu in Gegenwart solcher Männer – Männer, die ihn seines Standes wegen achteten, Männer, die es von sich aus zu etwas gebracht hatten, Männer, die wussten, was sie wollten, Männer von Welt. Ihre gewinnende Art machte ihn verlegen, ihr Selbstvertrauen verunsicherte ihn. Er merkte, wie er ins Stocken geriet, vorsichtig wurde, zauderte, bis der Moment für einen sich doch immer anbietenden Konterspruch oder trockenen Witz verpasst war. Stattdessen senkte er die schweren Lider, lächelte matt und sah sein Gegenüber hilflos an.
Erst als ihn der Arzt bat, Platz zu nehmen, knöpfte er seinen Wintermantel auf und setzte sich. Er nahm den Hut ab, legte die zusammengefalteten Handschuhe hinein und klemmte den Gehstock zwischen seine Knie. Vorsichtig stellte er die halbgeöffnete Ledertasche neben sich, aus der die in Papierförmchen steckenden glasierten kleinen Kuchen von seinem Frühstück bei Massimo hervorschauten und der Rücken des für später eingepackten Buches, Die Pickwickier, ihn anglänzte. Schon griff er nach den Zigaretten in seinem Jackett, fing jedoch den Blick des Arztes auf und hielt inne.
Nein?
Ach, Don Giuseppe – Coniglio lächelte mitleidig –, nicht alles Erfreuliche im Leben ist verboten. Manches aber schon, sollte es jedenfalls sein. Sie sehen müde aus, mein Freund.
Giuseppe zog die leere Hand zurück und schlug die Beine übereinander, wobei das purpurrote Knopfpolster des Sessels knarrte. Der Arzt hatte sich auf die Schreibtischkante gehockt, ein Bein angewinkelt und die Hände locker auf dem Oberschenkel verschränkt, jene Hände, die andere Menschen drehten und wendeten, ihnen die Haut aufschnitten und die Geheimnisse ihres Körpers aufzudecken suchten. Ruhig schaute er dem Arzt ins Gesicht.
Und, sagte er.
Es ist, was ich befürchtet habe. Der Arzt sprach jetzt leise und überlegt. Ein Emphysem. Es lässt sich vielleicht aufhalten, aber nicht heilen. Tut mir leid.
Giuseppe lächelte leicht. Er wusste nicht, was er dazu sagen sollte.
Der Lungenfunktionstest ist allerdings nicht immer schlüssig. Wir könnten Sie noch einmal untersuchen.
Würden Sie das empfehlen?
Coniglio sah ihn ein paar Sekunden ernst an. Nein, sagte er schließlich sanft. Sind Sie allein hier? Ich hatte gehofft, die Fürstin würde Sie begleiten.
Er schüttelte ruhig den Kopf.
Sie sollten nicht alleine sein, sagte der Arzt. Er stand auf, setzte sich hinter seinen Schreibtisch, nahm einen Füllfederhalter aus der Schublade und schraubte ihn auf. Ich verschreibe Ihnen etwas gegen die Schmerzen. Aber Sie wissen, dass die einzige richtige Medizin für Sie der Verzicht aufs Rauchen ist.
Der Wintermorgen hing grau und diffus in den Gardinen. Giuseppe schloss die Augen, öffnete sie.
Und wendet das die Krankheit zum Guten?, fragte er.
Sie ist chronisch, Don Giuseppe; da gibt es keine Wendung zum Guten. Sie schreitet in jedem Fall fort. Doch sie ist beherrschbar. Sie müssen Ihre Lebensweise ändern. Regelmäßig Sport treiben. Spazieren gehen. Weniger essen. Sorgen und Stress vermeiden, wo Sie können.
Eine andere Therapie gibt es nicht?
Hm. Versuchen wir es erst mal damit.
Aber die Krankheit bringt mich um?, hakte er nach.
Coniglio musterte ihn still von seinem Platz hinterm Schreibtisch aus. Da könnte Sie so einiges vorher umbringen.
Giuseppe lächelte unwillkürlich.
Das hier gebe ich Ihnen gegen die Schmerzen und damit Sie besser schlafen können. Der Arzt schrieb ein paar Minuten an dem Rezept. Dann schnürte er eine rote Mappe auf, nahm zwei maschinengeschriebene Seiten heraus, las sie durch und legte sie wieder zurück. Wir werden alt, Don Giuseppe, sagte er mit einem kleinen Stirnrunzeln. Er hob den Kopf. Darauf läuft es hinaus. Wir merken es vielleicht nicht, aber so ist es.
Ja.
Unser Körper lässt es uns nicht vergessen.
Allerdings.
Coniglio schwieg und legte die Fingerspitzen vor sich aneinander. Offenbar wusste er nicht recht, was er als Nächstes sagen sollte. Zu Giuseppes Überraschung wechselte er dann das Thema und begann, beiläufig von seiner Frau zu sprechen. Sie war Französin und dafür bekannt, dass sie ihn schlecht behandelte. Er sagte: Jeanette ist wieder nach Marseille gegangen. Ihre Schwester ist krank. Sie möchte bei ihrer Familie sein. Sie hat mir geschrieben, ich solle bitte zu ihr kommen. Und bleiben.
Oh.
Sie und die Fürstin haben doch lange getrennt gelebt, nicht wahr?
Ja. In den 30er Jahren.
Ich erinnere mich, dass Ihre Mutter davon sprach. Fürstin Alessandra war in Lettland?
Giuseppe nickte. Was seine Mutter dazu gesagt haben könnte, stellte er sich lieber nicht vor.
Coniglio klopfte vor Nervosität mit dem Füllhalter an seinen Ehering, klick, klack. Sein Gesicht indes war ruhig, sein Haar glatt, sein korallfarbenes Hemd knitterfrei und makellos. Ja, sagte er, bei Ihnen hat das Arrangement funktioniert. Das ist die Welt von heute, Coniglio, sage ich mir. Sei stark. Es gibt Telefon und Flugzeuge.
Giuseppe klärte den Mann nicht auf. Seine Frau Licy war immer gegangen, wohin sie wollte, wie sie wollte. Nach Sizilien war sie erst geflohen, als die Sowjets sich ihrem Anwesen in Lettland näherten und im Vormarsch die großen Höfe niederbrannten. Er bildete sich nicht ein, sie hätte sich seinen Wünschen gefügt.
Jeanette meint, für einen Arzt gibt es in jeder Stadt Arbeit. Sogar für sizilianische Ärzte, meint sie. Da wird etwas Wahres dran sein.
Was werden Sie tun?
Coniglio sah vage lächelnd aus dem Fenster. Ich werde mir den schlimmstmöglichen Ausgang vorstellen und mich für das glimpflichere Ende entscheiden, sagte er. Aber meine Patienten, um die würde ich mich sorgen, Don Giuseppe. Ich müsste ja vielen Lebewohl sagen.
Es ist immer besser, der zu sein, der geht, als der, der zurückgelassen wird, erwiderte Giuseppe nach einem Augenblick.
Ja. Und manche Reisen dulden keinen Aufschub.
Giuseppe neigte den Kopf.
Coniglio fasste sich an den Nasenrücken, eine Geste, aus der Kummer und plötzliche Ratlosigkeit sprachen. Er nahm die Brille ab und kniff die wasserblauen Augen halb zu. Die starke Gefühlsbewegung des Mannes kam für Giuseppe überraschend und machte ihn verlegen. Wissen Sie, sagte der Arzt, seit Jahren fällt mir, wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, etwas ein, das Ihre Mutter mir mal gesagt hat. Nehmen Sie immer den leichteren Weg, Dr. Coniglio, sagte sie. Und doch habe ich das nie getan. Was ist nur los mit mir?
Coniglio sah ihm kurz ins Gesicht, und es war, als hätte im kalten Sonnenlicht zwischen ihnen eine Münze geblinkt. Ihre Mutter war eine starke Persönlichkeit, fuhr er fort. Sie hatte feste Überzeugungen. Ich weiß noch, wie oft sie mit mir über Mussolini geredet hat.
Zum Ende hin war sie ziemlich verwirrt.
Sie hat über seine Gamaschen geschimpft. Andauernd Gamaschen, sagte sie. Coniglio schmunzelte bei der Erinnerung daran und schüttelte den Kopf. Ich weiß noch, wie sie eines Morgens meine Hand hielt und sagte, Mussolini hätte nichts geändert, und doch sei durch ihn alles anders geworden.
Sie dachte an ihr Haus, sagte Giuseppe leise.
Ein wunderschöner Palazzo, stimmte der Arzt bei. Den hätten die Amerikaner nicht so zerbomben müssen.
Mir war nicht klar, dass Sie das wussten, Doktor.
Coniglio sah ihn verwundert an. Ich habe Ihre Mutter dort besucht. Mehrmals.
Da war er wohl kaum noch schön.
Nun ja.
Vor seiner Zerstörung war es ein prächtiges Haus.
Der Arzt sah ihm in die Augen, nickte. Und auch danach noch, Don Giuseppe. Als Kind bin ich jeden Sonntagmorgen daran vorbeigelaufen. Mein Vater hatte eine Fischbude in der Vucciria. Es war nicht der schnellste Weg. Ich hatte es aber nicht immer so eilig, zu ihm zu kommen.
Er sagte das ohne Scham oder Verlegenheit wegen seiner niedrigen Herkunft, und Giuseppe konnte nur zerstreut nicken. All das schien ihm plötzlich von größter Belanglosigkeit. Seine Mutter hatte diesem Arzt zuletzt misstraut, hatte gehustet und das Gesicht verzogen und ihn ihren guten Doktor Mafioso genannt. Er wollte etwas sagen, schloss dann aber wieder den Mund. Glotz nicht wie ein Fisch, hatte seine Mutter ihn immer ermahnt. Abrupt stand er auf.
Verzeihen Sie mir, sagte er.
Coniglio erhob sich halb hinter seinem Schreibtisch. Aber natürlich.
Ich habe vergessen, wie spät es ist.
Gewiss doch. Man wird, da bin ich sicher, bald wieder voneinander hören, Don Giuseppe. Empfehlen Sie mich bitte Don Casimiro und Don Lucio. Und natürlich der Fürstin.
Auf einmal klang ihm aus der altmodischen Sprechweise des Arztes die Syntax eines englischen Romans entgegen, als wäre es eine laut übersetzte Passage von Meredith oder Eliot, und er warf ihm unter schweren Lidern hervor einen Blick zu. Wie kaum ein anderer hatte dieser Mann den Verfall der Liebe seiner kranken Mutter zu ihm miterlebt, die zunehmenden Spannungen mitbekommen, die Bitterkeit, die leisen Verwünschungen, die verhüllten Beleidigungen. Daran zu denken gab Giuseppe einen Stich, denn es hatte aus ihm einen verletzlichen Narren gemacht. Aber schon verschwand das Gefühl, und er wollte nur noch raus aus dem kleinen Sprechzimmer mit seinem Geruch nach Erfrischungstüchern, Lackfarbe und Kampfer, Gerüche, die er immer mit dem eigenen Tod verband.
Und so setzte Giuseppe Tomasi, der letzte Fürst von Lampedusa, sorgsam seinen Hut auf, schob die Finger in die Ziegenlederhandschuhe seines toten Vaters und ergriff seinen Gehstock und die abgewetzte Ledertasche. An der Tür hielt er inne.
Wie lange habe ich noch, Doktor?
Coniglios Hände waren adrett auf dem Schreibtisch gefaltet, und als er den Kopf schräg legte, fiel das Licht auf die Brille, so dass man die Augen nicht mehr sah. Das hängt von Ihnen ab, erwiderte er schließlich. Beten wir, dass es noch viele Jahre sind.
In dem Fall, sagte Giuseppe mit einem letzten ironischen Lächeln, hängt es überhaupt nicht von mir ab.
Der Arzt lächelte ebenfalls, doch das Lächeln hatte etwas Trauriges, und Giuseppe drehte sich um und ging. Das Milchglas an der Tür zur Straße klirrte leise, als er sie schloss, und er schlurfte auf seinen Stock gestützt hinaus an die kalte, klare Luft, als wäre es noch derselbe Morgen wie zuvor und er noch derselbe Mensch.
Draußen im Straßenlärm blieb er verdutzt stehen beim Anblick der staubigen Autos und Motorroller, die sich in einem Wust aus Abgasen, Bremslichtern und Geschrei durch den Fußgängerverkehr schoben. Das plötzliche, klare Bewusstsein vom eigenen Tod erfüllte ihn. Er dachte an Licy, die nichtsahnend noch in der Via Butera hinter zugezogenen Vorhängen schlief, und obwohl er wusste, dass Coniglio recht hatte und er zu ihr gehen und es ihr sagen musste, tat er es nicht. Eine Art Langsamkeit schien von ihm Besitz ergriffen zu haben: Er wollte nirgendwohin, an nichts denken, nur bleiben, wo er war, während die Passanten ihn umkurvten, die Lambrettafahrer pöbelnd hinterm Lenker standen und die Straßenhändler an den Tischen ihre Ware anpriesen. Hinter ihm erhob sich schemenhaft, wie im Traum die Arztpraxis. Licy schlafen zu lassen war nur freundlich, sagte er sich. Er würde am Abend mit ihr sprechen.
Bloß ist für dich jetzt immer Abend. Dieser Gedanke kam ihm ungebeten, und er senkte das Kinn auf die Brust und zog schmerzend scharf die Luft ein. Ja. Er würde vor seiner Frau sterben. Darauf lief seine Unterhaltung mit Coniglio letztlich hinaus – die Gewissheit, dass sie noch auf der Welt sein würde, wenn er nicht mehr da war. Einen Moment lang stimmte es ihn bitter, als Erster sterben zu müssen, dann stützte er sich auf den Gehstock, dass der dicke Wintermantel über seinen Hüften spannte, und schämte sich für den Gedanken.
Sie hatten keine Kinder. Was würde Licy von ihm bleiben? Sein Besitz war geschrumpft, bis er sich nicht mehr zu den Reichen von Palermo zählen konnte. Zeigte er sich jetzt im Bellini Club, schien ihm das nur noch Seitenblicke und Getuschel einzubringen. Die großen Paläste waren verkauft oder in Schutt und Asche gelegt. Seine Mutter war die letzte einflussreiche Lampedusa gewesen, die letzte wahre Lampedusa, und sie hatte Licy von Anfang an abgelehnt.
Giuseppe hob das Gesicht in die kalte Luft. Seine Mutter. Coniglio lag ganz richtig, sie hatte an Mussolini geglaubt. Wie viele andere. Er sah sie noch auf der Terrasse der Casa Lampedusa stehen und aus der im Wind knatternden Zeitung vom Marsch des Diktators auf Rom vorlesen, hörte noch die scharfe, kalte Freude in ihrer Stimme. Als geborene Cutò war sie in ihrer Jugend eine Schönheit und im Alter eine Achtung gebietende Aristokratin gewesen. Hinter ihrem unerschütterlichen Selbstvertrauen, ihrer Geistesgegenwart, ihrer Intelligenz verbarg sich eine Traurigkeit, die er auch bei sich selbst wahrnahm. Sie hatte vier Schwestern gehabt, von denen drei in rascher Folge gestorben waren und deren Tod seine Mutter dann zeitlebens verfolgt hatte. Ihre Schwester Lina war 1908 beim Erdbeben von Messina unter den Trümmern verhungert, drei Jahre später wurde ihre Lieblingsschwester Giulia in einem schäbigen Hotel in Rom von einem Liebhaber umgebracht, und der öffentliche Skandal, der daraus erwuchs, führte zum Selbstmord ihrer jüngsten Schwester. Maria war abseits der Familie beerdigt worden, und Giuseppe erinnerte sich an die kalte, leere Kirche, die Abwesenheit des Vaters, die ungnädigen Gebete des Priesters, wie Taubengeraschel in dem halbdunklen Gewölbe. An diese Jahre dachte er, an die blauen Laudanumfläschchen seiner Mutter, das ziellose Reisen durch Europa, an sein eigenes Jahr in Neapel und das zumindest für ihn veränderte Palermo, das sie bei ihrer Rückkehr vorfanden, eine Stadt der abweisenden Gesichter, eine Stadt der zugezogenen Vorhänge und versperrten Türen; nur die dunkle, ledergebundene Stille der Bibliothek seines Stadtpalasts war geblieben. Ja, sie hatte an Mussolini geglaubt, doch als seine Regierung 1940 den Krieg erklärte und von einem Reich in Afrika phantasierte, hatte sie angewidert die Zeitung zusammengeknüllt und die kleine Faschistennadel vom Revers genommen.
Was er aber in Erinnerung behalten wollte, war das zarte, glatte Weiß ihres Halses und ihrer Arme. Die weiten Schwünge ihres linken Arms, wenn sie abends vor dem Spiegel ihr Haar kämmte und die goldene Haarbürste bei jedem Strich zischte. Sie hatte einen langen, schlanken Hals, eine sehr schmale Taille und trug nach Art der Belle Époque tief ausgeschnittene Kleider zum hochgesteckten Haar. Er entsann sich an die Spaziergänge mit seiner Gouvernante Anna in den Grünanlagen von Santa Margherita di Belice, seine Mutter und Tante Giulia gut zwanzig Schritte vor ihnen, das Gleiten und Schweben ihrer hellen Röcke über dem weißen Kies unterm lodernden Himmel. Den Klang ihres Lachens, wie ein Silberlöffel auf Kristallglas. Er liebte sie wegen der großen, starken, überwältigenden Zuneigung, die sie einforderte und bekam, ein von allen, die sie kannten, und gerade auch von ihm geliebtes und gefürchtetes Wesen.
Vor allem eine Erinnerung stellte sich ein, wenn er an sie dachte. Er musste vier Jahre alt gewesen sein. Er und seine Mutter waren zu Gast bei den mächtigen und wohlhabenden Florios auf der Insel Favignana. Später sollte er Gerüchte über seine Mutter und den Patriarchen Don Ignazio hören. Eines frühen Sonntagmorgens hatte seine Sieneser Gouvernante die Vorhänge aufgerissen, ihn aus dem Bett gezerrt, ihn gekämmt, ihm mit einem rauhen Tuch Gesicht und Hals geschrubbt und ihn in seine besten Kleider gezwängt. Dann war sie mit ihm nach draußen gegangen und hatte ihn die Ufertreppe entlang zur großen Terrasse gegenüber dem Hafen geführt. Er erinnerte sich an das Wehen und Wogen orangefarbener Vorhänge, die den Wind abhalten sollten, an das im Schatten der weißen Klippen veränderte Licht, das Zusammenspiel von Sonnenschein und schwarzem Wasser. Auf einem vom Balkon geholten Plüschstuhl saß, den Gesichtsschleier zurückgeschlagen, mit erschrocken blinzelnden blauen Augen eine uralte Französin in einem windumflatterten, pechschwarzen Witwenkleid. Jahre später sollte er erfahren, dass sie die frühere Kaiserin Eugénie war, die Frau von Napoleon III., ebenfalls zu Gast bei den Florios, wenn auch schon bereit, auf ihrer Jacht davonzufahren. Er kniete sich vor sie hin, spürte die rauhe Berührung ihrer trockenen Lippen auf seiner Stirn, und dann legte sie ihm eine Hand, so leicht und papieren wie ein welkes Blatt, auf den Kopf und sagte: Quel joli petit. Er erinnerte sich, wie er unsicher zu seiner Mutter hinübergeschaut hatte, er erinnerte sich an die mächtige, struppige Gestalt des Mannes, der neben ihr saß, den locker auf der Lehne ihres Stuhls ruhenden Arm, sein kräftiges weißes Gebiss, wenn er lächelte. Das war Ignazio Florio, ihr Gastgeber, Adelsherr und Magnat. Dann erhob sich der Mann schwungvoll, klatschte in die ungeheuren Hände, und Klein Giuseppe war entlassen.
Ungefähr so behielt er das für immer im Herzen: ein Angstgefühl, winddurchwehter Sonnenschein, der Eindruck, den Sinn des Erlebten nicht ganz zu erfassen, während um ihn herum große Ereignisse abliefen und er wie benommen im honiggelben Licht Siziliens kniete, ein Kind.
Als er langsam durch die Altstadt zur Buchhandlung Flaccovio ging, wollte er nichts als sich ungestört dort in den Gängen verlieren, Coniglio und seine Diagnose und die aufkeimende Krankheit in seiner Lunge vergessen, sei es auch nur für ein Stündchen. Er wanderte durch die engen Straßen, vorbei an winterfest eingemummten Händlern, die ihre Stände aufbauten, an den mit Kisten beladenen, qualmenden Fiats, deren in der halboffenen Tür stehende Fahrer sich freie Bahn zu schaffen versuchten, den scheuklappengeschützt dahinkriechenden Karrenpferden, vorbei an den Kopftuch tragenden Frauen, die verschlafen auf ihre Balkons traten, um Eimer mit Papiergeld für die Vespa fahrenden Händler hinunterzulassen und Frühstücksbrot und Fisch heraufzuziehen. Das Winterlicht war matt und schattenlos. Aus einem Radio plärrte Rock ’n’ Roll. Er spürte eine unerklärliche Fremdheit in der Brust, eine Leichtigkeit, als hätte er Palermo mit seinem ganzen brodelnden Leben noch nie gesehen. Doch eine schöne Stadt, dachte er, trotz allem.
Als er um die Ecke bog und die Via Ruggero Settimo überquerte, erblickte er die Jungs, aber zum Ausweichen war es zu spät.
Sie warteten in der Kälte auf ihn. Schlaff und träge in ihrer Jugend, lehnten sie an den verzogenen Schaufensterscheiben der Buchhandlung, schwangen die Arme und klatschten in die Hände: Gioacchino und Orlando, seine studentischen Freunde – respektlos grinsten sie ihn im Näherkommen an.
Er und Licy hatten sie zwei Jahre zuvor im Salon eines Antiquariats kennengelernt, und in der Woche darauf waren die Jungs wiedergekommen und hatten sie erneut amüsiert. Giuseppe hatte ihr Humor gefallen, ihre spaßhaften, streitlustigen, markanten Sprüche, das beifällige Nicken seiner Frau, als sie ihre Gesichter gemustert hatte. Zu seiner eigenen Überraschung hatte er sie dann irgendwie in die Via Butera eingeladen, um über Stendhal, Shakespeare und Chaucer zu diskutieren, und im vergangenen Frühjahr schließlich hatte er auf einmal Notizen für Tischgespräche zur englischen Literatur vorbereitet, und aus diesen Gesprächen war so etwas wie eine zwanglose Vortragsreihe entstanden. Giuseppe hatte bereits über tausend Seiten vorbereitet. Die Jungs waren abwechselnd elegant und dekadent, wie er es sich in ihrem Alter nicht mal hätte vorstellen können. Und wenngleich Literatur, Musik und Film sie zunächst in Giuseppes Bannkreis gezogen hatten, zählte für ihn da noch etwas anderes, etwas unglaublich Modernes, das er um sich haben wollte. Alessandra hatte das noch vor ihm begriffen: Sie gehörten zu einer Welt, die ihn bereits hinter sich gelassen hatte, einer Welt, in der für Menschen wie ihn kein Platz mehr war.
Von seinem morgendlichen Termin bei Coniglio hatte er beiden nichts gesagt, und darüber war er plötzlich froh. Der Größere stieß sich mit dem Fuß ab, richtete sich auf, nahm die Arme auseinander und winkte. Das war Gioacchino, gerade mal zwanzig, unzähmbar, spottlustig, der Sohn eines entfernten Verwandten. Trotz der Kälte hatte er die Jackenärmel über den langen glatten Fingern bis zu den Ellbogen hochgeschoben, sein schmaler Schlips saß schief wie bei einem jungen Mailänder Fotografen. Giuseppe sah ihn im hellen Licht der Straße an, als möchte er ihn am Stück verschlingen mit seinem Elan, seiner Unverbildetheit. Denn Gioacchino war ihm und Licy sehr lieb geworden, und auf einmal war er dem Jungen dankbar dafür, dass er an diesem Morgen einfach nur da war.
Onkel!, rief Gio unnötig laut. Er schwenkte beide Arme. Eine mit Einkäufen beladene Frau hob erschrocken den Kopf und lief schnell vorbei.
Wir dachten, du wärst vielleicht hier, sagte der andere Junge und kam herüber, um neben Giuseppe herzugehen. Seine Stimme war kratzig, wie von Wein aufgerauht. Wir sind am Mazzara vorbei, aber da warst du nicht.
Also sind wir einfach dem Staub nach, grinste Gio. Hier landet alles, was alt ist, hab ich Orlando erklärt.
Francesco Orlando rückte seine schwere Schultertasche zurecht und zuckte die Achseln.
Da trat Gioacchino vor, stibitzte ein Küchlein aus Giuseppes Ledertasche und schlug die Zähne hinein. Du bist wie ein englischer Arzt, Onkel, sagte er mit vollem Mund. Alles, was du brauchst, hast du im Täschchen.
Gio, mahnte ihn Giuseppe. Es reicht.
Doch er war nicht wirklich böse. Er war nicht der Onkel des Jungen, ließ sich aber gern so anreden. Bei aller Respektlosigkeit konnte Gio in seinen Augen nichts verkehrt machen. Für ihn lag die Schuld bei der modernen Welt, die ihrer Jugend so wenig Ernst mitgab.
Dein Cousin war da, sagte Orlando jetzt. Im Mazzara. Wir haben ihm gesagt, wir würden dich für ihn suchen.
Casimiro ist in Palermo?
Casimiro nicht. Lucio.
Giuseppe räusperte sich, knöpfte seinen Mantel auf, kramte nach einer Zigarette. Mit Verspätung fiel ihm Coniglio und seine ärztliche Ermahnung ein, doch da ihn die Jungs beobachteten, steckte er sich die Zigarette an und inhalierte tief. Er musterte Francesco Orlando: untersetzt, die Brille schräg im Gesicht, breiter, runder Schädel und Narben auf der Stirn, ein Literaturstudent mit Hochschullehrerambitionen. Der Junge ließ sich gerade einen dünnen schwarzen Schnurrbart wachsen und fuhr dauernd mit dem Finger darüber, als wollte er sich vergewissern, dass er noch da war. Am Kragen seines dicken Mantels stand eine Ecke hoch, und ein Knopf war ab.
Gio leckte sich die Finger und zerknüllte das Papierförmchen. Sag Orlando, er soll mit mir zum Jachthafen gehen, Onkel, verlangte er. Orlando hört auf dich.
Weil er Respekt hat.
Gioacchino blickte lächelnd auf. Dazu sagte er nichts.
Was ist denn am Jachthafen?
Da wird gepokert. Wenn wir uns beeilen, können wir noch einsteigen. Bist du etwa in Spiellaune, Onkel?
Das graue Licht verschwand. Ein ausrangierter Militärlaster vom letzten Krieg ratterte in einer Wolke von Abgasen vorbei, und Giuseppe kniff die Augen zusammen, nahm die Zigarette runter und hielt sich ein Taschentuch vor den Mund. Aus Angst vor einem Hustenanfall antwortete er nicht, doch die jungen Männer nahmen keine Notiz davon.
Ich muss lernen, wandte Orlando gerade ein. Ich kann nicht mitpokern.
Zum Lernen ist noch jede Menge Zeit. Sag ihm das, Onkel. Wir sind jung. Wir sollten lernen, wie es auf der Welt zugeht. Hat Stendhal nicht so was gesagt?
Wohl kaum.
Nein?
Nein.
Gio lächelte mit kälteroten Backen. Na gut. Normalerweise lese ich einen Autor, bevor ich ihn falsch zitiere. Was hast du, Onkel? Warum guckst du so?
Giuseppe blinzelte und blinzelte. Er trank den Anblick der Jungs mit einer Verzweiflung in sich hinein, die ihn beschämte. Orlando hatte etwas Grobschlächtiges an sich, das stets seine Herkunft aus der Mittelschicht verriet, daran war nichts zu ändern. Er war zu konzentriert, zu verbissen. Gio dagegen war ganz Anmut und Geschmeidigkeit, wie ein Windhund, zerzaustes Haar, traurige Augen, scharfe Zähne. Er dachte an Licy in der Via Butera, stellte sich vor, wie sie ohne ihn zu unterbrechen steif dasitzen würde, wenn er ihr von Coniglios Diagnose erzählte.
Du nimmst immer den leichteren Weg, Gioitto, sagte er schließlich, jedoch ohne Rüge. Er sah durch das beschlagene Fenster der Buchhandlung. Kommst du nicht mit rein?
Gio lachte. Ach, Onkel. Genau in diesem Augenblick fällt irgendwo eine Gräfin in Ohnmacht und muss gerettet werden. Wenn du’s dir anders überlegst, findest du mich im Alfonso. Ich bin der, der mit den Stapeln amerikanischer Dollars neben sich am Ofen sitzt.
Als er ging, schüttelte Francesco Orlando den Kopf. Gioacchino nimmt nichts ernst, sagte er. Er will nichts lernen, er weiß nicht, wie es ist, leere Taschen zu haben. Er meint, die Welt würde auf ihn warten.
Und das tut sie auch, sagte Giuseppe. Durch leere Taschen wurde noch nie etwas Großes erreicht, Orlando.
Der Junge stutzte über seinen Ton.
Warum bist du noch hier, Orlando?
So leid es mir tut, Don Giuseppe –
Ja?
Ich kann heute Abend nicht zum Vortrag kommen. Ich muss lernen. Morgen früh habe ich eine Prüfung.
Giuseppe runzelte die Stirn. Er hatte vergessen, dass ihr Wochentreffen auf diesen Abend verlegt worden war. Sein Termin bei Coniglio hatte das aus seinem Gedächtnis verjagt, und jetzt wurde ihm klar, dass er den Abend brauchte, um mit Licy über die Diagnose zu reden. Er hätte ohnehin absagen müssen. Um aber seine Verlegenheit zu überspielen, sagte er schroff: Du musst selber wissen, was dir wichtiger ist, Orlando.
Der Junge wurde rot. Du hast dich schon vorbereitet. Verzeih mir.
Hm.
Es ist nicht so, dass ich deinen Unterricht nicht zu schätzen wüsste, Don Giuseppe. Wirklich nicht.
Mit einem Mal bedauerte Giuseppe seine barschen Worte. Er tätschelte den Ärmel des Jungen. Geh, sagte er, klemm dich hinter deine Bücher, denk nicht mehr an die Vorträge. Wir machen nächste Woche weiter.
Noch einen Vortrag verpasse ich nicht. Versprochen.
Schon gut.
Danke, Don Giuseppe.
Geh.
Orlando zögerte und ging.
Giuseppe, jetzt allein, blieb im kalten Schatten der Buchhandlungsschaufenster stehen und sah zu, wie die dunklen Schemen des Verkehrs vorbeiwogten. Er hatte zwar keine Gesellschaft haben wollen, doch jetzt, wo die Jungs fort waren, kam er sich eigenartig exponiert vor, so als wäre sein Mantel aufgeknöpft, als wären seine Privatangelegenheiten für jeden einsehbar. Er neigte den Kopf, wie um sich über etwas klarzuwerden, dann warf er die Zigarette auf den Boden, zertrat sie mit der Schuhspitze und schickte sich an, in Richtung Mazzara und Lucio die Straße zu überqueren. Er stellte den Mantelkragen auf. Einerseits hatte er keine Lust auf die Gesellschaft seines Cousins, andererseits war Lucio mit seiner Zurückhaltung und trockenen Selbstverliebtheit gar nicht unbedingt als Gesellschaft anzusehen. Statt jedoch die Via Ruggero Settimo zu überqueren, machte Giuseppe etwas Seltsames, etwas, das er, seit er dieses Viertel kannte, noch nicht getan hatte: Er bog in die Via Cerda ab, und nach etwa anderthalb Kilometern tauchte er nach links in ein Gewirr schmaler Sträßchen ein. Sofort verschwanden der Lärm und die dicke Luft der Stadt. Pfützen standen in der Gasse, in den Hauseingängen lagen Zeitungen und Abfall. Zu beiden Seiten erhoben sich hier Balkone, und er reckte den Hals und blickte zu dem weißen Streifen Himmel hinauf. Wie trügerisch die Welt war. Er sah Eisenkäfige auf den Balkonen hängen, leer in der Kälte, und über etlichen Geländern lagen bunte Teppiche, gelb, rot, wie zum Trocknen rausgehängt. War dies das wahre Palermo? Er kam an einem Knubbel jackenloser Schuljungen mit angeklatschten Haaren und heraushängenden Hemdschößen vorbei, die einen Fußball gegen eine Tür droschen, wobei sich jeder hohle Treffer anhörte, als würde ein Sarg zugenagelt. Er ging weiter.
Wassergefleckte Wände, rostige Angeln an den Fenstern zur Straße. Vorbei an einem zerbombten Mietshaus mit bröckelndem Stuck, durch den Türrahmen sah man die zusammengestürzten Trümmer. Die Gebäude links und rechts davon waren unangetastet. Die Gasse mündete in einen schmalen Platz, und an der Eingangstreppe der ärmlichen Kirche dort blieb er stehen. Durch die geschnitzte Tür hörte er leises Gebetsrauschen. Auf der anderen Seite des Platzes saß ein alter Mann auf einer Bank, den grauen Kopf gebeugt, den Hut auf seinem Knie, und Giuseppe wechselte Gehstock und Schultertasche nach links, erklomm die Treppe und hielt sich dabei am Geländer fest. Als er über die Schwelle trat und blinzelnd im jähen Halbdunkel stand, dachte er bei sich, er sei am Beginn seines Niedergangs angelangt.
Es war warm in der Kirche. Er blieb stehen und lauschte dem leisen Stimmengemurmel. Gestalten knieten im Dunkel der Bänke, und er hörte das eindringliche Wogen des Ave-Maria heraus. Was hatte ihn hergeführt? Er zählte nicht zu den Gläubigen und hatte seit dreißig Jahren keinem Gottesdienst beigewohnt. Langsam passten sich seine Augen an. Der Schrecken der Kreuzigung über dem Altar, das schmerz- und kummerverzerrte Gesicht des hässlichen Holzjesus. Ihn bedrückte, wie wenig von ihm bleiben würde, wenn er erst tot war. Wie wenig er hinterlassen würde. Er glaubte nicht an ein Leben jenseits des Grabes, und wenn er zu seiner Mutter betete, wusste er, dass es nur Worte waren, mehr nicht. Sie war nirgends. Er betrachtete die gebeugten Rücken der frommen Beter, und seine Gedanken wandten sich dem Vortrag zu, den er Orlando an diesem Abend hatte halten wollen. Er hätte um Rousseau gekreist, um Proust und Stendhal, den er mehr als alle anderen bewunderte. Hatte Stendhal an die Ewigkeit geglaubt? Er hatte geschrieben, jeder Mensch, wie unbedeutend auch immer, sollte eine Chronik seiner Zeit auf dieser Erde hinterlassen, einen Nachweis seiner gesammelten Erinnerungen und Erfahrungen. Das sei die einzige Ewigkeit. Er, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, hatte nichts hervorgebracht. Alles, was er gekannt hatte, die großen Häuser seiner Jugend, seine Erinnerungen, seine Ängste, das flüchtige Blühen der Bäume im Londoner St. James’s Park im Frühling, all das würde mit ihm verschwinden; dann gäbe es keinen Giuseppe mehr, keinen Jungen in kurzen Hosen, der einen Reifen vor sich hertrieb, keinen dicken alten Melancholiker, der nachdenklich das geschnitzte Leiden eines Christus betrachtete, keine Spur seines Daseins auf Erden. Dass er ein solches Bedauern darüber empfand, erstaunte ihn. Ganz gleich, wie man sein Leben zubrachte, für jeden ging die Zeit einmal zu Ende. Gioitto und Orlando würden das nicht verstehen. Sie waren ja noch so jung. Er, Giuseppe, dachte mit plötzlicher Bitterkeit, dass er nicht nur er selbst war, sondern alles, woran er sich erinnerte, alles, was er getan und gelernt hatte. All das würde mit ihm ausgelöscht werden.
Er fand es seltsam, dass Lucio gekommen war.
Das Café Mazzara befand sich im Erdgeschoss eines tristen modernen Gebäudes abseits der Via Ruggiero Settimo, gar nicht weit von Flaccovio, und drinnen blieb Giuseppe an der Tür stehen, knöpfte seinen Mantel auf und schaute in das Halbdunkel. Das Café gefiel ihm wegen seiner Abgeschiedenheit und weil er hier meist unbehelligt an seinen Abendvorträgen arbeiten konnte. Er erspähte seinen Cousin an einem Ecktisch, schreibend über ein kleines Notizbuch gebeugt. Mehrere braun verschnürte Pakete stapelten sich neben ihm. Langsam trat Giuseppe näher.
Lucio, sagte er und setzte seine Ledertasche mit einem unerwarteten Rums ab. Der Tisch wackelte, der Löffel klapperte in der Tasse.
Lucio hielt einen Finger hoch, schrieb zu Ende, hob den Kopf.
Das Monster erscheint also, sagte er, und es klang, als hätte sein Cousin ihn erwartet. Wie ein Bohemien aus Paris kaute er an einem Zahnstocher. Ich warte hier schon mindestens zwei Stunden, Giuseppe. Aber ich sehe, du hast gespeist. Damit schlug er ein Bein über das andere, zog Die Pickwickier unter dem Förmchengebäck hervor und warf einen Blick auf den Buchrücken.
Was schreibst du?, fragte Giuseppe. Kein Gedicht, hoffe ich.
Kein Gedicht, erklärte Lucio großartig. Nein.
Aber Giuseppe hatte nur gescherzt und schwieg, als er sich hinsetzte, verlegen, weil sein Cousin das nicht gemerkt hatte. Als der Kellner kam, bestellte er einen schwarzen Kaffee und einen Teller mit süßem Gebäck. Lucio hatte sich immer schon zu ernst genommen. Obwohl sein Cousin mühelos Persisch, Sanskrit und Altgriechisch lesen konnte und wenngleich er in Mathematik, Astronomie und Musikkomposition brillierte, kam er Giuseppe noch wie ein Kind vor, leicht verletzbar und daher auf seine Weise gefährlich. Dass er ein gefeierter Dichter war, spielte keine Rolle. Als er und Lucio und Casimiro noch Jungen waren, hatte immer Lucio bestimmt, was sie spielten, was für Kriegsschiffe sie aus Zahnstochern zusammenbauten und wer bei ihren Picknicks in den Bergen wo saß. Er hatte sich kaum geändert. Während Giuseppe den großen zerbombten Häusern im alten Palermo ähnlich geworden war: in Schutt und Asche gelegt von der Geschichte, ein peinliches Memento, das man am besten zudeckte und links liegen ließ. Bei dem Gedanken lächelte er traurig. Aber jetzt musste er so weitermachen wie immer, um nicht diejenigen zu enttäuschen, die darauf bauten, dass er so blieb, wie er war: unwandelbar, standhaft, gütig.
Kein Gedicht, sagte Lucio nochmals mit einem wohlbedachten Schulterzucken. Ich halte nur Eindrücke fest.
Eindrücke, wiederholte Giuseppe.
Mhm. Notizen für ein Gedicht vielleicht. Ein Dichterleben ist ja nichts anderes. Lucio drehte den Löffel in seinem Kaffee und klopfte ihn zweimal am Tassenrand ab. Er sagte: Durchsehen kommt später, Cousin. Jetzt schreibe ich einfach. Schlussendlich haben wir alle für unsere Worte einzustehen, oder?
Schlussendlich ja, sagte Giuseppe leise.
Er wusste, dass die Welt für Lucio nicht etwas Sinnenhaftes war, etwas, das ihn mit starken Düften und schillernder Schönheit überwältigte. Sein Cousin hielt sich strikt an die Oberfläche und traute dem eigenen Herzen nicht, so dass seine Lyrik äußerste Anstrengung und Konzentration erforderte. Da er jedoch im vorigen Sommer einen Preis aus den Händen des Dichters Montale empfangen hatte, sollte seine privat veröffentliche Gedichtsammlung später im Jahr von Mondadori in Mailand nachgedruckt werden, und Giuseppe nahm an, dass seine Grenzen letztlich keine Rolle spielten. Er zog die Brauen hoch, als der Kellner das Tablett mit Gebäck und dem Kaffee brachte, und rieb sich die behäbigen Hände.
Lucio trug eine schmale rosa Krawatte zum grauen Jackett, und als er den Hut abnahm, fielen ihm die Haare unordentlich in die Stirn. Er war ein kränklicher Junge gewesen und zu einem schmalschultrigen Mann mit großem Kopf herangewachsen. Giuseppe fielen wieder die kleinen Augen, die lange Nase, die hochsitzenden Augenbrauen auf – als wäre der Mann immerzu über die Traurigkeit der Welt erstaunt. Lucios Bruder Casimiro hingegen hatte die Ausstrahlung eines Gentleman. Die Piccolos wohnten im Osten, in Capo d’Orlando, und hatten im Krieg nicht ihre Villa über dem Meer verloren. Er liebte sie trotz ihrer Eigenheiten wie Brüder. Sie glaubten nicht nur an Geister und die Gemeinschaft mit den Toten, sondern zelebrierten ihren Glauben mit künstlerischer Leidenschaft, indem sie bei Kerzenlicht zu privaten Séancen in vorhangverhüllten Räumen spazierten und ihre Spiegel mit Bettlaken verhängten, um die Toten herbeizurufen. All das bewunderte Giuseppe, weil es so herrlich albern war. Er führte ihre grandiose Unschuld auf ihre Isoliertheit zurück; wie sonst hätten Lucio und Casimiro und sogar ihre einsiedlerische Schwester Agata Giovanna glauben können, sie würden nach dem Tod weiter in ihrer schönen Villa am Meer leben, zwischen Bussarden und Liebesblumen in den Zitrushainen wandeln, und ihre Diener und Dienstleute würden mit ihnen sterben, um sich ihrer auch im nächsten Leben noch anzunehmen?
Die Zeit schritt voran, das Tablett leerte sich, Giuseppe bekam Kaffee nachgeschenkt. Die Sprechstunde bei Coniglio verlor sich wie ein Traum.
Dich in Palermo zu sehen überrascht mich immer wieder, Cousin, sagte er.
Tja. Im Osten wird’s mir einsam, dann sehne ich mich nach der Stadt.
Tust du nicht.
Lucio lächelte. Casimiro braucht Farbe. Wo sind denn deine jungen Freunde? Gioacchino wollte mit dir wiederkommen. Der Junge ist irgendwie unberechenbar, hm?
Wir Tomasi verstehen uns mit Fanatikern aller Art, Lucio. Besonders den blutsverwandten. Bleibst du zum Abendessen?
Lucio zog ironisch die Brauen hoch. Kocht Licy?
Sie wird darauf bestehen. Sie wird ihren Phobikern und Neurotikern absagen und darauf bestehen.
Dann tut’s mir leid, dass ich nicht kann, sagte Lucio schnell. Ich muss noch heute Nachmittag nach Capo d’Orlando zurück. Sonst fragt sich Casimiro, wo seine Farben bleiben.
Und wenn Licy nicht kochen würde?
Du stammst aus einer Familie von Asketen und Mystikern, sagte Lucio ironisch. Wir Piccolos werden von unseren Gelüsten beherrscht. Was gibt’s da zu schmunzeln? Ich bin jünger als du, ich brauche Nahrung.
Die Steine sind jünger als ich.
Er sah, wie Lucio innehielt und ihn mit sanfter werdendem Blick musterte. Stille stellte sich ein.
Plötzlich unbehaglich und ohne es zu wollen, sagte Giuseppe: Dr. Coniglio bat mich, ihn dir zu empfehlen. Ich soll dir sagen, dass es ihm gutgeht. Seine Frau ist wieder in Marseille.
Coniglio?
Ja.
Wann warst du denn bei Coniglio?
Giuseppe rührte in plötzlicher Sorge seinen Kaffee um. Ihm wurde klar, dass Licy, da er ihr nichts von dem Termin gesagt hatte, sofort misstrauisch sein würde, wenn er jetzt darauf zu sprechen kam; sie würde etwas ganz Falsches denken und ihm seine Beschwichtigungen nicht abnehmen. Sie würde einbezogen werden wollen. Er hob den Kopf und sah in Lucios Gesicht das Mitgefühl und die dunkle Freude an einem entstehenden Gerücht und wünschte, er hätte nichts gesagt.
Ich war heute Morgen bei ihm, sagte er widerstrebend. Nur kurz. Im Vorbeigehn quasi.
Ist irgendwas?
Was soll denn sein?
Lucio schaute ihn an. Du siehst nicht gut aus, Cousin.
Danke.
Ist wirklich nichts?
Giuseppe schüttelte den Kopf. Er ließ den Blick über die besetzten Tische hinweg zum Messinghandlauf des Tresens schweifen. Die Zeit war eine Abfolge von Räumen, die sich auftaten wie die guten Stuben seiner Kindheit, ein Nacheinander von Lichtstrahlen und Staub und Stille. Das war es, was anscheinend kein Roman zum Ausdruck bringen konnte. Manchmal kam es ihm vor, als hätte ihn die Welt selbst dann nicht haben wollen, wenn er sie gewollt hätte. Das versuchte er, Lucio zu erklären, bekam es aber nicht richtig hin. Er blickte finster in die Stille, betrachtete seinen Kaffeelöffel und fragte schließlich seinen Cousin, ob er je darüber nachgedacht hatte, was nach seinem Tod von ihm blieb.
Im Diesseits, meinst du?
Ja.
Nein. Darüber denke ich nicht nach.
Giuseppe betrachtete die kleinen schwarzen Augen seines Cousins und kam zu dem Schluss, dass es ein Glück sein müsse, so unbekümmert zu sein. Das gibt einem der Glaube, dachte er.
Darüber denke ich nicht nach, sagte Lucio noch einmal. Die Poesie bleibt.
Er griff in die Tasche neben sich, nahm einen schmalen Band heraus und hielt ihn behutsam in den langen, dünnen Fingern.
Du hast deine Gedichte dabei, sagte Giuseppe.
Lucio ging darüber hinweg. Unsere Erinnerungen sind ungewöhnlich, Cousin. Wir stammen aus einer Welt, die es nicht mehr gibt. Was wird aus dieser Welt, wenn ich sie nicht mehr schreibe, nicht mehr von ihr schreibe? Er schwenkte lässig die Hand und zuckte die Achseln. Eine ganze Lebensweise wird mit uns dahingehen. Signor Montale meinte mal zu mir, ich hätte ein Sizilien bewahrt, das schon am Verschwinden sei.
Lucios Worte hatten etwas Komponiertes, Theatralisches, so dass sich Giuseppe fragte, ob sie einstudiert waren, doch er sagte nichts. Die Welt würde in der Tat kaum merken, was ihr verlorenging. Es schmerzte ihn, an den langen Niedergang der Fürsten von Lampedusa zu denken, an diesen Verlust, daran, wie leicht eine Ahnenreihe von historischer Schönheit sich abwürgen ließ. Anhand von Artefakten wäre ihre Herkunft nicht nachzuzeichnen, denn Sinn entstand nur durch die Augenblicke und Einsichten lebendigen Gedächtnisses, und niemand mehr würde diese Geschichten erzählen, niemand mehr diese Erinnerungen belegen können. Alles würde einfach aufhören.
Giuseppe fuhr sich mit dem Finger über die Oberlippe, um den Kaffee aus seinem Schnurrbart zu streichen. Ich dachte immer, ich würde mal einen Roman schreiben, sagte er zerstreut.
Ja. Deinen sizilianischen Ulysses.
Er war überrascht, dass sein Cousin das noch wusste.