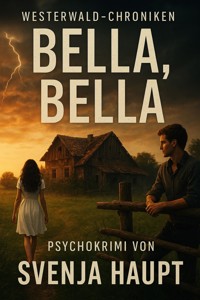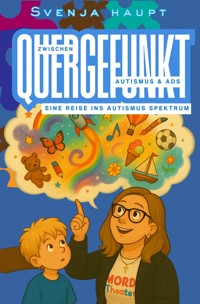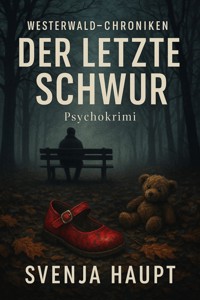
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Der letzte Schwur ist ein psychologisch dichter Regionalkrimi, der im Westerwald spielt. Als in dem kleinen Dorf Oberscheid ein Mädchen spurlos verschwindet, gerät die scheinbare Idylle ins Wanken. Hauptkommissar Erich Hofstädter, gezeichnet von einer eigenen schweren Vergangenheit, stößt bei seinen Ermittlungen auf ein Netz aus Lügen, Schweigen und alten Wunden. Zwischen engen Dorfgemeinschaften, verdrängten Wahrheiten und persönlichen Dämonen muss er sein Versprechen einlösen, Kinder um jeden Preis zu beschützen – auch wenn ihn dieser Fall an seine Grenzen bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Der letzte Schwur“Ein Psychokrimi von Svenja HauptErsterscheinung der überarbeiteten Ausgabe:
August 2025
© 2025 Svenja HauptAlle Rechte vorbehalten.
Satz, Lektorat und Gestaltung:
Svenja Haupt
Titelbild: Svenja Haupt in Zusammenarbeit mit KI
Druck & Vertrieb: Amazon Kindle Direct Publishing
Kontakt:Svenja Haupt – MordsTheaterE-Mail: [email protected]/mordstheater
Dieser Titel erscheint auch als E-Book und Hörbuch
Für Erich
Kapitel 1
Draußen legte sich der erste Schnee wie ein feiner Schleier auf den kalten Asphalt. Hauptkommissar Erich Hofstädter vermutete unter der puderweißen Schicht eine Oberfläche so hart wie Stahl. Täuschend schön, wie ein Mörder, verborgen unter einer trügerischen Maske.
Im Fernsehen lief eine dieser Jahresrückblick-Shows mit überdrehten Gästen und albernem Publikum. Immer wieder wurde ein Anrufer durchgestellt, der von einem peinlichen oder „unvergesslichen“ Erlebnis berichtete – und am Ende stolz seinen kompletten Stammbaum grüßte. Regelmäßig wurde das ohnehin schon belanglose Programm von ewig langen Werbeblöcken unterbrochen.
Wie jedes Jahr waren es vor allem Kinder, die andere Kinder vor dem Bildschirm anbrüllten, sie bräuchten dringend dieses eine neue, unverzichtbare Spielzeug. Hofstädter war sich sicher: Diese Spots sorgten in so manchem Wohnzimmer für lautstarke Debatten – inklusive Augenrollen und Diskussionen mit pädagogischem Unterton.
Ein elektrisch betriebener Spielzeughund wurde stolz von einem Kind ausgeführt. Er konnte laufen, bellen – und pinkeln. Die Firma hatte ihn auf den klangvollen Namen „Pipi-Max“ getauft. Allein das reichte schon, um unzählige Kinderherzen höher schlagen zu lassen.
Was für ein Schwachsinn, dachte Hofstädter.
Er hätte lieber eine Arte-Doku geschaut. Vielleicht eine über ein Naturvolk oder irgendwas mit Tieren.
Aber er hatte nachgegeben – die Aussicht auf einen mittelmäßigen ARD-Tatort war wenig verlockend. Verbrechen begleiteten ihn ohnehin durch die hellen Stunden seines Tages; er musste sie nicht auch noch am Abend auf dem Bildschirm ertragen. Und einen Krimi mit seiner Tochter zu schauen, glich eher einer Live-Podiumsdiskussion: Jede Wendung wurde zerlegt, jede Theorie ausdiskutiert.
Schon zum dritten Mal griff Maike in die Chips-Schale, kaute genüsslich mit halb geöffnetem Mund – was es nahezu unmöglich machte, dem bemühten Humor des Moderators zu folgen.
„Pssst!“, zischte Hofstädter und stupste seine Tochter sanft in die Seite.
Prompt verschluckte Maike sich – ein heftiger Hustenanfall übertönte die Pointe, was die Geräuschkulisse im Wohnzimmer nicht eben verbesserte.
Aus der Küche zog ein köstlicher Duft nach frisch gebratenen Frikadellen durchs Haus. Hinter der angelehnten Tür dudelte leise ein altes Kofferradio, das eine endlose Parade an Weihnachtsschnulzen zum Besten gab.
Hofstädter lief bei dem Gedanken an die hausgemachte Kost seiner Frau das Wasser im Mund zusammen.
Irene war nicht nur eine begnadete Köchin – sie war auch eine Frau von Format: klug, charmant und von ihrer Mutter solide in Hauswirtschaft und Lebenskunst unterwiesen. In dreißig Jahren Ehe hatte es keinen einzigen Tag gegeben, an dem er seine Entscheidung bereut hätte, sie geheiratet zu haben. Und das, dachte er, sei heutzutage durchaus bemerkenswert.
Wie oft hatte er Kegelkumpel Horst zugehört, wenn dieser über seine Frida herzog.„Wenn ich noch mal wählen könnte…“, hatte der erst kürzlich gesagt und dabei in sein Bier gestarrt.
„Aber nach 25 Jahren nickst du halt nur noch – und nimmst es hin.“
Viele seiner Freunde und Kollegen waren längst geschieden oder lebten nur noch der Kinder wegen mit ihren Partnerinnen zusammen. Manche hielten aus reiner Gewohnheit durch, andere aus Angst vor der Einsamkeit.
Aber Hofstädter? Für ihn war eine Trennung nie eine Option gewesen. Warum auch? Irene sorgte für ein warmes Zuhause, eine frische Mahlzeit – und für die Kinder. Auch wenn Tochter Jennifer meistens weghörte, wenn ihre Mutter erklärte, dass man eine Kartoffel auch ohne Sparschäler schälen könne.
Außerdem war seine Irene eine liebevolle und ehrliche Partnerin mit der er auch nach so vielen Jahren, tiefe und gute Gespräche führen konnte.
Für die Erziehung ihrer Kinder hatte Irene ihre vielversprechende Karriere als gerichtsmedizinische Assistentin aufgegeben.
Dr. Kant, ihr damaliger Vorgesetzter, hatte das als glatten Verlust bezeichnet – zu Recht. Irene hatte ein Talent, das selten war: Sie las aus einer Leiche wie andere aus einem Buch. Sie erkannte Dinge, die anderen verborgen blieben, als sei sie für die Forensik geboren.
Manchmal half sie sogar ihrem Mann bei seinen Fällen – vor allem dann, wenn er ihre Expertise, der seines Kollegen Frank Weimer vorzog. Was oft genug der Fall war.
Frank Weimer war für Hofstädter ein Armleuchter: ein Mann, der mit geschmacklosen Witzen über Tote seine Unsicherheit zu überspielen versuchte.
Wenn Dr. Weimer allein eine Leichenschau verantwortete, glich das jedes Mal einem Desaster. Er war unorganisiert, schusselig – und ein äußerst unangenehmer Zeitgenosse. Doch die Gerichtsmedizin war nun mal nicht überlaufen von jungen Talenten. Man musste nehmen, was man bekam. Und in diesem Fall war das eben: Frank Weimer.
Dass Irene ihre Karriere freiwillig an den Nagel gehängt hatte, war für Hofstädter bis heute ein bittersüßer Gedanke.
Er hatte sie nie dazu gedrängt – im Gegenteil. Sie war überzeugt gewesen, dass eine Frau besser Haus und Kinder im Griff haben sollte. So hatte man es ihr beigebracht, und so wollte sie es weitergeben. Altmodisch? Vielleicht. Aber damals war das noch legitim.
Dabei hatte sie zur Zeit ihrer Berufstätigkeit deutlich mehr verdient als er.
Allein das hatte im Dorf für Getuschel gesorgt. Es gehörte sich nicht – so dachten viele –, dass eine Frau einem so zeitraubenden Beruf nachging. Schon gar nicht, wenn sie dabei ihren Mann überflügelte. Je weiter man sich von der Stadt entfernte, desto schrulliger wurden die Ansichten. Und Hofstädter lebte quasi 50 Kilometer jenseits der Moderne – tief im Westerwald, wo Klöppeldeckchen und Kirchgänge noch Gewicht hatten.
In Buchholz reichte es für einen gesellschaftlichen Skandal, wenn eine Frau einen Computer bedienen konnte. Dass Irene ihr Leben lieber der Forensik als der Faltenpflege widmete, war für manche ein regelrechter Affront.
Als sie sich kennenlernten, war er ein unbedeutender Streifenpolizist mit Gummibärchen im Handschuhfach. Ein paar Temposünder, nächtliche Ruhestörungen – das war sein Alltag. An eine Karriere im Morddezernat hatte er damals nicht im Traum gedacht.
Sein erster Fall war ihm eher zufällig in den Schoß gefallen: Eine alte Schulfreundin Irenes hatte ihr Baby als vermisst gemeldet – das Kind war aus dem Kinderwagen verschwunden, während die Mutter sich in der Hospitalkantine einen Kaffee holte.
Hofstädter nahm sich der Sache an, obwohl er es offiziell gar nicht durfte – er war befangen. Aber das interessierte damals niemanden. Diese Form von Regeln nahm man damals noch nicht so genau.
Er erinnerte sich noch gut an die Verzweiflung der Mutter. Wie sie schrie, flehte, hyperventilierte. Ein Arzt hatte ihr ein Beruhigungsmittel spritzen müssen. Hofstädter war zu dem Zeitpunkt noch kinderlos, aber Irene war schwanger mit ihrer ersten Tochter. Das machte den Fall für ihn persönlich.
Wobei man gestehen musste, jeder Fall, den Hofstädter je bearbeitet hatte, war persönlich.
Er war jung, grün hinter den Ohren, und hatte keine Erfahrung im Umgang mit Angehörigen. Sein Mentor Paschnik vom Präsidium Koblenz versuchte, ihm die richtige Sprache beizubringen. Doch Hofstädter trat von einem Fettnäpfchen ins nächste: Er schürte Hoffnung, nur um sie im nächsten Satz unbeabsichtigt zu zerstören. Trotzdem: Die Geschichte schlug Wellen. Und er wurde plötzlich bekannt.
Was ihn beinahe seine Karriere gekostet hätte – denn er hatte sich, wie er später selbst zugab, dumm angestellt. Aber sein
Scharfsinn blieb davon unberührt.
Nur ihm war aufgefallen, dass die diensthabende Hebamme sich in Widersprüche verstrickte. Erst behauptete sie, an dem Tag gar keinen Dienst gehabt zu haben – der Plan sagte etwas anderes. Dann sagte sie, sie habe das Kind nur flüchtig gesehen, es sei oft allein herumgestanden. Einem anderen Kollegen erzählte sie, sie habe es regelmäßig versorgt – auch an jenem Tag.
Hofstädter hatte mühsam recherchiert und festgestellt:
Die Frau hatte bereits Kinder im Säuglingsalter verloren. Und als sie den Kinderwagen unbeaufsichtigt sah, glaubte sie, das Kind retten zu müssen. Während er sie festnahm, schluchzte sie immer wieder: „So einer darf man kein Baby anvertrauen.“
In den Medien wurde er als „der Kinderretter“ gefeiert. Es war ihm unangenehm. Fremde gratulierten ihm auf der Straße, lobten ihn für seine „Heldentat“. Aber das war doch nur sein Job – der Beruf, für den er sich entschieden hatte. Nicht mehr, nicht weniger.
Und doch schien der Fall wie ein Wendepunkt: Von da an wurden Kinder auffällig oft zur Zielscheibe von Verbrechen. Oder es kam ihm nur so vor. Jedenfalls hatte er plötzlich mehr Fälle, als er bewältigen konnte.
Er löste sie – einen nach dem anderen. Schließlich wurde er befördert, zum Polizeihauptkommissar, und bekam eine Partnerin zur Seite gestellt.
Seine kleine Wohnung platzte bald aus allen Nähten, also baute er sich ein Haus – ein Traumhaus, nahe dem Wallroth. Er hatte immer davon geträumt ein Haus zu bauen.
Wollte es mit seinen eigenen Händen errichten, hatte sich aber vollkommen überschätzt. Ein Holzhaus stampfte man nicht eben über Nacht aus dem Boden. Doch die harte Arbeit lohnte sich.
Das kleine Haus am Orteingang war ein Blickfang, der immer wieder interessierte anlockte. Er machte sich in vielerlei Hinsicht einen Namen.
Er wurde zu einem von vielen im Präsidium – aber zu einem der wenigen, die mit besonders heiklen Fällen betraut wurden.
Er und Irene heirateten spät. Eigentlich nur, um nicht „in Sünde“ zu leben – wie die Dorftratschen es nannten. Die Hochzeit fand in einem wild bewachsenen Garten statt, getraut wurden sie von einem freien Geistlichen.
Katholisch, in einer Kirche? Niemals. Das hätte man ihm aus dem Leib prügeln müssen.
Dennoch hatte selbst der alte Pfarrer Heinrich, der kurz darauf verstarb, den Damen aus dem Kirchenchor bestätigt:
„Die Ehe zählt. Die Sünde ist vergeben.“ Ausgerechnet aus seinem Mund – wie absurd.
Zum Trauergottesdienst war Hofstädter nicht gegangen, obwohl seine Mutter darauf bestanden hatte. Aber sie hatte ihm schon lange nichts mehr zu sagen.
Nach der Geburt von Jennifer folgte zwei Jahre später Maike – pausbackig, willensstark. Irene ging vollkommen in ihrer Mutterrolle auf. Doch ganz los ließ sie die Gerichtsmedizin nie. Immer wieder lagen medizinische Fachzeitschriften oder dicke Anatomiebände auf dem Wohnzimmertisch. Hofstädter störte das nicht – im Gegenteil. Ihre Klugheit war es gewesen, in die er sich einst verliebt hatte.
Doch dann kam dieser letzte Fall. Ein Fall, der ihn zerbrach. Wenige Tage, nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, stellte er einen Versetzungsantrag – raus aus dem Dunstkreis der Presse, raus aus dem Rampenlicht.
Er wollte nichts mehr beweisen. Wollte kein „Erster Polizeihauptkommissar“ werden. Nur noch: Hofstädter. Kommissar. In Frieden.
Seine neue Dienststelle lag in Straßenhausen, ein verschlafener Ort, der in keiner Akte wichtig klang. Ein Nebenschauplatz, der seinem Kaliber nicht gerecht wurde – und genau das war das Ziel.
Seine Kollegin, loyal wie eh und je, folgte ihm. Jetzt saßen sie gemeinsam im kleinen Büro des Rathauses in Asbach und kümmerten sich um das, was man früher „die Probleme der kleinen Leute“ genannt hätte.
Er blickte auf.
Rudi Carrell sang irgendetwas über die vergehenden Jahre und gezählte Tage. Hofstädters Gedanken drifteten zurück zu seinem letzten großen Fall. Unwillkürlich rieb er sich über das Bein. Tagelang hatte Irene ihm Fotos gezeigt, medizinische Zeichnungen, Modelle. Immer wieder hatte sie erklärt, dass eine Kugel in der Oberschenkelarterie sein Ende bedeutet hätte. Nicht vielleicht. Ganz sicher.
Da hätte kein Sanitäter der Welt mehr helfen können.
Das Knarren der Wohnzimmertür riss ihn aus dem Gedankensog. Jennifer steckte den Kopf herein und sah die beiden Fernsehzuschauer streng an.
„Mutti ist fertig“, verkündete sie und ließ die Tür offenstehen.
Maike griff noch einmal tief in die Chips-Tüte – man wusste ja nie, ob man den Weg bis zur Küche überlebte. Hofstädter schmunzelte. Nein, an Hunger würde sie bestimmt nicht zugrunde gehen.
Er hatte zwei bildhübsche Töchter, keine Frage. Doch Maike war eher eine Rubensfrau aus dem Barock als ein modernes Mädchen. Breite Hüften, kräftige Beine, volles Gesicht – aber immer ein Lächeln. Dass sie nicht ständig von Verehrern umschwärmt wurde, war für Hofstädter eher beruhigend. Jennifer machte schon genug Drama für beide.
Mit ihren siebzehn Jahren interessierte sie sich mehr für Jungs als für höhere Mathematik. Vokabeltests oder Klausurvorbereitung? Fehlanzeige. Stattdessen: Dorfdisco, enge Tops, lange Nächte.
Bei ihrer gertenschlanken Figur konnte sie sich das leisten – auch wenn es dem Vater missfiel.
Zum Glück beschränkte sich das pubertäre Chaos auf einen einzigen Kavalier:
Karsten Schuster, Sohn vom örtlichen Autohändler. Kein Wunsch-Schwiegersohn, aber höflich, pünktlich – und harmlos. Jennifer jedoch hatte das Talent, jede Kleinigkeit in ein Drama zu verwandeln.
Als Karsten ihr zum Valentinstag keine Rosen schenkte, flossen Tränen in Telefonlitern. Erst mit Susanne, dann mit Annika – und schließlich mit Karsten selbst, der sich anhören durfte, dass ihre Freundinnen jetzt glaubten, er liebe sie nicht.
Während Jennifer das Telefon blockierte, verpasste Irene den Anruf, der ihr sagen sollte, dass ihr Mann angeschossen worden war. Petra Lohmann musste sie schließlich mit der Streife abholen. Die Nachricht verbreitete sich im Dorf wie ein Lauffeuer. In Buchholz musste man aufpassen, wem man etwas erzählte – und noch mehr, wem man etwas verschwieg. Die Dinge hatten hier die Angewohnheit, sich selbstständig zu machen.
Oft wussten andere längst Bescheid, ehe man selbst verstand, was eigentlich geschehen war. Neuigkeiten reisten nicht per Post, sondern über Gartenzäune, durch Metzgereien und Kirchenbänke. Wer zu viel redete, wurde zerrissen – wer schwieg, wurde ausstaffiert mit Gerüchten. Im Zweifel konnte ein schräger Blick beim Bäcker mehr anrichten als ein Zeitungsartikel.
Und Vertrauen war hier keine Tugend, sondern ein Risiko.
Maike hingegen kam ganz nach ihrer Mutter – nicht nur äußerlich, sondern vor allem im Kopf. Keine Eskapaden, keine Telefonrechnungen im dreistelligen Bereich. Mit fünfzehn schrieb sie Bestnoten und belegte Leistungskurse, von denen ihre Schwester nur träumen konnte.
Sie wollte Ärztin werden. Nein – Pathologin.Das Praktikum bei Dr. Kant hatte sie begeistert. Sie wollte nicht nur zusehen, sie wollte selbst sezieren, verstehen, aufklären. Während andere Schüler den Mageninhalt von Fröschen erforschten, öffnete Maike Brustkörbe. Ohne zu zittern.
Dr. Kant war begeistert – Weimer eher nervös.
Einziger Wermutstropfen: Noch drei Jahre bis zum Abitur. Dann das Studium. Aber Weimer hatte schon gemurrt: „Wäre ja auch noch schöner, wenn jeder einfach so losschnibbeln dürfte.“
Jennifer hingegen überlegte ernsthaft, das Abitur ganz zu lassen. Mathematik war zeitraubend, und Zeit – so fand sie – zu wertvoll für Gleichungen. Eine Büroausbildung würde reichen.
Und wenn Karsten gut verdiente, würde sie sich um die Kinder kümmern. Zwei an der Zahl. Das stand für sie schon fest.
„Denkst du echt, der will so ’ne hohle Nuss wie dich heiraten?“, stichelte Maike eines Abends.
Und obwohl Maike sich zu wehren wusste – sie war schlagfertig, nicht nur verbal – weinte sie nachts leise in ihr Tagebuch. Schrieb über Janis Koch, der sie als „Lebensmittel Vernichterin“ verspottet hatte. Schrieb, dass sie sich wünschte, einmal jemanden zu finden, der sie mochte. Nicht trotz, sondern wegen ihres klugen Kopfes.
Beim Abendessen dozierte Maike oft über Leichenfunde und Autopsien, bis Jennifer der Appetit verging.
„Kannst du auch mal über was anderes reden als tote Menschen?“, fragte sie, angewidert.
„Kann ich“, konterte Maike, „aber das wäre zu hoch für dich.“
Es folgte ein Wortgefecht. Wie immer gewann Maike. Spätestens, wenn sie mit Fremdwörtern um sich warf, kapitulierte selbst ihr Vater.
Irene brachte den Nachtisch: Paradiescreme.„Ach, ist das nicht herrlich? Der Schnee!“, schwärmte sie und sah verträumt aus dem Fenster.
„Die perfekte Nacht für einen Mord“, murmelte Maike mit vollem Mund.
„Sag so was nicht“, mahnte Hofstädter.
Doch er wusste: Solche Nächte hatten etwas. Sie machten Menschen empfänglich. Für lange verdrängte Impulse. Für dunkle Fantasien. Manchmal fand man dann einen vergifteten Mann im Garten. Eine erschlagene Frau im Schnee.
Und wenn es keine Leiche war, dann war es wenigstens ein kleiner Aufruhr.
Ein geklauter Gartenzwerg, ein Kratzer im Autolack, eine Schneeschippe, die plötzlich beim Nachbarn stand. Bagatelldelikte, die niemand zugab, aber jeder verdächtigte.
Es waren dieselben Straßen, in denen Familien ihre Streitigkeiten hinter zugezogenen Gardinen austrugen – mit Worten wie Messern, die keiner hören sollte, obwohl sie jeder ahnte. Dieselben Gassen, in denen Teenager in der Abwesenheit ihrer Eltern Partys feierten, laut, hemmungslos, durchtanzt bis in den Morgen.
Die Musik war so dröhnend, dass sie das Dorf erschütterte – nur die besonders alten, besonders schwerhörigen Nachbarn schienen sich je zu beschweren.
Und selbst das klang oft mehr nach Neid als nach Ärger.
Buchholz war kein Ort für Verbrechen im großen Stil. Aber es war ein Pulverfass für das Kleine, das Alltägliche, das unterdrückte. Und manchmal, an Nächten wie dieser, reichte ein Funke.
Lag es am Wetter? Am Schnee? An der Dunkelheit?
Aus einem Seminar wusste er: Melancholie war ein Nährboden für Gewalt.
Er sah zu seiner Frau, wie sie am Fenster stand, die Arme verschränkt, den Blick nach draußen gerichtet. In solchen Momenten wirkte sie fast entrückt. Wäre sie je dazu gekommen, hätte sie eine faszinierende Abhandlung über wetterfühlige Mörder geschrieben.
Der schrille Klingelton des grünen Wählscheibentelefons riss ihn aus den Gedanken.
„Das darf doch nicht wahr sein“, murmelte er.
Irene ging ran. „Hofstädter“, sang sie gut gelaunt.
„Ach, Petra. Wie schön. Oh… ja, er ist da. Warte kurz.“
Sie steckte den Kopf durch die Küchentür. „Erich? Petra für dich.“
Hofstädter presste die Lippen zusammen. Warf Maike einen vielsagenden Blick zu. „Siehst du“, brummte er und legte den Löffel zur Seite.
„’N Abend, Petra“, sagte er in den Hörer.
Petra Lohmann rief nie ohne Grund an. Schon gar nicht nach Dienstschluss. Wenn sie anrief, dann war jemand tot. Oder auf dem besten Weg dorthin.
„Wir müssen nochmal raus“, sagte sie knapp. „Bin in fünfzehn Minuten bei dir. Okay?“
„Worum geht’s?“, fragte er, während er in den Flur ging und seine Schuhe aus dem Schrank zog.
„Ein Kind. In Oberscheid. Wird vermisst“, murmelte sie. Leise. Weil sie wusste, wie sehr Hofstädter solche Fälle hasste.
Nicht, weil es Vermisstenfälle waren. Sondern weil es Kinder waren.
Kapitel 2
Die Uhr auf dem Armaturenbrett von Petra Lohmanns silbernem Mercedes zeigte 20:45 Uhr, als sie Oberscheid durchquerten. Es war – zusammen mit zwei kurzen Nebenstraßen – die einzige Straße, die dieses Dorf zu bieten hatte.
Die Straße durch Oberscheid machte ein paar enge Schlenker, vorbei an einer Bäckerei, einem winzigen Krämerladen, der aus kaum mehr als einem Raum bestand, und einer Kneipe, die direkt hinter dem Ortsschild lag – als wolle sie jedem Neuankömmling sofort den Pegel diktieren.
Sie fuhren durch das verschlafene Dörfchen, vorbei an den beiden Querstraßen. Die eine führte zum Friedhof, zur kleinen Kapelle in die kaum eine Handvoll Menschen passte. Die andere schlängelte sich zu weiteren Wohnhäusern, die – wie die Hauptstraße – dicht an den Wald grenzten. Ein Wald, der das Dorf wie eine drohende Umarmung einzuschließen schien.
Nach ein paar weiteren Metern endete die Straße – und mit ihr Oberscheid – in einem Waldstück.
Die Häuser hier waren bereits weihnachtlich geschmückt, Lichterketten blinkten, Sterne funkelten. Es herrschte eine warme, festliche Stimmung. Weihnachten stand vor der Tür – und das war hier nicht zu übersehen.
Auf den ersten Blick waren es vier Häuser, die gegensätzlicher kaum sein konnten: pompös, gutbürgerlich, klein, aber gepflegt und abrissreif.
Letzteres war das Zuhause der Familie Martin.
Bunte Lichterketten und flackernde Leuchtschläuche versuchten, das baufällige Ambiente in ein festliches Licht zu tauchen. Doch wer genau hinsah, erkannte: Das kleine Haus war der Schlussstein von Oberscheid – und keiner der Glanzvollen.
Rechts daneben stand das Fachwerkhaus von Kurt Schuster, dem KFZ-Mechaniker seines Vertrauens. Auch dieses war früher einmal üppig geschmückt gewesen. Hofstädter erinnerte sich gut an das Rentier auf der Garage, an den leuchtenden Schlitten und die zahllosen Lichter, als die Schusters im Vorjahr zum Glühwein eingeladen hatten.
Dieses Jahr jedoch: nur zwei beleuchtete Sterne, links und rechts der Haustür.
Die Kinder waren inzwischen Teenager – und offenbar zu cool für Weihnachtskitsch.
Man hätte das nächste Gebäude für Schusters Scheune halten können, doch es war ein Haus – das Haus der Witwe Stockhausen. Es lag gut versteckt hinter hohen Tannen, die neben Schusters Grundstück aus dem Boden ragten.
Ihr verstorbener Mann, Dirk Stockhausen, hatte es liebevoll „das Hexenhaus“ genannt. Es hatte Charakter, war schief, windschief – und an Halloween ein echter Hingucker.
Doch seit seinem Tod kümmerte sich niemand mehr um die Dekoration. Die dunklen Fenster des Hauses blieben auch an diesem Dezemberabend stumm.
Zwischen dem Haus der Martins und dem der Schusters führte ein Trampelpfad direkt in den Wald – ein geheimer Weg, den die Dorfkinder liebten. Er führte zum provisorischen Spielplatz, der aus ein paar alten Geräten bestand, aber immerhin einen Rückzugsort bot.
Die Scheune hinter dem Haus der Martins war einst tatsächlich eine gewesen.
Heute wohnte dort Ansgar Kolewski, der das baufällige Gebäude in ein eigenwilliges Zuhause verwandelt hatte – ganz ohne offiziellen Straßenzugang.
Die Scheune hatte keinen richtigen Straßenzugang, was häufig dazu führte, dass Pakete für die Wallau Straße 47 bei einem der Nachbarn abgegeben wurden – oder eben gar nicht ankamen. Nur wer ortsansässig war, wusste, dass der alte Kolewski dort lebte. Und wenn der Postbote mal Urlaub hatte, glaubte seine Vertretung regelmäßig, die Adresse müsse ein Irrtum sein.
Die Scheune stand so versteckt hinter üppigen Büschen und einem gigantischen Haus, dass man die blinkenden Fensterbilder nicht wirklich erkennen, sondern höchstens erahnen konnte. Doch immerhin flimmerten bunte Punkte in der Dunkelheit – wie stumme Morsezeichen aus einem verborgenen Leben.
Das davorstehende, beeindruckende Haus gehörte der Familie Sommerfeld.
Es nahm die komplette linke Seite des Wendehammers ein und war von einem weißen Palisadenzaun eingefasst, der ungebetene Gäste davon abhalten sollte, die perfekt gestutzten Büsche auch nur zu streifen. Der Weg zur großen gläsernen Eingangstür war akkurat gepflastert, das Unkraut aus den Fugen mühsam herausgekratzt worden – vermutlich erst am Nachmittag.
Das Haus selbst war geklinkert und von großzügig angelegten Beeten umrahmt. Im direkten Vergleich wirkte das Haus der Familie Martin, vor dessen Gartentor sie nun parkten, wie eine Bruchbude. Es war ein uraltes Bauernhaus mit einem jener geschnitzten Holzbalken, in den stolz die Jahreszahl 1816 eingebrannt war. Trotz seiner Baufälligkeit verströmte es etwas Warmes, etwas Einladendes.
Die kleinen blauen Fensterläden im ersten Stock hingen schief und hätten längst nachgezogen werden müssen. Die Farbe blätterte vom Zaun, und auch die Haustür war vom Zahn der Zeit deutlich gezeichnet.
So etwas wäre der Königin des Dorfes, Ingrid Sommerfeld, nie passiert.
Wenn eine Pflanze nur den Anschein erweckte, sie könnte bald verwelken, wurde sie mit Feuereifer herausgerissen und auf den Kompost befördert.
Der stand natürlich diskret im hintersten Winkel des Gartens, verborgen hinter ein paar Tannen – denn die Fassade war heilig.
Sie war das Aushängeschild einer jeden Familie.
Was die Leute sahen, war Ingrid Sommerfeld immer wichtiger als das, was sie über sie sagten. Und das war selten schmeichelhaft.
Hofstädter kannte einige Geschichten über die unfreundliche Frau Sommerfeld – Geschichten, die bis nach Buchholz-Wallroth hallten. Und natürlich war auch ihr Mann kein Unbekannter. CDU-Parteivorsitzender für den „Wahlkreis“ Oberscheid – wobei man das kaum so nennen konnte. Außerdem war er ehemaliger Finanzbeamter, mit dem Hofstädter selbst schon über seiner Steuererklärung gebrütet hatte. In der Region war er angesehen und auf jeder Veranstaltung präsent.
Ob Straßenfest, Wahlkampfauftakt, Büroeröffnung oder Schützenfest – wo gefeiert wurde, hörte man auch seine durchdringende Stimme lauthals lachen.
Das Hemd stets faltenfrei, die Anzughose auf Schlag gebügelt und getränkt in einem halben Liter Kölnisch Wasser – ein Duftcocktail, der Irene keine fünf Minuten neben ihm stehen ließ, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
Während andere im Ruhestand auf Jeans und Strickpullover umstiegen, bekam man Herrn Sommerfeld nicht aus seinem feinen Zwirn. Der einzige Ort, an dem er je ohne Anzug gesehen wurde, war das Gemüsebeet, das er seit seiner Pensionierung mit bemerkenswerter Leidenschaft pflegte.
Wo hätte er sich auch sonst hin flüchten sollen – mit so einem schwierigen Frauenzimmer daheim?