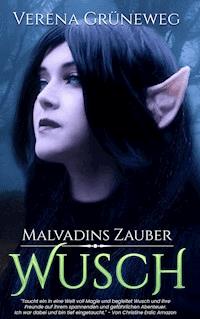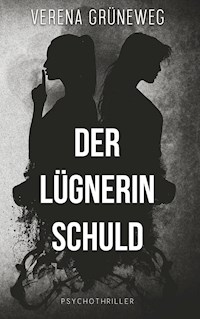
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie sagen, ich bin schlecht und habe kein Recht, ein Teil von ihnen zu sein. Sie sagen, ich bin anders, böse, und sie erzählen Lügen über mich. Schlimme Dinge, die ich getan haben soll. Sie tun das, weil sie nicht verstehen, was es heißt, jemand wie ich zu sein und eine Mutter wie meine zu haben. Dabei will ich doch gar nicht viel. Ich möchte nur dazugehören. Dass man mich mag und versteht, warum ich all diese Dinge tue. Mehr nicht - oder ist das zu viel verlangt? Zwei Mädchen, zwei unterschiedliche Leben, die durch Zufall verbunden werden. Als Simone mit ihren Eltern aus der Großstadt aufs Land zieht, lernt sie Olivia kennen. Eine Gleichaltrige, deren Kindheit alles andere als Geborgenheit kennt. Durch ein Unglück werden aus Freundinnen Schwestern, die gemeinsam gegen die Engstirnigkeit der Ortsansässigen kämpfen. Doch mit der Zeit zerreißt das zwischen ihnen geknüpfte Band und beide gehen ihre eigenen Wege. Während die eine augenscheinlich das Glück gepachtet hat, muss die andere weiter die Quälereien der Kleinstadtbewohner ertragen. Aber dann wendet sich das Blatt. Das Böse, die dunkle Seite der Gesellschaft, zieht in den bisher idyllischen Ort ein. Nichts ist mehr, wie es war, und alles, was vorher weit weg erschien, ist plötzlich ganz nah. Die Mauer gebaut aus Ignoranz und Naivität zerbricht! Der Preis dafür ist hoch und er wird mit Blut bezahlt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis zu der folgenden Geschichte:
Alle Personen, Orte sowie die Geschehnisse in diesem Buch sind frei erfunden und nur ein Produkt meiner Fantasie.
Sollten jegliche Ähnlichkeiten mit den oben genannten bestehen, so sind diese rein zufällig entstanden und entsprechen nicht der Realität.
Gewidmet der Thrillerspoilerbande, einer ganz besonderen Facebook - Gruppe. Danke an Euch alle.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kindheit
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Jugend
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Erwachsen
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Das letzte Kapitel
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 53
Epilog
-Prolog-
Ich höre die Möwen, wie sie schreien. Laut und fordernd, ohne Rücksicht. Aber warum sollten sie auch Rücksicht auf mich nehmen? Ihr einziger Anreiz ist die Suche nach Futter. Brötchen, Eis und Pommes, welche Touristen, ohne nachzudenken, hier am Strand hinschmeißen. Ahnungslos, was sie damit anrichten.
Wirklich ahnungslos - oder sollte ich eher sagen rücksichtslos?
Die Möwen, die Ratten des Meeres, sie werden immer mehr. Verdrängen andere Vogelarten. Stürzen sich auf alles, was sie irgendwie an Nahrung erinnert. Mehr als einmal passiert es, dass man Kinder schreien hört, weil wieder eine dieser Plagegeister ihnen das Eis im Sturzflug aus der Hand stiehlt.
Ich lebe in einer kleinen Stadt in Ostfriesland, nahe an der Küste, wo der Wind rau ist und die Menschen einfach. Nicht abgehoben, überkandidelt. Sie wollen nur ihr Leben in Ruhe genießen.
Ich bin hier aufgewachsen, kenne die Umgebung und liebte mein Leben. Meine Familie und meine Freunde waren ein Teil von mir, mit dem ich mein Glück teilte. Niemals dachte ich, es könnte eines Tages anders werden. Sah meine Zukunft in den schönsten Farben, stellte mir vor, wie sie sein würde, und rechnete nie damit, dass jemand diese Träume zerstören könnte.
Und doch fand dieser eine Mensch den Weg zu mir. Ich habe ihn nicht kommen sehen und er brachte Leid und Kummer mit sich. Er kam auf leisen Sohlen, verbreitete sich wie eine Seuche - und wie die Möwen vermehrte sich auch das Böse hier in unserem Ort. Es zog ein, ohne dass es jemand aufhalten konnte.
Ich schaue ins Weite und sehe die Inseln in der Ferne. Ein wunderschöner Anblick, wie die Sonne langsam untergeht und im Meer versinkt. Wie ihre letzten Strahlen im Wasser glitzern und alles friedlich aussehen lässt.
Nur ich, ich störe dieses friedvolle Bild. Meine Kleidung ist zerrissen und von meinem einstigen langen Haar sind nur noch vereinzelte Büschel übrig. Mein Gesicht ist geschwollen und es scheint, dass meine Nase gebrochen ist. Doch ich spüre den körperlichen Schmerz nicht. Das, was ich innerlich fühle, der Schmerz in meiner Seele, er ist es, der mich zerstört. Ich bin ein Mädchen, das alles verloren hat. Das mit hoffnungslosen Augen, einen Fetzen Papier krampfhaft in der Hand haltend, auf das Meer hinausstarrt. Tränen, die ihr die Wangen herunterlaufen, auf den Zettel tropfen und die letzten Worte verschmieren, unleserlich machen. Allerdings ist es völlig gleichgültig, ob jemand sie später noch entziffern kann, denn mir haben sie sich für immer in den Verstand eingebrannt:
Peter Fischer Jennifer Heit Diana Großer Antje Dörnbrack Jessica Kant Michaela Preuss Marlies Sommerfeld Olivia Brandt Und an letzter Stelle mein eigener Name Simone Fischer.
Ich kenne diese Namen zu gut. Sie bedeuteten einst die Welt für mich. Eine Welt, wie es sie niemals wieder für mich geben wird. Dies ist nun meine Geschichte.
Kindheit
Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir schreiben sollten.
-Peter Roseger-
Die Kindheit sollte aus Träumen in denen uns Elfen, Feen oder Trolle besuchen und wir mit dem Glauben an Wunder leben, bestehen Wir sollten jeden Tag fröhlich begrüßen und uns auf das Abenteuer Leben, ohne Angst immer wieder aufs Neue einlassen. Eltern und Geschwister, die Helden und Beschützer, die uns retten, sein. Wir sollten Freunde haben, an die wir uns als Erwachsener mit wunderbaren Bildern von der gemeinsamen Kinderzeit vor Augen, erinnern.
Ja, so sollte für uns alle die Kindheit sein...!
Verena Grüneweg
-1-
Ostfriesland, dort würde meine Familie hinziehen. Für mich, damals eine Siebenjährige, ein Land jenseits aller Vorstellungskraft. In Dortmund geboren und die ersten Jahre Großstadtkind, kannte ich kaum etwas anderes, als die Hochhäuser der Stadt. Lärm, rußige, dreckige Luft, Straßen, gefüllt mit Menschenmassen, gehörten für mich zur Normalität. Ab und zu sah ich auch ein wenig Natur. Doch dafür musste meine Familie mit dem klapprigen Wagen raus aus der Stadt fahren.
Ich hatte gerade das erste Schuljahr in der Grundschule beendet, als ich von dem Entschluss meiner Eltern erfuhr, an die Nordseeküste zu ziehen. Nach langer Arbeitslosigkeit erhielt mein Vater ein tolles Jobangebot von einer bekannten Firma, das, wie er sagte, uns eine bessere Zukunft garantierte.
Ostfriesland erschien mir so weit entfernt und fremd wie heute die Bahamas. Ich hatte keinerlei Vorstellung von dem Ort, in dem mein zukünftiges Leben stattfinden sollte. Während mein Vater in den höchsten Tönen von unserem neuen Zuhause schwärmte, wurde ich immer stiller.
Es machte mir Angst, von hier fortzugehen und nicht zu wissen, was mich erwartete. Meine Mutter tat ihr Bestes, mir meine Furcht zu nehmen und besorgte Bücher, in denen Fotos von der neuen Heimat abgebildet waren. Gemeinsam schauten wir sie uns an und Mama erklärte mir alles, was auf ihnen zu sehen war. Lange Landstriche, die nichts als Grün, saftige Wiesen und Ackerland zeigten. Große Gebäude, die sie Bauernhöfe nannte und vor denen Kühe auf Feldern grasten. Wälder, eine Burg, ein Schloss, all das wirkte wunderschön.
Aber ihr Highlight waren die Fotos von der Nordsee. Der Hafen, die Schiffe, der Deich und die wunderschönen Sonnenuntergänge. Sie konnte gar nicht genug von den Bildern bekommen und strahlte über das ganze Gesicht vor Vorfreude. Manchmal machte sie den Eindruck, als ob ich ihr Alibi wäre, um immer wieder in die Bücher zu schauen.
Bald schon begann das Kistenpacken in unserer kleinen Blockwohnung. Die Tage rannten dahin und eines guten Morgens stand der Umzugswagen vor der Tür. Die wenigen Habseligkeiten waren schnell verstaut. Große Abschiedsszenen gab es nicht, denn weder meine Eltern noch ich selbst besaßen Freunde, die uns vermissen würden. Unsere einzigen Verwandten, meine Großeltern, lebten nicht mehr und so setzten wir uns in den Wagen und fuhren einfach los.
Je näher das Ziel kam, umso häufiger entdeckte ich Kühe und Pferde am Rande der Straßen auf ihren Weiden grasen. Immer weniger Häuser und Fabriken verschandelten das Bild der Landschaft, bis es dann so weit war und wir an unseren Zielort gelangten.
Mit riesigen Augen schaute ich aus dem Autofenster. So viel Natur hatte ich noch nie gesehen. Die riesigen Bäume am Straßenrand. Imposant aber auch furchteinflößend. Ich wusste nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Der Blick war frei, nicht eingeengt durch zahlreiche Hochhäuser. Ein kleiner Ort, aber für ein Kind ein Platz, der dazu einlud, auf Abenteuerreise zu gehen.
Dann bog das Auto in eine Siedlung ein, wie es mein Vater nannte. Häuser, mal etwas größer, mal etwas kleiner, doch alle standen sie nahtlos aneinandergereiht an einer schmalen Kopfsteinpflasterstraße. Vorne mit Jägerzäunen versehen hinter denen Blumen in allen erdenklichen Farben wuchsen, sowie ein perfekt gepflegter Rasen sich zeigte. Die Fassaden der Häuser waren aus roten, weißen oder auch hier und da zweifarbigen Ziegelsteinen. Aber nirgends war das scheußliche Grau - Braun der Großstadtblocks zu entdecken. Wie gemalt lagen die Einfamilienhäuser da und strahlten in ihrer Schönheit um die Wette.
„Verdammt, Nadine, warum sagst du mir denn nicht Bescheid, wo wir hinmüssen! Ich glaube, ich bin gerade an unserem Haus vorbeigefahren!“ Fluchend trat Vater so heftig auf die Bremse, dass ein heftiger Ruck durch meinen Körper ging. „Dann wende doch einfach dort drüben in der Einfahrt!“, schimpfte Mutter zurück.
Eingeschüchtert von den aggressiven Stimmen meiner Eltern, zog ich den Kopf ein, denn ein weiterer Streit zwischen ihnen kündigte sich an. Wie schon so häufig zuvor. Die lange Arbeitslosigkeit von Vater hatte oft für Anspannungen und Diskussionen gesorgt. Ganz besonders, wenn sie dachten, ich würde sie nicht hören. Stundenlang lauschte ich ängstlich ihren Worten. Meistens endete es damit, dass mein Vater seine Jacke schnappte und die Tür krachend hinter ihm ins Schloss fiel. Mama blieb weinend zurück und obwohl ich noch ein Kind war, verstand ich sehr gut, was vor sich ging. Insbesondere das Wort Scheidung wurde ein Begriff, der mich, wenn ich in meinem Bett lag, die Decke über den Kopf ziehen ließ.
Ich hatte keine Geschwister mit denen ich reden konnte, die meine Ängste, Mutter und Vater würden sich trennen, beruhigten. Oft schlief ich deswegen von Alpträumen geplagt ein. Doch jetzt sollte ja alles anders werden.
Mein Vater tat trotz Murren das, was Mutter ihm vorschlug. Er fuhr auf die nächste Auffahrt und ich entdeckte ein Kind, das uns währenddessen beobachtete. Es spielte alleine mit einem Ball vor dem Haus auf dem Rasen. Neugierig betrachtete ich das Mädchen. Sie schien in meinem Alter zu sein und sah nett aus mit ihren kurzen braunen Locken. Immer wieder schob sie sich die von ihrer Nase rutschende Brille hoch und trat dann erneut gegen den Ball.
Als der Wagen die Auffahrt hochfuhr, schaute sie auf und unsere Blicke kreuzten sich. Zaghaft hob sie die Hand, lächelte und winkte mir zu. Ich erwiderte ihren Gruß und freute mich, dass es scheinbar wenigstens ein Kind in meinem Alter in dieser Siedlung gab. Die ersten Kontakte zu ihr waren geknüpft und ich schwor insgeheim, sehr bald das Mädchen zu besuchen, um sie näher kennenzulernen.
Nachdem Vater gewendet hatte, fuhr er die Straße zurück und stoppte bei einem großen Haus. Mit einem Lächeln im Gesicht drehte er sich zu mir um und sagte: „Da wären wir Moni, willkommen in unserem neuen Zuhause!“
-2-
Unsicher stieg ich aus dem Wagen und betrachtete staunend mein neues Zuhause. Wie alle anderen Häuser hatte es den Zaun, den Rasen und kleine Blumenbeete, die ringsherum das Grundstück einsäumten.
Ich fühlte mich so winzig, als ich gemeinsam mit meinen Eltern zum Eingang lief. Zwar waren die Betonbauten unserer ehemaligen Heimat riesig, aber sie standen wie eine Mauer, ohne dass es ein Ende links oder rechts zu geben schien. Mit ihrem Anblick wuchs ich die letzten Jahre auf und kannte ihn. Aber dieses Haus, das sich mir freistehend präsentierte, wirkte auf mich weitaus beeindruckender.
Die zwei oberen Fenster, das kleinere in der Mitte und die Haustür an der Vorderfront, erweckten den Anschein eines mich anstarrenden grimmigen Gesichtes.
Statt Freude, endlich Platz zum Spielen zu haben, schüchterte mich die neue Umgebung ein. Am liebsten hätte ich mich wieder in das Auto gesetzt und wäre mit den Eltern zurück nach Dortmund gefahren.
Aber mir blieb ja keine Wahl. Zögerlich folgte ich ihnen, als diese mit vielen Ahs und Ohs in das Haus schritten.
Als wir den Flur betraten, blieb ich, genau wie meine Eltern, unschlüssig stehen. Ich wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte. So viele Türen, die unzählige mir fremde Räume öffneten. Eine Treppe führte zum oberen Bereich in dem noch mehr Zimmer warteten.
Unsere kleine Blockwohnung im vierten Stock bestand aus vier Räumen, wovon zwei die Küche und das Bad gewesen waren. Es gab nicht einmal ein Wohnzimmer, denn aus diesem hatten meine Eltern ihren Schlafraum gemacht, damit ich ein eigenes Zimmer hatte. Ich glaube, uns ging es allen gleich und wir fühlten uns in unserem neuen großen Zuhause verloren.
Schweigend sahen wir uns um, ratlos, wie es weitergehen sollte. Bis mein Vater sich räusperte.
„Willst du dich nicht einfach mal alleine umschauen, Moni? Oben gibt es drei Schlafzimmer, suche dir doch schon mal eines aus!“
Mein Vater musste die Angst in meinem Gesicht bemerkt haben und wollte mir jetzt die Freude machen, selbstständig auszuwählen, welches das zukünftige Kinderzimmer sein sollte. Auch wenn alles neu war, ich mich fremd und klein fühlte, dennoch siegte die Neugier in mir.
So ließ ich es mir nicht zweimal sagen und lief die geschwungene Holztreppe nach oben. Ein beschwerlicher Weg für meine kurzen Beine, der mir unendlich lang vorkam. Ein wenig außer Atem meisterte ich die letzte Stufe und gelangte in den oberen Flur. Dort führte ein Gang zu vier weiteren geschlossenen Türen.
Langsam näherte ich mich der ersten, welche gegenüber der Treppe lag. Zwar war sie wie die anderen aus dunklem Kiefernholz aber ich erkannte, dass an ihr Sticker klebten.
Lauschend, ob ich die Stimmen meiner Eltern noch hören konnte, lief ich hin und schaute sie mir genauer an. Teilweise waren sie abgerissen und nur kleine Schnipsel übrig. Dennoch erkannte ich Bilder von Trickfilmfiguren, die ich selber sehr mochte. Für einen kurzen Moment beruhigte mich die Erkenntnis, dass hier vor mir ein Kind gelebt hatte. Doch das hielt nicht lange an, denn eine unheimliche Kindergeschichte fiel mir in dem Moment ein, als ich die Türklinke herunterdrückte.
In dieser hatte ein Mädchen verbotenerweise ein Zimmer geöffnet, in dem eine böse Hexe lebte. Befreit durch die Neugier dieses Kindes, belegte sie es mit einem Fluch und nahm dessen Gestalt an. Von nun an lebte die Hexe bei den Eltern des Mädchens. Sie aber konnte niemals mehr zurück zu ihnen und blieb für immer gefangen in diesem Zimmer.
„Aber das ist doch Quatsch, sich deswegen zu ängstigen. Es ist nur ein Märchen“, flüsterte ich. Die Eltern befanden sich in meiner Nähe und Papa hatte ja schließlich gesagt, ich solle mich umschauen. Trotzdem trat ich einen Schritt zurück und schloss die Tür, ohne den Raum zu betreten.
Vielleicht sollte ich doch auf meine Eltern warten. Unentschlossen stand ich im Gang herum, wartete darauf, dass sie die Treppe hochkamen. Doch nichts dergleichen geschah und nach wenigen Minuten wurde ich ungeduldig.
Trotz meiner Angst entschied ich mich dafür, einfach einen anderen Raum zu wählen. Die Augen geschlossen und mit zitternden Händen drehte ich mich um und griff einfach nach dem ersten Türgriff, den ich ertasten konnte. Tief Luft holend drückte ich ihn herunter und blinzelte vorsichtig. Nichts geschah, keine Hexe sprang hinter der Tür hervor und nahm mich gefangen. Meinen ganzen Mut zusammennehmend, öffnete ich die Augen. Helles Licht blendete mich und es dauerte einen kurzen Moment, bis ich etwas erkennen konnte. Doch dann schaute ich mich sprachlos um.
Ein Badezimmer! Aber was für eines! In der vorherigen Wohnung war es klein und gerade ausreichend, dass eine Person etwas Bewegungsfreiheit hatte. Eine Toilette, eine enge Dusche und ein Waschbecken und dazwischen konnte man sich kaum um die eigene Achse drehen. Nicht einmal ein Fenster hatte es gegeben.
Aber dieses Bad wirkte riesig. Ein Raum, der mir genauso groß, nein, größer, als mein altes Kinderzimmer in Dortmund erschien. Eine Badewanne an der Wand, die für mich wie ein Swimmingpool aussah. Eine Dusche, in der die ganze Familie Platz gehabt hätte. Zwei Waschbecken nebeneinander, eine Toilette und irgendeine Vorrichtung, ähnlich der Toilette, mit einer kleinen Brause. Der Platz zwischen all diesen Dingen ließ zu, dass man dort hätte tanzen können. Blauweiß funkelten die Fliesen um die Wette. Wunderschön und edel strahlten die Badezimmermöbel. Ich musste zugeben, es schaute alles einfach toll aus. Alleine die Badewanne! Ich sah mich bereits von Badeschaum bedeckt mit meiner Gummiente Lore und vielem anderen Spielzeug rumplantschen.
Immer mehr verließ mich die Angst. Eilig lief ich zurück in den Flur und nahm jetzt auch diesen genauer in Augenschein. Die Wände aus großen unregelmäßigen Steinen gemauert, kleinen Lampen in der Decke und einem weichen blauen Teppichboden, machte auch er einen einladenden Eindruck. Jetzt konnte ich meine Neugier nicht mehr bezähmen und stürmte zurück zu dem ersten Raum. Diesmal riss ich ohne Furcht die Tür auf. Die Panik vor der Hexe hatte ich verdrängt und wollte einfach nur noch wissen, was für ein Kinderzimmer sich hinter ihr verbarg.
In dem Augenblick, als ich sie öffnete und hineinschaute, stand es für mich fest, dies würde mein neues Zimmer werden.
Andächtig trat ich ein und entdeckte einen großen gemütlichen Raum. Mit hellem Holz vertäfelte Wände und aus dem gleichen Material gab es ein in die Mauer eingefasstes Bett. Über der Liegefläche eine Lampe, die, als ich den Schalter am Bett drückte, den Schlafplatz in einen warmen Lichtschein hüllte. Am liebsten hätte ich mein Märchenbuch geschnappt und mich in das Bett gekuschelt. Allerdings gab es noch so vieles zu entdecken.
Immer wieder Neues erspähte ich. Einen Wandschrank, ebenso mit einer Lampe ausgestattet. Regale und eine Kleiderstange, die selbst noch leer erscheinen würde, wenn ich alle meine Kleider dort einordnete. Gegenüber ein zweiter Wandschrank, ebenso mit Regalen versehen, auf denen mein komplettes Spielzeug Platz fand. Hin und her lief ich auf dem blauen Flauschteppich am Boden, nicht müde werdend, alles zu erkunden.
Doch das Tollste von allem war für mich das riesengroße Fenster. Eine niedrige breite Fensterbank davor, lud zum Sitzen und Hinausschauen ein. Was ich natürlich auch gleich tat.
Mein Blick wanderte über die Siedlung. Ohne Einschränkungen konnte ich jedes einzelne Haus, nebst Gärten, sehen. In der Ferne erblickte ich ein riesiges Feld, das allein aus gelben Blüten zu bestehen schien. Endlos erstreckte es sich und leuchtete wunderschön, wie ein riesiger Teppich.
Am Rande der Siedlung gab es einen Weg und daneben einen Wald. Unzählige Bäume, nicht zu überblicken, aus denen lautes Vogelgezwitscher, das ich selbst durch das geschlossene Fenster hörte, ertönte. Alles in allem wirkte es beruhigend und gleichzeitig erwachte das Gefühl von unendlicher Freiheit in mir. Vorfreude durchströmte mich, während ich mir vorstellte, wie es sein würde, all das zu erforschen.
Meine Eltern hatten die Besichtigungstour abgeschlossen. Jetzt kamen sie die Treppe herauf nach oben und ihre gedämpften Stimmen waren durch die Tür zu hören.
„Moni“, rief meine Mama und ich antwortete: „Ich bin hier!“ Die beiden betraten das Zimmer und Vater lächelte zufrieden. „Habe ich es mir doch gedacht! Als ich mir das Haus anschaute wusste ich, dass du dieses Zimmer nimmst. Es ist wie für dich gemacht.“ Sein Gesicht sah erleichtert aus und auch Mutter wirkte glücklich. Ich hüpfte von der Fensterbank herunter und gemeinsam sahen wir uns den Rest unseres neuen Heimes an.
-3-
Die nächsten Tage verbrachten wir damit, Möbel aufzustellen, Regale aufzubauen und unseren restlichen Besitz aus den Kartons zu packen. Meine Mama dekorierte liebevoll mein Zimmer und ich fühlte mich wie eine kleine Prinzessin. Vor dem Bett, das sie eine Butze nannte, wurde ein Sternenvorhang angebracht. Diesen konnte ich zuziehen, wenn ich ungestört sein wollte. Wie eine Höhle, die die Monster draußen ließ, lud es mich ein und ich kuschelte mich gerne hinein. Insbesondere nachdem ich mein Bett wieder mit Fridolin, meinem Kuscheltier, teilte.
Vor zwei Jahren hatten meine Eltern mir Fridolin die Fledermaus geschenkt. Eigentlich sollte ich mir in einem großen Kaufhaus einen niedlichen Bären oder ein wuscheliges Kätzchen aussuchen, doch ich wollte nur Fridolin. Die Fledermaus, beinahe so groß wie ich, mit ihren orangefarbenen Augen und Flügeln, den kleinen Vampirzähnchen und einem dicken schwarzen kugeligen Körper, hatte sofort mein Herz erobert. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich ihn in den Armen hielt, war er mein bester Freund. Auch jetzt hatte er in meinem Bett seinen Ehrenplatz bekommen.
Die Tage gingen dahin und ich wurde immer unruhiger. Ständig nur im Haus bleiben, während draußen die Sonne schien, ging mir gegen den Strich. Der Garten alleine reichte mir auch nicht aus - was gab es dort denn auch, außer ein paar Blumen und einem Rasen zu entdecken? Mich lockten die Straßen der Siedlung. Immer wieder schaute ich aus den Fenstern oder stand vorne auf unserem Rasen, hoffend, andere Kinder kennenzulernen. Doch jetzt im Sommer wirkte alles wie ausgestorben. Gut, es liefen einige Erwachsene und ältere Leute an unserem Haus vorbei, aber von Gleichaltrigen war nichts zu entdecken. Die Sommerferien dauerten noch zwei Wochen und ich langweilte mich bereits jetzt zu Tode.
Immer öfter nervte ich meine Mutter damit, dass ich das Mädchen, welches ich bei der Ankunft gesehen hatte, besuchen wollte. Ich quengelte und quälte so lange, bis sie schlussendlich nachgab. Sie wohnte zwei Straßen weiter, keine große Entfernung, um sich wirklich Sorgen zu machen. So gab mir meine Mama die Erlaubnis, nach dem Mittagsessen kurz bei ihr vorbeizuschauen.
Schnell lief ich die Straßen hoch und erhoffte mir, sie anzutreffen. Und wirklich, als ich mich dem Haus näherte, sah ich das Mädchen auf dem Rasen spielen.
Langsam ging ich näher und stoppte am Zaun, ein paar Schritte von ihr entfernt. Dort wartete ich auf eine Reaktion von ihr, einen Gruß, ein Winken, irgendetwas, doch es kam keine.
„He, erinnerst du dich an mich? Ich war die im Auto, der du vor ein paar Tagen zugewunken hast“, sprach ich sie an. Aber immer noch tat das Mädchen, als würde es mich nicht bemerken. Ich wiederholte meine Frage, dieses Mal etwas lauter. Überhören würde sie mich jetzt auf keinen Fall. Erwartungsvoll lächelte ich, als sie kurz hochschaute. Erneut kam jedoch kein Ton über ihre Lippen.
Mittlerweile machte mich ihr Verhalten wütend. Was stimmte denn nicht mit ihr? Auch wenn sie nicht wusste, wer ich war, sie konnte doch zumindest Hallo zu mir sagen. Schon komisch, wie sie mich einfach nur mit offenem Mund anstarrte. Ihr Gesichtsausdruck wirkte keinesfalls einladend, aber dennoch, so schnell ließ ich mich nicht abwimmeln. Bemüht, freundlich zu klingen, versuchte ich es noch einmal: „Ich bin Simone. Wir sind vor einigen Tagen dort drüben in das Haus neu eingezogen. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen spielen. Hast du Lust?“
Endlich erschien ein schüchternes Lächeln auf ihrem Gesicht. Dadurch ermutigt, trat ich ein paar Schritte näher an sie heran.
„Kennst du dich im Wald gut aus? Ich würde so gerne einmal dorthin gehen, aber meine Eltern erlauben es mir nicht.
Jedenfalls solange niemand, der sich hier auskennt, mit mir kommt. Aber wenn du mit mir gehen würdest, hätten sie bestimmt nichts dagegen. Wir könnten Verstecken spielen oder etwas, wozu du Lust hast.“ Während ich ununterbrochen weiterredete, war ich bei ihr angekommen. Nur der Zaun trennte uns und so streckte ich dem Mädchen über diesen meine Hand entgegen. Ihr Blick drückte Skepsis aus und ich erwartete schon, dass sie sie nicht ergreifen würde. Aber überraschenderweise griff sie zu. Weich und schlaff fühlte sich ihr Griff an. Weil ich es als unangenehm empfand, war mein erster Reflex, ihr meine Hand zu entziehen. Dennoch hielt ich ihre fest und schüttelte sie eifrig. „Hey. Also nochmal, ich bin Simone. Aber alle nennen mich Moni und wie heißt du?“
Zaghaft erklang eine helle Stimme aus ihrem Munde: „Ich bin Olivia.“ Plötzlich ließ sie abrupt meine Hand los und hielt ihre eigene hinter den Rücken. Fast so, als ob sie über das eigene Verhalten erschrak und befürchtete, einen Fehler begangen zu haben.
Warum, was hatten wir verkehrt gemacht? Was konnte so schlimm sein, dass sie jetzt zwei Schritte vor mir zurückwich? Ich verstand es nicht und wartete, was als Nächstes folgen würde.
Für kurze Zeit herrschte eine unangenehme Stille zwischen uns und ich hoffte, dass Olivia noch irgendetwas zu mir sagen würde. Mich vielleicht darum bat, mit ihr ins Haus zu gehen, um dort in ihrem Kinderzimmer zu spielen. Aber nichts dergleichen geschah.
Ich wartete ein paar Minuten. Als sie jedoch weiter schwieg, beschloss ich, mich auf den Rückweg zu begeben.
Gerade im Begriff, mich von ihr zu verabschieden, sah mir Olivia zum allerersten Mal direkt in die Augen. Dieser Moment ließ es zu, dass auch ich sie genauer betrachten konnte. Das, was ich in ihrem Gesicht erkannte, hielt mich davon ab, zu gehen. Der Ausdruck hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem eines glücklichen Kindes. Tiefe Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, all das drückte er aus. Heute trug Olivia keine Brille wie beim ersten Mal, als ich sie gesehen hatte, und an der linken Wange konnte ich einen blauen Fleck sehen.
Sie als hübsch zu bezeichnen, wäre eine Lüge, aber es gab etwas an ihr, was mich sie weiter fasziniert anstarren ließ. Olivia hatte eine braune und eine eisgraue Iris. Solche Augen hatte ich noch nie gesehen und konnte meinen Blick kaum davon lösen.
„Ich kann jetzt nicht spielen.“ Olivias Tonfall klang ruppig, unfreundlich und abwehrend. Ertappt in meiner unverhohlenen Neugier schreckte ich auf und schaute schnell in eine andere Richtung. „Schade, na dann vielleicht ein andermal. Ich glaube, ich gehe jetzt besser wieder nach Hause.“
Ich drehte mich um, lief die ersten Schritte zurück den Gehweg hinauf, als Olivias Stimme mich davon abhielt, weiter zu gehen. Leise drang ihre Stimme an mein Ohr: „Es geht heute nicht, aber vielleicht könnten wir ja morgen in den Wald, wenn du möchtest?“ Während sie hastig flüsterte, wanderten ihre Augen nervös zwischen mir und einem kleinen Fenster neben der Haustür hin und her. Als ob sie sich beobachtet fühlte und versuchte zu sehen, ob jemand mitbekam, wie sie sich mit mir verabredete.
Auch ich sah zu dem Fenster und für einen kurzen Augenblick meinte ich, ein Gesicht hinter der Scheibe zu entdecken. Neugierig schaute ich genauer hin, doch alles, was ich sah, waren eine weiße Gardine und eine Topfblume. Dabei dachte ich wirklich, jemanden gesehen zu haben. Aber selbst, wenn man uns beobachtet hatte, verstand ich Olivias Verhalten nicht. Was war daran so schlimm, wenn jemand, der mit ihr dort in diesem Haus wohnte, uns zusammen sah?
Ich schob den Gedanken beiseite, denn ich freute mich über ihre Einladung. „Ja, gerne. Das wäre toll. He, wenn du willst, komm doch morgen zu mir. Dann zeige ich dir mein Zimmer und wir beide fragen meine Mama, ob ich mit dir in den Wald gehen darf, okay?“
Anstatt etwas zu erwidern, nickte Olivia und winkte mir zum Abschied, während ich langsam die Straße hochlief. Doch sie sah mich nicht an. Abermals fiel mir ihr nervöser Blick zum Fenster auf.
Ich glaubte keineswegs daran, dass Olivia morgen wirklich zu mir kommen würde. Ihr ganzes Verhalten sprach dagegen. Aber ich hoffte es. Vielleicht brauchte sie genauso eine Freundin, wie ich. Und vielleicht würden wir - BFF- Best Friends Forever - werden.
Ich hatte im Fernsehen einen Film gesehen, in dem zwei Mädchen genau das waren. Von diesem Zeitpunkt an wünschte ich mir nichts sehnlicher, als auch eine BFF zu haben.
Kurz dachte ich noch über das Gesicht am Fenster und Olivias Reaktion nach. Aber als ich zuhause ankam, hatte ich endgültig aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen.
Ich klingelte und als Mama die Tür öffnete, stürmte ich lauthals von Olivia erzählend in den Flur und an ihr vorbei.
-4-
Olivia lief, den Ball unter den Arm geklemmt, zur Haustür. Je näher sie ihr kam, umso langsamer wurden ihre Schritte. Sehnsüchtig schaute sie die Straße hoch, Moni hinterher. Wie gerne wäre sie mit ihr gegangen, einfach fortgelaufen und nie mehr zurückgekommen. Aber ihr war klar, dass dieser Wunsch sich niemals erfüllen würde. Was hätte sie ihr sagen sollen? Die Wahrheit? Ein fremdes Mädchen bitten, sie mitzunehmen in ihr Leben, zu ihrer Familie?
Zögerlich setzte Olivia einen Fuß vor den anderen. Die Haustür, die jetzt nur noch wenige Schritte entfernt vor ihr lag, erschien ihr wie ein großes dunkles Loch, das sie verschlingen wollte. Doch es blieb ihr keine Wahl, sie musste sie öffnen, hineingehen und das, was sie erwartete, erdulden. Während Olivia mit der rechten Hand in der Hosentasche nach dem Haustürschlüssel suchte, krampfte sich ihr Magen schmerzhaft zusammen. Schauer liefen über ihren Körper und ließen die feinen Härchen auf ihren Arm sich aufstellen. Angst, ein ihr so bekanntes Gefühl, nahm wieder einmal Besitz von ihr.
Ihre Hände zitterten, als sie den Schlüssel in das Türschloss steckte und ihn umdrehte. Auch wenn alles in ihrem Inneren schrie, es nicht zu tun, dennoch war es klüger, jetzt ins Haus zu gehen. Mutter hatte alles beobachtet und das, was sie gesehen hatte, gefiel ihr nicht, dessen war sie sich sicher.
Dieses Mädchen, wie hieß sie noch gleich? Ach ja, Simone. Wie sie Olivia ansprach, nicht aufgab, einfach nicht wieder verschwinden wollte. Warum hatte sie sie nicht in Ruhe gelassen? Es wäre besser gewesen. Aber in Wahrheit hatte Olivia das keineswegs gewollt. Im Gegenteil, sie freute sich, Simone kennenzulernen. So sehr, dass sie ihr versprach, sie morgen zu besuchen. Wo sie doch bereits, als sie das Versprechen gab wusste, dass sie es brechen würde. Mutter erlaubte es ihr niemals.
Seufzend schloss sie die Haustür auf.
Während das Mädchen die Tür einen Spalt öffnete, hörte sie, wie Mutter sich dem Eingang näherte. Panisch dachte Olivia nach, was sie sagen sollte, um das Schlimmste zu vermeiden. Es war nicht ihre Schuld gewesen. Sie hatte dieses Mädchen keinesfalls darum gebeten, mit ihr zu sprechen. Aber war es nicht gleichgültig, welche Entschuldigung sie sich zurechtlegte? Mutter würde, egal was für Worte Olivia auswählte, sie anschreien, beschimpfen und im schlimmsten Fall, ihr wehtun. Wie gestern Abend, als sie ein Glas warf und ihr Gesicht traf. Olivias Brille fiel herunter und zerbrach genau wie das Glas am Boden. Jetzt dauerte es wieder Wochen, bis Olivia eine neue bekam. Wochen, in denen sie alles verschwommen sah. Ihre Bücher im Regal stehen blieben, weil sie sowieso kein einziges Wort entziffern konnte. Dabei waren die Geschichten in ihnen die einzige Freude in Olivias Leben. Wenn sie las, vergaß sie alles, was sie tagtäglich quälte. Und selbst das hatte Mutter ihr jetzt fortgenommen. Tränen traten in ihre Augen und sie kämpfte damit, ein Schluchzen zu unterdrücken.
Seit sehr langer Zeit fühlte sie sich einsam. Mehr als zwei
Jahre lagen zwischen heute und dem Unfall.
Davor, als ihr Bruder noch lebte, bestand so etwas wie Glück in ihrer Familie. Lachen, Spaß und dann und wann bekam sie auch den Trost, den sie brauchte. In seinen Armen fand sie ihn. Dirk war stark gewesen. Er kannte immer die richtigen Worte, damit die Tränen in Olivias Gesicht versiegten und sie wieder lächelte. Wenn es Ärger oder Streit mit Mutter gab, andere Kinder sie hänselten, stellte sich ihr Bruder an ihre Seite. Lange war das her. Jetzt hatte sie niemanden mehr, der sie beschützte.
Keine Freude, kein Lachen und keine starke Schulter, an die sie sich lehnen konnte. Niemand, der ihr half. Alles, was man Olivia entgegenbrachte, bestand aus Ablehnung. Zuhause, in der Schule, egal, wo sie auftauchte, alle verachteten sie.
Eine rauchige, harte weibliche Stimme erklang aus dem Hausflur, als sie die Tür öffnete: „Olivia, komm rein. Ich sagte, Olivia, du sollst endlich zu mir kommen! Du nichtsnutziges Ding, das sich meine Tochter nennt, kommst du jetzt endlich und hörst, wenn ich dich rufe!?!“
Olivia schluckte die Tränen herunter. Mutter erwartete sie und es wurde Zeit, sich ihr zu stellen, bevor das Zögern alles noch viel schlimmer machte. Mit gesenktem Kopf, geduckt und die Schultern hochgezogen, verschwand das Mädchen im Haus. Laut schlug die Tür hinter ihr zu. Niemand konnte sehen, was dort drinnen vor sich ging, doch jeder, der am Haus vorbeilief, hörte ihre Schreie.
-5-
Olivia ließ sich weder am nächsten noch am übernächsten Tag bei uns sehen. Gut, ich hatte damit gerechnet, aber mir dennoch gewünscht, dass ich mich irrte. Stundenlang wartete ich auf sie. Lief immer wieder zum Fenster, schaute hinaus, ob sie die Straße herauf zu unserem Haus lief.
Mehrmals öffnete ich die Haustür um nachzuschauen, ob Olivia davorstand. Womöglich hatten wir das Klingeln überhört. Aber keine neue Freundin kam mich besuchen, um mich zum Spielen abzuholen.
Meine Geduld ging langsam dem Ende zu. Wären da noch andere Freunde gewesen, jemand, der seine Zeit mit mir verbrachte, dann hätte es mich wahrscheinlich nicht so geärgert. Aber so ließ mich der Gedanke an Olivia einfach nicht los. Auch wenn sie keine Freundin werden würde, zumindest ihr sagen, wie enttäuscht ich bin, das wollte ich!
Diesmal brauchte ich um die Erlaubnis nicht lange zu betteln. Im Gegenteil, meine Mama schien ganz froh zu sein, etwas Ruhe zu haben. Also zog ich meine Schuhe und die Jacke an und lief erneut zu Olivia.
Ich hatte mir vorgenommen, zu klingeln und nach ihr zu fragen. Dann, wenn sie an die Tür kam, ihr die Meinung zu sagen und dass ich sie nicht als Freundin brauchte.
Wütend stapfte ich die Straße hoch und innerlich brodelnd vor Ärger, kam ich bei ihrem Zuhause an. Während ich zum Eingang des Hauses lief, legte ich mir die Worte in meinen Gedanken zurecht. Ein dunkles, verlassen wirkendes Haus empfing mich. Sämtliche Vorhänge an den Fenstern waren zugezogen und als ich lauschte, drang kein Laut an mein Ohr. Merkwürdig, dachte ich, während ich vor der Tür stand. Ach, irgendeine Erklärung gab es bestimmt. Als ich die Hand allerdings bereits auf dem Klingelknopf hatte, zögerte ich, ihn auch zu drücken.
Was tat ich hier, warum lief ich Olivia nach? Wenn sie nicht mit mir spielen will, dann suche ich mir eben andere Freunde.
Klägliche Versuche mir einzureden, es ginge um Olivia, als dass ich wieder von hier fort wollte. In Wirklichkeit jagte mir dieses düstere Haus eine Heidenangst ein. Ich wollte dort nicht hinein. Eingestehen konnte ich mir meine Furcht aber nicht. Zu albern, sich vor einem Haus zu ängstigen. Wie kindisch, dachte ich – ich, die immer schon groß sein wollte, erzitterte vor einem Hirngespinst. Was sollte mir schon passieren? Dies war ein Haus, ein ganz normales aus Mauersteinen und Ziegeln gebautes Haus. Keine Geistervilla, in der mich Gespenster oder Monster empfangen würden. Nervös kicherte ich, nahm aber trotzdem den Finger vom Klingelknopf. Dann setzte ich langsam rückwärtsgehend einen Fuß hinter den anderen, drehte schließlich um und schlich auf Zehenspitzen zur Zaunpforte.
Dort angekommen, rannte ich, so schnell mich meine Beine trugen, den Gehweg hoch. Die ganze Zeit mit dem Gefühl im Nacken, etwas würde mich verfolgen. Mein Herz klopfte wild und ich atmete erst erleichtert auf, als ich meinem Zuhause näherkam.
Mamas fragendem Blick, als ich atemlos und verschwitzt an ihr vorbei ins Haus stürzte, wich ich aus. Was sollte ich ihr erzählen, wenn ich die Flucht und meine Panik selber nicht verstand.
Der nächste Tag sollte kaum anders verlaufen, außer, dass ich dieses Mal keineswegs auf die Idee kam, Olivia zu besuchen. Mamas Fragen, was los gewesen sei, wich ich aus. Keine hundert Pferde würden mich so schnell wieder dort hinbringen. Aber dennoch wartete ich auf sie. Das Haus hatte mir Angst gemacht, doch Olivia nicht.
Am dritten Tag hatte ich endgültig aufgegeben, auf eine Freundschaft mit ihr zu hoffen. Wenige Tage noch, dann begann die Schule auch wieder für mich. Bestimmt gab es dort Kinder, die mich gerne kennenlernen wollten. Eines der Mädchen würde sicherlich meine Freundin werden. Wer brauchte schon Olli?
Die ganzen Tage über spielte ich im Garten oder las in meinem Zimmer ein Buch. Die Zeit verging und ich dachte nur noch selten an Olivia.
-6-
„Olivia, endlich bequemst du deinen faulen Arsch ins Haus.“ Das waren die Worte, mit denen Olivia von ihrer Mutter begrüßt wurde, als sie den Flur betrat. Es war normal für sie. Mutter sprach immer so mit ihr.
Sie beschimpfte sie als faul, hässlich, dumm, unnütz und manchmal auch als Miststück oder Bastard. Außer, ein Fremder betrat das Haus, dann veränderte sich das Keifen in eine warme fürsorgliche Stimme. Sanft nannte Mutter Olivia einen Engel, Schatz, Maus und ihren Sonnenschein. Liebevolle Ausdrücke, die dem Mädchen weitaus mehr wehtaten, als das, was sie sich sonst anhörte. Waren sie doch eine einzige Lüge, eine für andere aufgebaute Fassade. Das Bestreben, den Anschein einer Mutter, die stets hingebungsvoll für ihr Kind sorgte, zu bewahren.
Selten bekamen sie Besuch. Aber wenn, dann wurde vorher der Ablauf regelrecht einstudiert. Olivia musste lächeln und sich zu Mutter setzen, die ihre Hand nahm und sie streichelte. Mutter einen Kuss auf die Wange geben und fröhlich von ihren schönen Spielnachmittagen erzählen. So tun, als ob sie sich auf das leckere Essen von Mutter freute, und während sie das tat, den Hass, die Wut, aber auch die Traurigkeit herunterzuschlucken.
Wie so oft dachte sie in diesen Stunden an Dirk, der sie immer „Meine kleine Zauberin mit den magischen Augen“ nannte. Niemals hätte er es zugelassen, dass Mutter ihr diese fürchterlichen Dinge antat. Aber Dirk beschützte sie nicht mehr. Dirk war fort.
„Hörst du mir überhaupt zu, Drecksstück? Nein, natürlich mal wieder nicht. Ich sagte, die blöde Kuh von Sozialarbeiterin hat ihren Besuch für morgen angemeldet. Sieh zu, dass du die Küche sauber bekommst. Aber beeile dich, das Bad muss auch noch geputzt werden.“ Olivia schwieg und vermied es, ihre Mutter anzuschauen. Aber eine Antwort wurde sowieso nicht von ihr erwartet. Die kreischende Stimme zerschnitt weiter die Stille des Hauses.
„Die neugierige Ziege geht sicherlich aufs Klo und wird da eine Ewigkeit bleiben. Meint die, ich bin blöd? Weiß doch, dass sie sich alles genauestens anschaut. Sorg dafür, dass sie nichts findet! Hast du mich verstanden?“
Die Sozialarbeiterin kam zum Routinecheck. Wie jeden Monat. Seit zwei Jahren wechselten die Frauen ständig und meistens merkte Olivia ihnen die Gleichgültigkeit an. Sie und ihre Mutter waren nur ein Job, den die Damen erledigten.
Nur die Neue, die vor drei Wochen das erste Mal vor der Tür stand, schien anders zu sein. Sie zückte kein Notizbuch oder schlug eine Akte auf. Stellte abgelesene Fragen, um dann schnellst möglich zu gehen. Sie redete mit Olivia. Sah ihr ins Gesicht und arbeitete keine Liste ab, die auf den Blättern stand.
Als sie das erste Mal das Haus betrat, beachtete sie zuerst das Mädchen und nicht ihre Mutter. Lächelnd war sie zu ihr hingegangen und hatte mit einem: „Hallo, ich bin Hilka und du bist Olivia, nicht wahr?“, die Hand hingestreckt.
Warm und zart fühlte sich ihre Haut an, während sie Olivias Finger umfasste. Die Sozialarbeiterin war jung und hübsch. Lange blonde Haare und ein freches Gesicht. Ganz anders, als die alten Schachteln, die ihnen sonst die Pflichtbesuche abstatteten. In dem Moment, als sie ihr in die Augen schaute, empfand Olivia Vertrauen zu der Frau. Glaubte daran, ihr alles erzählen zu können. Die Wahrheit, wie das Leben mit Mutter aussah. Doch dann fiel der Blick des Mädchens auf das Gesicht ihrer Mutter und die Hoffnung zerbrach.
Olivia hatte keine Chance. Die Augen ihrer Peinigerin, kalt und voller Abscheu, ruhten auf ihr. Mutter brauchte keine Worte auszusprechen, um zu verdeutlichen was geschehen würde, falls Olivia es wagte, nur ein Wort von dem gemeinsamen Geheimnis zu verraten. Zwecklos zu glauben, dass diese Hilka etwas verändern würde. Auch sie stellte nur eine Rolle in Mutters gemeinem Schauspiel dar.
So lächelte Olivia auch an diesem Tag. Servierte Tee und Kuchen, kicherte albern und zeigte der jungen Frau die Wohnung. Während die Stunde ablief, erfand sie Geschichten von Freunden, tollen Nachmittagen und schönen Erlebnissen mit Mutter, die sie niemals erleben würde. Nichtsdestotrotz, als Frau Rickaz wieder ging, beugte sie sich zu dem Mädchen und flüsterte ihr in dem Moment, als Mutter wegschaute, zu: „Keine Sorge, ich komme wieder.“
Olivia schaute sie erstaunt an. Konnte es sein, dass sie ihr sagen wollte, sie würde ihr helfen? Hatte sie das Theaterstück von Mutter durchschaut? Erneut flackerte die Hoffnung in dem kleinen Mädchen auf. Aber im Laufe der nächsten Wochen, in denen niemand kam, um ihr zu helfen, sich nichts veränderte, erlosch auch diese wieder.
Dennoch, als ihre Mutter jetzt davon sprach, freute sich Olivia auf Hilka. Vielleicht gab es ja eine Überraschung und sie würde ...
„Olivia, hörst du mir überhaupt zu. Beweg dich endlich oder muss ich dir erst Dampf unterm Arsch machen?“
Mutters Stimme ließ Olivia ängstlich zusammenzucken.
Sie fühlte sich ertappt und beeilte sich, ihre Jacke und die Schuhe auszuziehen. Es war nicht gut, sie noch mehr zu reizen, gar nicht gut.
Als sie hörte, wie sich Mutters Rollstuhl mit quietschendem Geräusch langsam näherte, biss sie sich auf ihre Lippen. „Ach, ich verstehe. Die feine Dame glaubt, dass diese Hilka ihr hilft. Weißt du, Olivia, was ich glaube?“ Ein gemeines Lachen ertönte aus Mutters Mund. „Ich glaube, ich werde schon dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ein Anruf, eine Beschwerde, und dieses junge Ding kann sich einen neuen Job suchen!“
Olivia duckte sich, während sie mit fahrigen Bewegungen die Schnürbänder der Schuhe öffnete. „Möchtest du das? Ja? Dann erzähle ihr ruhig, wie schlecht es dir doch geht. Möglicherweise glaubt sie dir deine Lügen. Aber ich garantiere dir, das Jugendamt tut es nicht!“ Mittlerweile stand Mutters Rollstuhl neben ihr und ihre Hand griff erbarmungslos in ihre Haarlocken. Schmerzhaft zog sie damit Olivias Kopf nahe an ihr Gesicht. Sanft flüsterte sie dem Mädchen ins Ohr: „Und dann, mein Kind, gibt es niemanden mehr, der dir Drecksstück hilft. Dann gibt es nur noch uns beide. Gnade dir Gott, solltest du es so weit kommen lassen.“ Olivia begann leise zu weinen, doch sie hielt still. Sich gegen Mutter zu wehren hatte keinen Zweck, dass wusste sie aus Erfahrung. So biss sie die Zähne zusammen und ertrug den Schmerz. Sowohl jenen, den ihre Worte auslösten, wie auch den körperlichen. „Jetzt sieh zu, dass du deine Pflicht erfüllst, geh putzen!“
Endlich ließ sie los und Olivia konnte sich aufrichten. Immer noch mit einem Schuh am Fuß, stolperte das Mädchen blind vor Tränen in die Küche. Mutters keifendes Lachen hörend, das sie verfolgte.
Sich auftürmendes dreckiges Geschirr in der Spüle erwartete sie. Ebenso ein schmieriger Fußboden und ein Mülleimer, der vor Abfall überquoll. Essensreste klebten auf der Tischplatte und Fruchtfliegen umschwirrten das alte Obst, welches verschrumpelt in einer Schale lag. Natürlich durfte so niemand die Küche betreten und es würde wieder Stunden dauern, bis Olivia alles gesäubert hatte. Sie seufzte und machte sich an die Arbeit.
Mutter räumte nie auf. Sie ließ den Dreck überall liegen. Gleichgültig, wie ekelig und stinkend das Zuhause war. Ihre Entschuldigung lautete stets: „Ich wurde vom Schicksal gebeutelt. Warum soll ich als Opfer des Lebens dafür sorgen, dass du in einer schönen Umgebung lebst. Gib mir meinen Sohn und die Beine zurück, dann werde ich mich darum kümmern, dass alles andere wieder lebenswert wird.“ Wie Olivia sich fühlte, interessierte sie nicht. Olivia war für sie die Schuldige, das Hexenkind.
Ihre Tochter hätte in ihren Augen sterben sollen und nicht ihr Sohn. Mutter hatte Dirk geliebt, ihn vergöttert. Er hatte das Glück gehabt, das Kind von einem Mann zu sein, der ihr alles bedeutete. Aber dieser verließ Mutter wegen einer anderen Frau. Ab diesem Zeitpunkt veränderte sie sich. Sie trank nächtelang durch und ließ den Jungen in der Obhut irgendwelcher Nachbarn, sogenannten Freunden, zurück. Trotzdem hatte sie damals keine Ähnlichkeit mit der Frau, die heute Olivias Leben zur Hölle machte. Wenn Dirk ihr von früher erzählte, beschrieb er Mutter als einen liebevollen Menschen.
Dann lernte sie in einer Bar einen Fremden kennen. Wieder mal eine der Nächte, in denen sie betrunken durch die Kneipen zog. Schneller Sex mit irgendjemandem, der am nächsten Morgen vorbei und vergessen sein sollte. Doch der kurze Fick, wie Mutter es nannte, brachte Olivia hervor. Einen Bastard, den sie ab jetzt durchfüttern musste. Ihr Erzeuger war irgendein Penner, von dem sie nicht einmal den Namen kannte. Mutter hatte keine Erinnerungen an diesen Mann. Für sie nur einer von vielen, aber seine Augen, die waren in ihrem Gedächtnis geblieben. In ihnen schimmerten die gleichen Farben, wie auch in Olivias Augen.
Während das Kind das dreckige Geschirr abspülte, stellte sie sich vor, ihr Vater würde kommen. Sie von hier fortholen und an einen besseren Ort bringen. In ihrer Fantasie sah sie ihn als einen guten Mann, einen Helden, und nicht als diesen Loser, von dem Mutter sprach. Er würde seine Tochter lieben und dafür sorgen, dass sie glücklich ist. Ein zaghaftes Lächeln erschien auf dem Gesicht des Mädchens. Vielleicht würden ihre Träume eines Tages wahr werden. Sie musste nur darauf warten, dass er sie fand. Der Glaube daran, dass es ihn gab, hielt sie aufrecht. Er sorgte dafür, dass sie nicht die Scherbe von dem Glas, welches auf den Boden fiel, nahm, und ihrem Leben ein Ende setzte.
Olivia putzte unermüdlich weiter und lächelte auch noch als sie hörte, wie Mutter die Küchentür öffnete.
Spät in der Nacht legte Olivia sich ins Bett. Es hatte viele Stunden gedauert, bis Mutter sich endlich mit dem Ergebnis ihrer Schufterei zufrieden zeigte. Immer wieder fand sie etwas, was ihr noch nicht sauber genug erschien. Dabei lächelte sie strahlend. Dass es ihr Freude bereitete, ihre Tochter zu quälen, ließ sich nicht leugnen.
Olivia ertrug die Beschimpfungen, die Kniffe, die Schläge, und auch, dass Mutter sie biss. Viele neue blaue Flecken würden morgen neben den älteren auf ihrer Haut schimmern. Gut verborgen unter der Kleidung, würde sie niemand sehen. Unsichtbar für andere und Olivia daran erinnernd, was sie erduldete. Mutter war nicht dumm und wählte wohlweislich Stellen an ihrem Körper aus, an denen keiner nachschaute. So wie es keinen Menschen gab, der Olivia wirklich anschaute. Manchmal fühlte sie sich wie ein Geist, der zwischen Lebenden wandelte, ohne von ihnen jemals wahrgenommen zu werden. Stöhnend legte sie ihren schmerzenden Körper auf die harte Matratze. Jeder Muskel, jeder Knochen in ihrem Leib tat weh. Sie löschte die Nachttischlampe und drehte sich auf die Seite. Ins Dunkel starrend, schaute sie zum Fenster.
Nachts ließ sie die Vorhänge offen. Am Tag wollte Mutter, dass sie geschlossen blieben. Doch jetzt würde sie nicht mehr in ihr Zimmer kommen. Während der Mond hereinschien, betrachtete das Mädchen den Himmel. Wie kleine Lämpchen leuchteten unzählige Sterne. Sie stellte sich vor, dass einer von ihnen ihr Bruder sei, der auf sie herunterblickte. Dirk, der sah, was mit Olivia geschah, aber ihr nicht helfen konnte. Ein Kloß im Hals machte ihr das Atmen schwer. Allein und einsam zog sie die Decke bis ans Kinn und bemühte sich, die Gedanken an Dirk zu verdrängen. Sie sorgten nur dafür, dass sie weitere Tränen vergoss, Tränen, die niemanden interessierten.
Oder doch? Ihre Gedanken wanderten zu Hilka, der Sozialarbeiterin. Vielleicht hatte ja Dirk sie zu ihr geschickt. Ein Engel in dieser grausamen Welt, der sie retten wollte. Jeder Mensch hatte doch einen Schutzengel, warum sollte es nicht auch bei ihr so sein?
Und dann dieses Mädchen, Moni. Sie hatte Olivia wahrgenommen und mit ihr geredet. Womöglich würde sie wirklich ihre Freundin und damit zu jemandem werden, dem sie alles anvertrauen konnte. Wie sehr wünschte sie sich, Simone besser kennenzulernen.
Ein Kratzen am Fenster, ein Schatten, der auf den Boden ihres Zimmers fiel, brachte sie auf eine Idee. Der Eichenbaum bewegte im Wind seine Äste. Er war alt, an vielen Stellen krank und morsch, aber von ihrem Fenster aus zu erreichen. Es konnte gefährlich sein, an ihm herunter zu klettern, allerdings war er die einzige Möglichkeit, die das Mädchen hatte, unbemerkt von Mutter aus dem Haus zu flüchten. Olivia wog nicht viel. Der Baum konnte mit viel Glück ihr Gewicht aushalten, ohne dass ein sie tragender Ast abbrach. Olivia wollte hier raus und dass sich etwas veränderte in ihrem Leben. Auch wenn ihr alleine der Gedanke daran, was passieren könnte, Angst einjagte, wusste sie, dass es nur diesen einen Weg für sie gab.
-7-
Hilka, die Sozialarbeiterin, kam nicht. Die Frau, die statt ihrer erschien, sprach davon, dass ihre Kollegin krankgeschrieben und sie zur Vertretung gekommen sei. Olivia hatte Mühe, die Enttäuschung darüber zu verbergen. Hilka war die letzte Hoffnung gewesen, vielleicht heute Simone zu besuchen. Sie hatte geplant, Mutter in ihrer Anwesenheit zu fragen, ob sie draußen spielen dürfe. Die Vorstellung, auf den Baum zu klettern, machte dem Mädchen Angst. Wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, wollte Olivia das Risiko, sich die Knochen zu brechen, umgehen. Hilka wäre eine gute Alternative gewesen. Durch ihren Zuspruch und Mutters Wissen, dass sie Olivia mochte, wäre sie aus dem Haus gekommen. Genauso wie das letzte Mal, als der Arzt, der ab und zu nach Mutter schaute, da gewesen war. Der Tag, als sie Moni kennenlernte.
Olivia wusste, ihre Peinigerin hätte es erlaubt, blieb ihr doch keine andere Möglichkeit. Zwar war sie sich vollkommen klar darüber, was sie später erwartete, aber ihr Wunsch,
Simone zu besuchen, lebte stärker in ihr, als die Furcht vor der Bestrafung.
Das konnte sie jetzt vergessen. Diese Dame würde Olivia kein Stück unterstützen. Im Sekundentakt las sie die Fragen von dem Blatt Papier in der Akte ab. Danach lief sie eilig durch die Wohnung, um sich alles anzuschauen. Vielmehr gesagt, sie öffnete die Türen, sah kurz hinein und schloss sie wieder. Für sie stellten ihre Mutter und sie nur ein lästiges Übel, das sie vom Feierabend abhielt, dar. Bereits eine halbe Stunde später beendete sie die Kontrolle und verschwand wieder.
Als sie die Tür hinter sich schloss, grinste Mutter Olivia hämisch an. „Na, wo ist denn jetzt deine Retterin. Krankgeschrieben, dass ich nicht lache. Die hat genauso wenig Lust sich mit uns abzugeben, wie alle anderen. Naja, mir solls recht sein.“ Olivia sah ihr an, wie sie den Triumph auskostete. Wut stieg in ihr auf und sie beschloss, heute den Versuch mit der Eiche zu starten. Warum noch länger warten? Wenn sie herunterfiel, sich das Genick brach, konnte es ihr doch auch gleichgültig sein. Der Tod erschien im Gegensatz zu ihrem derzeitigen Leben weitaus verlockender.
Entweder hatte Mutter die Entschlossenheit in Olivias Gesicht gesehen oder sie konnte Gedanken lesen. In dem Moment, als das Kind sich zur Treppe drehte, um hinauf in ihr Zimmer zu gehen, sagte sie: „Moment, junges Fräulein. Du bleibst bei mir. Wir werden heute gemeinsam wie eine nette kleine Familie Fernsehen schauen. Erst, wenn ich es dir erlaube, kannst du auf dein Zimmer. Haben wir beide uns verstanden?“
Die nächsten Stunden saß Olivia stumm auf dem alten braunen zerschlissenen Sofa. Die Zeit verging langsam und die Minuten zogen sich zäh dahin. Im Fernseher lief irgendein Film, der Mutter ab und zu zum Lachen brachte. Für Olivia waren es nur bunte Bilder, nichtssagend und bedeutungslos. Je weiter der Uhrzeiger wanderte, umso mehr hasste Olivia ihre Mutter. Ihr Lachen und ihre Stimme, wenn sie das Geschehen im Fernsehen kommentierte. Aber am Schlimmsten war es, sie anzuschauen. Den aufgedunsenen Körper, wie er sich bewegte, wenn sie kicherte. Die Ekelgefühle durch den Geruch nach Zigaretten, Alkohol und altem Schweiß, der von Mutter ausging.
Erst als die Wanduhr zweiundzwanzig Uhr anzeigte, erteilte sie ihrer Tochter endlich die Erlaubnis, nach oben ins Bett zu gehen.
Am nächsten Tag hatte Olivia Glück. Mutter klagte, wie so häufig, über (wie sie es nannte) Phantomschmerzen in ihren nicht vorhandenen Beinen. Das Mädchen liebte diese Tage. Bescherten sie ihr doch ein wenig Ruhe vor den sonstigen Gewaltausbrüchen. Der Befehl der Mutter, ihr die Tabletten aus dem Nachtschrank zu holen, sorgte für ein verstecktes Grinsen in Olivias Gesicht. Zu oft hatte sie das jetzt bald Kommende bereits erlebt. Manchmal gebetet, Mutter würde es nicht überleben. Einschlafen und nie wieder aufwachen. Mittlerweile hatte sie aufgehört, Worte an den lieben Gott zu richten. Er erhörte ihr Betteln und Flehen sowieso nicht. Wahrscheinlich war sie ihm genauso gleichgültig, wie all den anderen.
Eilig ging Olivia in das Schafzimmer und schnappte die Schmerzmittel aus der Schublade. Danach lief sie in die Küche ein Glas Wasser holen.
Während sie wieder das Wohnzimmer betrat, starrte ihre Mutter gierig auf die Packung mit den Tabletten in ihrer Hand. „Nun mach schon, du lahme Ente“, kreischte sie und packte Olivia am Handgelenk, als diese neben dem Rollstuhl stand. Ungeduldig riss sie das Medikament aus Olivias Fingern. Ihre Hände zitterten, während sie der Tochter das Glas aus der Hand zog und das Wasser über den Rand auf ihre Beinstumpen schwappte. Doch dieses beachtete sie kaum und drückte die erste Tablette durch die Aluminiumfolie der Verpackung. Mit lautem Schlucken stürzte sie das Wasser hastig herunter, wartete kurz und griff nach der zweiten Pille. Das Wasserglas fiel ihr aus der Hand und rollte langsam über den Boden. Die Flüssigkeit lief aus und hinterließ eine nasse Spur auf dem zerkratzten Laminat. Olivia flitzte hinterher und hob es auf.
Als sie sich wieder aufrichtete, trafen ihre Augen das Gesicht der Mutter. Zufrieden erkannte sie, die Tabletten begannen zu wirken. Ihre Augen wurden immer schmaler. Die Stimme, während sie fortwährend weiter über die Schmerzen klagte, schwerfälliger. Bald folgte die dritte und vierte Tablette und irgendwann hörte Olivia auf, die Anzahl der Pillen, die sie in sich hineinstopfte, mitzuzählen.
Mutter lallte unverständlich und der Speichel tropfte ihr aus dem Mund auf das Kinn. Aufmerksam beobachtete Olivia sie. Geduldig wartend auf den richtigen Moment. Er kam einige Minuten später, denn mittlerweile hing ihre Mutter mehr in dem Rollstuhl, als dass sie saß. Langsam dämmerte sie ein und schreckte nur ab und zu auf. Zwar schlief sie nicht tief und fest aber es reichte aus, um Olivias Plan in die Tat umzusetzen. Jetzt hieß es für das Mädchen schnell zu handeln, bevor die Wirkung der Medikamente wieder nachließ.