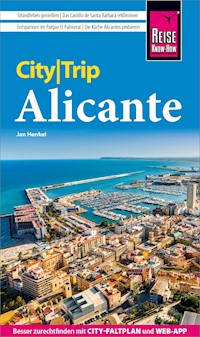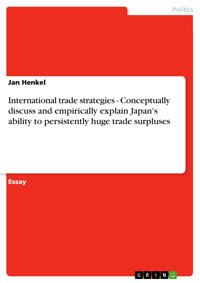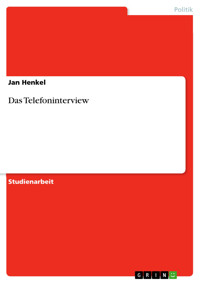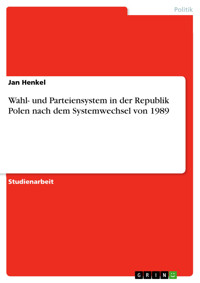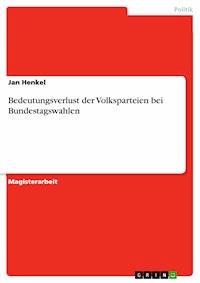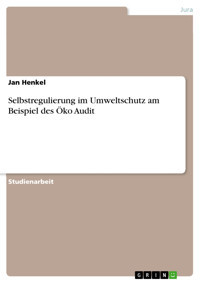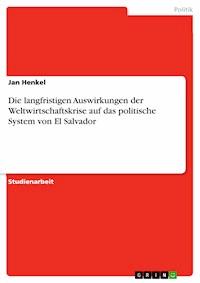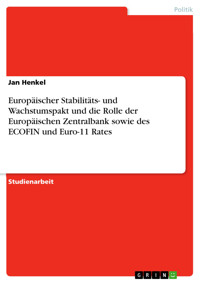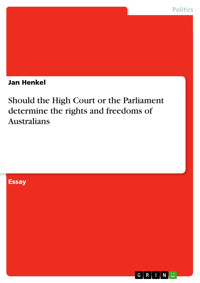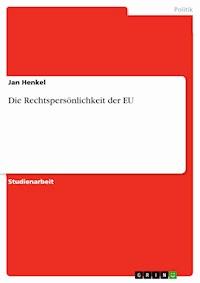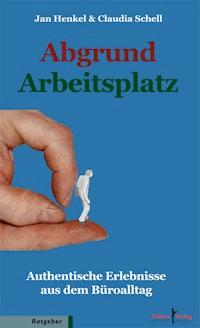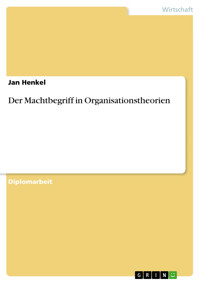
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 3,0, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alfred Weber Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Titel dieser Arbeit „Der Machtbegriff in Organisationstheorien“ nimmt eine Erkenntnis vorweg, die einer Erklärung bedarf. Es wird der Plural des Terminus Organisationstheorie verwendet, was impliziert, dass nicht nur von der Existenz einer einzigen Organisationstheorie ausgegangen werden kann. Um Klarheit in diesen Ansatz zu bringen, sollen zunächst die im Titel verarbeiteten Begriffe definiert werden. Die Erkenntnisse daraus werden dazu beitragen das Ziel der vorliegenden Arbeit zu formulieren, sowie die Vorgehensweise zu erläutern, wie dieses umgesetzt werden soll. Die bekannteste und „heute wohl geläufigste Definition ” des Machtbegriffs stammt von Max Weber. Er definiert Macht als „die Möglichkeit innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Möglichkeit beruht ”. Webers Machtdefinition bildet die Grundlage zahlreicher Weiterentwicklungen , was eine nähere Betrachtung dessen Konzeption zu rechtfertigen scheint. Webers Machtrelation bezieht ein Ungleichgewicht zwischen Machthaber und Machtunterworfenen mit ein, da letztere beispielsweise eine Handlung durchführen müssen, die sie aus freien Stücken, also aus ihrem eigenen Willen heraus, nicht durchführen wollen. Es kann von einer Asymmetrie zwischen Machthaber und Machtunterworfenen gesprochen werden. Weber versteht Macht demnach als Möglichkeit den eigenen Willen dem Verhalten anderer aufzuzwingen. Dabei wird Macht als allgemeine, beliebige Chance verstanden sich in sozialen Beziehungen durchzusetzen. Der Machtbegriff wird aufgrund dieser Tatsache auch als amorph bezeichnet, da eine Vielzahl von Eigenschaften dazu beitragen können, dass bestimmte Menschen auch gegen Widerstand ihren Willen durchsetzen. Weber polarisiert Wille auf der einen und Widerstand auf der anderen Seite und führt dies in soziale Beziehungen ein, die er mit dem Machtbegriff verknüpft. Macht wird in sozialen Beziehungen ausgeübt und dies impliziert, dass Macht mit subjektivem Handeln verbunden ist. Aufgrund der Tatsache, dass Macht sozial amorph und daher kaum fassbar ist, wird der Begriff der Herrschaft als Sonderfall von Macht von Max Weber eingeführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Der Machtbegriff in Organisationstheorien
eingereicht beim Prüfungsausschuss für Diplom- Volkswirte der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Page 4
Abkürzungsverzeichnis:
bzw. beziehungsweise et al. et alia, und andere etc. et cetera, und so weiter f. folgende ff. fortfolgende Hrsg. Herausgeber i. d. R. in der Regel i. S. v. im Sinne von S. Seite usw. und so weiter vgl. vergleiche z. B. zum Beispiel
Tabellenverzeichnis:
Tabelle 1: „Wissenschaftlicher Hintergrund der verschiedenen Organisationstheorien“ S. 34-35
Tabelle 2: „Darstellung der verschiedenen Verständnisse
Page 5
1. Einführung
Der Titel dieser Arbeit „Der Machtbegriff in Organisationstheorien“ nimmt eine Erkenntnis vorweg, die einer Erklärung bedarf. Es wird der Plural des Terminus Organisationstheorie verwendet, was impliziert, dass nicht nur von der Existenzeinereinzigen Organisationstheorie ausgegangen werden kann. Um Klarheit in diesen Ansatz zu bringen, sollen zunächst die im Titel verarbeiteten Begriffe definiert werden. Die Erkenntnisse daraus werden dazu beitragen das Ziel der vorliegenden Arbeit zu formulieren, sowie die Vorgehensweise zu erläutern, wie dieses umgesetzt werden soll.
1.1 Begriffsbestimmung
1.1.1 Der Begriff der Macht
Die bekannteste und „heute wohl geläufigste Definition1” des Machtbegriffs stammt von Max Weber. Er definiert Macht als „die Möglichkeit innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Möglichkeit beruht2”. Webers Machtdefinition bildet die Grundlage zahlreicher Weiterentwicklungen3, was eine nähere Betrachtung dessen Konzeption zu rechtfertigen scheint. Webers Machtrelation bezieht ein Ungleichgewicht zwischen Machthaber und Machtunterworfenen mit ein, da letztere beispielsweise eine Handlung durchführen müssen, die sie aus freien Stücken, also aus ihrem eigenen Willen heraus, nicht durchführen wollen. Es kann von einer Asymmetrie zwischen Machthaber und Machtunterworfenen gesprochen werden. Weber versteht Macht demnach als Möglichkeit den eigenen Willen dem Verhalten anderer aufzuzwingen. Dabei wird Macht als allgemeine, beliebige Chance verstanden sich in sozialen Beziehungen durchzusetzen.4Der Machtbegriff wird aufgrund dieser Tatsache auch als amorph bezeichnet, da eine Vielzahl
1Vgl. Weiss (1995): S. 306.
2Vgl. Fitzi (2004): S. 117 sowie Brennan (1997): S. 72. Zudem sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es noch eine frühere Definition Webers von Macht „als Chance verstanden wird, in einer sozialen Handlung seinen Willen trotz Widerstand anderer an der Handlung Beteiligter durchzusetzen.“ Diese sagt nichts darüber aus, worauf Macht beruht. Vgl. Brennan (1997): S. 72.3Als Beispiel für eine Weiterentwicklung des Weberschen Machtbegriffs sei hier die Definition bei Schreyögg (2003): S.435 genannt. Macht als Möglichkeit, in den Handlungsspielraum anderer, auch gegen Widerstreben zur Erreichung eigener Ziele einzugreifen.4Vgl. Schreyögg (2003): S. 33.
Page 6
von Eigenschaften dazu beitragen können, dass bestimmte Menschen auch gegen Widerstand ihren Willen durchsetzen.5Weber polarisiert Wille auf der einen und Widerstand auf der anderen Seite und führt dies in soziale Beziehungen ein, die er mit dem Machtbegriff verknüpft. Macht wird in sozialen Beziehungen ausgeübt und dies impliziert, dass Macht mit subjektivem Handeln verbunden ist.6Aufgrund der Tatsache, dass Macht sozial amorph und daher kaum fassbar ist, wird der Begriff der Herrschaft als Sonderfall von Macht von Max Weber eingeführt.
Herrschaft wird verstanden als „Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden7”. Damit wird die soziale Rahmenbedingung im Gegensatz zum Machtbegriff bei Herrschaft weiter spezifiziert, wodurch Herrschaft auch als institutionalisierte Macht zu verstehen ist. Es existiert eine asymmetrische soziale Beziehung in der die eine Seite befehlend, also aktiv, und die andere Seite gehorchend, also passiv, ist. Max Weber klassifiziert drei Arten von Herrschaftstypen8: Diese werden differenziert in traditionale, charismatische und legale, auch rationale, Herrschaft. Die Unterscheidung erfolgt somit nach Geltungsgründen und enthält, dass Herrschaft vom Bestehen einer legitimen Ordnung ausgeht an die die Beherrschten glauben müssen.9
Die traditionale oder traditionelle Herrschaft stammt aus dem Alltagsglauben an eine Heiligkeit einer seit jeher geltenden Tradition und der Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen. Festgelegte und überlieferte Regeln bilden dabei die Grundlage der Herrschaftsakzeptanz.
Die charismatische Herrschaft resultiert aus der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen. Der charismatische Führer, der sich durch außerordentliche Religiosität, Heldenhaftigkeit oder Vorbildlichkeit auszeichnet, zieht die Legitimität seiner oder ihrer Herrschaft aus dem persönlichen Vertrauen der Untergebenen.10Die legale Herrschaft beruht auf dem Glauben an die Legalität von
5Da es keine Rolle spielt worauf dies beruht. Vgl. Fitzi (2004): S. 118.6Vgl. Neuenhaus (1993): S. 12.7Vgl. Weiss (1995): S. 306.
8Vgl. dazu Fitzi (2004): S. 130ff; Brennan (1997): S. 78ff; Schreyögg (2003): S. 33f.9Vgl. Kieser (2006): S. 71.
Page 7
beispielsweise Gesetzen, also Rechtsordnungen, und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen. Die gesetzten Ordnungen gelten für jeden, einschließlich der Herrschenden selbst. Die legale Herrschaft gründet sich demnach auf den unpersönlichen Glauben an die Geltung gesetzter Ordnungen, die festlegt, wer zu welchem Zeitpunkt die Weisungsbefugnis inne hat.11Dabei gilt zusammenfassend, dass nur legale Herrschaft das Kennzeichen der Rationalität aufweist, da sie auf Sachlichkeit und Unpersönlichkeit beruht, während charismatische und traditionale Herrschaft vorrationale Formen der Herrschaft darstellen.12Die reinste Form legaler Herrschaft ist dabei die Bürokratie.13
Bei Max Webers Machtbegriff14lässt sich resümieren, dass er diesen als die allgemeine Form begreift seinen eigenen Willen durchzusetzen. Er verbindet dabei Macht mit Handeln, so dass davon gesprochen werden kann, dass Handeln Macht mit einschließt, die jedoch nicht legitimiert sein muss. Sobald aber der Einsatz und die Reichweite der Machtmittel geregelt, also legitim, sind, gilt dies als die spezifischere Form der Macht als Herrschaft.15Die Typen der legalen, traditionalen und charismatischen Herrschaft können als Machtgrundlagen interpretiert werden, da die Durchsetzung von Befehlen und damit Willen auf eine spezifische Basis gestellt werden müssen. Die Urdefinition Webers charakterisiert Macht als subjektives Handeln und findet in den Typologien der Herrschaft Grundlagen, auf denen die konkrete Machtausübung gebettet ist. Damit sind die beiden soziologischen Phänomene der Macht und der Herrschaft durch subjektives sinnhaftes Handeln hervorgebracht worden.16Die weiteren Ausführungen innerhalb dieser Arbeit werden zeigen, ob sich dieses Verständnis der Macht erhalten hat oder ob der „fundamentale Begriff der Gesellschaftswissenschaft17” nicht eindeutig gefasst werden kann.
10Vgl. Sanders/ Kianty (2006): S. 33.
11Vgl. Sanders/ Kianty (2006): S. 33f.12Vgl. Kieser (2006): S. 72.
13Vgl. dazu Max Webers Bürokratieansatz Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit.14Im Folgenden wird die Differenzierung von Machtbegriff und Machtverständnis aufgegeben und diese daher als Synonyme verwendet.15Vgl. Saam (2002): S. 141.16Vgl. Neuenhaus (1993): S. 10.17Vgl. Weiss (1995): S. 305.
Page 8
1.1.2 Der Begriff der Organisation
Der Begriff der Organisation ist zunächst einmal durch eine immense Vielzahl potenzieller Definitionsmöglichkeiten gekennzeichnet, da „kaum ein anderer Ausdruck […] in der Wissenschaft eine vergleichbare Vielfalt aufweist18”. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass wahrscheinlich genauso viele Definitionen des Begriffs Organisation existieren, wie es Autoren gibt, die in jenem Bereich forschen. Zur Illustrierung sind an dieser Stelle einige wichtige Varianten aufgeführt:
„Organisationen stellen von Personen gebildete […] Einrichtungen dar, die auf Ziele hin orientiert und gegenüber vielfältigen externen Einflüssen offen sind19”.
„Organisation als Tätigkeit kann als Summe aller auf bestimmte Zwecke ausgerichteten Regelungen verstanden werden20“. „Organisationen sind konkrete Mehr-Personen- Zusammenschlüsse, die auf ein bestimmtes System von Regeln (Normen) aufbauen mit dem Zweck das individuelle Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken21“. „Organisationen sind zielgerichtete soziale Systeme, die ihre Mitglieder durch Zwang, Belohnung und Bestrafung oder aufgrund von Normen und Werte dazu bringen zur Erreichung der Organisationsziele beizutragen. Um Ziele zu erreichen, werden einzelne Individuen zu einer geordneten Gesamtheit (Organisation) zusammengefasst22“.
„Organisation ist ein kollektives Ganzes […], das sich auf ein Endziel bezieht23”.
„Organisationen sind zweckgebildete, intendiert geschaffene und mit einer formalen Struktur ausgestattete Gebilde24”.
So verschieden die genannten Beispiele in ihrer detaillieren Ausgestaltung auch sein mögen, allen ist eines gemeinsam: Die Eigenschaft der Zielgerichtet- und der Zweckbezogenheit.25Da dieses Attribut als einziges bei
18Vgl. Vahs (2005): S. 9.
19Vgl. Bornewasser (2000): S. 523.20Vgl. Strunz (1993): S. 106.21Vgl. Kräkel (2007): S. 5.22Vgl. Kirchler et al. (2004): S. 14.23Vgl. Weinert (2002): S. 33.24Vgl. Schreiter (1994): S. 13.
25Vgl. Kieser/ Walgenbach (2007): S.7 sowie Vahs (2005): S. 11.
Page 9
allen explizit genannt wird, sollte es etwas genauer unter die Lupe genommen werden.
Es handelt sich demnach um die Frage, welche Ziele innerhalb von Organisationen verfolgt werden, das heißt an dieser Stelle sollte differenziert werden, welche verschiedenen Arten von Zielen innerhalb einer Organisation existieren. Zunächst gilt es Ziele auszufiltern, die zwar innerhalb der Organisation verfolgt werden, jedoch nicht als Ziele der Organisation apostrophiert werden können. Dazu zählen unter anderem persönliche Ziele von Individuen in Organisationen wie ein bestimmtes Prestige oder Einkommensniveau zu erreichen. Analog dazu gehören Ziele einzelner Mitglieder, die sich dieselben für die Organisation wünschen aber keineswegs in einem formal legitimierten Prozess festgelegt wurden, nicht zu den Zielen der Organisation.
Ziele der Organisation sind solche, die in Satzungen und Verfassungen von Organisationen festgeschrieben wurden, denen wiederum allgemeine Rechtsvorschriften wie z.B. das Gesellschaftsrecht zu Grunde liegen.26Die Ziele der Organisation sind somit beispielsweise in deren Unternehmensbzw. Betriebsverfassung festgelegt und können vielfältiger Natur sein. Zum einen sind dabei operationale Ziele zu nennen, wie beispielsweise Ziele zum Umsatz, zur Erzielung von Gewinnen27, dem Marktanteil oder Produktinnovationen. Dabei ist zu betonen, dass in einer wirtschaftlichen Organisation das Erzielen von Gewinnen für die Organisation überlebenswichtig ist. So kann argumentiert werden, dass die Deckung des Bedarfs ausschließlich zum Zweck der Erzielung von Profiten, also der Erwirtschaftung von Gewinnen, ist. Im Gegensatz dazu können Ziele von Organisationen auch primär auf die Deckung von Bedarf ausgerichtet sein, es ist dann das „unmittelbare Ziel28“. Die Erzielung von Gewinnen ist dann höchstens sekundär.
Zum anderen werden nicht- operationale Ziele unterschieden wie z.B. das Mitarbeiterwohl oder aber die Verringerung der Umweltbelastung. Auch diese
26Vgl. Kieser/ Walgenbach (2007): S. 9.
27Dabei wird Gewinn verstanden als die Differenz zwischen positiven und negativen Größen einer Periode. Vgl. Rürup et al. (2003): S. 117.28Es sei hier an die Unterschiede der kapitalistischen und kommunistischen Produktionsweise erinnert. Vgl. Strunz (1993): S. 80.
Page 10
Ziele können in Unternehmensverfassungen enthalten sein. All diese Ziele von Organisationen weisen eine Gemeinsamkeit auf: Sie sind von Prinzip her auf Dauer angelegt und von Personen unabhängig. Das bedeutet, dass beispielsweise die Verfolgung allgemeiner Ziele wie das Erwirtschaften von Gewinnen immer ein Ziel der Organisation bleibt, unabhängig davon welche Personen im Vorstand sitzen.29Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die Erhaltung des Zusammenschlusses, also das Fortbestehen der Organisation, ein eigenständiges Ziel bleibt, das Grundvoraussetzung ist, um das Ziel der Erwirtschaftung von Gewinnen überhaupt erreichen zu können. Die Ziele einer Organisation sind dabei in den Unternehmens- bzw. Betriebsverfassungen fixiert, die für alle Mitarbeiter einer Organisation Gültigkeit besitzen. Die Unternehmensverfassung steckt zu einem wesentlichen Teil den Handlungsspielraum der Mitglieder einer Organisation ab und kann Handeln determinieren.30Eine Erkenntnis auf die im Laufe dieser Arbeit noch näher eingegangen wird. Umfassend betrachtet, überwiegen die Unterschiede, welche als konstituierend für die Organisation betrachtet werden, so dass mehrere Weisen existieren, um den Begriff der Organisation zu bestimmen. Verschiedene Autoren sehen diverse Aspekte innerhalb von Organisationen als besonders wichtig an, so dass von einem immensen Gegenstandsbereich von Organisationen ausgegangen werden muss. Daraus lassen sich unterschiedliche Bilder von Organisationen und analog verschiedene Theorien ableiten, auf die sich im Folgenden bezogen wird.
1.1.3 Organisationstheorien
Es ist zu konstatieren, dass es aufgrund der beschriebenen Komplexität des Gegenstandes der Organisation nicht nur die eine Organisationstheorie gibt. So wird angenommen, dass „eine geschlossene Theorie bis heute nicht existiert und es vermutlich auch nie geben wird31“. Die verschiedenen Organisationswissenschaftler berücksichtigen nur gewisse Aspekte der Organisation und gehen von einem ganz bestimmten
29Vgl. Kieser/ Walgenbach (2007): S. 11.30Vgl. Picot (1981): S. 160.31Vgl. Vahs (2005): S. 44.