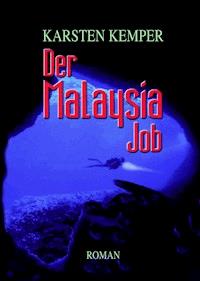
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Michael und Derek, zwei Tauchsportreporter, finden beim Tauchen vor Malaysia eine Anzahl Toter im Innern eines gesunkenen Frachters und filmen ihren Fund. Zurück in London stirbt Derek bei einem mysteriösen Autounfall, während Michael entführt wird. Er kann jedoch mit Hilfe eines russischen Polizisten entkommen, der vorgibt, die Bande zu observieren. Auch Sally, Michaels Ex-Freundin wird entführt. Gefordert werden die Bilder aus der Unterwasserkamera. Ivan kennt das Versteck der Ganoven und schlägt vor, sie zu befreien. Doch die Aktion misslingt. Hinzu kommt, daß Michael Steven, seinen Chefredakteur, als Verräter entlarven kann, der für die Gegenseite arbeitet. Und als Steven von Rickman, dem Boß der Bande, ermordet wird, erfährt Michael, daß Ivan kein Polizist ist, sondern einst zu Rickmans Bande gehörte und sich an ihm rächen will. Da Michael des Mordes an Steven verdächtigt wird, flieht er mit Ivan nach Südfrankreich, um den Reeder und möglichen Drahtzieher aufzuspüren. Doch dieser entpuppt sich nicht als Hintermann. In seiner Verzweiflung will sich Michael den Entführern ausliefern, um Sally auszulösen, da er das Band nicht besitzt. Doch beim Telefonat mit Rickman erhält er einen Hinweis auf das Versteck der Gegenseite. Bald schon können sie ihren Standort lokalisieren, als Michael von Ivan abgehängt wird. Ivan hat nur die Rache für seinen Bruder im Sinn, für dessen Tod er Rickman verantwortlich macht. Bei der nachfolgenden Schießerei stirbt Ivan, während Rickman mit Sally als Geisel vor der Polizei flieht. Nachdem die junge Frau befreit wurde, kommt es zum Unfall, bei dem der Bandenchef stirbt. In einem Geständnis, das er kurz zuvor ablegt, nennt er den Auftraggeber, Gordon Rosroth, einen australischen Milliardär. Der habe ihn beauftragt, mit ein paar Männern vor Malaysia Piraten zu jagen und zu töten. Dabei kamen auch arme Bootsflüchtlinge ums Leben. Bei einem Besuch in London wird Rosroth mit Michael als Lockvogel schließlich überführt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karsten Kemper
Der Malaysia-Job
Imprint
Der Malaysia-Job Karsten Kemper published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de Copyright: ©Karsten Kemper ISBN 978-3-7375-4584-6 Konvertierung: Sabine Abels / www.e-book-erstellung.de
Der ‚Malaysia-Job’
Der Frachter fuhr nur mit mäßiger Geschwindigkeit. Trotz des fehlenden Mondes in dieser Nacht war er bereits von weitem auszumachen. Alle Lichter auf Deck brannten, als wolle die Mannschaft absichtlich auf sich aufmerksam machen. Mit ihren motorisierten Schlauchbooten holten sie schnell auf und hielten von hinten auf ihre Beute zu. Sie wußten, daß sie bei der Dunkelheit im toten Winkel des Schiffes kaum wahrzunehmen wären. Dann gingen sie längsseits an Backbord, unbemerkt, wie sie glaubten. Nun mussten sie nur noch ihre Stricke und Enterhaken ausbringen und die Reling erklimmen, so wie es Piraten seit hunderten von Jahren tun. Dort angelangt wurden sie plötzlich geblendet. Von Scheinwerfern, die man von allen Seiten auf sie richtete und die ihre Pupillen stark verengten. Diesmal wurden sie erwartet, aber es war kein Empfangskomitee, das sie umzingelt hatte. Ihre wenigen Pistolen und Kalaschnikows konnten nichts ausrichten gegen die Übermacht der anderen und deren Waffenpotenzial. In dieser Nacht sollte nicht die Crew sondern sie die Opfer werden. Es würde ihr letzter Überfall gewesen sein, wurde ihnen schlagartig bewusst. Zum Reden war keine Zeit mehr. Nur noch ein paar flüchtige Gedanken, ein verzweifelter Schrei nach innen. Dann wurden die Abzüge betätigt, worauf lang anhaltende Salven aus automatischen Waffen ihre Körper durchschlugen und ihren Raubzügen für immer ein Ende bereiteten.
Ihr letzter Tauchgang war genauso erfolglos wie die vorangegangenen. Die Reste einer chinesischen Dschunke samt ihrer kostbaren Ladung sollen hier vor der Westküste Malaysias, auf dem Meeresgrund liegen. Als vor ein paar Monaten auf einem Schwarzmarkt in Manila plötzlich Teller mit kobaltblauem Dekor und Armreifen aus grünem Glas verscherbelt wurden, blieb dies vom fachkundigen Publikum nicht unbemerkt. Ein Expertenteam aus Peking datierte die Fundstücke in das 14. Jahrhundert. In jene Zeit, in der sich China auf seinem kulturellen Höhepunkt befand und mit einer gewaltigen Flotte von Seeschiffen Handelsbeziehungen zu fernen Ländern unterhielt. Ein Seebeben vielleicht oder eine Veränderung der Unterwasserströmung haben bewirkt, dass der Meeresboden ein paar seiner wertvollsten Trophäen wieder freigab. Der weiche, sauerstoffarme Schlick konservierte die begehrten Stücke mehr als ein halbes Jahrtausend. Malaysia gilt als eines der beliebtesten Tauchziele und lockt mit dem vielfältigsten Artenreichtum im Indopazifischen Becken. Doch die smaragdgrünen Inseln mit ihren perlmuttweißen Stränden, das warme Wasser mit seinen Barracudaschwärmen, Hammerhaien und riesigen Meeresschildkröten, interessierten sie nicht. Sie hatten einen Job zu erledigen. Michael und Derek sind Profis und machen so etwas nicht zum ersten Mal. Jeder der beiden hat weit über sechshundert Tauchgänge absolviert. Derek Coleman ist Brite und diente jahrelang als Kampftaucher in der Royal Navy, die er vor zwei Jahren nach Beendigung seiner Dienstzeit verließ. Michael Burk ist Amerikaner und begann bereits während seines Jurastudiums, dass er vor fünf Jahren absolviert hatte, mit dem Tauchen. Beide arbeiten als Tauchsportjournalisten für ,Divers Ground’, dem Marktführer unter den englischsprachigen Tauchsportmagazinen. Als er sich vor einem Jahr um den Job bemühte, lernte er dort Derek kennen, dem es schon vor ihm gelungen war, seine Leidenschaft erneut zum Beruf zu machen. Sie verstanden sich auf Anhieb und wurden auch privat zu Freunden. Seitdem arbeiten sie als Team, wann immer es die Situation erlaubt. Steven, ihr Chefredakteur, hatte die beiden auf die Dschunke angesetzt, weil er wusste, dass sie aus jeder Situation das Beste machen. Vor zwei Wochen bekam er von Dillon, einem seiner Agenten in Südostasien, die Informationen über die Position des Wracks zugespielt. Dillon galt als zuverlässig. Er hatte versucht, den Weg der begehrten Kostbarkeiten vom Schwarzmarkt in Manila mit Hilfe der dort üblichen kleinen Schmiergelder zu den Plünderern zurückzuverfolgen. Die Spur führte zu ein paar ortsansässigen Fischern, die die Chance wahrnahmen, ihre Armut ein wenig zu lindern, indem sie den freigelegten Teil der Ladung bargen und zu Geld machten. Doch die Koordinaten waren falsch. Sie mussten falsch sein. Wenn das Wrack dort läge, wo sie suchten, wären sie längst drauf gestoßen. Wie es aussah, hatte man Dillon diesmal getäuscht. Vielleicht um den tatsächlichen Fundort nicht preiszugeben und dennoch in den Genuss seiner Dollars zu kommen. Oder es waren nicht die richtigen Leute, die er aufspürte. Möglicherweise erzählte ihm irgendjemand irgendetwas, womit er zufrieden war und seine Scheine rausrückte. Ihr Tauchprofil westlich des hundertsten Längenund südlich des zehnten Breitengrades war mehr als zehn Meilen lang und genauso breit. Seit acht Tagen tauchten sie zweimal täglich. Die Atemluftflaschen stets mit Nitrox, einem Sauerstoffgemisch, gefüllt, das es ihnen ermöglicht, länger unten bleiben zu können. Oftmals gingen sie dabei runter bis auf sechzig Meter, womit sie ihre zulässige Tauchtiefe um fast die Hälfte überschritten. Die Dschunke kann jedoch nicht so tief liegen. Um den havarierten Segler dort unten zu plündern, hätten einheimische Fischer Tauchausrüstungen und Atemluftflaschen benötigt, genau wie sie. Kaum anzunehmen, dass sie mit so etwas richtig umgehen und arbeiten können. Bisher hatten sie nichts gefunden, was auch nur auf die Existenz des Schiffes hindeutete. Ihr Budget war fast vollständig aufgebraucht und ihre Stimmung auf dem Nullpunkt. Es war ihr letzter und verzweifelter Versuch, ihren Auftrag zu erfüllen. Aber wie es aussah, bliebe ihnen diesmal ein Erfolgserlebnis wie bei all ihren bisherigen Expeditionen verwehrt. Derek warf einen Blick auf seinen Tauchcomputer am linken Handgelenk, der ihm anzeigte, dass die Hälfte der Tauchzeit bereits überschritten war. Sie hatten keinerlei Hoffnung mehr, auf dem letzten Abschnitt doch noch etwas zu finden. Wenn sie ihr Boot erreichen würden, das am Ausgangspunkt auf sie wartete, wäre die ganze Sache für sie erledigt gewesen. Am darauf folgenden Tag würden sie in ihre Maschine steigen und das Inselparadies unverrichteter Dinge wieder verlassen. Sie befanden sich noch in vierzig Metern Tiefe, umgeben von völliger Dunkelheit. Ihre Flossenschläge waren langsam und kontinuierlich, ihre Atmung tief und gleichmäßig. Erfahrene Taucher können sich trotz des enormen Wasserdrucks, der auf ihnen lastet, völlig entspannen. Wie in Schwerelosigkeit schweben sie dann durchs Wasser und verbrauchen dabei so wenig Atemluft wie möglich. Das Licht ihrer Strahler erhellte den Meeresboden, der mit einem Teppich rötlich schimmernder Weichkorallen überzogen war. Ganze Schwärme von Kardinalfischen tummelten sich vor ihren Augen. Derek paddelte in einiger Distanz vor Michael und überwand als erster die Kuppe eines Felsenriffs, als es ihm fast den Atem verschlug. Vor ihnen zeichneten sich im dunstigen Licht ihrer Taucherlampen die Umrisse eines gesunkenen Schiffes ab. Ein moderner Stahlkoloss lag wegen des abfallenden Meeresbodens ein Stück nach vorne und zur Seite geneigt direkt vor ihnen. Sie kamen von hinten auf den Havaristen zu. Vorbei an den gewaltigen, messingfarbenen Schraubenblättern und dem haushohen Ruderblatt, das sich ihnen entgegenstreckte. Die Überraschung war perfekt, da keiner von ihnen damit gerechnet hatte, dass hier ein Wrack lag. In den Unterwasserkarten war nichts verzeichnet. Das wussten sie genau. Jeden Abschnitt ihrer Expedition hatten sie im Vorfeld besprochen, jedes Detail erörtert und jeden Hinweis bedacht. Jene Dschunke sollte hier irgendwo sein, aber auf keinen Fall ein Frachter aus der Gegenwart. Und er lag mit Sicherheit noch nicht lange dort. Sie tauchten längsseits am Wrack entlang. Der Rumpf war offenbar unversehrt. Weder ein Leck noch eine Beschädigung waren erkennbar. Nicht einmal Roststellen waren irgendwo zu sehen. Selbst der dunkelrote Anstrich unterhalb der Wasserlinie wirkte relativ unverbraucht und wies noch keinerlei Korallenbildung auf. Es war ein Containerschiff mittlerer Größe, 160-180 Meter lang, die Bordwände in hellem Grau gehalten, mit einem weißen Deckshaus am hinteren Ende. Eine große Anzahl Container hatte sich vermutlich schon beim Untergang aus ihrer Verankerung gelöst und lag nun in weitem Radius rund um das Schiff verstreut. Am Bug zeichnete sich im trüben Licht von Michaels Taucherlampe der Name ab. ,Treasure Island’ prangte dort in schwarzen Buchstaben über dem Anker. Michael fiel auf, dass man sich beim Malen der Buchstaben keine allzu große Mühe gegeben hatte. Die Abstände waren ungenau und an einer Stelle war sogar der Pinsel entgleist, ohne dass man es korrigiert hatte. Als er den Schriftzug mit den Fingern berührte, konnte er es spüren. Ihm fiel ein, dass der Name eines Schiffs noch während der Bauphase auf den Bug geschweißt wird. Zwar konnte er nicht ertasten, was genau da stand. Aber es war nicht identisch mit dem, was jetzt an der Bordwand zu lesen war. Während sie sich der Kommandobrücke näherten, bemerkten sie einen Strom von Luftbläschen, die irgendwo aus dem Deckshaus sprudelten. Mit dem Lichtschein ihrer Lampen verfolgten sie den Verlauf bis zum Austrittspunkt am Fuß des grün-weiß gestreiften Schornsteins. Eine größere Menge Luft befand sich anscheinend noch im Inneren und quoll aus einem Lüftungsschacht, was darauf hindeutete, dass es erst vor kurzem gesunken sein musste. Manchmal dauert es Tage, bis die Wassermassen auch den letzten Winkel geflutet haben. Aber eben nur Tage. Kein Wunder also, dass die Karten keinen Hinweis lieferten. Sicher waren sie die ersten, die auf die gesunkene ,Treasure Island’ stießen. Seltsam auch, dass sich noch alle Rettungsboote in ihren Halterungen befanden. Deshalb befürchteten sie insgeheim, im Rumpf befindliche Crewmitglieder zu finden. Wie sonst hätte sich die Mannschaft retten können, wenn nicht mit ihren Booten. Michael inspizierte das Deck, während Derek in die Brückensektion eindrang. Dort, zwischen umhertreibenden Papierfetzen und Plastikfolien, hatten längst die Bewohner des Meeres das Kommando übernommen. Ein blau gefleckter Stachelrochen ergriff, als er vom Lichtstrahl seiner Lampe geblendet wurde, sofort die Flucht durch eines der zerborstenen Fenster. Außer ein paar Aktenordnern, die nur Unmengen von Gebrauchsanweisungen sowie unverständliches Zahlen und Koordinatenwirrwarr beinhalteten, gab es nichts, was sein besonderes Interesse weckte. Beim Aufschlag auf den Meeresgrund waren einige Container aus ihren Verankerungen gerissen worden und hingen nun verschränkt und verdreht auf dem leicht abschüssigen Deck. Michael war verblüfft, dass alle Stahlboxen, deren Türen beim Aufprall aufgesprengt worden waren, keinerlei Ladung beinhalteten. Ein blaufarbener Container erregte besonders seine Aufmerksamkeit, da die Seriennummer mit den Zahlen 8.10.1952 auf der rechten Tür exakt dem Geburtsdatum seiner Mutter entsprach. Was ihn zugleich schmerzhaft daran erinnerte, das er es im vergangenen Jahr versäumt hatte, was schon ewig nicht mehr vorgekommen war. Derek hatte die Brücke mittlerweile verlassen und war zu Michael aufs Deck hinuntergelangt. Zwischen einigen Containern, die nicht mehr auf ihren vorgegebenen Positionen standen, wurde jetzt der Blick in die darunter liegenden Sektionen möglich. Michael gestikulierte seinem Partner mit den Händen, dass er vorhatte, dort hinabzutauchen, worauf Derek einen Blick auf seinen Tauchcomputer warf. Leider war darauf abzulesen, dass der Luftvorrat wegen der Kompressionszeiten nicht mehr für beide reichen würde. Da sie aus vierzig Metern Tiefe nicht ohne Zwischenstopps zur Oberfläche zurückkehren konnten, benötigten sie noch eine Restmenge an Luft, um ihren Körpern die Möglichkeit zu geben, den Stickstoff, der sich beim Tauchen im Blut bildet, wieder abbauen zu können. Andernfalls hätten sie ihr Leben riskiert. Infolgedessen entschloss sich Michael spontan, alleine die tiefer gelegenen Bereiche zu erkunden. Um seinen Auftrieb zu mindern öffnete er das Luftventiel an seiner Tarrierweste und ließ sich in den tiefschwarzen Raum absinken, der sich unter ihm auftat. Während er hinab glitt, winkte er Derek hämisch zu. Derek wusste, dass Michael ihn damit ärgern wollte. Denn was er da tat, war äußerst gefährlich. Für gewöhnlich taucht man nicht alleine ins Innere eines Wracks. Viele Taucher sind schon dabei ums Leben gekommen, weil sie die Orientierung verloren haben und nicht mehr rechtzeitig nach draußen fanden. Andere starben, weil sie in der Dunkelheit scharfe Metalltrümmer übersahen, die ihnen die Luftzufuhr abschnitten. Er wusste nur zu genau, dass sein Verhalten später noch von Derek gerügt werden würde. Sein Hang zum Risiko hatte trotz gegenseitiger Sympathie schon oft zu heftigen Konflikten zwischen ihnen geführt. Die Royal Navy hatte Derek gelehrt, dass Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein sich selber als auch dem Partner gegenüber oberstes Prinzip beim Tauchen sind. Deshalb quittierte er sein Verhalten nur mit einem Kopfschütteln. Als Michael am Boden des Frachtraums auftraf, zwang ihn der Ruck in die Knie, wobei er seine Lampe fallen ließ. Während er versuchte, sie im Dunkeln zu ertasten, wurde er unsanft von einem riesigen Fisch gestreift. Gern hätte er gewusst, was für ein Exemplar ihm einen solchen Schrecken versetzt hatte. Als er seine Lampe wieder fand, glaubte er an einen Defekt durch den Aufprall. Aber nach kurzer Zeit, nachdem er den Schalter ein paar Mal betätigt hatte, ging sie wieder an. Die graue Bordwand mit ihren senkrecht verlaufenden Stahlstreben und den paar abgerissenen Ketten, die vom Deck herunterhingen, waren das erste, was sich im wieder gewonnenen Lichtschein abzeichnete. Was er jedoch zu sehen bekam, als er die Lampe in den endlos wirkenden Raum richtete, ließ ihn augenblicklich erstarren. Nichts bereute er mehr in seinem Leben, als in diesem Moment hier unten zu sein. Hätte er vor Entsetzen schreien können, so wäre dies sicher noch an Land zu hören gewesen. Vor ihm trieben, Rücken an Rücken gefesselt, Paare von Toten im Wasser. Da der Lichtkegel nicht alle auf einmal erfassen konnte, ließ er die Lampe weiträumig kreisen. Immer mehr Leichen kamen so nach und nach zum Vorschein. Einige schwebten wie Geister hoch oben unter dem Deck, als hingen sie an unsichtbaren Fäden. Andere hingegen glitten nur knapp über dem Boden. Die Szenerie erinnerte ihn an ein abstraktes Kunstwerk, das er einmal als Kind beim Besuch eines Kunstmuseums in New York mit seinen Eltern gesehen hatte. Damals waren es menschenähnliche Statuen aus Gips, die wahllos in einem dämmrigen Raum aufgehängt waren und ihn mehr das Fürchten lehrten, als ihn der Kunst nahezubringen. Sein Eintauchen hatte eine Verdrängung des Wassers zur Folge, worauf einige Paare nun in Wallung gerieten und langsam wegtrieben. Es waren ausnahmslos Menschen asiatischer Herkunft. Darunter viele Frauen und sogar ein Kind, wie er schon von weitem erkennen konnte. Nach und nach überkam ihm ein Gefühl von Benommenheit. Die schrecklichen Eindrücke hatten bewirkt, dass er zu schnell und zu tief atmete. Er musste sich zwingen, langsamer zu atmen und sich zu entspannen. Angst und Stress können zu Hyperventilation führen. Wenn er jetzt das Bewusstsein verlöre, wäre das sein sicherer Tod. Michael sah sich mit einem Albtraum konfrontiert. Dann schloss er die Augen und versuchte sich zu konzentrieren, indem er sich hinkniete und sich mit den Händen abstützte. ‚Sie sind alle tot und niemand kann ihnen mehr helfen’, redete er sich ein, um sich zu beruhigen. Wer aber waren diese Menschen? Wie und warum waren sie gestorben? Wussten die Behörden von ihrem Tod? Wusste überhaupt jemand, dass sie tot waren? Falls nicht, sollte ihr Sterben dann unbemerkt und ungesühnt bleiben? Fragen, die ihm im Augenblick niemand beantworten konnte. Er verharrte noch kurze Zeit in der Hocke, bis er sich sicher war, seinen Schwächeanfall überwunden zu haben. Es war totenstill. Nur das Sprudeln der ausgeatmeten Luft, war in dem gefluteten Massengrab zu vernehmen. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, schaltete er die Unterwasserkamera ein, die mit der Taucherlampe verbunden war. Er sah es nun als seine Pflicht an, sie alle zu filmen. Denn er bezweifelte, dass vor ihm schon jemand da war oder in nächster Zeit herunter gelangen würde. Jemand, der wie er den grausigen Fund sogar dokumentieren könnte. In ein paar Wochen wird wahrscheinlich nichts mehr von ihnen übrig sein. Neben dem warmen Salzwasser in tropischen Gewässern gibt es genügend Aasfresser, die die Leichname in kürzester Zeit bis auf die Knochen dezimieren. Eine Identifizierung dieser Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale wäre dann unmöglich. Vielleicht war es diesmal Vorsehung, dass er wieder einmal die Regeln mißachtete und hier alleine eingedrungen war. Um letztendlich alle Bündel von Toten aus nächster Nähe aufnehmen zu können, musste er den Raum einmal bis zum Ende durchqueren und wieder umkehren. Jeder Einzelne von ihnen sollte deutlich zu erkennen sein. Deshalb beschloss er, jeden von ihnen von den Füßen an zu filmen und am Ende der Aufwärtsbewegung mit der Kamera auf ihren Gesichtern zu verharren. Mit Hilfe des Objektivs konnte er sie dann noch vergrößern und deutlicher machen. Ihre Augen und Münder waren halb geöffnet. Keiner aus der Gruppe wirkte älter als dreißig. Offensichtlich waren sie mit äußerster Brutalität verschnürt worden. Das silbergraue Isolierband, das ihre Körper umschlung, war mitunter so fest angezogen, dass es ihnen das Gewebe an den Armen abgestrammt hatte. Die meisten von ihnen hatten Blutergüsse und Hautverfärbungen an den Rändern. Noch nie in seinem Leben hatte er eine Leiche aus nächster Nähe gesehen. Irgendwie sahen sie nicht mehr aus wie leibliche Menschen, eher wie beigefarbene Wachspuppen, seltsam und unwirklich. Schwer vorstellbar, das sie einmal gelebt haben sollen. Ihre Kleidung bestand nur aus bunten Shorts und TShirts. Es war ihm noch immer unheimlich zumute, zwischen all den Körpern. Deshalb versuchte er sich voll und ganz auf die Bedienung der Kamera und die Optimierung der Aufnahmen zu konzentrieren. Die jungen Frauen hatten lange, zurückgebundene Haare. Nur einige trugen ihr Haar kurz, weshalb er sie zunächst für Männer gehalten hatte. Das Bündel mit dem Kind kam als letztes dran. Als er sich ihm näherte, sah er, dass es ein Junge war. Er schätzte sein Alter auf etwa acht bis zehn. Beim Anblick des Kleinen kam neben Mitgefühl viel an Wut in ihm auf. Jemand muss dafür verantwortlich sein, schoss es ihm durch den Kopf. In der Nahaufnahme bemerkte er ein Medaillon, das um seinen Hals hing. Leider war es zerbrochen, die Hälfte davon fehlte. Trotzdem konnte es wichtig sein um seine Identität zu klären, dachte er und nahm es langsam vom Hals ab. Die andere Hälfte lag vielleicht irgendwo im Raum herum. Aber für eine intensive Suche reichte die Zeit nicht mehr. Als er fertig war, schaltete er die Kamera aus. Obwohl er nicht gezählt hatte, glaubte er, dass es so um die dreißig Leichen gewesen sein mussten. Die genaue Anzahl würden die Auswertungen ja ergeben. Vielleicht aber waren sie ja gar nicht ertrunken, sondern schon tot, bevor sie untergingen, dachte er wiederum. Schließlich wurde ihm bewusst, dass sein Luftvorrat zuende ging, was sein Grübeln vorerst stoppte. Den Rest in seinen Flaschen würde er für seinen Aufstieg brauchen, um zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen. Derek war natürlich nicht mehr da. Er war bereits zum Boot zurückgekehrt, um Luft zu sparen. Luft, die Michael jetzt dringend brauchte. Er war spät dran, als er endlich den Ankerplatz ihres Bootes erreichte. Bevor er auftauchen konnte, musste er in jeweils verschiedenen Tiefen drei Dekompressionspausen absolvieren. Derek hatte ihm ausreichend Nitrox in einer seiner Flaschen zurückgelassen, die Michael an der Ankerkette befestigt vorfand. Dort oben über dem Wasser ging langsam der Tag zu Ende. Ein Wind wehte nun leicht und bald würde es dunkel sein. Michael hangelte sich hastig ins Boot. Bereits beim Auftauchen sah er, dass Derek aufrecht im Boot stand. Er wartete schon lange und wurde langsam ungeduldig. Besser gesagt, er kochte vor Wut.
»Bist du verrückt geworden. Wo hast du so lange gesteckt. Hast du dort unten einen Tresor gefunden und ihn nicht aufbekommen?«, schallte es ihm entgegen. Charly, ihr malaysischer Bootsführer, verharrte stillschweigend im hinteren Teil des Bootes und tat so, als hätte er am Bordmotor zu tun. Er gehörte zur Tauchstation und hatte die Aufgabe, sie täglich in ihr Gebiet zu bringen. Sein malaysischer Name war extrem lang und vergleichsweise schwierig auszusprechen. Deshalb entschied er vor ein paar Jahren, sich Charlie zu nennen, womit die Touristen gut umgehen konnten. Viele Amerikaner fühlten sich dadurch sogar belustigt. Sie erinnerten sich, dass man den Feind einst im Vietnamkrieg
‚Charlie’ genannte hatte. Nur er wusste es nicht. Tatsächlich hatte Michael jegliches Zeitgefühl verloren. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie lange er sich dort unten aufgehalten hatte. Bevor Derek seine Standpauke fortsetzen konnte, fiel er ihm ins Wort.
»Sachte, Derek, sachte. Ich hatte meine Gründe.«
»Was für Gründe sind es diesmal? Du hast immer irgendwelche Gründe. In Wirklichkeit aber bist du...?«
»Hör auf damit, verdammt noch mal! Hör auf, mich anzuschreien. Hör lieber zu!«, unterbrach er ihn, mit den Händen herumfuchtelnd. »Dort unten in dem Schiff sind Leichen ...Tote, verstehst du?« Seine Augen leuchteten intensiv, während er sich gehetzt die Ausrüstung vom Leib streifte. »Der Kahn ist ein schwimmendes Grab.«
»Also doch«, sagte Derek. »Ich hatte es geahnt, wegen den Rettungsbooten. Es musste ein paar von ihnen erwischt haben. Kein schöner Anblick, was?«, entgegnete er ihm flapsig.
»Nein, nein, verdammt, nicht so, es sind keine Seeleute. Zumindest glaube ich das nicht. Sie sind mit ihren Rücken aneinandergefesselt. Und außerdem sind auch Frauen dabei und sogar … ein Kind.« Er malmte mit den Kiefern und sah verkrampft an ihm vorbei. Derek wurde die Ernsthaftigkeit der Situation bewusst, und wie nahe Michael die Sache ging. »Okay, okay, ...sollen wir
...ich meine, wenn es so ist, wäre es vielleicht gut, wenn ich sie mir auch mal ansehen würde«, lenkte er ein.
»Nein, nein, nicht nötig. Tu dir das nicht an. Es reicht, wenn ich sie gesehen habe. Ich habe sie zur Sicherheit gefilmt«.
»Was, du hast alles auf Band?«
»Sicher, wie sollen wir denn sonst beweisen, dass es sie dort unten gibt?«
Michael atmete tief durch und raufte sich seine nassen Haare. »Ich erzähle dir alles im Hotel, okay? Lass uns endlich von hier verschwinden. Ich bin total erledigt. Mir reicht’s für heute.«
Dann ließ er sich im hinteren Teil des Bootes nieder und wandte ihnen den Rücken zu. Derek verstand, dass er einiges durchgemacht haben muss und schwieg, bis sie wieder an Land waren. Auch Charlie, der es sich nie nehmen ließ, während der Fahrt den Joker zu spielen, indem er die neuesten Witze in schlechtestem Englisch präsentierte, zog es diesmal vor, innezuhalten. Eine knappe Stunde brauchten sie noch, bis sie ihre Insel und die Tauchstation erreicht hatten, um die Neoprenanzüge sowie den Rest ihrer Ausrüstung abzuliefern. Michael war froh, dass es zuende war. Die Lust am Tauchen war ihm nach diesem Erlebnis erst einmal vergangen und er wollte nur noch schlafen. Schlafen und vergessen.
Kapitel 2
Tioman Pahang ist die größte Insel des Meeresparks Pahang. Neben den Touristen, die die Insel das ganze Jahr hindurch aufsuchen, leben hier ausschließlich Fischer. Die Unterkünfte für Touristen liegen auf der Westhälfte der Insel. Dort findet man auch die beliebtesten Tauchziele und außerdem ist die See dort ruhiger. Derek beharrte auf Tioman als Ausgangspunkt für ihre Suchaktion, weil sie täglich von Kuala Lumpur aus angeflogen wird. Motorboote brauchen eine Stunde, der Katamaran etwa doppelt so lange. Ihr Resort mit seinen aus Tropenholz gefertigten runden Hütten lag am Ende einer Landzunge. Die Unterkünfte waren einigermaßen komfortabel und auf ein weitläufiges Areal verteilt. Bis zur nächsten Tauchstation waren es nur fünf Minuten zu Fuß. Es war erst Vormittag. Trotzdem war das Thermometer schon auf sechsunddreißig Grad geklettert. Die Klimaanlagen in ihren Hütten sorgten für ausreichend Kühlung. Derek war bereits seit sieben Uhr auf den Beinen, hatte üppig gefrühstückt und ein paar Formalitäten für ihre Rückflüge erledigt. Er war körperlich in Bestform und brauchte nur wenig Schlaf. Seit er die Navy verlassen hatte, trainierte er regelmäßig mit Gewichten und joggte, um sich fit zu halten.
Es war gegen ein Uhr nachts, als das Telefon klingelte. Steven stand auf dem Balkon seiner Wohnung und blickte hinunter auf den nächtlichen Verkehr der ‚Bayswater Road’. Wenn der Hyde Park keine Bäume gehabt hätte, hätte er mit einem Fernglas bis hinüber zur Kensington Road schauen und sehen können, ob in seiner alten Wohnung noch Licht brannte. Als seine Frau erfuhr, dass er bisexuell ist und hinter ihrem Rücken mit Männern verkehrte, reichte sie die Scheidung ein. Daraufhin musste er ausziehen. Seitdem lebt er allein, während sie mit der gemeinsamen Tochter in der Wohnung verblieben ist. Die Einsamkeit aber schmerzte ihn nur anfangs. Mittlerweile wusste er die Vorteile und Freiheiten zu schätzen, die das Single-Leben mit sich bringt. Nun konnte er essen und trinken, soviel er schaffte, wetten soviel er wollte und wenn er jetzt Lust verspürte, jemanden für eine Nacht mit nach Hause zu nehmen, konnte er auch dies tun, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Die restlichen Mieter wohnten wie er fast ausnahmslos alleine und schätzten die Anonymität. Leute wie Steven, die es sich leisten konnten, die hohen Mieten in Londons Innenstadt zu zahlen und nur für ihren Job lebten. Gelegentlich begegnete man sich im Aufzug, grüßte höflich und das war’s dann auch. Er hatte einen langen, harten Tag hinter sich. Mittwochs war Redaktionsschluss. Dann waren vierzehn Stunden, die er hinter dem Schreibtisch zubringen musste keine Seltenheit. Entsprechend lange dauerte es jedes Mal, bis er wieder abschalten konnte. Im Hintergrund lief noch immer der Fernseher. Nachdem er die Sportnachrichten gesehen und sich wieder einmal über einen verlorenen Wetteinsatz geärgert hatte, stellte er den Ton ab und mixte sich einen Drink, den er anschließend mit auf den Balkon nahm. Wenn er doch nur einmal über seinen Schatten springen könnte und für einen der Londoner Fußballclubs wetten würde. Aber er liebte nun einmal Manchester. Immer wieder setzte er hohe Beträge auf Manchester und lag nun erneut, zum dritten Mal in Folge, daneben. »Derek, weißt du, wie spät wir es hier haben?«
»Sicher doch. Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass du schon im Bett liegst. Heute ist Mittwoch, zumindest noch bei dir.«
»Okay, schieß los! Ihr habt sie endlich... nein, lass mich raten. Ihr habt gleich zwei von den Dingern gefunden, bis zum Rand mit Porzellan und Edelsteinen gefüllt, richtig?«
»Klar, schön wär’s. Nein, wir haben nichts. Wir haben das ganze Gebiet abgegrast. Sie liegt dort nicht, ganz sicher. Aber wir haben etwas anderes gefunden.«
»Etwas anderes? Hoffentlich etwas, was wir brauchen können.«
»Kommt drauf an. Wir haben einen Frachter gefunden.«
»Was für einen?«, fragte Steven spontan.
»Einen von heute, einen modernen«, antwortete Derek.
»Hervorragend«, kam es von Steven abfällig.
»Steven, das Ding ist …voller Leichen.«
»Na und! Beabsichtigt Ihr jetzt eine Reportage über tote Seeleute zu machen?«, entgegnete er Derek noch immer missmutig.
»Nein, Steven. Es sind keine Seeleute.«
»Was dann? Ich meine, woher wollt ihr wissen, wie... ?«
»Glaubst du, dass sich Matrosen aneinander fesseln, wenn ihr Schiff untergeht?«
»Nein, das entspricht nicht gerade ihrer Mentalität«, sagte Steven mit verzerrtem Gesicht, nachdem er sich mit einem einzigen Zug seinen Drink einverleibt hatte.
»Diese Menschen sind mit ihren Rücken aneinander gefesselt. Es sind Frauen darunter und auch ein Kind, verstehst du?«
»Genauer, Derek. Wie sehen sie aus?«
»Asiaten, allesamt. Um die vierzig an der Zahl.«
»Und was für ein Schiff ist es? Irgend so ein verrosteter Seelenverkäufer aus der dritten Welt?«, hakte er nach, während er sein Glas dabei nachdenklich hin und her drehte. Derek spürte nun, dass Steven angebissen hatte.
»Keineswegs«, entgegnete Derek. »Das Ding sieht wie neu aus. Ein ganz gewöhnliches Containerschiff eben!«
Steven verspürte plötzlich Lust auf einen weiteren Drink und hantierte, den Hörer zwischen Kopf und Schulter verschränkt, hektisch mit den Flaschen aus seiner Hausbar herum. »Gut! Weiter!«
»Wir wissen nichts Genaues. Michael war drin in dem verdammten Kahn und hat sie zufällig gefunden. Dann hat er zur Kamera gegriffen und sie aufgenommen.«
»Das alles hört sich interessant an. Und wie sind die Aufnahmen geworden?«
»Grauenhaft.«
»Schade!«
»Nein, ich meine, es ist grauenhaft, was auf dem Film zu sehen ist. Die Qualität ist hervorragend.«
»Ihr habt also gute Arbeit geleistet.«
»Nein, Michael hat gute Arbeit geleistet.«
»Aha, der Kleine hat einen Alleingang gewagt?«
»So ist es. Unser Sonnyboy hat sich von der Leine gerissen und eine Sondernummer absolviert. Ich wäre auch mitgekommen, aber wir hatten nicht mehr genügend Luft«, erläuterte Derek.
»Nun, gut. Was wisst ihr noch über das Schiff?«
»Sonst nichts. Wir haben den Namen des Frachters und wissen, wo er liegt. Das reicht doch, oder?«
»Nein, tut es leider nicht. Namen sind wie Schall und Rauch. Einen Namen kann man ändern. Dazu braucht man nur Farbe. Wichtiger wären Papiere, oder so etwas. Schiffspapiere, Frachtdokumente. Wenn sich herausstellen würde, dass diese Menschen ermordet worden sind, wäre das ein dicker Fisch für uns. Ein Verbrechen auf hoher See, dazu die passenden Bilder. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Aber im Vorfeld müssen wir es beweisen und hierfür benötigen wir Fakten.«
»Mir fällt da gerade etwas ein«, sagte Derek, fast abwesend wirkend.
»Prima. Ich bin noch dran.«
»Ich muss auflegen. Die Zeit rennt mir davon.«
»Derek, he, noch eins. Kein Wort zu den Behörden dort unten. Ihr habt hoffentlich noch nichts unternommen. Wenn sie euch das Filmmaterial abnehmen, war alles umsonst. Sobald wir die Nuss geknackt haben, können wir Scotland Yard einschalten. Aber vorher sollten wir davon profitiert haben, in Ordnung? Wir sind nämlich Journalisten.«
»Ja, sicher, das weiß ich auch. Ich bin doch kein Anfänger mehr.«
Für Derek und Michael stand außer Frage, dass es eine schlechte Idee wäre, die Polizei vor Ort einzuschalten. Sie hielten Malaysias Ordnungshüter für unzureichend ausgebildet und korrupt. Womöglich würde man die Leichen, nachdem man sie geborgen hat, verschwinden lassen und versuchen, die Hintergründe zu vertuschen. Letztendlich würden man ihnen nur Schwierigkeiten machen, fürchteten sie. Während Steven in London wieder den Balkon betrat, um sich seinen fertig gemixten Drink zu verabreichen, eilte Derek noch einmal außerplanmäßig zur Tauchstation. Dort lieh er sich eine Ausrüstung und ließ sich aufs Meer hinausfahren, um noch einmal zum Wrack hinunterzutauchen. Ihm war eingefallen, dass das Werftschild, das an Bord jedes Schiffes im Umfeld der Brücke montiert ist, das beste Beweisstück wäre, wenn es darum ginge, die Identität zu ermitteln. Er wurde schnell fündig. Es hing über dem Trepppenaufgang, genau wie er es vermutet hatte und ließ sich in kürzester Zeit abmontieren. So benötigte er nur kurze Dekompressionspausen und war relativ schnell wieder zurück an Land. Michael wurde unsanft geweckt, als Derek den Raum betrat und hinter sich laut die Tür ins Schloss fallen ließ. Er war total verkatert. Sein ganzer Körper war verspannt und er hatte fürchterliche Kopfschmerzen. Hinzu kam ein enormer Durst. Während er sich langsam von seinem Bett erhob, starrte er wie hypnotisiert auf eine Flasche amerikanischen Bourbon, die vor ihm auf dem Fußboden stand. Er hatte sie sich am Vorabend in der Hotelbar besorgt und zur Hälfte ausgetrunken. Er hoffte, sich so entspannen und Abstand gewinnen zu können und war darüber eingeschlafen. Es half ihm jedoch nichts. Sein gestriges Erlebnis bei ihrem letzten Tauchgang hatte sich wie ein glühendes Eisen in sein Gedächtnis gebrannt und ihn nicht zur Ruhe kommen lassen. Wenn er geahnt hätte, wie er sich am Morgen danach fühlen würde, hätte er keinen Tropfen davon angerührt. Derek war verwundert, weil er Michael noch nie betrunken erlebt hatte. Für gewöhnlich mied er Alkohol, weil er ihn sowieso nur in geringen Mengen vertrug. Stattdessen wendete er sich gelegentlich verbotenen Substanzen wie Marihuana oder Dope zu. Meist auf Partys oder wenn er mit bestimmten Leuten zusammen war.
»Wie fühlst Du dich?«, fragte Derek besorgt und ließ sich in eine Sitzecke fallen, nachdem er Michael ein Glas kalte Milch aus dem Kühlschrank ans Bett gebracht hatte.
»Den Umständen entsprechend«, antwortete Michael und trank in hastigen Zügen. »Du hast sie nicht gesehen. Verstehst du. Du warst nicht dort drin«, sagte er in sich gekehrt, als wolle er sich für seinen Zustand rechtfertigen. Derek war im Nachhinein froh, dass er ihm nicht in den Ladetrakt gefolgt war. Er hatte die Aufnahmen einige Male auf seinem Laptop abgespielt und wusste, wovon Michael sprach. Was er auf seinem Bildschirm sah, schockierte ihn ebenso, er musste deshalb nicht unmittelbar vor Ort sein. Deshalb war er auch nur bestrebt, das Werftschild zu sichern. Den Ladetrakt hatte er bewusst gemieden, obwohl es der enge Zeitplan, den er sich auferlegte, noch zugelassen hätte. Dann holte er das polierte Messingschild aus einer Plastiktüte und warf es auf den Glastisch.
»Was ist das,« fragte Michael verdutzt.
»Das Werftschild,«
»Was ist ein Werftschild?«, hakte Michael nach.
»Der Fingerabdruck eines Schiffes, die Visitenkarte sozusagen. Nenn es, wie du willst. Ich war heute morgen noch einmal unten, während du noch geschlafen hast.«
»Was sagst du da? Du warst in dem Frachter, alleine und hast dir alles angesehen?«
»Nein, hab ich nicht! Ich bin noch einmal getaucht, um das Werftschild zu holen. Den Laderaum habe ich gemieden. Ich habe auch so gesehen, was du gesehen hast. Alles, was wir brauchen, steht hier drauf.« Dann griff er nach dem Schild und hielt es senkrecht auf dem Tisch. »Sieh her! Das Baujahr, Bauoder Code
Nummer der Werft und hier die Maße und sogar die PS-Zahl. Damit können wir herauszufinden, wem der Kahn gehört und was es mit den Toten auf sich hat.«
»Und das alles lernt man in der Navy?«
»Nein, mein Freund«, kam die Antwort lakonisch, wobei er versuchte absichtlich überheblich zu klingen. »Das... ist Allgemeinbildung«, worauf Michael zum Spaß die Augen verdrehte. Dann wurde er wieder ernst und sah Michael an, als sei er ihm etwas schuldig. »Das ist mein Beitrag, okay?«
»Sicher, ja, in Ordnung.«
»Was ist mit dem Zoll? Glaubst du, sie werden uns irgendwelche Fragen stellen?«
»Nein, werden sie nicht. Weil wir es hier lassen«, entgegnete Derek fest entschlossen. Auch ihm kamen ernsthafte Bedenken, dass sie vor dem Flug in Erklärungsnot geraten könnten, wenn die Zollbeamten ihr Gepäck durchsuchten.
»Du willst es erst gar nicht versuchen? Wir könnten es doch als Souvenir vom Trödelmarkt deklarieren. Oder ihnen weismachen, wir seien Spaßvögel und hätten das Tüv-Schild vom Swimmingpool mitgehen lassen, oder so etwas.«
»Und wenn es nicht funktioniert? Dann sitzen wir in der Klemme. Wenn wir Glück haben, ist nur das Schild futsch. Nicht das Blech ist entscheidend, sondern das, was draufsteht. Lass uns die Daten abschreiben und eine genaue Kopie machen. Wenn wir fertig sind, vergraben wir es in der Nähe der Tauchstation. Dort bleibt es uns für den Bedarfsfall erhalten. Das Wichtigste ist sowieso die Aufzeichnung.«
»Zu Befehl, Sir. Wie sie wollen. Und was sagt Steven zu der Sache?« Er wusste, dass Derek längst mit ihm telefoniert hatte, weil er es jeden Morgen tat.
»Steven ist sofort drauf angesprungen. Er plant wohl, eine Recherche darüber anzustellen und die Sache als Story zu verwerten. Du kennst ihn ja.«
‚Divers Ground’ gehört zu einem Konsortium unterschiedlichster Magazine. Die Büros liegen zum Teil im selben Gebäude. Man kennt sich untereinander und tauscht regelmäßig Informationen aus. Auch wenn die Hintergründe am Ende keine Story für ihr Tauchsportmagazin ergeben sollten, fände man vielleicht bei einem der anderen Blätter Verwendung dafür.
»Also gehen wir nicht direkt zur Polizei?«
»Nein. Dafür ist es noch zu früh. Wenn wir die Fakten zusammen haben und wissen was passiert ist, schalten wir Scotland Yard ein. Solange sollten wir den Mund halten.«
Sie ließen die letzten Minuten verstreichen, indem sie sich noch einmal ausstreckten und entspannten, während sie das Martyrium ihrer Langstreckenflüge näherrücken sahen. Es verging einige Zeit, bis wieder gesprochen wurde.
»Was meinst du? Glaubst du, dass man sie umgebracht hat?«
Derek ließ sich Zeit mit der Antwort. »Nun, zumindest glaube ich, dass sie nicht vorgehabt haben zu sterben. Entscheidend ist, dass sie aneinander gefesselt waren. Niemand tut so etwas selber oder lässt es freiwillig über sich ergehen. Ich glaube, dass man sie dazu gezwungen hat. Kann auch sein, dass man gar nicht vorhatte, sie zu töten. Vielleicht hatte man sie nur einfach ihrem Schicksal überlassen, als das Schiff sank.«
»Was ebenfalls einem Verbrechen gleichkommt.«
»So ist es. Wenn ich jemanden fessele, verhindere ich, dass er sich frei bewegen und sich im Notfall selber helfen kann. Weiter heißt das, dass ich dafür verantwortlich bin, wenn ihm etwas zustößt.«
»Also ist in jedem Fall jemand schuld an ihrem Tod.«
»Natürlich, zwangsläufig. Und ich glaube auch, dass sie nicht zur Mannschaft gehört haben. Ich habe noch nie von Frauen unter asiatischen Seeleuten gehört. Nur die Russen und andere ehemalige Ostblockstaaten führen auch weibliche Besatzungsmitglieder. Und wie wir ja wissen, war da noch... dieses Kind.« Derek atmete tief durch und stand nun auf, um sich etwas zu trinken zu holen. Michael spürte, dass auch er den Anblick des toten Jungen nicht ohne weiteres verdrängen konnte. Es war kurz vor zwölf, als sie ins Freie traten. »Oh, mein Gott!«, stieß Michael hervor. Schnell verbarg er seine Augen hinter einer Sonnenbrille. Er hatte den Eindruck, als würde die helle Mittagssonne in den hintersten Winkel seines vom Restalkohol gepeinigten Gehirns vordringen. Derek marschierte ein paar Meter vor ihm zwischen turmhohen Palmen auf einem mit Hölzern ausgelegten Weg entlang, in Richtung Hauptportal. Sein Gesicht war leicht angespannt. Er glaubte, sich noch eine Weile um Michael bemühen zu müssen und trug deshalb ihr gesamtes Gepäck am Körper. Als sie die Hotellobby betraten, begegneten sie noch einmal Mandy Wong. Mandy war eine äußerst attraktive Asiatin mit amerikanischem Pass und arbeitete an der Rezeption. Sie studierte Philosophie und Fremdsprachen an der Universität San Diego. Während der Semesterferien besuchte sie regelmäßig ihre wohlhabende Verwandtschaft in Hongkong, die auch Miteigentümer des Resorts war. Sie war bildhübsch und hatte schulterlanges Haar. Dazu war sie perfekt gebaut, was niemand übersehen konnte. Und Michael wäre der letzte gewesen, der es übersehen hätte. Als Hotelangestellte war es ihr verboten, sich mit den Gästen einzulassen. Doch für ihn war sie bereit, die Vorschriften zu ignorieren. Mit seinen schulterlangen blonden Locken, seinen azurblauen Augen und seiner leicht gebräunter Haut vermochte er stets einen bleibenden Eindruck beim weiblichen Geschlecht zu hinterlassen. Wegen seiner athletischen Figur und den oftmals vom Salzwasser verfilzten Haaren hielten sie ihn meistens für einen Profisurfer. So auch Mandy. Er musste überhaupt nichts tun. Wie die meisten kam sie von alleine auf ihn zu. Dass auch er Amerikaner war, machte die Sache noch leichter. Nach sieben Uhr hatte sie frei und schlich sich in seine Hütte. Beiden war jedoch klar, dass es nur ein Abenteuer sein würde. Mehr wollten sie nicht und jetzt war es eben vorbei. »Hat ihnen der Aufenthalt in unserem Resort gefallen, Mr. Burk?«, fragte Mandy mit einem breiten Lächeln und reckte ihren Kopf schnippig nach oben.
»Natürlich«, entgegnete Michael, »das Personal hier war besonders zuvorkommend.« Dabei zog er die Augenbrauen hoch und lächelte zurück. Sie sahen sich noch einmal an, während er auscheckte und noch ein paar Papiere unterschrieb. Ihr fiel sein verquollenes Gesicht auf, woraufhin sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. »Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Rückflug und hoffen, dass sie wieder unser Resort wählen, wenn sie hier Urlaub machen.« Ein paar offene Worte zum Abschied waren wegen der anderen Gäste, die mit ihm in der Reihe standen nicht möglich. Aber was sie sich hätten sagen wollen, verstanden sie auch durch ihre Blicke. Derek sah aus einiger Entfernung zu. Er hatte vor kurzem geheiratet und flüchtige Affären waren nicht sein Ding. Er hatte ohnehin nicht das Glück bei Frauen wie Michael, trotzdem empfand er keinerlei Neid. Beim Verlassen der Lounge packte er Michael fest am Arm. »Und ...hast du den Reis noch einmal so richtig zum Kochen gebracht? Ich meine, hast du es der kleinen Lotusblüte noch einmal richtig besorgt?« stichelte er von der Seite.
»Nein, sie hat es mir besorgt. Hast du etwa meine Hilferufe nicht gehört?«
»Ich hätte es wissen müssen. Es ist nur, weißt du, ich stelle mir gerade vor, wie du mit dieser kleinen, verdorbenen Pekingente die Drachenstellung...«
Michael musste zum ersten Mal an diesem Tag lachen. »Warum halten sie nicht einfach die Klappe, Lieutenant Coleman?« Ein kleiner weißer Bus mit offenen Fenstern stand draußen vor dem Hotel. Er hatte auf sie gewartet, Um sie zusammen mit anderen Touristen, die noch in den umliegenden Resorts abgeholt werden mussten, zum Flughafen zu bringen. Die Maschine würde sie zuerst nach Kuala Lumpur bringen. Und nach zwei Stunden Aufenthalt würde es weitergehen nach London und New York.
Kapitel 3
Die Frau, die vor ihm stand, war Asiatin. Sie schrie und flehte ihn an, ihr zu helfen. Ihr Gesicht war verweint und wie alle im Raum fürchtete sie, dass sie gleich sterben würde. Doch er konnte nicht. Er war genau wie sie mit dem Rücken an jemanden gefesselt und hatte schreckliche Angst. Sein Herz raste, sein Puls war extrem hoch und er glaubte, seinen Urin nicht mehr halten zu können. Alle im Raum waren aneinander gefesselt und durchlitten das Gleiche. Im Hintergrund ertönte die Stimme eines Kindes, das nach seinen Eltern rief. Zwei Gefesselte strauchelten in ihrer Verzweiflung unkoordiniert im Raum herum, rannten mal gegen diese Wand, mal gegen jene Wand. Andere fluchten laut in ihrer Panik. Sie verfluchten die, die ihnen das antaten. Dann ging das Licht aus und was jetzt noch zu vernehmen war, waren ihre Schreie. Schreie von Menschen, die nun gegen ihren Willen sterben sollten. Sie konnten sich nicht in ihr Schicksal fügen, weil sie es nicht verdient hatten. Im Getöse der einströmenden Wassermassen gingen ihre Schreie unter. Das Wasser war kalt. Es war Meerwasser, das von allen Seiten schäumend und spritzend anstieg und sie schon nach kurzer Zeit überflutete. Er atmete immer schneller, immer kräftiger, als könne er das, was nun folgen würde, dadurch abwenden. Noch einmal holte er tief Luft und hoffte, dass es schnell gehen würde. Eigentlich hätte er besser keinen Atemzug mehr getätigt, dann wäre es noch schneller gegangen. Das aber brachte er nicht fertig. Seine Reflexe waren dafür bestimmt zu überleben und nicht zu sterben. Gleich würde die Luft in seinen Lungen verbraucht sein und der Todeskampf begänne. Immer wieder würde sich sein Brustkorb ruckartig heben, Wasser statt Atemluft in die Lungen saugen und wieder ausstoßen. Bis sein Körper den Kampf gegen den qualvoll einsetzenden Tod aufgeben müsste und sein Bewusstsein für immer erlösche. Vielleicht würde er sein ganzes Leben noch einmal in einem dreidimensionalen Zeitraffer vor seinem geistigen Auge ablaufen sehen, wie es viele Menschen berichten, die dem Tod schon einmal nahe gewesen sind. Plötzlich spürte er, wie eine fremde Hand seinen Unterarm umschlang und ihn schüttelte. »Sie träumen, ....Sie haben einen Traum«, sagte eine sanfte, verständnisvolle Stimme und erlöste ihn so von seinem Qualen. Die vor ihm liegenden Sitzreihen sowie ein paar leer gegessene Plastikschalen samt Essbesteck auf seiner Ablage waren das, was Michael zuerst erblickte, als er die Augen wieder auftat. Er atmete tief ein und streckte seinen Rücken durch, während die Stewardess ihm half, den Sitz wieder aufrechtzustellen. Ihr war aufgefallen, dass er eingeschlafen war, aber keinesfalls gut geschlafen hatte. Er stöhnte ein paar Mal und drehte dabei ruckartig seinen Kopf hin und her. Als sie auf ihn aufmerksam wurde, entschied sie, ihn zu wecken, falls es ihm nicht bald besser gehen würde. »Ich danke Ihnen, haben Sie vielen Dank«, erwiderte er, während er mit einer Serviette seine feuchte Stirn abwischte. Neben ihm auf der anderen Seite des Ganges saß eine dicke Chinesin mit einer Baseballmütze, die ihn durch ihre Lesebrille mitleidvoll ansah.
»Alles in Ordnung, es geht mir gut... wirklich«, sagte er krampfhaft lächelnd. Er hatte die Nacht schon nicht gut geschlafen und das feuchte, heiße Klima in Malaysia sowie die lange Wartezeit zwischen den Flügen taten ihr Übriges. Nachdem er sein Essen eingenommen hatte, das ihm schon kurz nach dem Start serviert worden war, bekam er seinen ‚toten Punkt‘ und schlief ein. ,Es wird wohl noch eine Weile vergehen, bis ich mein Erlebnis ganz verarbeitet habe‘, wurde ihm im selben Moment bewusst.
Kapitel 4
Derek war über Asien Richtung Osten geflogen und war bereits in London angekommen. Michael flog auf der Westroute über den Pazifik und landete mit zehn minütiger Verspätung in New York. Es war vereinbart, dass er sich im Anschluss an ihren Trip eine fünftägige Auszeit gönnte. Eine große Feier zum siebzigjährigen Bestehen von ‚Burk & Cannon‘, der Anwaltskanzlei seines Vaters, stand an. Dazu natürlich jede Menge Gäste. Während des Anflugs auf den J.F. Kennedy Flughafen flogen die Piloten eine Kurve, so dass man durch den wolkenlosen Himmel die Skyline von Manhattan sehen konnte. Das Fehlen der Twin Towers trübte die Freude über den Anblick jedesmal erheblich. Beim Verlassen des Terminals war es stets dasselbe Ritual. Immer kam jemand auf ihn zu und bot ihm an, ihn in die Stadt oder sonstwohin zu fahren. Mit dem Privatwagen natürlich und für wenig Geld. Zuerst war es ein Schwarzer, dann ein Weißer und später noch zwei Typen mit Rastalocken, vermutlich aus der Karibik. »Ich möchte ein Taxi nehmen, haben Sie vielen Dank«, wiegelte er mit fester Stimme ab. Er war kein blauäugiger Tourist, sondern Amerikaner und wusste, worauf er sich einlassen konnte. Es war wie eine Erlösung, als er die Glastür aufstieß. Das Klima stand in krassem Widerspruch zu Malaysias feuchter Hitze. Es war trocken und die Nachmittagsluft hatte sich schon ein wenig abgekühlt. Das Taxi an erster Position war offiziell registriert. Erschöpft ließ er sich auf die Rücksitzbank des Fords fallen. »Ich muss zunächst auf die Fifth Avenue, in Höhe 49. Straße. Fahren Sie mich bitte durch Brooklyn über die Williamsburg Bridge nach Downtown Manhattan und von da aus die First Avenue, Richtung Norden. Dort warten Sie dann einen Moment. Die Fahrt geht anschließend weiter nach Long Island, einverstanden?«
Der Fahrer, ein Litauer, wie er ihm später noch offenbaren würde, freute sich aufrichtig, da sich das lange Warten für ihn diesmal gelohnt hatte. ‚Burk & Cannon’ war eine der größten und erfolgreichsten Anwaltskanzleien des Landes. Sein Urgroßvater, Jatzek Burkowsky, wanderte, aus der Gegend um Krakau stammend, vor hundert Jahren nach Amerika aus. Er verdiente sein Geld zunächst in den Rinderschlachthöfen von Chicago und zog dann während der Wirtschaftskrise in den zwanziger Jahren an die Ostküste, weil ihm dort ein Bekannter einen Job verschafft hatte. Sein Großvater erhielt in den dreißiger Jahren ein Stipendium für ein Jurastudium und gründete später mit einem seiner Kommilitonen die Kanzlei. Sein Partner Scott Cannon war es, der ihn damals dazu gedrängt hatte, seinen Namen auf ‚Burk’ zu vereinfachen. Sein Vater wiederum trat zur Freude seines Großvaters in seine Fußstapfen und stieg nach seinem Jurastudium als Juniorpartner ein. Gern hätten sie es gesehen, wenn auch Michael die Familientradition fortgesetzt und sich dazu gesellt hätte. Er hatte bereits Entgegenkommen signalisiert, indem er ein Jurastudium an einer Eliteuniversität absolviert hat. Aber das Ganze lag ihm nicht. Seine Leistungen waren eher mittelmäßig, außerdem konnte er sich nicht vorstellen, jemals als Anwalt zu arbeiten. Insgeheim hasste er Anwälte. Ihre Winkelzüge und Strategien hatten für ihn bestenfalls etwas mit Recht, jedoch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Er kannte das Geschäft von Haus auf und mehr als ein Geschäft war es für ihn auch nicht.
Es gab kein Schild am Eingang. Nichts deutete von außen darauf hin, das hier auf zwei Stockwerke verteilt die fünftgrößte Kanzlei der Stadt mit ihren sechzig Mitarbeitern untergebracht war. Michael wusste, welchen Klingelknopf er zu betätigen hatte und nach einiger Zeit schaltete jemand die Sprechanlage ein.
»Hey, hier ist Michael, Michael Burk«, sagte er, worauf die Eingangstür sofort summte und aufsprang.
»Michael, ich habe Sie lange nicht mehr gesehen«, sagte eine ebenso hellhäutige wie hagere Dame mit rot getöntem Haar zur Begrüßung, als er oben ankam. »Leben sie noch immer in Europa?« Es war Dorothee, eine langjährige Mitarbeiterin aus dem Büro, mit ihrer riesigen schwarzumrandeten Brille, die stets den Eindruck vermittelte, als würde sie das schmale Gesicht, das ihr sicheren Halt gewährte, erdrücken. Und von der er dachte, dass sie längst in Rente gegangen sei. »Wie geht es Ihnen?«
»Danke, es geht mir blendend«, antwortete er zuvorkommend.
Was hätte er sonst sagen sollen? Dass das Gegenteil der Fall war, weil er beim Tauchen in Südostasien zufällig eine Ansammlung von Toten entdeckt hat, gefesselt in einem Schiffsrumpf auf dem Grund des Ozeans?
»Sie sind alle zum Dinner. Heute ist Mittwoch«, erklärte sie ihm. Mittwochsnachmittags ging der gesamte Stab traditionsgemäß zum Dinner in eines der umliegenden Restaurants. Das hatte er vergessen. Er hatte versprochen, dass er kommen würde. Nur wann genau, hatte er nicht gesagt. Deshalb hatte sich auch niemand auf ihn eingestellt. Gut, dass er den Taxifahrer angewiesen hatte zu warten. Er wollte sich sowieso nicht lange in der Kanzlei aufhalten. Er hatte lediglich gehofft, flüchtig ein paar alte Gesichter zu erspähen. Er war erschöpft und hatte entschieden, sich nun auf direktem Weg nach Hause fahren zu lassen. Der schlechte Straßenbelag, über den das Yellow Cap mit seinen einfachen Blattfedern rumpelte, erinnerten ihn daran, dass er nicht in Europa, sondern in seiner Heimat New York gelandet war. Dennoch genoss er die Fahrt durch Queens, weiter in Richtung Osten, während er dabei gebannt aus dem Fenster sah. Er liebte London. Aber New York war für ihn noch immer die großartigste Stadt der Welt. Hier war er geboren worden, aufgewachsen und hier hatte er seine Jugend verbracht. Er war der Spross reicher Eltern, die ihm eine behütete Kindheit ermöglicht hatten. Weit weg von den sozialen Brennpunkten und fern ab der Kriminalität auf den Straßen. An den Schulen, die er besuchte hatte, gab es keine Gangs und auch keine Gewalt. Es wurde dunkel, als sie sich dem Familiensitz näherten. Trotzdem konnte er sehen, dass der weiße Zaun, der das Anwesen umgab, frisch gestrichen war. »Dort ist es. Halten Sie bitte rechts vor dem Tor«, sagte er durch die Trennscheibe. In den dreißiger Jahren erbaut und weitestgehend aus massivem Holz gefertigt, gehörte es zu den traditionellen Landhäusern, die in den Long Island Counties zu finden waren. Nur die äußeren Enden mit ihren großen Kaminen waren aus Stein gemauert. Die Wände waren zur Außenseite mit weißen Schindeln bedeckt, von denen sich moosgrüne Fensterläden abhoben. Wie die meisten Anwesen in der Gegend lag es weit zurückversetzt, umgeben von mächtigen Bäumen, deren herabfallendes Laub in den Herbstmonaten eine romantische Atmosphäre schuf. Auf einem Anbau war ein Wintergarten errichtet, von wo aus ein guter Ausblick auf das gesamte Grundstück und darüber hinaus gegeben war. Drinnen brannte Licht und es dauerte nicht lange, bis seine Mutter und seine Schwester, die seine Ankunft bemerkt hatten, auf das Taxi zugeeilt kamen. »Wie schön, dass du gekommen bist, mein Junge, wir alle haben uns schon so auf dich gefreut«, sagte seine Mutter freudig erregt. »Und wie gut du aussiehst, so braungebrannt, wie du bist.«
»Oh, ja, ein richtiger Mädchentyp«, ergänzte seine Schwester ironisch aus dem Hinterhalt. Er schloss sie beide in die Arme, drückte sie abwechselnd so fest er konnte.
»Dad hat vom Auto aus angerufen, als er losgefahren ist. Er wollte den Freeway nehmen und wird hoffentlich bald hier sein.« Sofort griffen sie sein Gepäck und brachten es ins Haus, während er das Taxi bezahlte. Sie hatten kein Personal. Trisha, seine Mutter, war Mitte vierzig und eine resolute Frau, die es ablehnte, sich bedienen zu lassen. Sie hatte ebenfalls studiert und früher als Anwältin gearbeitet. Seit sie die Kinder zur Welt brachte ging sie nicht mehr arbeiten und widmete sich ausschließlich ihrer Familie und dem Haus. Es bereitete ihr Freude, sich um alles selber zu kümmern. Lediglich die Fenster ließ sie einmal pro Woche putzen, seit sie vor ein paar Jahren von der Leiter gefallen war und sich zwei Rippen gebrochen hatte. Drinnen duftete es nach Apfelkuchen. »Oh, mein Gott, daran habt ihr tatsächlich gedacht«, stieß er freudig aus. Schon als Kind hätte er sich am liebsten nur von
warmem Apfelkuchen mit Schlagsahne ernährt.
»Wenn du schon einmal vorbeischaust, was äußerst selten vorkommt, dann sollst du dich auch wohlfühlen«, sagte seine Schwester.
»Höre ich da etwa einen Vorwurf heraus?«
Ellens Gesicht wurde plötzlich ernster, während sie sich umsah, um sicher zu gehen, dass sie im Augenblick alleine waren.
»Findest Du es tatsächlich in Ordnung ein einziges Mal in zwei Jahren deine Eltern zu besuchen? Du kennst Trishas Familiensinn und wie sehr sie dich vermisst, kannst du dir denken!«
»Hey, was soll das? Ich bin gerade fünf Minuten hier und wir streiten uns schon wieder. Ich lebe mein eigenes Leben, verstehst du? Und darauf bin ich stolz.«
»Niemand verbietet dir dein eigenes Leben zu führen. Aber bedenke, wer du bist und woher du kommst. Du musstest nicht wie Robert in das Rekrutierungsbüro am Times Square gehen und dich verpflichten, nur um studieren zu können.«
»Was sagst du da? Rob ist in die Army eingetreten?«
»Ja, im Herbst letzten Jahres. Nicht einmal das wusstest du. Und seit einem halben Jahr ist er im Irak. Aber an einer sicheren Stelle. Er hat dort irgendwie mir Logistik zu tun und sitzt an einem sicheren Ort, weit weg von Bagdad.«
»Oh, verdammt. Das habe ich nicht gewusst.«
»Und im Gegensatz zu dir schreibt er seinen Eltern regelmäßig. Du könntest wirklich mehr Respekt zeigen. Wenn du schon zu faul bist, Briefe zu schicken, könntest Du wenigstens ab und zu mal anrufen.«
Es war nur eine Frage der Zeit, bis er von Ellen seine erste Rüge erhielt. Von je her war sie so etwas wie sein schlechtes Gewissen. Der Fingerzeig auf all seine Eskapaden. Nie hätte sie es gewagt, den Erziehungsstil ihrer Eltern in Frage zu stellen. Trotzdem war sie der Überzeugung, dass eine striktere Gangart hier und da einen anständigeren Menschen aus ihm gemacht hätte. Insbesondere, was sein Verhältnis zum weiblichen Geschlecht anbelangt. Auch seiner Familie war es nicht entgangen, dass er bei Mädchen stets leichtes Spiel hatte. Darin mag der Grund liegen, warum er es nicht fertig brachte, sie auch ausreichend zu achten, was zumindest bei seiner Schwester regelmäßigen Unmut auslöste.
»Das werde ich, Helen. Ich verspreche es dir. Von nun an werde ich es tun«, versuchte er sie zu beschwichtigen. Seine Demutsgeste war nicht gespielt. Er war schockiert gewesen als er von Roberts Militärdienst erfahren hatte. Robert war ein Junge aus der Nachbarschaft, ebenfalls aus wohlhabenden Verhältnissen. Als Kinder spielten sie oft zusammen und gingen später auf dieselbe Highschool. Sein Vater war Textilfabrikant, doch vor sieben Jahren machte er mit seiner Firma Pleite. Seitdem besaßen die Tannas nichts mehr, außer einen Berg an Schulden, den sie vermutlich nie mehr loswürden. Da Roberts schulische Leistungen nicht für ein Stipendium reichten, jobbte er zunächst und beschloss dann, in die Army einzutreten. Als Gegenleistung würde ihm dann ein Studium gewährt. Insgeheim tat es Michaels Ego außerordentlich gut, ihnen so wichtig zu sein. Und so lange er hier war, würde er genügend Ablenkung haben. Er hatte nicht vor, über das, was er erlebt hatte, zu reden. Ebensowenig wollte er sie damit belasten. Sie hielten die Taucherei ohnehin für gefährlich und wenn sie erfuhren, was passiert war, würden sie erneut versuchen, ihn davon abzubringen. Er wollte seinen Aufenthalt genießen, die Anwesenheit inmitten der Familie, dazu gutes Essen sowie guter Wein und ausspannen. Vielleicht würde er in den nächsten Tagen ein Segelboot mieten, oder im Wald spazieren gehen. Aber ganz sicher würde er mit den Oldtimern herumfahren, die sein Vater in den umfunktionierten Pferdeställen auf dem Grundstück sammelte und aufbewahrte. Nach einigen Stücken vom noch ofenwarmen Apfelkuchen und ein paar Tassen starkem Kaffee war seine Müdigkeit verflogen. Und kurz darauf war die Familie komplett versammelt. Paul Burk war ein hoch gewachsener Mann. Er überragte seinen verstorbenen Vater, seine Kinder und seine Frau sowieso. Er ließ sein Sakko und den Aktenkoffer auf einer Anrichte zurück und eilte zu den anderen in die geräumige Küche. Burk wurde noch streng erzogen und gehörte nicht zu denen, die Menschen umarmen, noch wollte er selber umarmt werden. Ein fester Händedruck musste zur Begrüßung genügen, was nicht hieß, dass er seinen Sohn nicht ebenso liebte wie seine Frau es tat. »Schön, dich endlich wiederzusehen,« sagte er tief ausatmend. »Wie geht es dir, Sohn?« Seine hellblauen Augen strahlten vor Freude, dabei lächelte er erwartungsvoll.
»Gut, Dad. Mir geht es wirklich gut. Wie könnte es auch anders sein, wenn ich hier bei euch bin. Ihr seid schwer gealtert. Du und Mom habt eine Menge neuer Fältchen bekommen.«
»Pass bloß auf, du Spitzbube! Wo ist Derek? Hast du ihn nicht mitgebracht? Oder hätte es einer formellen Einladung bedurft?«, erkundigte er sich. »Er war doch noch nie in Amerika. Das hatte er doch gesagt als wir in London waren, ist es nicht so?« Dabei blickte er auf Trisha und seine Tochter.
»Derek hat einen wichtigen Job zu machen. Es reicht schon, dass ich nicht mit zurückgeflogen bin. Außerdem hat er doch geheiratet, ihr wisst schon.«
»Was ist mit diesem Mädchen aus London?«, wollte seine Mutter wissen. «Seid ihr noch zusammen? Du hast noch gar nichts von ihr erzählt. Wie war doch gleich ihr Name?«
»Nun, sie hieß Sally, aber wir sind nicht mehr zusammen. Wir haben uns äh… auseinander gelebt«.
»Und wie hieß die andere noch gleich?«, kam es jetzt von Ellen.
»Welche andere?«, fragte Michael verdutzt.
»Na die, mit der sie dich erwischt hat!«
»Hört zu! So war das nicht, ...ich schwör’s euch!«, erwiderte Michael und sah dabei angestrengt in die Runde. Keiner von ihnen konnte sich ein hämisches Grinsen verkneifen. »Was ist mit James Cameron?«, fragte Paul Burk, um seinem Sohn Weiteres zu ersparen.
»David Cameron, Dad. James Cameron ist der Regisseur von
,Titanic‘. Der jetzige Premier heißt David.«
»Auch gut. Und, wird er es demnächst noch einmal schaffen?«
»Hat er nicht schon seine zweite Amtszeit?«, redete Trisha dazwischen.
»Nein«, antwortete Michael. »In Europa ist das meist egal. Das Regieren ist dort nicht auf zwei Perioden wie bei uns beschränkt.«
»Was ist aus Tony Blair geworden?«, fuhr Ellen fort. Den fand ich total cool. Ist der jetzt wieder mit seiner Band zusammen?«
»Sie hat Recht«, kam von Michael die Rettung. »Blair spielte während seiner Studienzeit in Schottland in einer Band. Sie nannten sich ,Ugly Rumuors‘. Blair trug tatsächlich lange Haare, aber man warf ihm vor, immer nur Mick Jagger von den Stones zu imitieren.«
»Was trägst du da um den Hals? Ein Souvenir aus dem fernen Osten?«, wollte Paul Burk wissen und deutet auf die Kette.
»So was ähnliches. Ich habe es am Strand gefunden. Aber nun ist es schon kaputt. Ich glaube, es ist ein Drachen«, sagte Michael und holte es unter seinem Shirt hervor.
»Es könnte aber auch ein Seepferdchen sein«, entgegnete Trisha von der Seite.
»Es ist ein Drache, ganz sicher«, beendete Paul Burk die Begutachtung.
Dann war es soweit. Trisha holte nun ihren herzhaft duftenden Braten aus dem Ofen und das Begrüßungsdinner konnte beginnen. Sie aßen lange und saßen noch bis spät in die Nacht hinein zusammen. Dabei redeten sie über Europa, seinen Job in London, von Derek und immer wieder von Europa.
Kapitel 5
»Bitte den Führerschein und die Zulassung!«, sagte der Officer ebenso freundlich wie bestimmend. Weil zum Segeln nicht genug Wind wehte und er sich zum Wandern im Wald nicht überreden konnte, hatte er einen Buick ‚Master’, Baujahr 1927, aus Dad´s Sammlung genommen und war damit in die Stadt gefahren. Dort fuhr er den Broadway runter bis zum Union Square und dann die Park Avenue wieder Richtung Norden, einfach so. Nähe Central Park, Ecke 63. Straße hatte er sich bei ‚Livingston’ einen neuen Smoking für die Feier gekauft. Seinen alten hatte er in London gelassen. Weil er unregelmäßig aß, seit er nicht mehr zu Hause wohnte, hatte er abgenommen. Deshalb passte er ihm nicht mehr, außerdem hatte er ihn nie getragen. Auf dem Rückweg von Manhattan nahm er die Stadtautobahn und behinderte geringfügig den Verkehr. Nicht, dass er nicht genug Tempo machte. Er beschleunigte nur nicht schnell genug. Eine Polizeistreife wurde auf ihn aufmerksam und zwang ihn zum Anhalten. Dass die Papiere in Ordnung waren, wie ihm über Funk gemeldet wurde, wunderte den Mann in Uniform keineswegs. Er hatte ihn ohnehin nur angehalten, um sich das Prachtstück näher ansehen zu können. Er sah sofort, dass der Wagen nicht restauriert war, sondern sich noch immer im Originalzustand befand, was äußerst selten ist. »Würden sie bitte die Haube öffnen«, forderte er ihn desweiteren auf.
»Ich möchte mich vergewissern, ob auch alles in Ordnung ist, wegen des hohen Alters, verstehen sie?«
»Sie dürfen sich sogar reinsetzen, Sir, wenn Sie möchten.« Daraufhin fühlte sich der Polizist entlarvt und beendete sein
Spiel. Was nun folgte, war eine zwanzig minütige Fachsimpelei, die damit begann, dass auch er ein altes Auto, einen 48er Buick
‚Roadmaster’, in der Garage hatte, dessen Restaurierung eine Menge Geld verschlungen und ihn beinahe die Scheidung gekostet hatte.





























