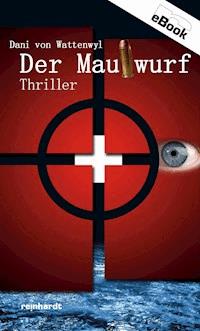
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reinhardt, Friedrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Denis Benz
- Sprache: Deutsch
Denis Benz ist ein junger, mässig erfolgreicher Schauspieler von 30 Jahren. Der Umstand, dass er aus einer gutbetuchten Berner Familie stammt, lässt ihn grosszügig über seine berufliche Mittelmässigkeit hinwegsehen. Eines Morgens erhält er einen Telefonanruf, der sein Leben komplett verändern wird: Der Schweizer Geheimdienst meldet sich bei ihm. Denis Benz soll auf einer Kreuzfahrt Informationen über Ramon Vasquez einholen. Der Argentinier wird verdächtigt, in grossen Mengen Kokain zu schmuggeln. Auch ein Schweizer soll in seinem kriminellen Kartell auf oberster Ebene kräftig mitmischen. Das Pikante daran: Der Verdächtige ist ausgerechnet der Sohn eines Bundesrates. Denis Benz nimmt den Auftrag an. Doch schon bald entpuppt sich die harmlose Kreuzfahrt als sein persönlicher Albtraum: Juan Fuentes, ein Profikiller und Vasquez' rechte Hand, lässt keine Gelegenheit ungenutzt, Denis unerbittlich zu jagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dani von Wattenwyl
Der Maulwurf
Thriller
Alle Rechte vorbehalten© 2013 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel© eBook 2014 Friedrich Reinhardt Verlag, BaselLektorat: Beatrice RubinUmschlaggestaltung: Joël JiraISBN 978-3-7245-2033-7
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-1931-7Ungekürzte Taschenbuchausgabe 2013
www.reinhardt.ch
Als stolzer, dreifacher Patenonkel möchte ich dieses Buch meinen Patenkindern Nina, Nils und Mikka widmen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7: 1. Tag, Barcelona, 08:30, Ankunft Vasquez
Kapitel 8: 1. Tag, Barcelona, 12:30, Ankunft Denis Benz
Kapitel 9: 2. Tag, Formentera, 11:00, Auftrag Juan
Kapitel 10: 2. Tag, Formentera, 16:32, Denis’ Rückkehr
Kapitel 11: 3. Tag, Bern, 09:14, PRIOS unter Druck
Kapitel 12: 3. Tag, auf See, 20:32, Denis sucht Kontakt
Kapitel 13: 4. Tag, auf See, 09:41, Juan und Kommissar Zufall
Kapitel 14: 4. Tag, auf See, 21:47, Denis’ Mitternachtsausflug
Kapitel 15: 5. Tag, Büro PRIOS, 16:22, Pascal Webers Gedankenblitz
Kapitel 16: 6. Tag, auf See, 06:30, Denis Benz ist auf sich alleine gestellt
Kapitel 17: 6. Tag, Bundeshaus, 09:39, Glück und Leid sind nahe beieinander
Kapitel 18: 6. Tag, auf hoher See, 15:12, «La Mano» greift durch
Kapitel 19: 6. Tag, auf hoher See, 17:32, Denis gefangen auf hoher See
Kapitel 20: 7. Tag, Hafen von Lissabon, 04:12, Schiff in Not
Kapitel 21: 8. Tag, Büro PRIOS, 08:52, Weber entlarvt den Verräter
Kapitel 22: 9. Tag, Wohnung von Denis Benz, 09:58, Denis zurück in Bern
Dank
Über den Autor
Dani von Wattenwyl im Friedrich Reinhardt Verlag
Kapitel 1
Denis Benz wurde jäh aus dem Schlaf gerissen. Das Telefon klingelte unentwegt in der immer gleichen, nervenden Tonabfolge.
Ich muss diesen beschissenen Klingelton endlich einmal ändern!
Denis griff mit noch geschlossenen Augen zum Hörer seines schnurlosen Telefons. Nachdem er sich von der Kante des Nachttisches über seinen Radiowecker bis zum Telefon herangetastet hatte, richtete er sich mit einem Stöhnen im Bett auf. Er drückte auf die grüne Taste mit dem Telefonsymbol und nahm das Gespräch gereizt entgegen.
«Hallo?»
«Denis? Bist du noch nicht wach? Dein Leben möchte ich mal haben!»
«Was gibts?» Denis erkannte die Stimme sofort. Es war Marc Steiger, sein Manager.
«Was gibts? Du weisst genau, was es gibt! Ich habe gerade mit Pegasus telefoniert!» Marcs Stimme klang vorwurfsvoll. Pegasus war eine über die Landesgrenzen bekannte Filmproduktionsfirma, die sich vor allem auf Werbespots spezialisiert hatte.
Denis fuhr sich genervt durch das Haar.
«Ja ich weiss. Es lief halt nicht so gut gestern.»
«Nicht so gut? Ich sag dir mal, was nicht gut ist: deine Einstellung! Weisst du, wie viel Überredungskunst es mich gekostet hat, dich in diesen Spot zu bringen?»
«Es ging ja nur um Hundefutter!»
«Nur um Hundefutter? Siehst du, genau da liegt dein Problem! Mit dieser Einstellung wirst du es nie schaffen!»
Denis hörte deutlich, wie Marc mit seinem Kugelschreiber auf den Schreibtisch hämmerte. Ein sicheres Zeichen dafür, dass sein Manager ausser sich vor Wut war. Marc setzte nach.
«Was war denn das Problem?»
«Das hat dir doch sicher schon längst dieser Regisseur und Oscarpreisträger für Hundekuchen erzählt», antwortete Denis mürrisch.
«Ich möchte aber deine Version hören!»
«Nun ja, es war eigentlich keine grosse Sache. Ich musste halt dastehen, einen netten Satz über diesen Hundefrass sagen und anschliessend diesen klebrigen Keks dem Tier zum Fressen geben.»
«Und war das so schwierig?»
«Nein, schwierig war es nicht, aber …» Denis legte eine kurze Pause ein. Er wusste, dass er sich auf dünnem Eis bewegte.
«Aber was …?» Marc schnaubte hörbar.
«… aber, du weisst doch, dass ich so meine Probleme mit Hunden habe! Ich hatte immer Angst, dieser fiese Kläffer beisst mir in die Hand.»
«Warum denn in die Hand?»
«Weil dieser Starregisseur meinte, der Hund müsse mir den Keks aus der Hand fressen!»
«Entschuldige meine Neugier, Denis, aber ich verstehe immer noch nicht, wo das Problem liegt.»
«Jedesmal wenn ich meinen Satz gesagt hatte, liess ich aus Angst den Keks aus meiner Hand fallen, kurz bevor dieses Biest zuschnappen konnte.»
«Kann es denn so schwierig sein, einem Hund einen Keks zu geben? War es eine bissige Deutsche Dogge oder was?»
«Nein, es war, glaube ich, so eine Art Terrier mit struppigem Fell. Er hatte aber diesen fiesen Blick drauf …» Die Stimme von Denis wurde leiser, er kam sich gerade ziemlich dumm und feige vor.
«Ein Terrier?» Marc konnte es kaum fassen. «Das sind doch diese ganz kleinen Hunde, die nicht mal grösser als meine Katze sind! Und du hast Schiss vor einem solch kleinen Vieh?»
Denis sah sich gezwungen, seine Ehre zu verteidigen.
«Nicht Schiss! Ich hatte einfach Respekt! Zudem hat mich der Hund ständig angebellt.»
«Und darum kläffst du das Tier an? Aus Respekt?»
«Ich habe es nicht angekläfft … Ich habe nur versucht, mit diesem Hund auf einer Ebene zu kommunizieren.»
«Bist du wahnsinnig? Du hast den Hund mit deiner Bellerei total verängstigt! Weisst du eigentlich, was so ein dressierter Hund pro Tag kostet? Den hat Pegasus extra aus Hollywood einfliegen lassen. Von dem Geld, das du da in den Sand gesetzt hast, könntest du eine ganze Woche sorglos leben!»
«Es war ja nicht so schlimm, keine grosse Sache!» Denis wurde es langsam peinlich.
«Warum hast du denn das arme Tier so gequält?»
«Mein Gott, ich habe es nicht gequält. Da ich immer diesen Keks fallen liess und der Hund ihn trotzdem genüsslich gefressen hat, war er nach der dreizehnten Wiederholung einfach nicht mehr hungrig.»
Marc klopfte immer lauter mit seinem Stift auf den Tisch.
«Und darum hast du den Hund doof angemacht? Wirklich sehr erwachsen, Denis.»
«Na ja …» Denis suchte nach passenden Worten. «Als ich es endlich geschafft hatte, ihm diesen Keks hinzuhalten, ohne ihn vorher fallen zu lassen, der Hund ihn aber nicht mehr fressen wollte, war ich halt etwas frustriert und da habe ich kurz die Beherrschung verloren.»
«Scheisse, Denis! So geht es nicht! Ich reisse mir hier den Arsch für dich auf, setze meinen guten Ruf für dich aufs Spiel und du dankst es mir so!»
Nun fühlte sich Denis endgültig schuldig.
«Es tut mir ja leid, soll nicht wieder vorkommen!»
«Das will ich doch hoffen, Scheisse nochmal!»
Denis bemerkte, wie Marc mit dem Klopfen aufhörte, das war meistens ein gutes Zeichen. Marc atmete aus, um sich zu beruhigen und fuhr mit einer gefassteren Stimme fort.
«Also, dieser Auftrag ging flöten. Erwarte bloss keine Bezahlung von mir.»
Denis war erleichtert. Er wusste, dass dieser Vorfall in ein paar Stunden vergessen war.
«Alles klar und vielen Dank für deine Geduld mit mir!»
«Schon okay, aber von nun an werde ich dich von meiner Katze fernhalten, wenn du zu Besuch kommst, du Tierquäler!» Marc konnte ein Lachen nicht unterdrücken.
«Kein Problem, deiner Katze muss ich ja auch keinen Keks hinhalten!»
«Also, tschüss Denis. Ich melde mich, wenn ich wieder was für dich habe.»
«Das ist lieb von dir, tschüss.»
Mit einem Schmunzeln beendete Denis das Gespräch.
Eigentlich war Marc mehr als nur sein Manager. Über all die Jahre der Betreuung entstand so etwas wie eine Freundschaft zwischen den beiden. Schon beim ersten Treffen in der damals noch improvisierten Agentur von Marc waren sie sich sympathisch gewesen. Nicht nur, weil sie dasselbe Alter hatten, sondern auch weil sie beide das gleiche Ziel verfolgten. Sie wollten sich in der schwierigen Welt des Showbusiness durchsetzen und Erfolg haben. Denis vor der Linse und Marc hinter der Kamera. Bei Marc hatte es geklappt. Seine Agentur «Creativ» musste jedes Jahr mehr Mitarbeiter beschäftigen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Inzwischen war sie die erfolgreichste Künstlervermittlung des Landes und Marc Steiger war Chef über ein Team von einunddreissig Angestellten. Jeder Schauspieler des Landes, der etwas auf sich hielt, wollte in seine Kartei und Marc liess sich diesen Umstand fürstlich bezahlen. Es gab kein Filmprojekt, kein Musical oder Theaterstück, ohne dass die Agentur «Creativ» ihre Finger mit im Spiel hatte.
Manchmal fragte sich Denis, wie lange es noch gehen würde, bis ihn Marc aus seiner Agentur werfen würde, denn er war zweifellos der erfolgloseste Legionär in seiner Datenbank. Wahrscheinlich war er nur noch dabei, weil Marc an das Talent von Denis glaubte, und es ihm wichtig war, als Gewinnertyp mit dem richtigen Riecher für Talente wahrgenommen zu werden. Würde er Denis kündigen, käme das wohl einem Versagen Marcs gleich. Zudem hatte Denis schon lange bemerkt, dass Marc eine spezielle Begeisterung für ihn aufbrachte, weil er aus einer einflussreichen und bekannten Familie stammte. Da Marc aus ärmlichen Verhältnissen kam, sah er in Denis so etwas wie eine Eintrittskarte in die erlesene Gesellschaft. Es kam öfters vor, dass Denis seinen Freund an exklusive Anlässe mitnahm.
Denis rieb sich nach diesem aufreibenden Gespräch die Augen und nahm sich noch einen Moment Zeit, um wach zu werden. Er liess seinen Blick durch das Zimmer gleiten. Seine Wohnung war sein ganzer Stolz. Seit zwei Jahren wohnte er nun in dieser Dreizimmerwohnung im Herzen von Bern. Sie lag direkt beim Bundesplatz, im ersten Stock, mit grosszügigem Balkon. Die Aussicht auf das Bundeshaus mit den Alpen im Hintergrund gab es gratis dazu. Wobei, was hiess schon gratis? Es war ein offenes Geheimnis, dass Wohnungen an solcher Lage eine ganze Stange Geld kosteten. Er machte sich nie etwas vor. Er war ein mässig erfolgreicher, dreissigjähriger Schauspieler. Trotz solider vierjähriger Ausbildung an der Berner Schauspielakademie blieb die grosse Hauptrolle aus. Zwar spielte er immer wieder mal an mehr oder weniger bekannten Theatern der Stadt, doch richtig leben konnte er von seinem erlernten Beruf nicht. Denis war jedoch ein krankhafter Optimist: «Irgendwann einmal wird mein besonderes Talent entdeckt!», war einer seiner Leitsätze.
Er war zufrieden mit seinem Leben. Er wohnte in einer hundertzwanzig Quadratmeter grossen und stilvoll ausgestatteten Wohnung. Er verfügte über ein gutes Auge für schöne Möbel und so überraschten die bunten, gut arrangierten Designerstücke in seinem Zuhause niemanden. Oft bekam er Komplimente von seinen Freunden für seinen guten Geschmack. «Du bist ein Ästhet!» war die bislang schmeichelhafteste Äusserung über seine Wohnung. Eine ehemalige Freundin von ihm hatte das einmal gesagt.
Nur von seinen Engagements hätte Denis sich diese Wohnung nicht leisten können, aber er hatte den Vorteil, aus einer gut betuchten und einflussreichen Familie zu stammen. Zudem war er ein Einzelkind. Sein Vater, Paul Benz, ein erfolgreicher und mächtiger Anwalt der Stadt, unterstützte ihn immer wieder mit grosszügigen Zuschüssen. Er tat das nur widerwillig, denn wenn es nach den Vorstellungen seines Vaters gegangen wäre, hätte Denis nach erfolgreichem Jurastudium und einigen Auslandaufenthalten die florierende Familienkanzlei übernehmen sollen. «Benz & Sohn» hatte ihm sein Vater immer wieder stolz vorgeschwärmt und ihm mit einem glücklichen Strahlen noch einen anerkennenden Klaps auf die Schulter gegeben. Doch Denis wollte die Familientradition nicht fortführen. Er fühlte schon immer eine kreative Kraft in sich. Als er eines Abends allen Mut zusammennahm, um zu beichten, er wolle nicht Jura studieren, war sein Vater sehr enttäuscht. Diese Enttäuschung war auch für Denis schwer zu ertragen. Noch heute versetzte es ihm einen Stich, wenn er an den besagten Abend zurückdachte. Trotzdem war Denis immer noch stolz darauf, den Mut aufgebracht zu haben, seinem Vater die Stirn zu bieten. Seine Pläne, Schauspieler zu werden, tat sein Vater als Phase, als Rebellion ab. «Er wird schon wieder zur Vernunft kommen!», hörte er seinen Vater oft sagen. Jedes Mal, wenn dieser Satz fiel, wussten sie beide, dass es wohl mehr mit väterlicher Verdrängung als mit väterlicher Intuition zu tun hatte. Erst als Denis tatsächlich an der Schauspielakademie Bern aufgenommen wurde, fand sich sein Vater damit ab.
Ganz anders seine Mutter, Manuela Benz. Sie war stets um sein Wohlergehen besorgt. Oft musste Denis seine Wünsche nicht einmal äussern, seine Mutter hatte sie ihm einfach erfüllt. Trotzdem konnte sie auch streng sein, denn bei aller Liebe zu ihm stand eine gute Erziehung immer im Zentrum ihres Lebens. Sie war es auch, die ihn von Anfang an bei seinem Wunsch, Schauspieler zu werden, unterstützt hatte. Dies tat sie auch heute noch und es war kein Geheimnis, dass Denis die Unterstützung der Eltern seiner Mutter zu verdanken hatte.
Denis rieb sich nochmal die verschlafenen Augen, gähnte ausgiebig und quälte sich aus dem breiten Designerbett. Er war kein Morgenmensch. Nach einem kurzen Blick auf seine teure ORIS Pro Diver, ein Geburtstagsgeschenk seiner Eltern, stellte er fest, dass es bereits halb elf war. Mit Schwung sprang er aus dem Bett. Nur mit T-Shirt und Boxershorts bekleidet, ging er über den lackierten Parkettboden quer durch sein Schlafzimmer, vorbei an einem grossen Spiegel, einem orangenen und einem gelben Designerstuhl, dem Kleiderschrank in Übergrösse und einer Stehlampe. Ein grosses Bild an der Wand gegenüber des Balkonfensters war bereits von der Sonne hell erleuchtet und unterstrich in vielen schrillen Farbtönen seinen Hang zum Aussergewöhnlichen. Die Wände waren, wie bei vielen Altbauwohnungen, sehr hoch. Denis gefiel diese Bauweise. Er mochte es grosszügig und darum hing von der Schlafzimmerdecke ein mächtiger Kronleuchter mit viel Glitzerzeug herunter.
Er gähnte noch zwei Mal, bevor er das Badezimmer erreichte. Es war schwarz. Schwarze Fliesen, schwarze Wanne, schwarze Schränke. Er mochte diese Farbe, doch sein Hang zum Ausgefallenen hatte sich im Nachhinein gerächt. Schwarze Keramik und Wasser vertrugen sich nicht gut, wie er schon nach der ersten Dusche im neu renovierten Bad feststellen musste. Nach jedem Duschgang waren überall weisse Kalkflecken zu sehen. Man hatte ihn schon vor der Renovation gewarnt, doch Denis wollte nicht hören. Er wollte Schwarz und er bekam Schwarz. Er hatte einen Dickschädel, wenn es um seine Ideen ging. Den Umstand, dass sein Bad nun jeden zweiten Tag gereinigt werden musste, nahm er in Kauf. Das machte sowieso die Putzfrau, die ihm seine Mutter besorgt hatte.
Siehst du heute scheisse aus! Seine blauen Augen wirkten müde und sein dichtes braunes Haar wucherte wild auf seinem Kopf. Denis nahm sich noch ein paar Momente vor dem Spiegel, um sich zu betrachten. Er tat dies gerne, denn meistens gefiel er sich – an diesem Morgen jedoch nicht. Er hatte schlecht geschlafen. Seine Freundin Kim hatte vor zwei Tagen mit ihm Schluss gemacht. Eigentlich keine grosse Sache, denn dank seines guten Aussehens hatte er schon viele Freundinnen gehabt und die Beziehung zu Kim dauerte erst zwei Monate. Trotzdem hatte es ihn getroffen, als sie sich von ihm löste. Zum ersten Mal empfand Denis mehr für eine Frau als nur diesen oberflächlichen Reiz wie bei seinen vergangenen Beziehungen. Das dachte er zumindest. Vielleicht liess er sich aber gefühlsmässig einfach in die Ecke drängen, weil sie die Beziehung beendet hatte und nicht er. Das ging gegen seinen Stolz.
Nach der Morgentoilette ging er pfeifend zurück ins Schlafzimmer zu seinem Kleiderschrank, nahm sich eine Jeans, ein weisses Hemd, frische Socken und einen breiten Ledergürtel mit auffälliger Schnalle heraus, zog sich an und ging in die Küche. Er hatte das Parfüm «Armani Gio» aufgetragen. Denis mochte diesen frischen Sommerduft an sich. Er roch gerne gut, was ihn oft dazu veranlasste, einen Spritzer zu viel zu verwenden. Denis holte noch schnell die Zeitung, die bereits frühmorgens in den Briefschlitz gesteckt wurde. Auch das gefiel ihm an seiner Altbauwohnung. Seine Post wurde bis zur Haustür gebracht. Er hatte diesen Türservice nur dem Umstand zu verdanken, dass sein Haus denkmalgeschützt war und das Anbringen von Briefkästen im Hausflur unten von der Stadt nicht bewilligt worden war. Zum Leidwesen des Briefträgers, der nun die gesamte Post von Tür zu Tür bringen musste.
Als Denis die Zeitung vom Boden genommen hatte, ging er in die Küche. Er nahm eine Nespresso-Kapsel aus dem gläsernen Gefäss neben der Kaffeemaschine und steckte sie in die dafür vorgesehene Öffnung. Er bewegte den Hebel, der die Kapsel in die richtige Position rückte, stellte eine Tasse darunter und betätigte den grün leuchtenden Knopf an der Maschine. Das Gerät fing leise an zu surren und einen Augenblick später, nach einem kurzen Luftstoss, floss der Kaffee in die Tasse. Der frische Kaffeeduft liess ihn die Sorgen mit Kim und die Auseinandersetzung mit Marc vergessen.
Mit der vollen Tasse und der Zeitung ging er ins Wohnzimmer. Er hatte bei seinem Einzug die Wand, die das Esszimmer und das Wohnzimmer getrennt hatte, kurzerhand rausreissen lassen, sodass er nun einen riesigen Raum, eine Art Loft, hatte. Er setzte sich an den langen Esstisch aus Nussbaumholz. Sechs Stühle aus demselben Material mit Lederbezug standen um den Tisch und ein weiterer Kronleuchter, im gleichen Stil wie im Schlafzimmer, rundete das Gesamtbild ab.
Denis blätterte sich wie immer lustlos durch die «Berner Zeitung». Eigentlich hatte er sie nur abonniert, um sich selber das Gefühl zu geben, wenigstens etwas am aktuellen Tagesgeschehen dieser Welt teilzunehmen. Doch es kam öfters vor, dass er die Zeitung durchblätterte und sie, ohne einen Bericht zu lesen, wieder weglegte. Nur wenn ihn eine Schlagzeile ansprach und die Bilder dazu stimmten, begann er zu lesen. Dies kam aber äusserst selten vor. Meistens hatte er die Zeitung innert kürzester Zeit durchgeblättert und wieder weggelegt. Er schaute zum Balkonfenster hinaus. Auch von diesem Raum konnte man auf den Balkon gelangen. Die Terrasse vom Schlafzimmer verlief über die Ecke bis zum Wohnraum. Er mochte diese Aussicht. Oft sass er einfach nur an diesem Tisch und liess den Blick durch den hellen Raum gleiten. Dank einer breiten Fensterfront mit drei grossen geschwungenen, aneinandergereihten Altbaufenstern mit Doppelflügeltüren hatte er praktisch den ganzen Tag Sonne.
Zufrieden hielt sein Blick einen Moment bei dem Bild an der Seitenwand inne. Er hatte es auf einem Markt in Belgien entdeckt. Die Frau lag nackt mit dem Rücken zum Betrachter auf einem roten Sofa, umgeben von grossen farbigen Blumen und einem stahlblauen Himmel. Denis hatte sich sofort in den Hintern der Frau verliebt.
«So muss eine Frau gebaut sein!», pflegte er seinem männlichen Besuch zu sagen. Manchmal sagte er es auch zu Frauen, doch meistens wurde dies wenig geschätzt. Eigentlich äusserte er diesen Spruch einer Frau gegenüber nur dann, wenn ihm sein Gast zu langweilig wurde. So entstand wenigstens ein spannendes Gespräch über innere und äussere Werte. Ein leichtes Schmunzeln huschte Denis über die Lippen. Sein Blick streifte noch kurz die weisse Ledersitzreihe mit dem Flachbildfernseher an der Wand, bevor er auf den Balkon ging.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, und obwohl es noch nicht ganz Mittag war, herrschte bereits reges Treiben in der Stadt. Denis’ Terrasse ragte zur einen Hälfte über den Bärenplatz und zur anderen Hälfte über den Bundesplatz. Die Lage hatte ihn immer fasziniert, auf der einen Seite der Bärenplatz, der wegen seiner vielen gemütlichen Cafés ein Treffpunkt für Jugendliche und Junggebliebene war, auf der anderen Seite der Bundesplatz, ein historischer Ort, geschmückt mit einem lustigen, in den Boden eingebauten Brunnen, der immer wieder überraschend und unkoordiniert Wasserfontänen in die Höhe spritzte. Von seinem Balkon aus konnte er immer die Seite beobachten, auf die er gerade Lust hatte.
Heute wollte Denis Trubel und Leben, also Bärenplatzseite. Er lehnte sich über die Brüstung und schaute auf die Menge herunter. Es herrschte bereits viel Betrieb vor und in den Cafés. Alle hatten wegen des guten Wetters die Stühle und Tische bereits in ihren Sektoren auf dem Platz aufgestellt. Die Menschen besetzten jeden frei gewordenen Platz sofort wieder, um bei einem Espresso oder Mineralwasser die herrliche Sommersonne zu geniessen. Denis schaute gerne von oben zu. Da selten jemand nach oben blickte, konnte er so manch interessante Unterhaltung oder intime Situation unentdeckt beobachten. Kellner hetzten mit ihren Getränken und Kuchen gekonnt durch die engen Stuhl- und Tischreihen, Mütter unterhielten sich lautstark über neue Modetrends, während sie ihr Frischgeborenes im Kinderwagen in den Schlaf wiegten, Touristen fotografierten sogar noch im Sitzen alles, was es ihnen wert war, mit einem Bild daran erinnert zu werden.
An einem Tisch ganz in der Nähe von Denis’ Balkon gaben zwei junge, wahrscheinlich noch frisch verliebte Menschen ihren Gefühlen freien Lauf. Sie knutschten und fummelten, als ob sie alleine auf dem Platz wären. Denis beobachtete die beiden eine Weile lang und musste wieder an Kim denken. Die langen, gewellten Haare der Frau erinnerten ihn an Kim. Von hier oben sah sie ihr verdammt ähnlich. Was, wenn sie schon einen Neuen hat? Oder noch viel schlimmer: Was, wenn dieser Typ der Grund für die Trennung ist? Er verdrängte die aufkeimende Verzweiflung gleich wieder. Keine Frau ist es wert zu leiden! Es schien aber nicht so richtig zu funktionieren.
Wegen der Hitze hatte Denis die Ärmel inzwischen hochgekrempelt und die Sonne schien heiss auf seine Arme. Lässig aufgestützt, wandte er sein Gesicht der Sonne zu, um es zu bräunen. Die wohlige Wärme liess ihn auf andere Gedanken kommen. Plötzlich wurde er wieder durch einen Klingelton aus seiner Entspannung gerissen. War es sein Handy? Nach genauerem Hinhören stellte er fest, dass es sich um seinen Festnetzanschluss handelte. Idiot! beschimpfte er sich mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Der Klingelton seines Handys war nämlich unverkennbar. Jedes Mal, wenn ihn jemand anrief, kreischte eine schrille Stimme: «Telefon, Teeleefoon, Teeeleeefooon!» Denis liess an einem lustigen Abend mit Freunden in einer Bar einen indischen Kellner diese Worte in sein Handy sagen. Seither verwendete er diese Aufnahme als Klingelton. Für eine SMS liess er den Kellner «Sssiimmms!» sagen, was sich genauso schräg anhörte. Er hatte sich schon lange vorgenommen, diesen Jux wieder in ein normales Klingeln zu ändern, war aber immer zu faul dazu gewesen. Auch wollte er sich nicht stundenlang durch das Menü kämpfen, bis er wusste, wie er diese Aufnahmen löschen konnte. Also liess er sie einfach drauf.
Denis eilte ins Wohnzimmer und nahm das Telefon von der zweiten Station, die sich auf dem Sideboard gleich unter dem Bild befand. Erstaunt las er die Nummer vom Display ab: «0000 110 100 10». Wer hat denn so eine Nummer? Verwundert nahm er das Gespräch entgegen.
«Hallo?»
«Spreche ich mit Denis Benz?» Die Stimme klang nach einem jungen Mann.
«Am Apparat.»
«Mein Name ist Pascal Weber, bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich rufe Sie im Namen des Schweizerischen Nachrichtendienstes an.»
«Nachrichtendienst? Sind Sie von einer Zeitung?»
Am anderen Ende ertönte ein verständnisvolles Lachen.
«Nein, der Schweizerische Nachrichtendienst ist eine Bundesinstitution. Wir sind Spezialisten, wenn es um Beschaffung, Koordination, Kommunikation oder Verteilung von Nachrichten von nationalem und internationalem Interesse geht.»
«Das hört sich für mich wie eine journalistische Tätigkeit an!»
«Nun ja, im weitesten Sinne stimmt die Bezeichnung.»
Denis merkte, wie die Stimme am anderen Ende das Thema wechseln wollte.
«Herr Benz, ist es Ihnen möglich, bei uns mal reinzuschauen?»
«Reinschauen?»
Die Art, wie Denis nachfragte, brachte den Anrufer in Verlegenheit.
«Sie haben recht, diese Formulierung scheint mir etwas unpassend zu sein. Wir vom NDCH würden gerne ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen.»
«Und um was geht es?» Jetzt war seine Neugier geweckt.
«Es wäre uns ein grosses Anliegen, Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Gründe nennen zu können.»
«Dies ist aber kein Scherz, oder?»
«Ich kann Ihnen versichern, Herr Benz, dass es sich um keinen Scherz handelt!»
«Und warum wollen Sie ausgerechnet mich treffen?»
«Wie gesagt, Herr Benz, wir möchten Ihnen das persönlich sagen.»
«Da kann ja jeder anrufen, mich zu einem Treffen locken und zum Schluss verkauft man mir eine Heizdecke!» Denis war sich sicher, dass es sich um einen Scherz handelte.
Die Stimme am anderen Ende wurde unmissverständlich scharf.
«Herr Benz, wir sind ein Bundesamt in der Exekutive und damit direkt dem polizeilichen Gesetz auf Bundesebene unterstellt. Ich kann Ihr Misstrauen zwar verstehen, möchte Sie aber daran erinnern, dass ich Sie notfalls auch mit Polizeigewalt abholen kann. Ich hoffe nicht, dass dies nötig sein wird.»
Das machte Denis Eindruck.
«Wann und wo wollen Sie mich treffen?»
Der Anrufer schien froh zu sein, dass Denis eingelenkt hatte und klang wieder freundlicher.
«Wäre es Ihnen in einer halben Stunde recht?»
Denis fiel aus allen Wolken.
«In dreissig Minuten?» Er schaute auf seine Uhr, sie zeigte zehn nach elf an. «Also bereits um zwanzig vor zwölf?»
«Ich weiss, es ist etwas kurzfristig, aber die Sache hat eine hohe Dringlichkeitsstufe.»
Nochmals wollte Denis den Bundesbeamten nicht reizen.
«Gut, wenn es so dringend ist, bin ich in einer halben Stunde bei Ihnen. Wo muss ich hin?»
«Unser Büro befindet sich im Bundeshaus. Fragen Sie am Hauptempfang nach mir, Pascal Weber vom NDCH, Nachrichtendienst Schweiz. Ich werde Sie dann abholen.»
«Pascal Weber», wiederholte Denis folgsam.
«Genau, Pascal Weber. Dann sehen wir uns in einer halben Stunde bei uns. Sie haben ja nicht weit! Ich freue mich, auf Wiederhören, Herr Benz!» Das Gespräch wurde abrupt beendet.
Denis musste sich erst mal setzen. Was war denn das? Er fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare und starrte dabei ungläubig auf das vor ihm liegende Telefon. «Nachrichtendienst Schweiz», wiederholte er laut. Hab ich die Steuern nicht bezahlt? Oder geht es wieder um die Geschichte mit der Rekrutenschule? Haben die gemerkt, dass ich damals geschummelt habe? Denis hatte keinen Militärdienst geleistet. Er hatte sich bei der Aushebung mit der Begründung gedrückt, dass er nicht wisse, was passiere, wenn er eine Waffe in seinen Händen halten würde. Damals hatte diese Ausrede ganz gut funktioniert, denn es war die Zeit, als die Schweizer Armee in einer tiefen Krise steckte und per Volksabstimmung beinahe aufgehoben worden wäre. Jede noch so kleine Verfehlung der Armee wurde von den Armeegegnern als dankbares Fressen aufgenommen und in der Presse breitgetreten. Da hätte sich ein potenzieller Amokläufer im Dienst sicherlich nicht gut gemacht. Natürlich wusste Denis, dass er keineswegs so veranlasst war. Doch die Aussicht auf ein militärfreies Leben schien es ihm wert zu sein, dass er als Preis dafür irgendwo in einem Militäraktenschrank als potenzieller Psychopath verzeichnet wurde. Sein Vater, ein hoher Offizier der Schweizer Armee, war über diesen Vorfall gar nicht erfreut gewesen und hatte lange daran zu beissen gehabt. In der Zwischenzeit hatte er sich aber damit abgefunden.
Oder geht es doch um die Steuern? Denis wurde es ganz heiss. Vielleicht war der Staat wegen seines aufwendigen Lebensstils misstrauisch geworden. Als Schauspieler konnte man sich unmöglich eine solche Wohnung leisten, das wusste jeder. Der Umstand, dass er nur einen geringen Betrag versteuerte, aber trotzdem in Saus und Braus lebte, musste nach aussen verdächtig wirken. Natürlich wurden in keiner Steuererklärung die grosszügigen Zuschüsse seiner Eltern erwähnt. Vielleicht denken die, ich sei ein Dealer oder ein Krimineller, weil ich so lebe, aber fast nichts zu versteuern habe? Denis atmete tief durch. Er kam zum Schluss, dass der Staat nicht wissen könne, wie er lebte, sonst hätten sie die Wohnung von innen sehen müssen. Dieser Gedanke beruhigte ihn etwas. Plötzlich schoss ihm wieder das Blut in den Kopf. Was hatte der Mann am Telefon gesagt? Sie haben ja nicht weit!
«Die wissen, wo ich wohne!», sagte Denis laut und stand dabei auf.
«Scheisse! Woher wissen die das?» Er ging nervös im Zimmer umher.
«Kein Problem, kein Problem! Jedermann kann in einem Telefonbuch nachschauen. Jeder Mensch, der wissen will, wo ich wohne, geht ins Internet und, zack, schon hat er die Adresse! Und von irgendwo muss dieser Mann ja meine Telefonnummer haben. Also beruhige dich, es ist alles in bester Ordnung!»
Denis setzte sich wieder an den Tisch. Langsam senkte sich sein Puls. Er starrte mit leerem Blick auf die Tischplatte. Dabei fiel ihm sein iPhone auf. Er hatte es am Vorabend dort liegen gelassen. Um sich abzulenken, schaltete er es ein. Schon kurz darauf ertönte das laute «Sssiimmms!» des indischen Kellners. Kims Name erschien auf dem Display und Denis öffnete die Nachricht.
Es tut mir sehr leid, dass es so kommen musste.
Lass uns Freunde bleiben!
«Das hat mir gerade noch gefehlt!» Er warf sein iPhone unsanft zurück auf den Tisch.
«Lass uns Freunde bleiben!», äffte er ihre Botschaft nach. Er musste auf andere Gedanken kommen! Er beschloss, noch schnell einen Espresso auf dem Bärenplatz zu trinken, bevor er sich auf den Weg zum Bundeshaus machte. Er hatte ja noch zwanzig Minuten Zeit und weit war es nicht. Er musste nur den Bundesplatz überqueren. Widerwillig nahm er wieder das iPhone, steckte es in seine Hosentasche und ging zur Tür. Er öffnete im Eingangsbereich den Schuhschrank, zog ein paar Turnschuhe heraus und schloss die Klappe unsanft wieder. Nachdem er sich die Schuhe gebunden und einen Blazer angezogen hatte, schnappte er sich seinen Schlüsselbund, der auf dem Tischchen neben der Tür bereitlag und verliess die Wohnung.
Denis setzte sich nervös an einen freien Tisch im «Café Fédéral». Hastig bestellte er einen Espresso. Er war immer hier, wenn es ihm in seiner Wohnung zu langweilig wurde. Darum kannte er das ganze Personal mit Vornamen. Eigentlich ging es ihm beim Personal auf dem ganzen Bärenplatz so. Oft genehmigte er sich noch einen Schlummertrunk in einem dieser zahlreichen Restaurants, bevor er nach Hause ging. Doch diesmal war Denis nicht aus Langeweile oder wegen eines Gin Tonics im «Café Fédéral», sondern weil es am nächsten beim Bundeshaus lag. Ungläubig starrte er hinüber. Was wollen die von mir? Das seltsame Gespräch mit diesem Mann ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Immer wieder schaute er auf die Uhr. Er hatte noch fünfzehn Minuten Zeit.
Theo brachte ihm den bestellten Espresso.
«Na, wie geht es denn unserem Hollywoodschauspieler? Schon einen Oscar bekommen?» Mit einem breiten Grinsen stellte Theo die Tasse auf den Tisch.
«Nein, noch nicht.» Denis antwortete mürrisch.
«Oje, da hat wohl einer schlecht geschlafen!»
«Bin heute einfach nicht so gut drauf.»
«Weisst du was, dann geht diese Runde auf mich. Vielleicht hebt sich dadurch deine Stimmung wieder!»
«Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir, Theo.» Denis lächelte gequält.
«Telefon, Teeleefoon, Teeeleeefooon!», schrie der indische Kellner aus seinem Handy.
«Hallo?»
«Herr Benz?»
Denis erkannte die Stimme sofort wieder, sein Herz raste.
«Ja, am Apparat.»
«Hier ist nochmals Pascal Weber vom Nachrichtendienst. Bitte entschuldigen Sie meine erneute Störung.»
«Kein Problem!», schwindelte ihm Denis vor.
«Ich habe vorhin noch etwas Wichtiges vergessen zu erwähnen. Könnten Sie bitte Ihren Pass mitbringen?»
«Meinen Pass?»
«Genau, Ihren Pass, es ist eine reine Formsache.»
«Mach ich gerne. Ich muss aber nochmals zurück in meine Wohnung. Vielleicht verspäte ich mich einige Minuten.»
«Das macht gar nichts, ich warte hier auf Sie. Bis gleich, Herr Benz.»
Denis konnte sich wieder nicht verabschieden, zu schnell wurde das Gespräch abgebrochen.
Seltsam! Wieso brauchen die meinen Pass? Er war nun vollends verwirrt. Den Espresso hatte er noch nicht angerührt. Ihm war auch nicht mehr danach. Mit dem Löffel schlug er einige Male gegen die Tasse. Das klirrende Geräusch half ihm beim Nachdenken. Wieso meinen Pass? Die Frage liess ihn nicht mehr los. Plötzlich kam ihm ein anderer Gedanke. War es wieder diese komische Nummer? Denis nahm sein Telefon zur Hand und schaute nach. Tatsächlich, es war wieder die Nummer mit den vier Nullen zu Beginn. Komischerweise beruhigte ihn das ein wenig. Er wusste, wenn der Anrufer vom selben Anschluss anrief, hatte er nichts zu verstecken. Denis starrte noch einen Moment auf das Display. Plötzlich zuckte er zusammen. Woher haben die meine Handynummer? Dass sie seine Festnetznummer herausfanden, war ihm noch verständlich, aber die Handynummer? Er hatte sie nie irgendwo veröffentlicht. Denis war verunsichert. Mit ein paar gezielten Fingerbewegungen ging er mit seinem Telefon ins Internet und gab seinen Namen im Telefonbuch ein. Nach einigen Augenblicken erschien sein Eintrag:
Denis Benz
Schauspieler
Bundesplatz 11
3001 Bern
Tel. 031 960 20 37
Er wusste es, nie hatte er seine Handynummer freigegeben! Wie war es möglich, dass dieser Weber mich auf dem Handy anrufen konnte? Hat der Bund Zugang zu meinem Telefonanbieter? Das wäre doch aber eine grobe Verletzung des Datenschutzgesetzes! Verzweiflung machte sich in ihm breit. Wer sind diese Leute und vor allem, was zum Teufel wollen sie von mir? Seine Verunsicherung wandelte sich in Wut. Kurzentschlossen warf er etwas Kleingeld auf den Tisch und liess den inzwischen kalt gewordenen Espresso stehen. Schnell eilte er wieder zurück in seine Wohnung. Er rannte die Treppe hoch, öffnete die Wohnungstür, ging ins Wohnzimmer und griff gezielt in die oberste Schublade des Sideboards, nahm seinen Pass und verliess wieder seine Wohnung. Die Aufregung und das schnelle Laufen brachten ihn ins Schwitzen. In der Mitte des Bundesplatzes hielt er kurz an, um seinen Blazer auszuziehen. Sein Hemd war schon ganz nass. Kein Wunder, es war ein heisser Sommertag mitten im August. Denis ging geradewegs auf den Haupteingang des Bundeshauses zu. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er sich trotz seiner unmittelbaren Nähe zu diesem Gebäude nie die Zeit genommen hatte, mal reinzuschauen. Er blickte an dem imposanten Bauwerk hoch. Es war wie ein Schloss gebaut. Ein Flügel links, ein Flügel rechts und in der Mitte das Hauptgebäude mit grossem Eingang. Auf dem Dach glänzte eine grosse, runde, grüngoldene Kuppel mit einer Schweizer Fahne darauf.
Denis nahm zwei Stufen auf einmal. In der Eingangshalle war es erstaunlich kühl. Der Boden war aus Marmor. Das schwarz-weiss karierte Muster erinnerte ihn an ein Schachbrett. Mitten in der grossen Empfangshalle führte eine edle Steintreppe in die oberen Etagen. Am Fusse der Treppe standen zwei massive, antike Statuen, die grosse leuchtende Lampen in ihren kräftigen Armen hielten. Links und rechts der Treppe befanden sich hohe Gänge. Vor jedem Gang stand diskret, aber gut sichtbar ein bewaffneter Wachmann. Alles wirkte offen und luftig konstruiert. Er entdeckte auf der linken Seite einen Empfangstresen mit zwei Frauen in eleganter, aber unauffälliger blauer Kleidung. Entschlossen ging er auf die beiden zu. Er wählte die rechte Angestellte. Sie schien ihm jünger und hübscher zu sein. Er wusste, dass er bei jungen Frauen wegen seines guten Aussehens leichteres Spiel hatte.
«Guten Tag!» Die Frau hinter dem Tresen empfing Denis mit einem breiten Lächeln. Sie hatte blondes, gepflegtes Haar und wunderschöne Zähne.
«Einen schönen guten Tag!» Denis erwiderte das Lächeln und versuchte seinen ganzen Charme auszuspielen. Unbeholfen stützte er sich auf dem Tresen ab.
«Wie kann ich Ihnen helfen?»
Denis versuchte, cool zu wirken.
«Mein Name ist Denis Benz. Ich soll mich hier bei einem Herrn Weber melden.»
Die sympathische Frau blickte auf eine Liste auf ihrem Pult.
«Weber sagen Sie?»
«Genau, Weber!»
«Wir haben hier einige Weber. Haben Sie noch einen Vornamen oder eine Abteilung?» Sie sah ihn mit ihren hellgrünen Augen an.
Diese wunderschönen Augen brachten Denis für einen kurzen Moment aus dem Konzept.
«Äh ja, klar, … Moment … Pascal war sein Vorname. Ich glaube, seine Abteilung heisst NGDCH oder so was.» Nun hatte er sich als totaler Laie verraten.
«Meinen Sie NDCH? Nachrichtendienst?»
«Das wars! Nachrichtendienst!»
«Ich werde Sie gleich anmelden. Einen Moment bitte.» Die junge Frau wählte eine Nummer. Denis nutzte die Gelegenheit, ihr Namensschild zu lesen. «N. Rothenbühler» stand darauf. Wofür steht wohl das N.? Nadine, Nina, Nicole oder gar Natalja? Wahrscheinlich Nadine. Sie ist so ein Nadine-Typ. Er beschäftigte sich gerne mit Namen und war der festen Überzeugung, dass man über den Namen den Menschen, der dahintersteckte, einschätzen konnte. Ihm gefiel der Name «Nadine». Er stand nach seiner Erfahrung für Schönheit, Intelligenz und eine gewisse Zickigkeit. Alles Dinge, die er bei einer Frau mochte.
«Herr Weber wird jeden Moment hier sein.»
Die junge Frau holte Denis wieder in die Realität zurück.
«Sie dürfen gerne einen Moment Platz nehmen.» Mit einer freundlichen, aber bestimmten Geste zeigte sie Denis, wo er zu warten hatte. Etwas entfernt stand eine kleine Sitzecke für Gäste bereit.
Denis bedankte sich mit einem charmanten Lächeln und ging zur Sitzgruppe hinüber. Er setzte sich und schaute auf seine Armbanduhr. Viertel vor zwölf. Seine Verspätung hielt sich in Grenzen. Eine Weile lang verfolgte er das rege Treiben in der Eingangshalle. Es amüsierte ihn, all diese geschäftigen Leute zu sehen, die keinen glücklichen Eindruck machten. Mit steinernen Mienen und schweren Aktentaschen beladen suchten sie sich ihren Weg. Alle sahen gleich aus. Dunkle Anzüge, schwarze Taschen und schütteres Haar. Vermutlich mutierte man einfach zu einem typischen Politiker, wenn man zu lange im Bundeshaus war. Ein Grund mehr, warum Denis die Politik nicht interessierte.
Schon bald verlor er das Interesse an diesem hektischen Bundeshausalltag. Das Gefühl, unter so vielen Menschen untätig dazusitzen, bereitete ihm Unbehagen. Darum fing er an, sich mit seinem Handy zu beschäftigen. Er strich und tippte fast zärtlich auf seinem iPhone herum. Er hatte keine neuen Nachrichten erhalten, also öffnete er nochmals die Nachricht von Kim.
«Lass uns Freunde bleiben!» Denis wiederholte den zweiten Teil der Nachricht leise vor sich hin. Erneut regte er sich über diese abgedroschene Phrase auf. Wenn sie sich wenigstens die Mühe gemacht hätte, eine andere Formulierung zu finden. Denis wurde den Eindruck nicht los, dass Kim diesen Standardsatz auch schon bei ihren vorherigen Beziehungen angewendet hatte. Wahrscheinlich hat sie den Satz auf ihrem Handy schon abgespeichert, um ihn bei Bedarf schnell griffbereit zu haben. Dieser Gedanke machte ihn wütend. Er war keiner, den man einfach so mit einem «Lass uns Freunde bleiben» abschieben konnte. Ich kann jede Frau haben. Dieser Gedanke tat ihm gut. Kurzentschlossen löschte er die SMS. Die Vorstellung, Kim damit aus seinen Gedanken gelöscht zu haben, gefiel ihm. Ein Lächeln huschte über seine Lippen.
«Denis Benz, wo ist er?»
Diese Worte liessen Denis aufhorchen. Sofort erkannte er die Stimme wieder. Er schaute zum Tresen hinüber und beobachtete einen jungen Mann mit dichtem, blondem Haar. Er sah ihn nur von hinten, konnte aber erkennen, dass er sehr sportlich gebaut war. Er trug eine schwarze, gut sitzende Stoffhose, einen passenden Gürtel dazu und ein weisses Hemd. Die Ärmel des Hemdes hatte er modisch bis kurz unter die Ellenbogen hochgekrempelt. Die teuren Schuhe stachen Denis sofort ins Auge. Braunes Leder, handgenäht. Ein trendiger Stufenschnitt rundete das Bild ab. Entweder ist dieser Mann ein Model oder sehr eitel.
«Herr Benz sitzt dort drüben!»
Denis wurde nervös. Der junge Mann drehte sich zu ihm um.
Kapitel 2
Juan nippte gelangweilt an seinem Drink. Die Eiswürfel in seinem Whisky klimperten bei jedem Schluck. Er sass nur mit Boxershorts bekleidet auf dem kleinen Balkon seiner spärlich eingerichteten Zweizimmerwohnung hoch über den Dächern von Buenos Aires, rauchte genüsslich eine Zigarette und verfolgte von oben den hektischen Alltag der Grossstadt. Er wohnte in einem heruntergekommenen, ungepflegten Hochhaus in Retiro, einem Gebiet im Süden von Buenos Aires, das vor allem wegen der Hafennähe und einem riesigen Güterbahnhof als Handelszentrum bekannt war. Es war halb elf am Morgen und die Sonne brannte bereits heiss vom Himmel. Hupende Autos, Taxis, die jede kleine Lücke nutzten, um dem Verkehrsstau zu entkommen und damit den Zorn der Autofahrer auf sich zogen, röhrende Busse mit kaputten Auspuffen und Tausende von Menschen, die sich auf den engen Gehwegen gegenseitig im Weg standen. Das Chaos rund um die Plaza San Martin nervte Juan. Er mochte es geordnet. Ich hätte die grösste Lust, mein Gewehr mit Zielfernrohr zu holen und jeden Autofahrer, der mich mit seinem Gehupe nervt, abzuknallen! Dieser Gedanke amüsierte Juan. Ihm gefiel das Gefühl, das er dabei empfand, über andere Menschen und deren Schicksal bestimmen zu können. Er lebte nach dem Machtprinzip. Wer Macht über andere Menschen besass, kontrollierte deren Leben. Eine Weisheit, die ihm sein Vater beigebracht hatte.
Juan war Mörder aus Überzeugung, kein kleiner Gelegenheitsmörder, der aus Verzweiflung oder Geldnot tötete. Das Töten war sein Beruf und seine Berufung. Er machte sich einen Spass daraus, seinen Opfern auch nach ihrem Tod noch die letzte Würde zu nehmen. Oft beliess er es nicht nur beim Töten, sondern inszenierte noch etwas mit Körperteilen der Leiche. Ganz am Anfang seiner zweifelhaften Karriere schnitt er einem Opfer beide Ohren ab und nagelte sie an die Wand neben der Leiche. Mit einem Stift schrieb er darüber: «Wer nicht hören will, muss fühlen!» Dieser Mord brachte ihm damals den Übernamen «La Mano de Van Gogh» ein – die Hand Van Goghs. Ihm gefiel das. Übernamen waren für ihn immer eine Respektsbezeugung. Um seinem Ruf gerecht zu werden, schnitt er fortan seinen Opfern immer mindestens ein Körperteil ab und verband es mit einem Spruch. Mit den Jahren verkürzte sich sein Übername auf «La Mano» – die Hand.
«Warst du zufrieden mit mir?»
Juan drückte seine Zigarette auf dem Balkongeländer aus. Isabella, eine Edelhure mit langen braunen Haaren und Modelfigur, stand in aufreizenden Strapsen hinter ihm und massierte ihm kräftig den Nacken. Forsch wischte Juan ihre Hände von seinen Schultern. «War ganz okay. Dein Geld liegt auf dem Esstisch. Bis bald.» Juan nahm einen grossen Schluck Whisky.
«Soll ich es dir nochmals besorgen?»
«Nein», antwortete Juan gelangweilt. Starr blickte er auf das Verkehrschaos unter ihm.
«Rufst du mich wieder an, Süsser?»
«Jaja!» Sie fing an, Juan zu nerven. Er drehte sich zu ihr um und schaute ihr bedrohlich in die Augen.
«Hör zu, Mädchen, ich habe dich nicht dafür bezahlt, um mit mir zu quatschen. Ich hatte meinen Spass und du hast dein Geld, also sind wir beide glücklich. Jetzt nimm es und verpiss dich!»
«Ist ja gut, ich wollte nur freundlich sein!»
Beleidigt schlüpfte die Hure in ihr knappes Kleid, stieg in ihre hohen Schuhe, nahm die dreihundert US-Dollar vom Tisch und verliess leise fluchend das kleine Apartment.
Undankbares Miststück! Wahrscheinlich hat sie gedacht, sie könne noch mit mir frühstücken! Juan leerte sein Whiskyglas in einem Zug und stand auf. Der Alkohol machte sich bereits in seinen Beinen bemerkbar. Etwas benommen ging er in sein Schlafzimmer und zog sich an. Er entschied sich für eine leichte, beige Stoffhose und ein weisses Seidenhemd, um den Hals hatte er eine schwere Goldkette. Zu dieser Jahreszeit war die Hitze in Argentinien unerträglich. Barfuss schlüpfte er in seine braunen Wildlederschuhe. Juan hielt sonst nicht viel von teuren Dingen, aber schöne Kleidung war ihm wichtig. Seine kleine Wohnung im Herzen von Buenos Aires war eine Bruchbude und auch die alten, unpassenden und schlecht arrangierten Möbel liessen nicht vermuten, dass Juan reich war. Dabei war er sogar sehr reich. Sein Vater, Gerhard Kessler, ein geflohener SS-Offizier aus Deutschland, hinterliess ihm nach seinem Tod ein Vermögen in Kunstschätzen und Raubgold, das er bei seiner Flucht aus Deutschland hatte mitgehen lassen. Wie viele andere deutsche Kriegsverbrecher, erkaufte sich auch Juans Vater eine teure Staatsbürgerschaft und die damit verbundene Immunität in Argentinien. Darum hiess Juan eigentlich Juan Kessler. Eine ulkige Kombination. Er war während der Schulzeit oft deswegen gehänselt worden. Seine roten Haare und blauen Augen liessen jeden erkennen, dass er ein Fremder war. «Fosforito» – Zündhölzchen – hatten sie ihm auf dem Schulhof immer zugerufen. Juan hatte damals sehr darunter gelitten und lernte, seine Gegner mit Gewalt zu bändigen.
Er hatte nie verstanden, warum er nicht wie ein Einheimischer wahrgenommen wurde. Schliesslich wurde er 1968 in Buenos Aires geboren und hatte immer dort gelebt. Noch immer hörte er seine Mutter sagen: «Du hast halt einen deutschen Vater und seine Gene haben sich leider mehr durchgesetzt als meine! Dafür bist du hier etwas Einzigartiges, ein Star.» Seine Mutter Esmeralda war Argentinierin. Mit diesen Worten hatte sie ihn zu beruhigen versucht, wenn er wieder einmal weinend und mit blutigen Händen nach Hause gekommen war.
Dass sein Vater ein international gesuchter Kriegsverbrecher war, wusste damals niemand, nicht einmal seine Mutter. Sie hatte geglaubt, einen reichen Deutschen und damit ihr Lebensglück gefunden zu haben. Erst als man seinen Vater 1975 nach langen Recherchen ausfindig machen konnte, war die ganze Wahrheit ans Tageslicht gekommen. Von da an waren sie nur noch auf der Flucht. Da die argentinische Regierung plötzlich auf internationalen Druck so etwas wie ein moralisches Gewissen bekommen hatte, half auch das sonst so effiziente Schmieren der Beamten nicht mehr, sie wurden erbarmungslos verfolgt. Aus taktischen Gründen nannte sich die Familie fortan nach der Mutter: «Fuentes». Sie waren ständig unterwegs, die Angst, entdeckt zu werden, immer im Nacken. Seine Mutter zerbrach daran, mit einem Kriegsverbrecher verheiratet zu sein, und beging 1979 Selbstmord. Sein Vater Gerhard starb 1986 mit einundneunzig Jahren einsam und verlassen auf dem Land.
Juan löste sich schon vorher von seinem Vater und zog mit sechzehn zu seiner Tante in die Hauptstadt, bis er auf eigenen Füssen stehen konnte. Er fing ein Studium als Zahnmediziner an und bestritt den Lebensunterhalt mit kleinen Botengängen als Drogenkurier. Zu jener Zeit war das an der Uni nicht ungewöhnlich. Für Juan bedeuteten diese Botengänge den Einstieg in die Unterwelt, und sein erster Auftragsmord liess nicht lange auf sich warten. Seine Fähigkeit, den Opfern medizinisch genau die Zähne ziehen und Fingerkuppen abschneiden zu können, bevor er sie verbrannte, hatte sich schnell herumgesprochen. Damals gab es noch keine DNS-Analysen. Namenlose Opfer machten es der Polizei nahezu unmöglich, die Geschichte hinter dem Mord herauszufinden. Damit waren die Auftraggeber geschützt. Eine Goldgrube für Juan.
Zu jener Zeit fiel ihm auch die Sache mit den Ohren ein. Als er dann mit zweiundzwanzig noch das Erbe seines Vaters erhielt, wusste er nicht wohin mit dem vielen Geld. Schon als Auftragskiller kannte er keine Geldsorgen mehr, doch mit den zusätzlichen Millionen des Vaters schien ihm seine Ausbildung sinnlos geworden zu sein. Er brach das Studium ab. Mit den Morden hätte er eigentlich auch aufhören können, doch er machte weiter. Zu sehr genoss er es. Töten war für ihn eine Sucht. Auch das schien er von seinem Vater geerbt zu haben. Wie er später einmal herausfand, war sein Vater ein gefürchteter Leiter eines Konzentrationslagers gewesen. Dadurch, dass Juan es nicht mehr nötig hatte, jeden Auftragsmord anzunehmen, wurde er noch interessanter und gefürchteter in der Szene. Nur noch die einflussreichsten Verbrecher konnten ihn sich leisten.
Mit einem lauten Signalton verkündete Juans Handy den Empfang einer SMS. Juan griff in die Tasche seiner braunen Lederjacke, die er am Abend zuvor über einen Stuhl gehängt hatte. Neugierig schaute er auf das Display.
Hast du Zeit für etwas Kunst?
Im Museo de la Cuidad gibt es
eine fantastische Ausstellung.
Kommst du mit?
Wir treffen uns in einer Stunde
am Eingang. Bring den
Fotoapparat mit.
Gruss, Perro
Juan war erstaunt. Perro – Hund – war der Deckname seines Bosses, Ramon Vasquez, des grössten und gefürchtetsten Drogenhändlers des Landes. Sein Kartell wurde das «Barone-Kartell» genannt. Sicherheit hatte in diesem Geschäft höchste Priorität, darum gab keiner seinen wirklichen Namen im öffentlichen Netz preis. Vasquez kontaktierte ihn nur in Notfällen persönlich, was in ihrer langjährigen Zusammenarbeit bislang erst zweimal vorgekommen war. Normalerweise bekam er die SMS von einem seiner Angestellten.
Juans Arbeitgeber verfügte nicht nur über eine kleine Armee von Sicherheitsleuten, sondern auch über fast so viele abgerichtete Kampfhunde. Bei seinem ersten Besuch auf der Finca von Vasquez begegnete Juan diesen aggressiven Tieren. Vasquez amüsierte sich über Juans Respekt vor den Hunden.
«Hunde sind dir immer treu, setzen ohne zu zögern ihr Leben für deines ein und werden dich nie bescheissen! Eigenschaften, die ich keinem Menschen zutraue!», belehrte ihn Vasquez damals. Eigentlich trug Ramon Vasquez den ehrenvollen Übernamen «El Barone» – der Baron. Nur Juan durfte ihn Perro nennen. Zudem war Juan die einzige Person, die Vasquez persönlich kontaktierte. Da die Hundegeschichte ihr ganz persönliches, gemeinsames Erlebnis war, drängte sich der Deckname «Perro» auf. Juan genoss bei Vasquez eine absolute Sonderstellung. Über all die Jahre war so etwas wie eine respektvolle Freundschaft zwischen ihnen entstanden. Obwohl Ramon Vasquez mit fünfundfünfzig Jahren rund vierzehn Jahre älter als Juan war, verstanden sie sich auf Anhieb gut.
Vasquez’ Sicherheitspolitik war beeindruckend. Jeder im Lande kannte ihn, auch die Behörden. Vasquez besass mehrere Hotels, Restaurants, eine eigene Kreuzfahrtgesellschaft, Immobilien und eine riesige Finca im Landesinnern. Er zeigte sich gerne in der Öffentlichkeit, liess sich als Wohltäter feiern und war immer für ein Foto in der Boulevardpresse zu haben. Obwohl jeder wusste, dass er ein Drogenboss war, verehrte man ihn für seine grosszügigen Spenden. Sein grosses Vorbild war Juan Domingo Peròn, ehemaliger Präsident von Argentinien, der als Wohltäter der Armen im ganzen Land bekannt und beliebt gewesen war. Vasquez wollte mit grosszügigen Spenden ebenfalls einen solchen Ruf erreichen. Da er geschäftlich sehr geschickt und vorsichtig vorging, konnte man ihm bis jetzt keine Verwicklungen in krumme Geschäfte nachweisen.
Juan wusste, dass Vasquez, wenn er eine SMS verschickte, im Anschluss die SIM-Karte sofort vernichtete. Dem Boss war das Risiko einfach zu gross, dass man Rückschlüsse auf ein Verbrechen mit seinem Namen machen konnte. Mit der heutigen Nachricht wollte ihm Vasquez mitteilen, dass er ihn in seinem Hotel «El Royal» in einer Stunde erwartete. Das «El Royal» war ein Fünfsternehotel mit internationalem Ruf in Puerto Madero, die als eine der schicksten Gegenden von Buenos Aires galt. Immer wenn Vasquez in der Stadt weilte, wohnte er in diesem Hotel. Vasquez liess sich die obersten beiden Stockwerke ganz nach seinem Geschmack einrichten. Niemand ausser seinen Leuten hatte dort Zutritt. «Bring den Fotoapparat mit» hiess, dass Juan eine Waffe brauchte. Die Nachrichten änderten sich jedes Mal. Einzig die Hinweise «Stadt» oder «Land» und mit oder ohne Objekt waren immer in den Botschaften platziert. Wäre zum Beispiel «Wanderung in den Bergen mit Rucksack» gestanden, hätte sich Juan auf Vasquez’ Ranch in Córdoba mit einer Waffe einfinden müssen.
Juan wusste, dass um diese Zeit der Mittagsverkehr seinen Höhepunkt erreichte, es war bereits kurz vor zwölf. Pünktlichkeit war ihm wichtig, darum wollte er sich auf den Weg machen. Er musste auch noch ein Taxi auftreiben, was um diese Zeit gar nicht so einfach war. Da er aus Sicherheitsgründen auf alles verzichtete, was eine Unterschrift von ihm verlangte, besass er kein Auto. Für Situationen, in denen es nicht ohne Ausweispapiere ging, besass er mehrere gefälschte Pässe. Da er jedoch oft mit seinem Boss im Ausland unterwegs war, wollte er diese kostbaren Güter nur am Flughafen oder an anderen Zollstellen benutzen.
Aus einer Küchenschublade zog er eine Pistole heraus, eine Glock 30, und steckte sie in den Hosenbund am Rücken. Juan trug immer eine Waffe bei sich oder hatte zumindest immer eine griffbereit. In seiner kleinen Wohnung versteckte er insgesamt fünf Waffen, um in jeder Situation eine in Reichweite zu haben. Obwohl er unter falschem Namen in einer schäbigen Wohnung lebte und die Gefahr, ausfindig gemacht zu werden, äusserst gering war, wollte er für jeden Notfall gerüstet sein. Aus einer anderen Küchenschublade schnappte er sich ein dickes Bündel mit Geld und steckte es ein. Er verstaute viele Dinge in den Küchenablagen, die man dort nicht vermuten würde: Schuhe, frische Wäsche, Bücher und Computerzubehör. Das Einzige, was man in seiner Küche nicht finden konnte, waren Küchenutensilien, da er sie nie benutzte. Sein Kühlschrank war bis auf ein paar Wasserflaschen immer leer.
Juan verliess seine Wohnung nie ohne Baseballmütze und Sonnenbrille. Zu auffällig waren seine helle Haut und die roten Haare. Er verschloss die Wohnungstür und eilte zum Lift am Ende des Gangs. Unten angekommen, ging er zur Strasse und gab mit grossen Handzeichen zu verstehen, dass er ein Taxi brauchte. Nach drei vorbeirauschenden Taxis hielt ein alter, verbeulter Toyota am Strassenrand.
Juan stieg ein und befahl dem Fahrer in knappen Worten, ihn zum Hotel «Royal» zu fahren. Das Taxi fuhr los. Juan bemerkte, wie ihn der Taxifahrer freundlich durch den Rückspiegel anlächelte. Er kannte dieses Spiel. Alle Taxifahrer, die ihn zum Hotel «Royal» fahren sollten, gingen automatisch von einem grosszügigen Trinkgeld aus. Es dauerte nicht lange, bis der Fahrer ein Gespräch mit Juan suchte.
«Sind Sie das erste Mal in Buenos Aires?», gluckste der Fahrer in gebrochenem Englisch.
«Nein, ich wohne hier», antwortete Juan genervt auf Spanisch.
«Ah, dann arbeiten Sie sicher für einen internationalen Konzern?» Der Taxifahrer sprach nun ebenfalls Spanisch.
«Nein, ich bin Argentinier!» Juan schaute aus dem Fenster. Vielleicht hat dieser Arsch jetzt begriffen, dass ich kein Gespräch führen möchte. Das Trinkgeld kann er sich auf jeden Fall abschminken.
Der Taxifahrer fragte unbeirrt weiter.
«Und in welcher Branche sind Sie tätig?»
Jetzt platzte Juan der Kragen.
«Hör mal, du Schwatztante, wenn ich reden will, dann rufe ich meine Mutter oder einen guten Freund von mir an. Da du weder das eine noch das andere bist, schlage ich vor, du machst deinen beschissenen Job und fährst mich zum Hotel. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du es schaffen würdest, bis dorthin deine blöde Fresse zu halten! Haben wir uns verstanden?»
Der Taxifahrer, sichtlich eingeschüchtert von den deutlichen Worten, starrte beleidigt auf die Strasse.
Endlich Ruhe! Juan sass unbequem. Seine Pistole drückte ihm beim Sitzen schmerzhaft ins Kreuz. Mit einer grossen Geste griff er nach seiner Waffe und steckte sie vorne in den Hosenbund. Er bemerkte, wie der Chauffeur ihn mit weit aufgerissenen Augen im Rückspiegel beobachtete.
«Schau nach vorne, verdammt noch mal!», schrie er ihn an. Der Fahrer gehorchte sofort und traute sich von da an nicht mehr, in den Rückspiegel zu schauen. Juan konnte sich ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen. Amüsiert stellte er fest, dass sich beim Taxifahrer Schweissperlen auf der Stirn gebildet hatten. Genüsslich zündete er sich trotz grosser Verbotstafel eine Zigarette an und blies provozierend den Rauch zum Chauffeur nach vorne. Er wusste, der Taxifahrer machte sich vor Angst fast in die Hosen. Da war es wieder, dieses Machtgefühl, das ihm diese unendliche Befriedigung bereitete. Juan verfolgte entspannt und zufrieden das hektische Treiben in der Stadt.
Nach zwanzig Minuten fuhr das Taxi vor dem gedeckten Eingang des Hotels «El Royal» vor. Sofort sprang ein Hotelangestellter mit Zylinder und Uniform zur hinteren Tür, um den Gast mit den Worten «Willkommen im ‹El Royal›» freundlich zu begrüssen.
Juan griff in seine Hosentasche und holte ein Geldbündel hervor.
«Was bin ich Ihnen schuldig?», fragte Juan mit gespielter Freundlichkeit und der brennenden Zigarette im Mundwinkel.
«Gar nichts, Senior! Betrachten Sie sich als eingeladen!»
Juan konnte es sich nicht verkneifen, mit ihm zu spielen.
«Bitte sagen Sie mir, was ich Ihnen schulde!»
«Wirklich, Senior, es wäre mir eine Ehre, Sie einzuladen!», antwortete der völlig verängstigte Taxifahrer.
«Sag mir, was es kostet, Scheisse nochmal, oder muss ich erst meine Geduld mit dir verlieren!»
Juan tippte sich bewusst auf den Bauch.
Der Hotelangestellte stand immer noch vor der geöffneten Wagentür. Diskret schaute er in die Ferne der Grossstadt.
«Senior, ich habe drei Kinder. Bitte tun Sie mir nichts. Ich arbeite hart und habe nie etwas Unrechtes getan. Bitte, ich möchte jetzt nur in Ruhe weiterfahren und meinen Job machen. Ich will Ihnen wirklich keinen Ärger bereiten. Lassen Sie mich einfach gehen.»
«Langsam verliere ich die Geduld mit Ihnen!»
«Bitte, Senior, wenn Sie darauf bestehen, bezahlen zu wollen, dann geben Sie mir einfach, was Ihnen angemessen erscheint. Aber bitte tun Sie mir nichts!» Der Taxifahrer stand den Tränen nahe.
Juan war zufrieden. Er stieg aus, spuckte die Zigarette aus und warf dem Taxifahrer einen Hundertdollarschein auf den Rücksitz. Mit offenem Mund schaute der Fahrer auf den Schein. Für ihn bedeutete dieser Schein ein Monatsgehalt.
Gut gelaunt nach diesem Intermezzo betrat er die Lobby und tippte auf die Glocke der Rezeption. Sofort eilte eine Dame herbei.
«Wie kann ich Ihnen helfen?»
«Ich sage Ihnen, wie Sie mir helfen können. Ich will zu Herrn Vasquez.» Juan zog seine Sonnenbrille cool bis zur Nasenspitze vor. Er wusste, was dieser Name auslösen würde.
«Sind Sie angemeldet?», fragte ihn die Dame nervös, während sie eine separate Liste hervorzog.
Juan kannte das Ritual. Wer nicht auf dieser Liste stand, konnte gleich wieder verschwinden. Vasquez höchstpersönlich stellte die Liste aus und bestimmte damit, wer empfangen wurde und wer nicht.
«Darf ich Sie um Ihren Namen bitten?», hakte die Frau hinter der Rezeption nach.
«Juan Fuentes.» Er nahm seine Brille ab und schaute gelangweilt in die Lobby.
«Ah ja, Herr Fuentes. Ich lasse Ihnen gleich den Lift runterkommen.» Erleichtert hakte sie Juans Name auf der Liste ab.
«Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, Herr Fuentes.» Sie griff zum Telefon, um den Lift zu bestellen.
Ohne zu antworten setzte Juan seine Brille wieder auf und ging zum Lift mit der Nummer 1, Vasquez’ persönlicher Aufzug, der nur in die zwei obersten Etagen fuhr. Nur Vasquez oder sein Personal konnten den Lift hinunterschicken. Mit einem leisen «Ping» öffnete sich die Lifttür. Juan stieg ein und liess sich in die vierundvierzigste Etage fahren.
Oben angekommen, wurde er sofort von Carlos und Enrico, zwei bulligen Leibwächtern mit gepflegten, buschigen Schnäuzen, empfangen. Sie stellten sich Juan mächtig in den Weg. Er schob seine Sonnenbrille zur Nasenspitze herunter und fixierte den schnauzbärtigen Mann zu seiner Linken.
«Na, Carlos, spielen wir wieder den Helden?»
Carlos wich sofort einen Schritt zurück.
«Guten Tag, Herr Fuentes. Der Baron erwartet Sie bereits.» Seine Hand wies Juan den Weg.
«Lasst euch nicht unterkriegen, Jungs. Irgendwann einmal seid ihr mehr als nur die Schuhabtreter von Vasquez. Glaubt mir, ich sehe, wenn jemand Talent hat. Und ihr zwei habt viel Talent!» Juan freute sich über den Groll, den er mit seiner sarkastischen Bemerkung bei den Männern ausgelöst hatte, und stiess seine Brille wieder bis zur Nasenwurzel zurück. Die zwei Fleischklopse gingen wieder zu ihrer Ausgangsposition am Lift.
Normalerweise wäre eine gründliche Leibesvisitation üblich gewesen, aber da Juan zum engsten Kreis von Vasquez gehörte, traute sich keiner der Leibwächter, ihn anzurühren. Juan ging den langen Gang entlang. Ein flauschiger und wahrscheinlich saumässig teurer roter Teppich wies ihm den Weg. Die Wände waren mit goldenen Seidentapeten geschmückt, edle Gemälde in Goldrahmen rundeten das Bild ab.
Am Ende des Ganges empfingen ihn wieder zwei Leibwächter, diesmal begleitet von zwei Hunden. Juan kannte sie schon von der Finca. Dobermänner, mit coupierten Ohren und coupiertem Schwanz. Jeweils fünfzig Kilogramm pure Muskelmasse. Um den Hals hatte man ihnen noch Halsbänder mit zahlreichen spitzen Nieten gebunden. Juan hatte sich an ihren Anblick gewöhnt und liess sich davon schon lange nicht mehr beeindrucken. Als er näher kam, sprach einer der beiden Leibwächter in ein Funkgerät. Die Tür zur Suite «Péron» wurde von innen geöffnet. Juan ging an den beiden vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Hinter ihm schloss sich die Tür wieder.
Vasquez persönlicher Assistent, Pepe Gonzalves, empfing ihn wortlos mit einem leichten Händedruck. Er war ein hagerer fünfundvierzigjähriger Mann mit kantigem Gesicht, der viel älter aussah. In seinem massgeschneiderten, schwarzen Anzug wirkte er wie ein Kardinal auf Reisen. Wie immer hatte er sein schütteres Haar nach hinten gekämmt, was ihm ein intelligentes Aussehen verlieh. Juan nahm seine Sonnenbrille ab und blickte sich um. Dieser Raum faszinierte ihn jedes Mal von Neuem. Sein Blick schweifte über die riesige Marmorbar mit Spiegeln und viel Gold zu einer gigantischen Fensterfront mit Aussicht über Buenos Aires und zu mehreren Sitzgruppen in verschiedenen Farben. Direkt hinter der Bar schlängelte sich eine goldene Wendeltreppe in den oberen Stock der Suite. Juan wusste von früheren Besuchen, dass sich dort das Fernsehzimmer, der Billardtisch und sechs Schlafzimmer mit Bädern befanden. Auch gab es einen grossen Konferenzraum, den Vasquez aber als Büro benutzte.
«Ah, da ist er ja! Komm, lass dich umarmen!»
Juan blickte nach rechts und sah Vasquez aus einer der zahlreichen Türen im unteren Stock auf ihn zukommen. Auch hier gab es Schlafzimmer, Wohnräume und Büros. Vasquez trug einen Morgenrock aus roter Seide mit goldenen Streifen und schwarze Samtpantoffeln mit einem Krönchen darauf. Dieser kleine Mann wird von Tag zu Tag dicker, schoss es Juan durch den Kopf. Eine riesige, goldumrahmte Brille sass auf der fleischigen Stupsnase und verlieh ihm das Aussehen einer Fliege. Wie immer hatte er sein dichtes, schwarzes Haar mit viel glänzendem Gel nach hinten gekämmt. Jeder wusste, dass sich der Baron nicht nur die Haare färben liess, sondern auch seinen gepflegten Schnurrbart und die Augenbrauen. Der Morgenmantel war ein sicheres Indiz dafür, dass Vasquez gerade Frauenbesuch hatte. Er liess sich immer Prostituierte in die Suite kommen, wenn er, fernab von seiner Tochter und seiner Frau, in der Stadt weilte. Mit offenen Armen kam er auf Juan zu. Von seinen Handgelenken glitzerten mehrere teure, mit Diamanten versetzte Armkettchen aus Gold.
«El Barone!» Juan streckte ihm mit einem Lächeln die Hand entgegen. Er wusste, wie geschmeichelt sich Vasquez fühlte, wenn er so angesprochen wurde.
«Aber bitte, mein lieber Juan, für dich doch immer noch Ramon! Hast du schon meine Hunde begrüsst?»
Inzwischen hatten sie sich auf halbem Weg getroffen und gaben sich mit einem gegenseitigen Schulterklopfen die Hand. Ein penetranter, blumiger Duft stieg Juan in die Nase.
«Na, wie geht es dir, Juan?» Vasquez trat einen Schritt zurück, um ihn anzuschauen. «Gut siehst du aus! Machst du Sport?»
«Nein, Ramon, immer noch nicht. Du kennst ja meinen Sport!» Juan zwinkerte ihm zu.
«Natürlich kenne ich diese Sportart! Den schönsten Sport, den es gibt auf der Welt: Liebe machen!»
Beide lachten.
«Eigentlich sollte man das ‹Vögeln› olympisch machen, nicht wahr, mein Freund?»
«Ganz meine Meinung. Dann würden auch wieder mehr Menschen mit Freude Sport betreiben!»
«Vor allem wir Männer! Komm, mein Freund, gehen wir zur Bar und trinken einen Schluck auf unser Wiedersehen!» Vasquez ging hinter die Bar.
«Was darf ich dir Gutes tun?»
«Ich nehme einen Whisky.»





























