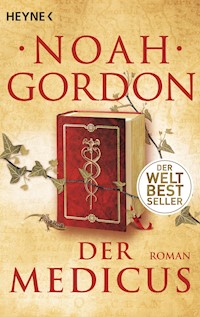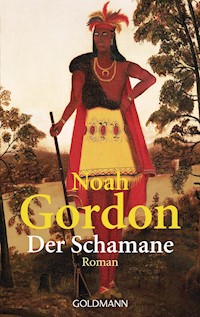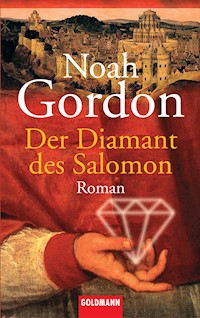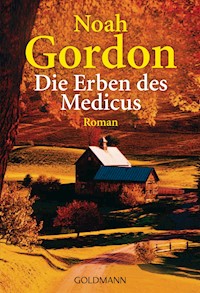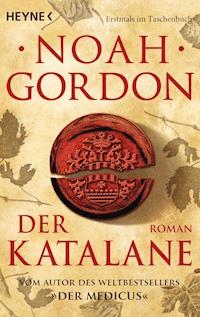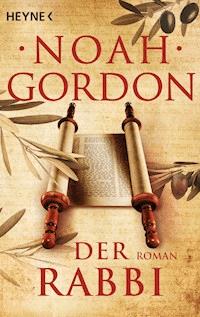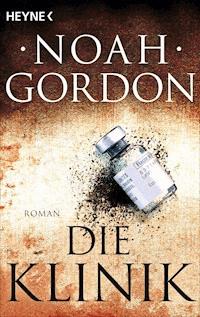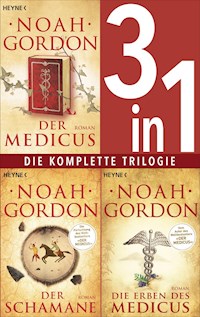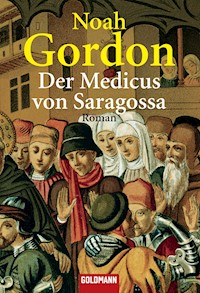
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1492 hat die Inquisition Spanien fest im Griff. Per Edikt wird verkündet, dass alle Juden das Land zu verlassen hätten, und ein großer Exodus beginnt. Jona, der dreizehnjährige Sohn des jüdischen Silberschmiedes Helkias Toledano, steht nach der Ermordung seines Bruders Meir und dem Tod seines Vaters durch einen aufgebrachten Mob völlig allein da. Doch statt sich zum Christentum zu bekehren oder zu fliehen, beschließt er, zu seinem Glauben zu stehen und sich auf eigene Faust durchzuschlagen. Für ihn beginnt eine abenteuerliche Odyssee kreuz und quer durch Spanien. Drei Jahre und zahllose Abenteuer später, im Sommer 1495, ist Jona zu einem kräftigen jungen Mann herangewachsen, der gelernt hat zu überleben und sich dennoch nichts sehnlicher wünscht, als zur Ruhe zu kommen. In Granada begegnet er endlich wieder Glaubensgenossen: der Familie des Seidenhändlers Saadi, die immer noch heimlich ihre Religion praktiziert. Jonas Liebe zu Inés, Saadis schöner Tochter, muss dennoch unerfüllt bleiben. Ein Schiff bringt Jona nach Gibraltar, wo er als Lehrling bei dem Waffenschmied Fierro unterkommt. Fierro muss schließlich selbst vor der Inquisition fliehen und bittet den jungen Mann, ihn zu seinem Bruder Nuno, einem alten Medicus, nach Saragossa zu begleiten. Als der Waffenschmied heimtückisch ermordet wird, beschließt Jona, dennoch seinen Weg nach Norden fortzusetzen. In Saragossa angekommen, entscheidet die Begegnung mit Nuno Jonas Schicksal, denn er spürt sofort, dass in der Heilkunst seine wahre Berufung liegt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Im Jahre 1492 hat die Inquisition Spanien fest im Griff. Per Edikt wird verkündet, dass alle Juden das Land zu verlassen hätten, und ein großer Exodus beginnt. Jona, der dreizehnjährige Sohn des jüdischen Silberschmiedes Helkias Toledano, steht nach der Ermordung seines Bruders Meir und dem Tod seines Vaters durch einen aufgebrachten Mob völlig allein da. Doch statt sich zum Christentum zu bekehren oder zu fliehen, beschließt er, zu seinem Glauben zu stehen und sich auf eigene Faust durchzuschlagen. Für ihn beginnt eine abenteuerliche Odyssee kreuz und quer durch Spanien. Drei Jahre und zahllose Abenteuer später, im Sommer 1495, ist Jona zu einem kräftigen jungen Mann herangewachsen, der gelernt hat zu überleben und sich dennoch nichts sehnlicher wünscht, als zur Ruhe zu kommen. In Granada begegnet er endlich wieder Glaubensgenossen: der Familie des Seidenhändlers Saadi, die immer noch heimlich ihre Religion praktiziert. Jonas Liebe zu Inés, Saadis schöner Tochter, muss dennoch unerfüllt bleiben. Ein Schiff bringt Jona nach Gibraltar, wo er als Lehrling bei dem Waffenschmied Fierro unterkommt. Fierro muss schließlich selbst vor der Inquisition fliehen und bittet den jungen Mann, ihn zu seinem Bruder Nuno, einem alten Medicus, nach Saragossa zu begleiten. Als der Waffenschmied heimtückisch ermordet wird, beschließt Jona, dennoch seinen Weg nach Norden fortzusetzen. In Saragossa angekommen, entscheidet die Begegnung mit Nuno Jonas Schicksal, denn er spürt sofort, dass in der Heilkunst seine wahre Berufung liegt ...
Autor
Noah Gordon, 1926 in Worcester, Massachusetts, geboren, arbeitete lange Jahre als Journalist beim »Boston Herald«, bevor er mit seinem ersten Roman »Der Rabbi« den Durchbruch als Schriftsteller erlebte. Mit »Der Medicus« gelang ihm ein Weltbestseller, der auch in Deutschland viele Monate auf der Bestsellerliste stand. Noah Gordon lebt mit seiner Frau auf einer Farm in Massachusetts.
Inhaltsverzeichnis
FÜR CALEB UND EMMA UND GROSSMUTTER
IN LIEBE
TEIL I
DER ERSTE SOHN
TOLEDO
23. AUGUST 1489
1. KAPITEL
DER SOHN DES SILBERSCHMIEDS
ür Bernardo Espina begannen die schlechten Zeiten an einem Tag, an dem die Luft schwer war wie Eisen und der hochmütige Sonnenschein ein Fluch. An diesem Morgen hatte sich die überfüllte Krankenstation schon fast geleert, als im Wartezimmer bei einer Schwangeren die Fruchtblase platzte und er die beiden noch verbliebenen Patienten aus dem Raum scheuchen mußte. Die Frau war nicht einmal eine Patientin, sondern hatte ihren betagten Vater wegen eines Hustens, der nicht vergehen wollte, zum Arzt gebracht. Das Baby war ihr fünftes und kam ohne Zögern auf die Welt. Espina empfing den glitschigen, rosigen Knaben mit beiden Händen, und als er ihm auf die winzigen Pobacken klatschte, wurde das dünne Schreien des stämmigen kleinen peón von denen, die draußen warteten, mit Hochrufen und Gelächter begrüßt.
Die Entbindung stimmte Espina heiter, doch diese Verheißung eines glücklichen Tages sollte sich als falsch erweisen. Für den Nachmittag hatte er keine Verpflichtungen mehr, und er überlegte, ob er einen Korb mit Süßigkeiten und einer Flasche tinto packen und mit seiner Familie an den Fluß gehen sollte, wo die Kinder planschen konnten, während er und Estrella im Schatten eines Baums saßen und tranken und plauderten.
Er behandelte eben seinen letzten Patienten, als ein Mann auf einem Esel, den er in der Hitze offenbar zu scharf geritten hatte, auf den Hof getrottet kam. Der Mann trug die braune Kutte eines Novizen.
Aufgeregt und ein wenig wichtigtuerisch stammelte der Mann, daß das Erscheinen des Herrn Arztes in der Abtei zur Himmelfahrt Mariä gewünscht werde, von Padre Sebastián Alvarez höchstpersönlich.
»Der Prior möchte, daß Ihr auf der Stelle kommt.«
Der Mann wußte, daß Espina ein converso, ein Konvertit, war, das merkte der Arzt sofort. Zwar erwies er ihm die Ehrerbietung, die Espina dank seines Berufes zustand, aber in seinem Ton schwang auch jene Anmaßung mit, die er einem gewöhnlichen Juden gegenüber an den Tag gelegt hätte.
Espina nickte. Er kümmerte sich darum, daß der Esel Wasser und auch der Mann eine kleine Stärkung erhielt. Er selbst pinkelte vorsichtshalber noch einmal, wusch sich Gesicht und Hände und verzehrte ein Stück Brot. Der Novize war noch beim Essen, als Espina vom Hof ritt.
Espinas Konversion lag elf Jahre zurück. Seit dieser Zeit war er ein inbrünstiger Anhänger seines gewählten Glaubens, ein Mann, der jeden Feiertag achtete, täglich mit seiner Frau zur Messe ging und sich darum bemühte, seiner Kirche treu zu dienen. Jetzt machte er sich unverzüglich auf, um der Forderung des Priesters nachzukommen, allerdings in einem Tempo, das sein Tier in der Hitze der kupfernen Sonne schonte.
Als er in der Hieronymiten-Abtei ankam, läuteten gerade die Glocken, deren schmelzender Klang die Gläubigen zum Angelus der Menschwerdung rief, und vier verschwitzte Laienbrüder schleppten einen Korb mit hartem Brot und einen Kessel mit sopa boba herbei, der dünnen Mönchsbrühe, die für die Bedürftigen, welche sich vor dem Tor des Klosters versammelt hatten, die einzige Mahlzeit des Tages sein würde.
Padre Sebastián befand sich zusammen mit Fray Julio Pérez, dem Mesner der Kapelle, im Kreuzgang des Klosters, wo die beiden, ins Gespräch vertieft, auf und ab schritten. Verwundert sah Espina den Ernst in ihren Gesichtern.
Er wirkt verstört, kam es dem Arzt in den Sinn, als der Prior den Mesner fortschickte und Bernardo Espina mit düsterer Stimme in Christi Namen begrüßte.
»In unserem Olivenhain wurde die Leiche eines Jungen gefunden.«
»Der Junge wurde ermordet«, sagte der Priester. Er war ein Mann mittleren Alters mit beständig besorgter Miene, als ängstige er sich, daß Gott nicht zufrieden sei mit seiner Arbeit. Konvertiten gegenüber hatte er sich immer sehr anständig verhalten.
Espina nickte langsam, aber ihm schwante Übles. Es war eine gewalttätige Zeit. Mit leidvoller Regelmäßigkeit wurde jemand tot aufgefunden, doch ist das Leben erst aus einem Menschen gewichen, gibt es keinen Grund mehr, einen Arzt zu rufen.
»Kommt.«
Der Padre Prior führte den Arzt in eine Mönchszelle, in der die Leiche aufgebahrt war. Die Hitze hatte bereits Fliegen angelockt, und der unverwechselbare süßliche Gestank menschlicher Sterblichkeit lag in der Luft. Wegen des Gestanks versuchte er, flach zu atmen, aber es half nichts. Unter der Decke, dem letzten Zugeständnis an die Schicklichkeit, trug die stämmige junge Leiche nur ein Hemd. Es gab Bernardo einen Stich, als er das Gesicht des Jungen erkannte, und er bekreuzigte sich, ohne zu wissen, ob dieser Reflex dem ermordeten jüdischen Jungen oder ihm selbst galt oder von der Anwesenheit des Priesters herrührte.
»Wir wollen die Umstände seines Todes erfahren.« Der Priester sah ihn an. »Alles. Soviel man herausfinden kann«, fügte er hinzu, und der noch immer verwirrte Bernardo nickte.
Eines wußten sie beide bereits. »Das ist Meir, der Sohn von Helkias Toledano«, sagte Bernardo, und der Priester nickte. Der Vater des ermordeten Jungen war einer der besten Silberschmiede von ganz Kastilien.
»Wenn ich mich recht erinnere, war der Junge kaum fünfzehn Jahre alt«, sagte Espina. »Kaum mehr als ein Kind jedenfalls, als der Tod ihn ereilte. Wurde er so gefunden?«
»Ja. Von Fray Angelo, der in der Morgenkühle nach der Frühmette Oliven pflückte.«
»Darf ich ihn untersuchen, Padre Prior?« fragte Espina, und der Prior wedelte ungeduldig mit der Hand.
Das unschuldige Gesicht des Jungen wies keine Verletzungen auf. Auf Brust und Armen waren Blutergüsse zu sehen, ferner eine Sprenkelung auf dem Oberschenkel, drei oberflächliche Stiche auf dem Rücken und ein Schnitt auf der linken Brustseite, über der dritten Rippe. Der Anus war aufgerissen, auf den Hinterbacken klebte Sperma. Und hellrote Blutstropfen auf der durchschnittenen Kehle.
Bernardo kannte die Familie des Jungen, alles fromme und sture Juden, die jene haßten, welche wie er den Glauben ihrer Vorväter aus freien Stücken aufgegeben hatten.
Nach der Untersuchung bat Padre Sebastián den Arzt in die Kapelle, wo sie auf dem harten Steinboden vor dem Altar auf die Knie sanken und ein Vaterunser beteten. Dann trat Padre Sebastián hinter den Altar und zog aus einer Truhe ein kleines Sandelholzkästchen. Er öffnete das Kästchen und nahm ein Rechteck aus stark parfümierter, scharlachroter Seide heraus. Als er das Tuch auffaltete, sah Bernardo Espina ein vertrocknetes und ausgebleichtes Fragment von kaum einer halben Spanne Länge.
»Wißt Ihr, was das ist?«
Der Priester schien den Gegenstand nur sehr widerwillig aus der Hand zu geben. Espina trat in den flackernden Schein der Votivkerzen und betrachtete ihn. »Das Stück eines menschlichen Knochens, Padre Prior.«
»Ja, mein Sohn.«
In diesem Moment befand sich Bernardo auf einer schmalen und schwankenden Brücke über dem Abgrund eines Wissens, das er in langen, geheimen Stunden am Seziertisch erworben hatte. Die Kirche betrachtete das Sezieren als Sünde, aber Espina war noch Jude gewesen, als er bei Samuel Provo in die Lehre ging, einem berühmten jüdischen Arzt, der seit Jahren heimlich sezierte.
Jetzt sah er dem Prior direkt in die Augen. »Ein Teilstück des Femurs, des größten Knochens im Körper. Dies hier stammt von knapp oberhalb des Knies.«
Er untersuchte den uralten Knochen und vermerkte seine Masse, die Winkelbildung, die charakteristischen Erhebungen und Gruben. »Er stammt vom rechten Bein einer Frau.«
»Und das alles erkennt Ihr nur durch bloßes Ansehen?«
»Ja.«
Das Kerzenlicht lag wie ein gelber Glanz auf den Augen des Priors. »Es ist das heiligste Bindeglied zu unserem Erlöser.«
Eine Reliquie.
Bernardo Espina betrachtete interessiert den Knochen. Er hatte nicht erwartet, einer heiligen Reliquie einmal so nahe zu kommen. »Ist es der Knochen eines Märtyrers?«
»Es ist ein Knochen der Santa Ana«, sagte der Prior leise.
Espina brauchte einen Augenblick, bis er begriffen hatte. Die heilige Anna, Mutter von La Virgen María? Das kann nicht sein, dachte er und war entsetzt, als er merkte, daß er den Gedanken laut ausgesprochen hatte.
»O doch, mein Sohn. Bestätigt von jenen, die sich in Rom mit solchen Dingen beschäftigen, und uns gesandt von Seiner Eminenz Rodrigo Kardinal Lancol.«
Espinas Hand, die den Gegenstand hielt, zitterte, wie man es bei jemandem, der seit Jahren als guter Chirurg arbeitete, nicht erwarten würde. Behutsam gab er dem Priester den Knochen zurück und sank dann wieder auf die Knie. Nachdem er sich schnell bekreuzigt hatte, stimmte er gemeinsam mit Padre Prior Sebastián ein neues Gebet an.
Als sie etwas später wieder draußen in der heißen Sonne standen, bemerkte Espina, daß sich mehrere bewaffnete Männer, die offensichtlich keine Mönche waren, auf dem Gelände der Abtei aufhielten.
»Habt Ihr den Jungen gestern abend noch lebendig gesehen, Padre Prior?« fragte Espina.
»Ich habe ihn nicht gesehen«, sagte Padre Sebastián und erklärte ihm nun endlich, warum er ihn hatte rufen lassen.
»Die Abtei hatte den Silberschmied Helkias beauftragt, ein Reliquiar aus getriebenem Silber und Gold anzufertigen. Es sollte ein außergewöhnliches Reliquiar in der Form eines Ziboriums sein, ein würdiges Behältnis für unsere geheiligte Reliquie. Darin sollte diese ruhen, bis wir einen angemessenen Schrein zu Santa Anas Ehren finanzieren und bauen können.
Die Entwürfe des Handwerkers waren großartig und ließen darauf hoffen, daß sich die fertige Arbeit ihres Zweckes würdig erweisen werde.
Der Junge sollte das Reliquiar gestern abend liefern. Als man seine Leiche entdeckte, lag neben ihr eine leere Ledertasche.
Möglicherweise sind die Mörder des Jungen Juden, aber vielleicht sind sie auch Christen. Ihr habt als Arzt Zugang zu vielen Häusern und vielen Leben und seid Christ und zugleich Jude. Ich möchte, daß Ihr herausfindet, wer die Täter sind.«
Bernardo Espina ärgerte sich insgeheim über die gefühllose Ignoranz dieses Geistlichen, der glaubte, ein Konvertit sei überall willkommen. »Ich bin vielleicht der letzte, den Ihr mit einer solchen Aufgabe betrauen solltet, Hochwürdiger Padre.«
»Dennoch.«
Der Priester sah ihn unverwandt und mit der unversöhnlichen Bitterkeit eines Menschen an, der allem Irdischen entsagt hat und jegliche Hoffnung auf das Jenseits setzt. »Ihr werdet diese Diebe und Mörder finden, mein Sohn. Ihr müßt unseren Teufeln zeigen, daß wir gegen sie gewappnet sind. Gottes Werk muß getan werden.«
2. KAPITEL
DAS GESCHENK GOTTES
adre Sebastián wußte, daß Fray Julio Pérez ein Mann unanfechtbaren Glaubens war, jemand, den man zweifellos zum Leiter der Abtei zur Himmelfahrt Mariä ernennen würde, sollte der Tod oder das Schicksal ihn, den Prior, zwingen, sie zu verlassen. Doch der Mesner der Kapelle besaß den Makel einer Unschuld, die zu vertrauensselig war. Padre Sebastián fand es beunruhigend, daß von den sechs Bewaffneten, allesamt hartäugige Männer, die Fray Julio angestellt hatte, um das Kloster zu bewachen, nur drei ihm selbst oder Fray Julio persönlich bekannt waren.
Der Priester war sich schmerzlich bewußt, daß die Zukunft der Abtei, von seiner eigenen ganz zu schweigen, in dem kleinen Holzkästchen lag, das er in der Kapelle versteckt hielt. Der Besitz dieser Reliquie erfüllte ihn mit Dankbarkeit und immer wieder mit Erstaunen, aber sie verstärkte auch seine Angst, denn daß er sie in seiner Obhut hatte, war ebenso eine große Ehre wie eine schreckliche Verantwortung.
Als Junge von kaum zwölf Jahren in Valencia hatte Sebastián Alvarez in der polierten Oberfläche eines schwarzen Keramikkrugs etwas gesehen. Die Vision – denn als solche erkannte er sie – kam ihm, als er mitten in der Nacht, vor der er sich immer fürchtete, plötzlich in der Schlafkammer aufwachte, die er mit seinen Brüdern Augustin und Juan Antonio teilte. Er starrte die schwarze Keramik im mondhellen Zimmer an und sah darin Unseren Herrn Jesus am Kreuz. Sowohl die Gestalt des Herrn als auch das Kreuz waren verschwommen und undeutlich. Alsbald sank er wieder in einen warmen und angenehmen Schlaf, und als er am Morgen aufwachte, war das Bild verschwunden, doch die Erinnerung daran hatte sich seinem Bewußtsein klar und deutlich eingeprägt.
Er verriet niemandem, daß Gott ihm eine Vision geschickt hatte. Seine älteren Brüder hätten ihn ausgelacht und ihn belehrt, er habe wohl nur das Abbild des Vollmonds in dem Krug gesehen. Sein Vater, ein Baron, der glaubte, seine Abstammung und sein Landbesitz gäben ihm das Recht, ein hirnloser Rohling zu sein, hätte ihn geschlagen, weil er sich zum Narren mache, und seine Mutter, eine gedemütigte Frau, die in Angst vor ihrem Gatten lebte, sprach sowieso kaum mit ihren Kindern.
Aber von dieser Nacht der Vision an wußte Sebastián, welche Rolle ihm im Leben beschieden war, und er hatte eine Frömmigkeit an den Tag gelegt, die es seiner Familie einfach machte, ihn in den Dienst der Kirche abzuschieben.
Nach der Priesterweihe hatte er sich zunächst damit zufriedengegeben, in verschiedenen untergeordneten Stellungen zu dienen. Erst im sechsten Jahr nach der Weihe kam ihm schließlich die wachsende Berühmtheit seines Bruders Juan Antonio zugute. Ihr Bruder Augustin hatte Titel und Besitzungen in Valencia geerbt, aber Juan Antonio hatte in Toledo eine vortreffliche Partie gemacht, und die Familie seiner Frau, die mächtigen Borgias, verschaffte Sebastián schließlich eine Stelle am Bischofssitz von Toledo.
Sebastián wurde zum Kaplan eines neuen Hieronymiten-Klosters und zum Gehilfen ihres Priors, Padre Jerónimo Degas, ernannt. Die Abtei zur Himmelfahrt Mariä war ausgesprochen arm. Außer dem winzigen Fleckchen, auf dem die Klostergebäude standen, besaß sie keine eigenen Ländereien, aber sie hatte einen Olivenhain gepachtet, und aus Barmherzigkeit gestattete Juan Antonio den Mönchen, in den Ecken und an den schmalen Rändern seines Landes Wein anzubauen. Auf Geldgeschenke von Juan Antonio oder anderen war dagegen kaum zu hoffen, ebensowenig wie auf wohlhabende Novizen, die in den heiligen Dienst der Kirche treten wollten und dieser ihren Besitz vermachten.
Dennoch gab sich Sebastián Alvarez, als die Mönche ihn nach Padre Jerónimo Degas’ Tod zum Prior erwählten, der Sünde des Stolzes hin; dabei ahnte er, daß die Ehre ihm nur zuteil wurde, weil er Juan Antonios Bruder war.
Die ersten fünf Jahre der Leitung der Abtei zehrten an ihm und seinen Lebensgeistern. Doch in all der quälenden Erbärmlichkeit seines Lebens wagte der Priester noch zu träumen. So war zum Beispiel der riesige Zisterzienserorden von einer Handvoll eifriger Männer gegründet worden, die noch weniger und ärmer waren als seine eigenen Mönche. Sobald eine Gemeinschaft sechzig Männer in weißen Kutten zählte, wurden zwölf von ihnen ausgeschickt, um ein neues Kloster zu gründen, und so hatten sie sich in Jesu Namen über ganz Europa ausgebreitet. Padre Sebastián sagte sich, daß seine bescheidene Abtei dasselbe erreichen könnte, wenn Gott ihnen nur den Weg wies.
Im Jahr des Herrn 1488 war es ein Besucher aus Rom, der bei Padre Sebastián für Aufregung und für eine Aufmunterung der gesamten religiösen Gemeinschaft Kastiliens sorgte. Rodrigo Kardinal Lancol hatte spanische Wurzeln, er war als Rodrigo Borgia in der Nähe von Sevilla geboren worden. Als Jüngling war er von seinem Onkel, Papst Calixtus III., unter die Fittiche genommen worden, und er hatte sich zu einem Mann entwickelt, den man fürchten mußte, ein Mann mit enormer kirchlicher Macht.
Die Alvarez’ waren seit langem Freunde und Verbündete der Borgias, und die Heirat von Elienor Borgia mit Juan Antonio hatte die engen Bande zwischen den beiden Familien noch gestärkt. Juan Antonio war wegen dieser Verbindung mit den Borgias bereits zu einer beliebten Figur bei Hofe geworden und galt sogar als Günstling der Königin.
Elienor war eine Cousine ersten Grades von Kardinal Lancol.
»Wir brauchen eine Reliquie«, hatte Sebastián zu Elienor gesagt.
Er haßte es, seine Schwägerin um etwas zu bitten, denn er konnte sie nicht ausstehen wegen ihrer Eitelkeit, ihrer Unaufrichtigkeit und Gehässigkeit, wenn man sie reizte, aber nun tat er es doch. »Die Reliquie eines Märtyrers, oder vielleicht eines unbedeutenden Heiligen. Wenn Seine Eminenz dem Kloster eine solche Reliquie verschaffen könnte, wäre das unser größtes Glück. Ich bin überzeugt, daß er uns beistehen wird, wenn Ihr ihn nur darum bittet.«
»Ach, das kann ich unmöglich tun.«
Doch Sebastiáns Flehen wurde immer unterwürfiger und beharrlicher, je näher der Zeitpunkt von Lancols Besuch rückte, und schließlich ließ Elienor sich erweichen. Um sich den lästigen Bittsteller vom Hals zu schaffen, und nur ihrem Gatten zuliebe, versprach sie schließlich, Ihr Möglichstes zu tun, um ihm in seinem Anliegen weiterzuhelfen. Es war bekannt, daß der Kardinal in Cuenca, auf dem Gut ihres Onkels Garci Borgia Junez, nächtigen würde.
»Ich werde mit meinem Onkel reden und ihn bitten, für Euch ein gutes Wort einzulegen«, versprach sie Sebastián.
Bevor Kardinal Lancol aus Spanien abreiste, hielt er in der Kathedrale von Toledo eine Messe, die von jedem Mönch, Priester und Prälaten der Region besucht wurde. Nach dem Gottesdienst stand Lancol da, umringt von einer jubelnden Menge, die Kardinalsmitra auf dem Kopf, den riesigen bischöflichen Hirtenstab in der Hand und um den Hals das Pallium, das ihm der Papst verliehen hatte. Sebastián sah ihn von ferne, und ihm war, als erlebte er eine zweite Vision. Den Versuch, sich nach der Messe Lancol zu nähern, wagte er freilich nicht. Elienor hatte berichtet, ihr Onkel habe die Bitte wirklich vorgebracht. Er habe darauf hingewiesen, daß nach jedem der großen Kreuzzüge Ritter und Soldaten aus aller Herren Länder durch Spanien gezogen seien. Jedesmal hätten sie vor ihrer Heimkehr das Land aller heiligen Reliquien beraubt, hätten die Knochen von Märtyrern und Heiligen ausgegraben und aus Kirchen und Kathedralen an ihrem Weg Reliquien fortgeschafft, fast wie es ihnen beliebte. Und dann hatte der Onkel Kardinal Lancol behutsam zu verstehen gegeben, daß er sich der tiefen Bewunderung ganz Kastiliens sicher sein könne, wenn er nur dem spanischen Priester, der ihrer beider angeheirateter Verwandter sei, eine Reliquie sandte.
Sebastián wußte, daß jetzt die Sache von Gott und seinen ernannten Dienern in Rom entschieden würde.
Die Tage vergingen langsam für ihn. Anfangs waren seine Hoffnungen noch kühn; er schwelgte in der Vorstellung, eine Reliquie zu erhalten, die die Macht hatte, christliche Gebete zu erhören, und die gnädige Barmherzigkeit, die Leidenden zu heilen. Solch eine Reliquie würde Gläubige und Spenden von weither anlokken. Aus der kleinen Abtei würde ein großes und blühendes Kloster werden, und der Prior würde …
Doch als aus den Tagen Wochen und Monate wurden, verblaßten solche Träume mehr und mehr. Er hatte schon beinahe alle Hoffnung aufgegeben, als man ihn eines Tages an den Toledaner Bischofssitz bestellte. Gerade war die Kuriertasche aus Rom, die zweimal jährlich nach Toledo geschickt wurde, eingetroffen, und neben anderen Dingen enthielt sie auch eine versiegelte Botschaft für Padre Sebastián Alvarez von der Abtei zur Himmelfahrt Mariä.
Es war sehr ungewöhnlich, daß ein unbedeutender Pfarrer vom Heiligen Stuhl ein versiegeltes Paket erhielt. Weihbischof Guillermo Ramero, der es Sebastián aushändigte, war voller Neugier und wartete ungeduldig darauf, daß der Prior es öffnete, so wie es einem gehorsamen Priester geziemte. Er wurde sehr wütend, als Padre Alvarez das Paket nur entgegennahm und davoneilte.
Erst als Sebastián allein in der Abtei war, erbrach er mit zitternden Fingern das Wachssiegel.
Das Paket enthielt ein Dokument mit dem Titel Translatio Sanctae Annae, und als Padre Sebastián auf einen Stuhl sank und ehrfurchtsstarr zu lesen begann, dämmerte ihm, daß es sich um die Geschichte der sterblichen Überreste der Mutter Unserer Heiligen Jungfrau handelte.
Die Mutter der Jungfrau, Anna die Jüdin, Frau des Joachim, war in Nazareth gestorben und dort begraben worden. Sie wurde von den Christen schon früh verehrt. Bald nach ihrem Tod brachen zwei ihrer Basen, beide mit dem Namen Maria, und ein entfernterer Verwandter namens Maximin aus dem Heiligen Lande auf, um in der Fremde die Botschaft Christi zu verkünden. Besondere Weihe erhielt ihre Mission durch das Geschenk einer hölzernen Truhe mit einer Anzahl Reliquien der Mutter der Heiligen Jungfrau. Die drei überquerten das Mittelmeer und landeten in Marseille, wo die beiden Frauen sich in einem nahen Fischerdorf niederließen, um Bekehrungswillige zu suchen. Da die Gegend häufig überfallen wurde, betrauten sie Maximin mit der Aufgabe, die heiligen Gebeine an einen sicheren Ort zu bringen, und er reiste weiter bis in die Stadt Apt, wo er sie in einen Schrein legte.
Die Knochen blieben viele hundert Jahre in Apt. Doch dann, im achten Jahrhundert, trat eines Tages ein Mann vor den Schrein, den seine Soldaten Carolus Magnus nannten – Karl der Große also, der König der Franken –, und er las mit Verblüffung die Inschrift: Hier ruhen die sterblichen Überreste der heiligen Anna, der Mutter der glorreichen Jungfrau Maria.
Der kriegerische König nahm die Knochen aus ihrem vermoderten Leichentuch, und als er dies tat, spürte er die Gegenwart Gottes und wurde sich staunend bewußt, daß er etwas in den Händen hielt, was ihn direkt mit Jesus Christus verband.
Einige der Reliquien schenkte er seinen engsten Freunden und nahm sich auch selbst ein paar, die er nach Aachen schickte. Er ließ ein Verzeichnis der Gebeine anfertigen und sandte eine Abschrift an den Papst. Den verbliebenen Rest der Reliquien ließ er in der Obhut des Bischofs von Apt und seiner Nachfolger.
Im Jahre des Herrn 800, als Carolus Magnus, der sein militärisches Genie unter Beweis gestellt und innerhalb weniger Dekaden ganz Westeuropa erobert hatte, zum Römischen Kaiser Karl I. gekrönt wurde, prangte die gestickte Gestalt der heiligen Anna auf seinem Krönungsornat.
Der Rest der Reliquien dieser Heiligen war zu diesem Zeitpunkt längst aus dem Grab in Nazareth entfernt worden. Der Großteil war an Kirchen in verschiedenen Ländern gegangen, während drei Knochen in die Obhut des Heiligen Stuhls gelangt waren und mehr als ein Jahrhundert lang in den Katakomben Roms geruht hatten. Im Jahre 830 plünderte ein Reliquiendieb namens Duesdona, ein Diakon der römischen Kirche, die Katakomben, um zwei deutsche Klöster, Fulda und Mannheim, mit Reliquien beliefern zu können. Er verkaufte unter anderem die Überreste der Heiligen Sebastian, Fabian, Alexander, Emmerentia, Felicitas, Felicitissimus und Urban, doch irgendwie übersah er bei seinem Raubzug die drei Knochen der heiligen Anna. Als die kirchlichen Behörden die böse Tat entdeckten, brachten sie Santa Anas Knochen in einen Lagerraum, wo sie jahrhundertelang Staub ansetzten.
Padre Sebastián erhielt nun die Nachricht, daß eine dieser drei kostbaren Reliquien an ihn gesandt werden würde.
Vierundzwanzig Stunden brachte er kniend in der Kapelle mit Dankgebeten zu, von einer Morgenandacht zur nächsten ohne Essen und Trinken. Als er dann versuchte, wieder aufzustehen, hatte er kein Gefühl mehr in den Beinen und wurde von besorgten Mönchen in seine Zelle getragen. Aber schließlich schenkte Gott ihm neue Kraft, und er brachte die Translatio zu Juan Antonio und Garci Borgia. Von Ehrfurcht und Staunen erfüllt, waren sie bereit, die Kosten für ein Reliquiar zu übernehmen, in dem das Fragment aufbewahrt werden konnte, bis ein angemessener Schrein errichtet war. Sie zerbrachen sich den Kopf, welcher berühmte Handwerker mit dieser Aufgabe betraut werden sollte, und schließlich schlug Juan Antonio vor, Sebastián solle den Auftrag für das Reliquiar an Helkias Toledano vergeben, einen jüdischen Silberschmied, der mit seinen einfallsreichen Entwürfen und seinem großen handwerklichen Können schon viel Anerkennung gefunden hatte.
Der Silberschmied und Sebastián hatten sich wegen der Gestaltung des Reliquiars und wegen des Preises besprochen und waren zu einer Übereinkunft gelangt. Dabei kam dem Priester der Gedanke, wie schön es doch wäre, wenn er die Seele dieses Juden für Christus gewinnen könnte, quasi als Ergebnis dieser Arbeit, die der Herr notwendig gemacht hatte.
Die Entwurfszeichnungen, die Helkias angefertigt hatte, zeigten, daß er sowohl Künstler als auch Handwerker war. Die Kelchschale, der quadratische Sockel und der Deckel sollten aus Blatt- und Massivsilber bestehen. Helkias schlug vor, die Figuren von zwei Frauen in Silberfiligran zu gestalten. Nur die Rücken sollten zu sehen sein, anmutig und deutlich weiblich, Anna zur Linken, ihre Tochter Maria noch nicht ganz erwachsen, aber erkennbar an einem Heiligenschein um ihren Kopf. Verzieren wollte Helkias das Ziborium mit einer Fülle von Pflanzen, mit denen Anna vertraut gewesen sein dürfte: Weintrauben und Oliven, Granatäpfel und Datteln, Feigen und Weizen, Gerste und Dinkel. Auf der gegenüberliegenden Seite des Grals – als Vorahnung des Künftigen, von den Frauen so weit entfernt wie die Zukunft – wollte Helkias in massivem Silber das Kreuz gestalten, das erst nach Annas Lebzeiten zum christlichen Symbol werden sollte. Das Jesuskind sollte am Fuß des Kreuzes in Gold prangen.
Padre Sebastián hatte befürchtet, daß die beiden Spender ihre Zustimmung zu dem Entwurf hinauszögern würden, weil sie ihre eigenen Ideen berücksichtigt sehen wollten, doch zu seiner Freude zeigten sich sowohl Juan Antonio als auch Garci Borgia höchst beeindruckt von Helkias’ Zeichnungen.
Innerhalb weniger Wochen wurde ihm klar, daß das bevorstehende Glück der Abtei kein Geheimnis mehr war. Irgend jemand – Juan Antonio, Garci Borgia oder der Jude – hatte mit der Reliquie geprahlt. Vielleicht hatte auch jemand in Rom unklug geplaudert; manchmal war die Kirche ein Dorf.
Mitglieder der religiösen Gemeinde Toledos, die Sebastián bis dahin nie Beachtung geschenkt hatten, starrten ihn jetzt an, doch er merkte, daß Feindseligkeit in ihren Blicken lag. Eines Tages besuchte sogar Weihbischof Guillermo Ramero die Abtei und inspizierte Kapelle, Küche und Mönchszellen.
»Die Eucharistie ist der Leib Christi«, belehrte er Sebastián. »Welche Reliquie kann mächtiger sein als diese?«
»Keine, Euer Exzellenz«, erwiderte Sebastián bescheiden.
»Wenn Toledo eine Reliquie der Heiligen Familie zum Geschenk erhält, dann sollte das Bistum sie besitzen und nicht eine ihm untergeordnete Einrichtung«, sagte der Bischof.
Diesmal erwiderte Sebastián nichts, sondern erwiderte offen und ohne die vorherige Bescheidenheit Rameros Blick, und der Bischof schnaubte vor Wut und schritt mit seinem Gefolge davon.
Bevor Padre Sebastián sich dazu durchringen konnte, Fray Julio diese bedeutsame Nachricht mitzuteilen, hatte der Mesner der Kapelle es bereits von einem Vetter erfahren, der Priester im Offizium für Glaubensangelegenheiten der Diözese war. Bald war es für Sebastián offensichtlich, daß jeder Bescheid wußte, seine eigenen Mönche und Novizen eingeschlossen.
Fray Julios Vetter berichtete, daß die verschiedenen Orden prompt und heftig auf die Nachricht reagiert hätten. Sowohl Franziskaner als auch Benediktiner hatten deutlich formulierte Protestnoten nach Rom geschickt. Die Zisterzienser, bei denen die Verehrung der Jungfrau im Mittelpunkt stand, waren wütend darüber, daß eine Reliquie der Mutter Mariä an eine kleine Abtei der Hieronymiten ging, und hatten sich einen Advokaten besorgt, der ihren Fall in Rom vortrug.
Selbst innerhalb des Hieronymiten-Ordens wurden Stimmen laut, daß eine so kostbare Reliquie nicht an eine so unbedeutende Abtei gehen solle.
Padre Sebastián und Fray Julio war klar, daß die Abtei in eine sehr gefährliche Lage geraten würde, falls irgend etwas die Lieferung der Reliquie verhindern sollte, und die beiden verbrachten viele Stunden kniend im gemeinsamen Gebet.
Doch schließlich kam an einem warmen Sommertag ein großer, bärtiger Mann in der ärmlichen Kleidung eines peón in die Abtei zur Himmelfahrt Mariä. Bei seinem Eintreffen wurde eben die sopa boba ausgegeben, die er so begierig wie die anderen hungrigen Bedürftigen annahm. Als er den letzten Tropfen der dünnen Brühe getrunken hatte, fragte er namentlich nach Padre Sebastián, und als die beiden allein waren, stellte er sich als Padre Tullio Brea vom Heiligen Stuhl in Rom vor und übermittelte ihm die Grüße Seiner Eminenz Rodrigo Kardinal Lancol. Dann zog er aus seiner zerlumpten Tasche ein hölzernes Kästchen. Als er es öffnete, fand Padre Sebastián darin ein stark parfümiertes Tuch aus blutroter Seide, und darin eingewickelt lag das lang erwartete Knochenstück, das eine so weite Reise hinter sich hatte.
Der italienische Priester blieb gerade so lange, um die freudigste und dankbarste Vesper mitzuerleben, die man in der Abtei zur Himmelfahrt Mariä je gefeiert hatte. Das Abendgebet war kaum vorüber, als Padre Tullio, so unauffällig wie er gekommen war, wieder abreiste und in die Nacht davonritt.
In der nun folgenden Zeit dachte Padre Sebastián mit Wehmut daran, wie sorgenfrei der Dienst an Gott sein mußte, wenn man in Verkleidung die Welt durchwanderte. Er bewunderte den Scharfsinn der Entscheidung, ein so kostbares Gut mit einem einzelnen und unauffälligen Boten zu schicken, und übermittelte dem Juden Helkias den Vorschlag, das Reliquiar nach seiner Fertigstellung ebenfalls von einem einzelnen Träger und erst nach Einbruch der Dunkelheit liefern zu lassen.
Helkias war damit einverstanden, und er schickte seinen Sohn aus, wie Gott es einst getan hatte und mit dem gleichen Ergebnis. Der tote Junge Meir war Jude und konnte deshalb nie ins Paradies kommen, aber Padre Sebastián betete dennoch für seine Seele. Der Raubmord zeigte ihm, wie belauert die Beschützer der Reliquie waren, und so betete er auch für den Erfolg des Arztes, den er ausgeschickt hatte, um Gottes Werk zu verrichten.
3. KAPITEL
EIN CHRISTLICHER JUDE
er Padre Prior war das gefährlichste aller menschlichen Wesen, denn er war ein weiser Mann und ein Narr zugleich, dachte Bernardo niedergeschlagen, als er davonritt. Bernardo Espina wußte, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach weder von Juden noch von Christen etwas erfahren würde, denn er wurde von den Anhängern beider Religionen verachtet.
Zu gut kannte er auch die Geschichte seiner eigenen Familie. Der Legende nach war der Vorfahr, der sich als erster in Spanien niedergelassen hatte, ein Priester im Tempel Salomos gewesen. Die Espinas hatten die westgotischen Könige und die wechselnden maurischen und christlichen Eroberer überlebt und sich immer genau an die Gesetze der Monarchie und der Nation gehalten, wie es ihre Rabbis vorschrieben.
Juden waren bis in die höchsten Ränge der spanischen Gesellschaft aufgestiegen. Sie hatten den Königen als Wesire gedient, und sie waren reich geworden als Ärzte und Diplomaten, Geldverleiher und Finanziers, Steuereintreiber und Händler, Gutsbesitzer und Handwerker. Und doch waren spanische Juden in fast jeder Generation abgeschlachtet worden von einem Pöbel, der von der Kirche aktiv oder passiv unterstützt wurde.
»Juden sind gefährlich und einflußreich, denn sie treiben gute Christen in den Zweifel« – so die eindringliche Ermahnung des Priesters, der Bernardo getauft hatte.
Jahrhundertelang hatten Dominikaner und Franziskaner die unteren Schichten – die sie pueblo menudo, die »kleinen Leute«, nannten – aufgehetzt und sie zuzeiten in einen unversöhnlichen Judenhaß getrieben. Seit dem Gemetzel des Jahres 1391 – fünfzigtausend ermordete Juden – hatten in der einzigen Massenkonversion in der jüdischen Geschichte Hunderttausende von Juden Christus anerkannt, einige, um ihr Leben zu retten, andere, um in einer judenhassenden Gesellschaft Karriere machen zu können.
Manche, wie Espina, hatten Jesus tatsächlich ihr Herz geöffnet, aber viele der nominellen Christen beteten weiterhin ihren Gott des Alten Testaments an, so viele, daß im Jahr 1478 Papst Sixtus IV. die Gründung der Heiligen Inquisition genehmigte, welche abtrünnige Christen aufstöbern und vernichten sollte.
Espina hatte gehört, daß einige Juden die Konvertiten los marranos nannten, die Schweine, und davon überzeugt waren, daß sie auf ewig verdammt seien und zum Jüngsten Gericht nicht mehr auferstehen würden. Andere, Barmherzigere, nannten die Apostaten anusim, die Gezwungenen, und sie glaubten, daß Gott jenen, die unter Zwang gehandelt hatten, vergeben werde, weil er ihren Überlebenswillen verstehe.
Espina gehörte nicht zu den Gezwungenen. Schon als kleiner Junge hatte ihn dieser Jesus fasziniert, wenn er durch die offenen Türen der Kathedrale einen Blick auf die Gestalt am Kreuz erhaschte, die sein Vater manchmal »den Hingerichteten« nannte. Als junger ärztlicher Lehrling, dem es ein Anliegen war, das Leid der Menschen zu lindern, war er empfänglich für das Leiden Christi, und sein anfängliches Interesse entwickelte sich mit der Zeit zu Überzeugung und zu brennendem Glauben und schließlich zu einer Sehnsucht nach persönlicher christlicher Reinheit, nach dem Stand der Gnade.
Nachdem er sich Jesus erst einmal verschrieben hatte, verliebte er sich auch in den neuen Gott. Für ihn war das eine viel stärkere Liebe als die eines Menschen, der einfach ins Christentum hineingeboren worden war. Die Jesus-Leidenschaft eines Saulus von Tarsus hätte nicht stärker sein können als die seine; sie war unerschütterlich und sicher und verzehrender als jede Sehnsucht eines Mannes nach einer Frau.
Seine Konversion zum Christentum hatte Bernardo Espina in seinem zweiundzwanzigsten Lebensjahr erbeten und erhalten, ein Jahr nach dem Abschluß seiner Ausbildung zum Arzt. Seine Familie hatte getrauert und das Kaddisch aufgesagt, als wäre er gestorben. Sein Vater Jakob, der ihn zuvor mit Stolz und Inbrunst geliebt hatte, war auf der plaza an ihm vorübergegangen, ohne seinen Gruß zu erwidern, als würde er ihn nicht kennen; zu dieser Zeit befand er sich bereits in seinem letzten Lebensjahr. Erst eine Woche nach der Beerdigung seines Vaters erfuhr Bernardo überhaupt, daß er gestorben war. Er hatte eine Novene für ihn gehalten, aber er hatte auch dem Verlangen nicht widerstehen können, das Kaddisch für ihn aufzusagen, und so weinte er alleine in seiner Schlafkammer, während er ohne die tröstende Anwesenheit des Minjan das Totengebet rezitierte.
Wohlhabende oder erfolgreiche Konvertiten wurden vom Adel und der Mittelklasse akzeptiert und heirateten in alte Christenfamilien ein. Und auch Bernardo Espina hatte sich mit einer Christin vermählt, mit Estrella de Aranda, der Tochter einer adligen Familie. In der Euphorie, die diese Aufnahme in die Familie und seine neue religiöse Verzückung mit sich brachten, hatte er – gegen besseres Wissen – gehofft, daß seine Glaubensbrüder ihn als »vollendeten Juden«, der ihren Messias angenommen hatte, akzeptieren würden, aber er war auch nicht überrascht, als sie ihn weiterhin als Hebräer verspotteten.
Bereits als Espinas Vater noch ein junger Mann war, hatte der Magistrat von Toledo einen Erlaß veröffentlicht:
Wir erklären hiermit, daß die sogenannten conversos, Nachkommen verderbter jüdischer Ahnen, von Rechts wegen für niederträchtig und gemein erachtet werden müssen, für ungeeignet und unwürdig, innerhalb der Grenzen der Stadt Toledo und seiner Gerichtsbarkeit ein öffentliches Amt zu bekleiden oder ein Lehen zu erhalten oder Eide oder Urkunden zu beglaubigen oder sonstwelche Machtbefugnisse über wahre Christen der Heiligen Katholischen Kirche auszuüben.
Heute nun, an diesem Sommertag des Jahres 1489, ritt Bernardo an mehreren klösterlichen Gemeinschaften vorbei, einige kaum größer als die Abtei zur Himmelfahrt Mariä, andere von der Größe kleiner Dörfer. Unter der katholischen Monarchie war in Spanien der Dienst in der Kirche sehr beliebt geworden. Segundones, die jüngeren Söhne adliger Familien, die nach dem Ältestenrecht von der Erbfolge ausgeschlossen waren, wandten sich dem religiösen Leben zu, in dem ihnen dank ihrer Familienverbindungen ein schneller Aufstieg sicher war. Die jüngeren Töchter derselben Familien wurden wegen der riesigen Mitgift, die nötig war, um weibliche Erstgeborene zu verheiraten, oft gezwungen, Nonnen zu werden. Und selbst die ärmsten Bauern zog es in den Kirchendienst, denn ein Priesteramt mit einer Pfründe stellte für viele die einzige Möglichkeit dar, der erdrückenden Armut der Leibeigenschaft zu entfliehen.
Die wachsende Zahl klösterlicher Gemeinschaften hatte zu heftigen und häßlichen Kämpfen um finanzielle Unterstützung geführt. Das war auch der Nährboden für die Auseinandersetzung um die Reliquie der heiligen Anna. Für die Abtei zur Himmelfahrt Mariä mochte sie ein Glücksbringer sein, aber der Prior hatte Bernardo erzählt, daß es Ränke und Intrigen unter den mächtigen Benediktinern, den verschlagenen Franziskanern und den aufstrebenden Hieronymiten gebe – und allein Gott wisse, unter wie vielen anderen –, die allesamt in den Besitz dieser Reliquie der Heiligen Familie kommen wollten. Espina war unbehaglich zumute, denn er befürchtete, zwischen diese mächtigen Fraktionen zu geraten und einfach zerquetscht zu werden – so wie es offenbar auch mit Meir Toledano geschehen war.
Als erstes machte sich Bernardo daran herauszufinden, was dem Jungen in den letzten Stunden vor seiner Ermordung widerfahren war.
Das Haus von Helkias dem Silberschmied lag zusammen mit mehreren anderen Gebäuden zwischen zwei Synagogen. Seit die Hauptsynagoge von der Heiligen Mutter Kirche übernommen worden war, feierten die Juden ihre Gottesdienste in der Samuel-Halewi-Synagoge, einem prachtvollen Gebäude und Ausdruck einer Zeit, in der das Leben noch einfacher für sie alle gewesen war.
Die jüdische Gemeinde war so klein, daß jeder wußte, wer unter ihnen vom Glauben abgefallen war, wer bloß so tat und wer Jude geblieben war. Kontakt mit Neuen Christen pflegte man nur, wenn es unvermeidlich war. Und trotzdem hatte vier Jahre zuvor ein verzweifelter Helkias den Arzt Espina aufgesucht.
Seine Gattin Esther, eine wohltätige Frau und Sproß der großen Rabbinerfamilie der Salomos, war plötzlich immer schwächer geworden, und der Silberschmied hatte nur noch den einen Gedanken gehabt, die Mutter seiner drei Söhne zu retten. Bernardo hatte sich große Mühe mit ihr gegeben, er hatte alles getan, was in seiner Macht stand, und auch Christus um ihr Leben angefleht, so wie Helkias zu Jahwe gebetet hatte. Aber er hatte sie nicht retten können. Sie war gestorben, möge Gott ihrer ewigen Seele gnädig sein.
Jetzt eilte er an Helkias’ Haus des Unglücks vorbei, ohne innezuhalten, denn er wußte, daß bald zwei Mönche der Abtei zur Himmelfahrt Mariä einen burro hierherführen würden, der die sterblichen Überreste des erstgeborenen Sohnes heim zu seinem Vater trug.
Frühere Generationen hatten die Synagogen vor Jahrhunderten erbaut und dabei die uralte Vorschrift beachtet, daß ein Gotteshaus an der höchsten Stelle der Gemeinde errichtet werden müsse. So hatten sie als Bauplatz das steile Hochufer über dem Fluß Tajo gewählt.
Bernardos Stute scheute, als sie sich der Kante zu sehr näherten.
Mutter Gottes, dachte er und zog die Zügel an; und als das Pferd sich wieder beruhigt hatte, fiel ihm die Reliquie ein, mit der das alles begonnen hatte.
»Großmutter des Erlösers!« rief er, wider Willen schmunzelnd.
Er stellte sich vor, wie Meir ben Helkias hier auf seinem Weg zur Abtei ungeduldig auf den Schutz der Dunkelheit gewartet hatte. Angst vor den Klippen hatte der Junge gewiß keine gehabt. Und Bernardo erinnerte sich an manch einen Abend seiner eigenen Jugend, als er mit seinem Vater, Jakob Espina, auf diesem Hochufer gestanden und den sich verdüsternden Himmel nach dem Funkeln der ersten drei Sterne abgesucht hatte, die das Ende des Sabbat ankündigten.
Er schob den Gedanken beiseite, wie er es mit jeder verstörenden Erinnerung an seine jüdische Vergangenheit tat.
Es war gewiß klug von Helkias gewesen, einen Fünfzehnjährigen allein mit der Lieferung des Reliquiars zu betrauen, das erkannte Bernardo jetzt. Eine bewaffnete Wache hätte allerlei Gesindel auf den Plan gerufen, das sofort geahnt hätte, daß hier etwas Kostbares unterwegs war. Dagegen hatte ein Junge, der ein unauffälliges Bündel durch die Nacht trug, gewiß bessere Aussichten, ans Ziel zu kommen.
Eine trügerische Hoffnung, wie sich gezeigt hatte.
Espina stieg ab und führte das Pferd auf den Pfad, der zum Fluß hinabführte. Knapp unterhalb der Kante stand eine Steinhütte, die vor langer Zeit von den Römern erbaut worden war; von dort hatte man Verurteilte in den Tod gestürzt. Tief unter ihm schlängelte sich der Fluß in unschuldiger Schönheit zwischen dem Hochufer und einem Granithügel am anderen Ufer dahin. Jünglinge, die in Toledo aufwuchsen, mieden nachts diesen Ort, denn es ging das Gerücht, daß man hier noch immer das Wehklagen der Toten hören konnte.
Er geleitete sein Pferd den Pfad hinunter, bis aus dem steilen Abhang eine sanftere Böschung wurde, bog dann ab und folgte einem Weg, der ihn bis an den Wasserrand führte. Die Alcántara-Brücke war nicht für ihn passierbar, selbst Meir ben Helkias hatte sie wohl kaum benutzt. Nach einer kurzen Strecke flußabwärts kam Bernardo zu der Furt, auf der auch der Junge vermutlich den Fluß überquert hatte, und dort bestieg er wieder sein Pferd.
Am anderen Ufer mündete ein kleiner Weg, der zur Abtei zur Himmelfahrt Mariä führte. Nur einen Steinwurf entfernt lag fettes und fruchtbares Ackerland, aber hier war die Erde dürftig und trocken, gerade gut genug, um ein paar Tiere darauf mehr schlecht als recht grasen zu lassen.
Kurz darauf hörte Espina denn auch das Blöken von Schafen und traf auf eine Herde, die das kurze Gras abweidete, nur von einem alten Mann bewacht. Espina kannte ihn; er hieß Diego Diaz. Der Schäfer besaß eine weitverzweigte Familie, die fast so groß war wie seine Herde, und Espina hatte schon eine ganze Reihe seiner Verwandten behandelt.
»Einen guten Nachmittag, Señor Bernardo.« »Einen guten Nachmittag, Señor Diaz«, sagte Espina und stieg ab. Er ließ das Pferd mit den Schafen grasen, plauderte ein wenig mit dem Schäfer und fragte dann: »Diego, kennt Ihr einen Jungen namens Meir, den Sohn von Helkias dem Juden?«
»Meint Ihr den Neffen von Aaron Toledano dem Käser, Señor?«
»Ja. Wann habt Ihr ihn das letzte Mal gesehen?«
»Gestern am frühen Abend. Er war unterwegs, um Käse für seinen Onkel auszuliefern, und für nur einen Sueldo hat er mir einen Ziegenkäse verkauft, den ich heute morgen zum Frühstück verzehrt habe. Das war ein Käse, davon hätte er mir zwei geben können.« Er sah Espina an. »Warum sucht Ihr ihn? Hat er etwas ausgefressen, der Kleine?«
»Nein. Ganz und gar nicht.«
»Das dachte ich mir schon, der ist nämlich kein schlechter Junge, dieser Meir.«
»Waren gestern abend auch andere hier in der Gegend unterwegs?« fragte Espina, und der Schäfer sagte ihm, kurz nachdem der Junge weggegangen war, seien zwei Bewaffnete vorbeigekommen, die ihn beinahe niedergeritten hätten. Er habe sie freilich nicht angesprochen, und auch sie hätten ihn keines Wortes gewürdigt.
»Zwei, sagt Ihr?« Bernardo wußte, daß er sich auf die Angaben des alten Mannes verlassen konnte. Der Schäfer hatte die beiden Männer sicher sehr genau beobachtet, konnte er doch froh sein, daß zwei bewaffnete nächtliche Reiter an ihm vorbeizogen, ohne anzuhalten und ihm ein oder zwei Lämmer abzunehmen.
»Der Mond stand hoch am Himmel. Ich sah Bewaffnete, einen Ritter sicherlich, denn er trug ein Kettenhemd. Und einen Priester oder Mönch, die Farbe seines Gewandes habe ich nicht behalten. Er zögerte. Der Priester hatte das Gesicht eines Heiligen.« »Welchem Heiligen ähnelte er?« »Keinem bestimmten«, sagte der Schäfer, dem es schon lästig wurde. »Ich wollte damit sagen, daß er ein schönes, von Gott geschaffenes Gesicht hatte, heilige Züge«, sagte er und bekreuzigte sich.
Diego grunzte und lief davon, um seinen Hund vier Schafen nachzuschicken, die sich von der Herde entfernten.
Seltsam, dachte Bernardo. Ein von Gott geschaffenes Gesicht?
Dabei nahm er seine Stute am Zügel und stieg auf. »Seid mit Christus, Señor Diaz.«
Der alte Mann warf ihm einen schelmischen Blick zu. »Christus sei mit Euch, Señor Espina«, sagte er.
Ein kurzes Stück hinter den mühsam weidenden Schafen wurde die Erde fetter und fruchtbarer. Bernardo ritt durch Weingärten und einige Felder. In dem Feld neben dem Olivenhain der Abtei hielt er an, stieg ab und band die Zügel des Pferdes an einen Busch.
Das Gras war von Hufen platt gedrückt und zertrampelt. Das schien tatsächlich zu den zwei Pferden zu passen, die der Schäfer gesehen hatte.
Irgend jemand hatte von dem Auftrag des Silberschmieds erfahren und vermutlich, als Helkias kurz vor dem Abschluß der Arbeit stand, sein Haus beobachten lassen, um die Lieferung abzupassen.
An genau dieser Stelle war Meir seinen Mördern begegnet.
Die Schreie des Jungen hatte niemand gehört. Der von der Abtei gepachtete Olivenhain lag in freiem, unbewohntem Gelände, einen strammen Fußmarsch vom Kloster entfernt.
Blut. Hier hatte der Junge den Stich in die Seite erhalten, vermutlich von einer ihrer Lanzen.
Über dieses platt getrampelte Stück Gras, das Bernardo jetzt langsam abging, hatten die Reiter Meir ben Helkias vor ihren Pferden hergetrieben wie einen gejagten Fuchs und ihm dabei die Wunden an seinem Rücken beigebracht.
Hier hatten sie ihm den Lederbeutel samt Inhalt abgenommen. Gleich daneben lagen, von Ameisen bedeckt, zwei helle Käse der Art, wie Diego sie beschrieben hatte – der Vorwand des Jungen für seinen nächtlichen Botengang. Ein Käse war noch ganz, der zweite war zerdrückt, wie von einem großen Huf.
Und hier hatten sie ihn vom Pfad in den Olivenhain gejagt, der ihnen zusätzlichen Schutz bot. Hier war er geschändet worden, von einem oder von beiden.
Schließlich hatte man ihm die Kehle durchgeschnitten.
Bernardo wurde schwindelig. Plötzlich fühlte er sich sehr schwach.
Er war noch nicht so weit weg von seiner jüdischen Knabenzeit, um sich nicht mehr an die Angst zu erinnern, an die Furcht vor bewaffneten Fremden, an das Wissen um die Greuel, weil in all den Jahren so viel Böses passiert war. Und er war auch noch nicht so weit weg von seinem jüdischen Leben als Erwachsener, um diese Dinge nicht noch immer zu empfinden.
Einen Augenblick lang war er in seiner Vorstellung dieser Junge. Er hörte sie. Roch sie. Spürte die ungeheuren, bedrohlichen Gestalten der Nacht, die riesigen Pferde, die immer näher kamen, ihn niederritten.
Das grausame Stechen scharfer Klingen. Die Schändung.
Mit einemmal wieder Arzt, wankte Bernardo blindlings auf seine Stute zu. Die Sonne war am Sinken, und er mußte weg von hier. Vielleicht würde es ihm ja erspart bleiben, die Seele Meir ben Helkias’ schreien zu hören, aber er hatte trotzdem wenig Lust, sich an diesem Ort aufzuhalten, wenn die nächste Dunkelheit hereinbrach.
4. KAPITEL
DAS VERHÖR
s war so, wie Espina bereits vermutet hatte: Über den Mord an dem jüdischen Jungen und den Raub des Ziboriums fand er nur sehr wenig heraus. Fast alles, was er wußte, hatte er bei seiner Untersuchung der Leiche, der Unterhaltung mit dem Schäfer und der Besichtigung des Tatorts erfahren. Die einzig sichere Erkenntnis nach einer Woche ergebnislosen Herumfragens in der Stadt war, daß er seine Patienten vernachlässigt hatte, und so stürzte er sich wieder in seinen sicheren und tröstenden ärztlichen Arbeitsalltag.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!