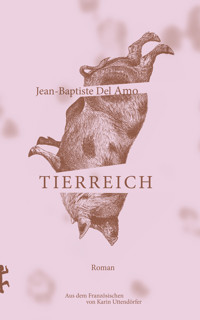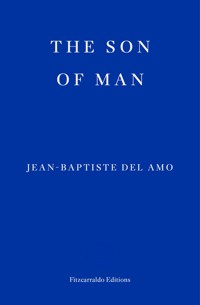Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach Jahren der Abwesenheit taucht er plötzlich wieder auf: Der Mann steht am Hauseingang, eine Zigarette im Mundwinkel, und mustert den Sohn. Das harmonische Duo aus Mutter und Kind soll wieder eine vollständige Familie werden, der Vater will beweisen, dass er sich zum Guten verändert hat, und bringt die beiden nach Les Roches, zu jenem abgeschiedenen Haus in den Bergen, in dem er selbst mit einem erbarmungslosen Vater aufgewachsen war. Ein Sommer im Gebirge verspricht, die drei näher zusammenzubringen. Doch eingeschlossen von der weiten, atemberaubenden Natur geraten Mutter und Sohn zunehmend unter die Kontrolle und Macht des Vaters, der, von eigenen Glaubenssätzen gefangen, ihre neue Existenz bestimmt. In Schlaglichtern treten unausgesprochene Zwiste, brodelnde Geheimnisse und verdrängte Gefühle zutage und offenbaren, dass es aus diesem Familienausflug kein Zurück mehr gibt. In beeindruckenden, bildgewaltigen Sätzen zeichnet Del Amo mit Der Menschensohn die einengenden Prägungen und Verhältnisse, die über Generationen hinweg von den Vätern auf die Söhne übertragen werden und denen sich niemand zu entziehen weiß, sosehr er es auch versucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Menschensohn
Jean-Baptiste Del Amo
DER MENSCHEN SOHN
ROMAN
Aus dem Französischen
von Karin Uttendörfer
»Und die rasende Wut der Väter wird wieder aufleben bei den Söhnen in jeder Generation.«
Seneca, Thyestes
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Impressum
Der Anführer hält inne, hebt das Gesicht zum Himmel und für den Bruchteil einer Sekunde deckt sich der dunkle Kreis seiner Pupille mit dem weißen Kreis der Sonne, der Stern trifft blitzartig die Netzhaut und das im Mutterschlamm kriechende Wesen wendet den Blick ab, um das Tal zu betrachten, durch das es zusammen mit den Seinen zieht: Eine von den Winden gepeitschte Heide mit karger Vegetation, durchsetzt von kümmerlich gewachsenen Sträuchern; eine trostlose Erde, über der das Bild des Tagesgestirns als Negativ schwebt, ein schwarzer Mond über dem Horizont.
Sie wandern seit Tagen in Richtung Westen gegen den beißenden Herbstwind. Struppige Bärte verdecken das harte Gesicht der Männer. Frauen mit geröteten Gesichtern tragen unter abgewetzten Fellen ihre Neugeborenen. Viele werden unterwegs sterben, von der Kälte blau gefroren oder von der Ruhr dahingerafft, wenn sie vom fauligen Wasser aus den Wasserlöchern trinken, an denen die wilden Herden ihren Durst löschen. Mit den bloßen Fingern oder mit ihren Klingen werden die Männer für sie traurige Löcher in den Boden graben.
Dort hinein werden sie den eingewickelten Körper legen, der in der Nacht des Grabs noch kümmerlicher erscheinen wird; sie werden ein paar entbehrliche Sachen hineingleiten lassen, das Fell, in dem das Kind sich zusammenrollte, ein Püppchen aus Hanf, eine Kette aus Knochen, die sich bald unterschiedslos mit denen des kleinen Toten vermischen. Sie werden ihm ein paar Handvoll Erde ins Gesicht werfen, die seine Augen und seinen Mund verschließen, dann werden sie schwere Steine auf den Grabhügel legen, um den sterblichen Überrest vor Aasfressern auf Nahrungssuche zu schützen. Schließlich werden sie weiterziehen, und allein die Mutter wirft vielleicht einen letzten Blick über ihre Schulter in Richtung des kleinen funkelnden Erdwalls, der schnell vom Schatten eines Hügels verschluckt wird.
Ein alter Mann schleppt seinen abgemagerten Körper unter einem fettigen Fell, dessen Haare sich im Rhythmus der Windböen wiegen. Früher einmal hat er selbst die Gruppe geführt, über die Hochebenen und die Täler, entlang der Wasserläufe mit dicht gesäumten Ufern, hin zu fruchtbaren Erden, milden Himmeln. Nun folgt er mit großer Mühe jenen, die jünger und kühner sind als er, die an der Spitze des Zuges gehen, die am Ende des Tages beschließen, das Lager aufzuschlagen, und im Morgengrauen, es wieder abzubrechen. Und vielleicht entzünden sie am Eingang einer Höhle, bei der sie Halt machen, ein Feuer, das die Nacht aufreißt und dessen Flammen die Umrisse von Höhlenwesen beleuchten, die andere vor ihnen im zitternden Schein einer Fettlampe gezeichnet haben.
Im Herzen der Finsternis pressen sie ihre rauen Leiber unter den großen Fellen, aus denen nur ihre Gesichter hervorschauen, eng aneinander. Ihr Atem dampft und ihre Augen bleiben lange geöffnet, während die Mütter versuchen, weinende, ihre Lippen an Brustwarzen reibende Säuglinge zu beruhigen. Manche der Männer sprechen mit leiser Stimme, sie entfachen die Glut, die rotglimmend aufsteigt – ihr Widerschein huscht wie ein Satellit durch die Iris der nächtlichen Wächter –, sie schwirrt umher, als strebte sie danach, in die himmlische Weite zu gelangen, wo andere Gestirne verbrennen, ehe sie vom gierigen Herzen der Nacht verschlungen werden.
Die sie bedeckenden Felle ermöglichen eine Promiskuität, die sie zur Paarung drängt. Manchmal, ohne Rücksicht auf das Kind, das sie noch an ihrem Bauch wärmt, packt das Männchen den Hintern, den das Weibchen ihm kaum unterscheidbar hinhält oder aber verweigert, traktiert das Geschlecht, das er zuvor mit seiner dickflüssigen Spucke benetzt hat, und windet sich zuckend, bis er sich in ihr entlädt. Ehe es ihren Oberschenkel hinunterläuft, während sie wieder einschläft, wird das Sperma vielleicht das Weibchen befruchten, das dann, die Zähne in einem Stück Holz verbissen, drei Jahreszeiten später im Schatten eines Strauches gebären wird, in der Nähe eines von der Gruppe für die Zeit der Niederkunft aufgeschlagenen Lagers.
In der Hocke, gehalten von den Armen anderer Frauen, die abwechselnd ihre Stirn, ihre Waden, ihr Geschlecht abtupfen, wird sie die Frucht ihrer Begattung direkt auf den Boden ausstoßen oder aber in die Hände einer Hebamme. Mit der Klinge eines Feuersteins wird die Nabelschnur durchschnitten werden. Das ins Licht gezogene und auf den leeren Beutel des Bauches gelegte kriechende Ding wird das Kolostrum aus der Zitze trinken und so den für sein Überleben notwendigen Kreislauf einleiten, in dem es unaufhörlich die Welt verschlingen und wieder ausscheiden wird.
Falls das Kind die ersten Sommer und die ersten Winter überlebt, falls sein sterblicher Überrest sich nicht zu den bereits zurückgelassenen gesellt – ein solcher, vom Marder zu einem kleinen Teich getragen, erhält sich eine Zeitlang noch als halb im Schlamm steckender Brustkorb, und aus dem Rippenbogen, ehe dieser zu Staub zerfällt, sprießt der knochenweiße Stängel eines Ackerschachtelhalms hervor –, wird es bald mit den Seinen laufen, in ihre Mitte aufgenommen, wird den Weg der Sterne entziffern, Steine zerschlagen, um Feuer und Klingen aus ihnen zu gewinnen, das Geheimnis der Pflanzen kennenlernen, Wunden verbinden und die Körper der Toten für ihre letzte Reise vorbereiten.
Vielleicht wird dem Kind ein Aufschub gewährt und es erreicht jenes Stadium, in dem sein bereits ermüdetes Fleisch ihm befiehlt, sich fortzupflanzen. Dann wird es ohne Unterlass danach streben, mit einem der Seinen zu verschmelzen, wird wahllos und tastend ein anderes dieser elendigen Wesen umarmen, in der Kälte einer flammenden Nacht, während die Milchstraße über ihnen den Himmel verwirbelt. Nachdem es wandernd ein Stück Erde erkundet, eine Handvoll fahler Morgengrauen und Dämmerungen erlebt, die Leuchtkraft der Kindheit ebenso erfahren hat wie den unaufhaltsamen Verfall des Körpers, verendet es auf die eine oder andere Weise, noch ehe es das Alter von dreißig Jahren erreicht.
Doch zur Stunde gehört das Kind noch dem Nichts; es ist nur eine winzige, eine kaum haltbare Wahrscheinlichkeit, während die Horde der Menschen mit gesenktem Kopf im Sturmwind voranschreitet, eine vertikale, unermüdliche und zerlumpte Herde. Sie tragen auf ihren Schultern oder ziehen auf Stangenschleifen gegerbte Lederhäute und von ihren Händen geformte Tonwaren, die Fettreserven bergen. Sie bewahren darin die unterwegs gesammelten Wurzeln, Nüsse, Früchte und Beeren auf, von denen sie sich ernähren, indem sie auf dem getrockneten Fruchtfleisch herumkauen, den Fasern, die sie durch ihren Speichel genießbar machen, und schlucken den mal bitteren, mal süßlichen Saft.
Nach wochenlanger Wanderung erreichen sie das Ufer eines fischreichen Flusses mit einem gewundenen Strombett, das so weit das Auge reicht eine weite Ebene durchquert, in der die Schatten der von Ost nach West treibenden Wolken spuken. Die Schatten huschen dahin und sind dem Lauf der Wolken voraus, verdunkeln ganze Teile der Landschaft, graben die Schluchten, ebnen die Torfmoore, verdichten die Wälder, deren grünliches Braun plötzlich zu rußigem Schwarz wird, und verwandeln das Wasser der Sümpfe in riesige Glasflächen, ganz mit trockenen Binsen gespickt, die im Wind rascheln, als wären es Flügel von Insekten. Die Wolken mit den makellosen Spitzen verziehen sich und der Tag bricht von Neuem an, lässt wieder die Erde erglühen. Ein Reiherschwarm erhebt sich über den Mooren; der Pfeil ihrer Hälse zerteilt die Luft und ihre ausgebreiteten Flügel blitzen im elektrischen Blau.
Die Menschen machen Halt und schlagen das Lager auf. Einige der im Fischfang geschicktesten tauchen in die Strömung ein, die gegen die Felsen schäumt oder an den vom Wasser bis hierher geschwemmten Baumstämmen sprudelt. Die Fischfänger arbeiten sich am Ufer entlang vor und suchen den Wassergrund ab. Die Oberfläche wirft das Spiegelbild ihrer affenähnlichen Gesichter zurück und, darüber, das des nebligen, auf dem Gesprenkel der vom Fluss gerollten und geschliffenen Steine schwebenden Himmels. Vom Tosen des Stroms und der Konzentration, die sie aufbringen müssen, um das Funkeln des Wildwassers mit dem Blick zu durchdringen, werden die Fischer rasch in eine Art Trance versetzt. Nach vorn gebeugt, mit pendelnden Armen, die Gischt bis zu den Schenkeln oder zur Taille, streichen sie mit den Fingerspitzen über die Wasseroberfläche und bewegen sich vorwärts wie braune, vom Fluss geformte Stelzenläufer.
Einer von ihnen beugt sich weiter nach vorn und taucht seine Arme in den Strom. In einem Becken mit ruhigem Wasser, beiderseits eines am Ufer liegenden Baumstamms, nimmt der Fischer das geisterhafte Schweben eines Lachses wahr, der gegen die Strömung ablaicht, seine metallischen Lichtreflexe verschmelzen mit dem sich ständig ändernden Gewoge. Er nähert sich ihm in extremer Langsamkeit, gibt Acht, dass sein Schatten ihm nie vorauseilt. Er lässt seine Unterarme im Wasser schweben – dessen Oberfläche verzerrt ihren Anblick so stark, dass die beiden Gliedmaßen nun vom Fischer abgetrennt zu sein scheinen, zu der in sich geschlossenen Wirklichkeit des Flusses gehörend – und er lässt das Auge des Lachses nicht aus dem Blick, die goldgesprenkelte Pupille, die schillernde Opaleszenz der Voraugenschuppen.
Mit unendlicher Vorsicht führt der Fischer seine Hände unter dem Bauch des Lachses zusammen und für einen Augenblick sieht es so aus, als hielte er den Lachs wie eine Opfergabe, als böte er den Lachs dem Fluss dar, oder zumindest als unterstützte er dessen statisches, graziles, filigranes Schwimmen. Als seine Handinnenfläche die Bauchflossen des Lachses streift, zuckt der Fisch mit einem Ruck zur Seite, ohne jedoch zu versuchen zu fliehen. Der Fischer verharrt reglos, seine Handteller halten nur noch die sich bewegenden Lichtblitze. Er führt seine Hände von Neuem unter das Tier; dieses Mal lässt sich der Lachs leicht berühren und sogar anheben, und erst in dem Augenblick, als seine Rückenlinie die Wasseroberfläche spaltet, versucht er, sich durch eine grandiose Windung zu befreien.
Doch die Hände des Fischers haben sich geschlossen; mit einer kräftigen Bewegung zieht er den Fisch aus dem Strom und schleudert ihn durch die Luft in Richtung Ufer, wo ein paar Kinder mit scharf angespitzten Haselnussstöcken in den Händen umherlaufen. Eines von ihnen, ein zotteliges, einäugiges Mädchen, eilt zu dem auf den Kieseln zappelnden Lachs, geht in die Hocke und drückt ihn mit einer Hand auf den Boden. Sie sticht die Lanzenspitze in die Kiemenöffnung und lässt sie aus dem Maul wieder austreten. Der Unterkiefer öffnet und schließt sich vergeblich, und mit durchgestreckten Armen hebt das Mädchen den aufgespießten Fisch, dessen Flanke silbern in der Sonne schimmert.
Am Ufer auf den Kieseln hockend bereiten zwei Frauen die von den Fischern gefangenen Lachse zu. Funkelnde Schuppen besprenkeln die braune Haut ihrer Hände, während sie die Spitze eines Feuersteins in die Analöffnung stechen, den Bauch der Länge nach aufschneiden und Zeige- und Mittelfinger durch diese Öffnung einführen, um die Bauchhöhle aufzuklappen. Sie ziehen einen kleinen Klumpen roter und brauner Eingeweide heraus, den sie mit einer heftigen Bewegung des Handgelenks auf den Boden schleudern. Das einäugige Mädchen ist nun in ihrer Nähe und beobachtet sie aufmerksam. Sie greift sich die zwischen zwei Steinen liegende Schwimmblase und betrachtet einen Moment lang das schillernde Weiß, bevor sie sie zwischen ihren Fingern zerplatzen lässt.
Die Frauen hängen eine Lederhaut an einer Konstruktion aus Ästen auf, füllen sie mit Wasser und legen zuvor in der Asche eines Feuers erhitzte Kieselsteine hinein. Sie geben auch von den Kindern aufgesammelte Flussmuscheln, Wurzelknollen und getrocknete Würzkräuter aus dem vorigen Sommer hinzu und schließlich die Fische selbst, deren Fleisch rasch zerfällt. Bald verbreitet sich der Duft der Brühe am ruhigen und bläulichen Ufer.
Abends essen sie sich satt und die Jüngsten, erschöpft von der Wanderung und ihren Spielen im wilden Wasser des Stroms, schlafen beim Klang einer vom einstigen Anführer nahe beim Feuer angestimmten Psalmodie ein. Dieser Gesang ist etwas noch vor dem Gesang, sogar noch vor der Stimme, eine gutturale, modulierte Klage aus dissonanten Vibratos und Tonschwingungen, aus tiefen und dunklen Exspirationen, deren vollendeter Resonanzraum der Körper des alten Mannes ist. Es scheint für Momente so, als käme diese Klage nicht aus dem Innern des Alten, sondern von irgendwo außerhalb von ihm, aus den Geheimnissen der tiefen Nacht, der unsichtbaren Tiefebene, dem schwarzen Flussbett und dem Innersten der Steine – Geheimnisse beschworen in diesem Körper, der so vertrocknet und knorrig ist wie ein Wurzelstock, denn nichts rührt sich in diesem buschigen Gesicht, über das allein der Lichtkreis der lodernden Flammen huscht.
Kaum zittern die Lippen unter dem Bart und die Augen sind geschlossen, der Blick nach innen gerichtet. Der Singsang führt eine Flut von Bildern, von Empfindungen mit sich, deren tiefe Melancholie sie alle im eigenen Fleisch verspüren, die Schwermut ihrer ziellosen und jeden Sinns beraubten Wanderung auf der Erde, des immer wiederkehrenden Zyklus der Jahreszeiten, der Toten, die weiterhin an ihrer Seite unterwegs sind und sich ihnen in der Nachtkulisse durch einen flüchtigen Schatten oder das Heulen eines Wolfes in Erinnerung rufen. Und als der Alte verstummt, als der Gesang in seinem Innern verklingt, halten sie den Atem an; gerade war etwas gesagt worden von ihrer Nichtigkeit und von ihrer Erhabenheit.
Im Licht eines blassen Morgens zeigt sich die Welt mit Eiskristallen überzogen, glitzernd. Der Atem der Männer dampft in der eiskalten Luft, während sie das Feuer wieder anfachen. Sie haben an mehreren Stellen Löcher im Boden ausgehoben, Fellhäute an Pflöcken aufgehängt und so einige Hütten errichtet, unter denen die Frauen und Kinder, eng aneinandergeschmiegt, unter weiteren Fellen begraben, noch schlafen.
Dohlen fliegen über das Lager, lassen sich weiter entfernt auf den Ästen eines Baumes nieder, ihr tiefschwarzes Gefieder kontrastiert mit der vom Raureif bedeckten Rinde. Sie beobachten die Männer, die ihnen etwas Fressbares hinterlassen könnten, und die Männer beobachten ihrerseits die Dohlen, die ihnen manchmal ein Stück Aas anzeigen, um das sich die Vögel scharen und zanken – sie stehlen es ihnen dann und tragen es ins Lager, um sich daran gütlich zu tun.
Bald werden die Vorräte schwinden. Sie ernähren sich von Nüssen, von Eicheln, die sie zerstoßen, wieder und wieder kochen, um ihnen die Gerbstoffe zu entziehen, zu Fladen kneten und dann in der Glut schmoren. Sie suchen die abgestorbenen Baumstümpfe nach Larven ab, graben Wurzeln aus, schaben essbare Rinden und Moose von den Bäumen.
Im Morgengrauen eines neuen Tags entdecken sie eine Gruppe von Rehen, die am Rand eines Waldes weiden. Sie bewaffnen sich mit Speeren, deren Schaft aus dem Stamm junger, entrindeter Kiefern gefertigt ist, die Spitze aus einem Feuersteinsplitter, die Befiederung aus Federn vom Habicht, Falken oder der Schleiereule. Sie ziehen los; schweigsam, eine Frau und drei Männer. Der letzte treibt ein Kind vor sich her, noch kaum geschlechtsreif, mit ausgezehrtem Gesicht. Seine Glieder sind mager, seine Bewegungen unsicher, ein jugendlicher Bart bedeckt die Oberlippe und Wangen. Er lässt seine dunklen, erstaunt blickenden Augen, die unter einer hervorstehenden Stirn in wie mit dem Meißel tief ausgehobenen Augenhöhlen liegen, von einem Jäger zum anderen wandern. Er dreht den Kopf andauernd zu demjenigen, der das Schlusslicht bildet – sein Erzeuger – und verfolgt alles, was er tut. Er versucht etwas vom Gebaren der Jäger zu erfassen, von ihrer Stummheit, die nachzuahmen er sich bemüht.
Sie scheinen sich zunächst von den Rehen zu entfernen, die ungerührt weiter äsen – eines von ihnen, ein junger Spießer, dessen Geweih im Herbst abgefallen war, richtet sich auf, atmet tief ein, bläst aus, sein weißer Atem schwebt über seinem Schädel, als hätte er gerade seine Seele ausgeatmet – und ihr Vordringen beschreibt eine weite Kurve in Richtung Westen, durch dichtes Buschwerk, in dem die Nacht noch verweilt, ihre Umrisse kaum wahrnehmbar unter dem Mond, der sinkt, über ihnen immer schwächer wird, während der Tagesanbruch, plötzlich rosa und purpurn, den Himmel von der Erde trennt.
Sobald der Rehbock Ausschau hält, bleiben die Jäger augenblicklich stehen, um ihren Vormarsch erneut aufzunehmen, kaum hat das Tier den Kopf wieder gesenkt. Sie machen Halt im weißen Gras, und der Heranwachsende sieht den Vater einen Lederbeutel aus den ihn bedeckenden Schichten der Fellhäute ziehen. Er hebt ihn hoch und lässt mit einem Fingerdruck eine Aschewolke herausstäuben, die sich schräg zwischen ihren aufmerksamen und versammelten Körpern verteilt, somit anzeigt, dass ein sanfter Wind über die Ebene ihnen entgegenweht.
Der Vater nickt mit dem Kopf und die Jäger rücken weiter vor. Sie erreichen den Waldrand, tauchen just in dem Moment in das Dunkel des Unterholzes ein, als das große Feuer im Osten aufgeht und über der Ebene sein fahlgelbes Licht ausbreitet.
Die Jäger bewegen sich vorwärts, bedachtsam abwägend, wo auf dem Bett aus Blättern und mit Raureif überzogenen Ästen sie ihren Fuß aufsetzen. Bald erkennen sie die Herde genauer, die sich aus dem Spießer, drei Ricken und einem Kitz zusammensetzt, das wahrscheinlich im Frühjahr geboren wurde, denn sein Fell gleicht schon dem der erwachsenen Rehe, ein dunkles Grau, mit Tauperlen benetzt. An der Vorderseite des Halses tragen sie eine helle Serviette, die sie entblößen, sobald sie den Kopf heben; die Unterlippe ist weiß unter schwarzen Nüstern, ihre Kruppe mit einem weißen Spiegel geschmückt.
Mit einer schnellen Handbewegung bedeutet der Vater den beiden anderen Jägern, sich zu verteilen, um die Herde einzukreisen, und sie dringen tiefer in den Wald ein. Allein mit ihm zurückgelassen, sieht der Junge sie verschwinden, bald von den braunen Stämmen, dem Dunkel des Waldes verschluckt. Indem er ihm eine Hand auf die Schulter legt, weist der Mann ihn an, sich hinter einen liegenden Baum zu ducken. Alle beide verharren sie so, niedergekauert, und suchen mit den Augen die Ebene ab, über die jetzt Nebelschwaden treiben, der ferne Rauch des Lagers, die Rehe, im Gegenlicht des steigenden Gestirns reduziert auf kompakte Umrisse in ihrer Mitte, deren Konturen aber das Licht auflöst, sodass sie schmaler, fragiler wirken, als ob sie sich jeden Augenblick verflüchtigen würden.
Ihre Körper schmerzen vom Warten und der Kälte. Mit der Hand umklammern sie fest den Schaft ihrer Speere. Der Sohn lässt das Gesicht des Vaters nicht aus den Augen. In der Ferne erhebt sich ein Ton, ähnlich dem spitzen Schrei eines Raubvogels, und der Mann setzt den Speer in die Speerschleuder, der Sohn macht es ihm nach. Sie halten den Atem an, bis ein zweites Signal durch das Tal dringt. Sie sehen die Rehe hochspringen, aus dem Äsen aufgeschreckt, in einer einzigen Bewegung genau in ihre Richtung hetzen. Die beiden Treiber sind aus dem Unterholz herausgesprungen und rennen, in einiger Distanz voneinander, hinter dem Rudel her.
Die vom Spießer angeführte Herde schickt sich an, eine Fluchtbewegung in das freie Gelände der Ebene zu tun, aber die Jägerin ändert ihren Kurs und treibt sie. Mit einer bis zur Brust angehobenen Hand befiehlt der Vater dem Sohn, still zu verharren. Der Sohn sieht die Rehe ihnen direkt entgegenspringen, in einer Stille, die einzig durch den von ihnen ausgestoßenen Atem und das gedämpfte Aufschlagen ihrer Hufe auf dem Boden zwischen zwei majestätischen Sprüngen unterbrochen wird.
Der Vater senkt die Hand und sie richten sich beide wie ein einziger Mann wieder auf, tauchen plötzlich hinter dem Stamm des umgestürzten Baums hervor. Sie sehen, wie der Rehbock mit dem Kopf für einen kurzen Moment zurückweicht. Der Schrecken weitet seine Augen, das Tier verlagert sein Gewicht nach links und dreht ab in Richtung Unterholz.
Im selben Augenblick werfen die Jäger ihre Speere, die sich im fahlen Morgen erheben. Alles ist in der Schwebe: die Waffen, die ihren ansteigenden Lauf über die Ebene ziehen, die Rehe im Sprungflug über Grasbüschel, der Hals des Spießers, der schon den Schatten des Unterholzes berührt, wo noch immer Laubblätter in Spiralen von den Baumkronen herabtrudeln, der dunkle Körper der Menschen, die hinter ihnen her sind, und, weiter entfernt, das Aufstieben eines Schwarms von der Flucht des Rudels erschreckter, weißer Vögel.
Die vom Vater und der Jägerin gleichzeitig geworfenen Speere bohren sich in den Windschatten der Rehe, wobei der Aufprall entlang des Schafts in einer Schallschwingung widerhallt. Der des zweiten Treibers sinkt mit dem Zischen einer Natter ins Gras, während der Speer, den der Jugendliche geworfen hat, eine der beiden Ricken lautlos an der Schulter trifft.
Das Tier wird nach rechts geworfen und stürzt auf die Vorderbeine, in das unter seinem Gewicht knirschende Bett aus Laub und vereisten Ästen. Es gelingt ihm, sich wieder aufzurichten, kraft eines Schüttelkrampfs im ganzen Leib, und mit einem Satz den Waldrand zu erreichen. Die Menschen sammeln ihre Waffen auf, dringen, dem Rudel dicht auf den Fersen, in den Wald ein, aber schon vermischt sich das Fell der Rehe mit der unendlichen Wiederholung der Baumstämme und allein der Spiegel ihrer Kruppe erlaubt es, ihre krampfartigen Bewegungen noch zu erkennen, während sie immer tiefer in die hohen, von der Kälte braun gefärbten Farne vordringen. Die Jäger teilen sich von Neuem auf, bewegen sich in angemessenem Abstand vorwärts, die Vegetation, die starkduftenden Moore behindern ihren Lauf.
Ein kaltes Licht flutet das Unterholz, zersetzt die Formen, die Farben. Als der Vater sich bückt, um mit den Fingerspitzen einen modrigen Baumstumpf zu berühren, und die Hand wieder hebt, scheint das feucht auf seiner Fingerkuppe glänzende Blut seltsam dunkel; er muss den Arm in den schachtförmigen Einfall des Tageslichts strecken, den die kahlen Äste einer Buche freigeben, damit der Fleck sich in einem leuchtenden Rot offenbart. Er wischt sich die Finger am Fell ab, das seinen Oberkörper bedeckt, betrachtet prüfend den Boden und entdeckt neben einem Schlammloch ein paar von der verletzten Ricke hinterlassene Hufspuren, die zeigen, dass sie hinkt und ihren Vorderlauf nicht mehr belasten kann.
Das Klopfen eines Spechts auf einem hohlen Baumstamm ertönt in gleichmäßigen Abständen. Ein Ast fällt mit einem gedämpften Rascheln auf ein Bett aus Laub. Weiter entfernt, außer Sichtweite des Vaters, hebt der Sohn das Gesicht empor zu den Baumkronen mit dem dunklen Geäst. Sein Atem steigt auf und verflüchtigt sich über ihm. Er betrachtet das unentwirrbare Pflanzengeflecht, gegen das er ankämpfen muss, um vorwärtszukommen, die ringsum schimmernden Baumstämme, die spinnenartigen Wurzeln, die unter dem Humus hervortreten. Der Duft des Waldes steigt ihm in den Kopf und bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Er nimmt die Anwesenheit der anderen Jäger nicht mehr wahr. Ihm scheint, als habe der Wald ihn hinein in organische Tiefen getrieben, hinein in das holprige, klebrige Gelände, in dem er seine geheimen Gärungen orchestriert. Der Sohn stützt sich auf der durchweichten Rinde der Bäume ab, zieht seinen Fuß aus einem schlammigen Wasserloch, aus einer Liane, zieht sich heraus aus dieser großen Verwesung, die die Erde nährt und im Frühjahr aus ihrem Bauch wieder ein unbarmherziges Leben sprießen lassen wird. Direkt vor ihm tut sich der Tag auf, bricht zwischen den Stämmen hervor.
Er dringt weiter vorwärts und entdeckt eine mit Winterheide überwachsene Lichtung. Die Ricke liegt ausgestreckt im mit zartlila Blüten gesprenkelten Gestrüpp. Den Kopf zur Seite gedreht leckt sie die Flanke, in der der Speer steckt, dessen Schaft auf dem Boden aufliegt. Er sieht das Kitz im nervösen Trab am Waldrand hin und her laufen. Die Ricke hört auf, ihre Wunde zu lecken, hebt den Kopf, um das Kitz zu betrachten. Sie versucht, sich auf ihren Hinterbeinen abzustützen, um wieder aufzustehen, doch es gelingt ihr nur, ihre Kruppe anzuheben, ehe sie erschöpft wieder zurückfällt. Sie streckt ihren Hals, legt dann ihren Kopf auf den Boden und hebt ihn auch nicht, als der junge Jäger sich nun ungedeckt vorwärtsbewegt. Nur ein kurzes Zittern läuft durch ihren von der Idee der Flucht durchzuckten Körper, und das Kitz taucht in das Unterholz ein, wo es verharrt.
Der Heranwachsende geht auf die Ricke zu, steht dicht bei ihr, sein Schatten legt sich auf ihre Brust, auf die Flanke, die ein schneller Atem anhebt. Er saugt den lieblichen Duft des Wildes ein, den eisenhaltigen Geruch des Bluts, das ihr Fell befleckt. Er erahnt die fieberhaften Kontraktionen des Herzens unter dem deutlich sichtbaren Rippenbogen. Ihr Auge mit der ovalen Pupille und der braunen Iris spiegelt eine verzerrte Sicht der Welt wider, die Umrisse des jungen Jägers, die konvexen Linien der Kiefern mit kupferfarbenen Stämmen, den gewölbten Himmel über den Wipfeln. Eine durchscheinende Flüssigkeit fließt heraus, verfängt sich in den Wimpern, färbt das kurze Fell der Wange dunkler. Im Laub sind Schritte zu hören. Der junge Jäger wendet den Kopf und sieht die Konturen des Vaters, der sich zwischen den Bäumen seinen Weg bahnt.
Er richtet seine Aufmerksamkeit auf das immer noch im Halbdunkel des Unterholzes lauernde Kitz, bückt sich, um einen halbvergrabenen Stein aus dem Boden zu ziehen, den er mit aller Kraft in Richtung des Tieres schleudert. Das Wurfgeschoss trifft einen Baumstamm, das Kitz hastet davon, hält inne, um einen letzten Blick auf die Lichtung und die liegende Ricke zu werfen, macht einen Sprung und verschwindet.
Der Vater erscheint auf der Lichtung, kommt mit seinen schweren Schritten auf den Sohn zu, den Schaft seines Speers fest in der Faust umklammert. An der Seite des jungen Jägers angekommen, senkt er den Blick auf die Ricke, hebt seine Hand trichterförmig an die Lippen und erzeugt einen kurzen, repetitiven Pfiff, der in der vibrierenden Luft aufsteigt. Als der Mann neben ihr in die Hocke geht, stößt das Tier einen heiseren Seufzer aus. Die Sonne ist gerade hinter den Bäumen hervorgekommen und taucht sie nun alle drei – den Mann, das Kind, die Ricke – in ein warmes Licht, das ihre vom Tau benetzte Haut dampfen lässt. Die beiden anderen Jäger tauchen aus dem Wald auf und kommen ihnen entgegen.
Der Vater legt seine Waffe im Gebüsch ab, führt die linke Hand an die Schulter der Ricke und greift mit der anderen nach dem Schaft des Speers, den der junge Jäger geworfen hatte. Seine Hand gleitet den polierten Holzgriff entlang, um einen größeren Halt zu gewährleisten. Mit einer kraftvollen Bewegung, die die Sehnen seines Halses plötzlich hervortreten lässt, stößt er ihn hinein in die Brust des Tieres. Die Klinge aus Feuerstein bahnt sich ihren Weg durch das komplexe Geflecht aus Muskeln, Nerven, Gefäßen, durchbohrt das Herz der Ricke, die ein einziger heftiger Ruck durchzuckt, abgemildert durch die stützende Hand des Jägers auf ihrer Schulter. Mit einer gegenläufigen Bewegung zieht der Mann den Speer wieder heraus. Der Schaft und die Klinge schnellen hervor, scharlachrotes Blut ergießt sich über die Flanke und tropft auf den Boden.
Der Vater taucht seine Finger in die tief in der Flanke der Ricke geöffnete Wunde, erhebt sich und versieht die Stirn des jungen Jägers mit einem roten, senkrechten Strich. Dann legt er seine Hand auf dessen Wange, den beschmierten Daumen auf den Wangenknochen, die Kuppen der anderen Finger unters Ohr. Er verweilt in einer kurzen Liebkosung, die noch lange nachdem er sie zurückgezogen hat, auf der Haut des Jungen die Empfindung seiner rauen und eiskalten Handfläche hinterlässt. Die beiden anderen Jäger kommen zu ihnen, betrachten das Wild und das Mal, das auf der Stirn des Jungen bereits nachdunkelt.
Der Vater packt das erlegte Wild an den Sprunggelenken, hebt es vom Boden hoch und hievt es sich auf die Schultern. Der Hals des Tieres liegt auf seinem Arm; im erloschenen, verschleierten Auge spiegelt sich gar nichts mehr, die Wunde fließt weiter träge aus. Als er sich auf den Rückweg in Richtung Lager macht und den Wald erreicht, der Kopf der Ricke baumelt dabei an seinem Arm hin und her, folgen ihm die Jäger. Der Knabe bleibt reglos mitten auf der Lichtung stehen. Er hebt den Blick empor zum Schwebeflug eines Falken, das Gesicht von Licht überflutet. Und als er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Seinen richtet, sieht er, dass die Jägerin sich nach ihm umdreht, ehe sie im Gehölz verschwindet. Nun ist er allein im ruhigen Herzen des Waldes. Die Vögel sind verstummt. Er scheint zu zögern, ob er nicht hier bleiben soll, im Heidekraut, im Flüstern und Säuseln der Bäume, und darauf verzichten, der Gruppe zu folgen. Er würde sich in den noch feuchten, von der Ricke hinterlassenen Abdruck legen und sich, die Augen in den Himmel gerichtet, von den braunen Blättern und dem fruchtbaren Nährboden begraben lassen.
Der Falke stößt einen schrillen Schrei aus und fegt im Sturzflug herab auf eine kleine Beute irgendwo auf der weiten Ebene. Da bückt sich der junge Jäger und greift sich seinen Speer vom Boden.
In den ersten Morgenstunden lassen sie die Stadt hinter sich.
Der Sohn döst auf der Rückbank des alten Kombi. Mit halb geschlossenen Augen sieht er durch die Scheibe die Vorstadtpavillons, die Gebäude eines Gewerbegebiets und ihre in der Dunkelheit aufblitzenden Lichter vorbeiziehen.
Sie fahren am alten Güterbahnhof entlang, Waggons ganz in Rost und Schwärze gehüllt, gestrandet inmitten von Brombeerranken und Silos einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, über denen Nebel schwebt, bläulich gefärbt von einem Scheinwerfer, der eine riesige Betonplatte beleuchtet, über die plötzlich ein Hund mit ausgehöhlten Flanken läuft.
Das Kind sieht ihn im Schatten eines Muldenkippers verschwinden. Es schläft halb und der Hund taucht in seinen Träumereien wieder auf, skandiert durch den Pulsschlag der Lichter, die zu ihm hereindringen. Das Tier läuft an seiner Seite einen Pfad entlang, im Herzen eines tiefen Waldes – oder ist es eine wilde und ruhige Ebene, es könnte es nicht sagen. Seine Hand hat soeben den Kopf des Hundes gestreift, seine Handfläche auf ihm geruht. Alle beide laufen im Gleichschritt, ihr beider Atem vollkommen im Einklang und sie bilden nunmehr ein einziges und selbes Wesen, das Tier und das Kind, ihr vereinter Körper, durch den Raum und die Nacht geschleudert, die sich endlos vor ihnen öffnen.
Die Mutter hebt den Blick zu ihm, im Rückspiegel. Im Halbschlaf spürt er ihre braunen Augen wie einen wohltuenden Balsam auf sich ruhen. Er hat sich oft zur Mutter ins Bett gelegt, beide einander gegenüber, mit angezogenen Knien, ihren Kopf auf einem angewinkelten Arm abgestützt, und in der frischen Kühle des vom Licht durchfluteten Schlafzimmers hat er das Gesicht der Mutter betrachtet, die Augen der Mutter, erfüllt von etwas Unaussprechlichem, einer unendlichen Traurigkeit oder einer Resignation, als fühlte sie sich ihm, ihrem Sohn, gegenüber hilflos und schuldig.
Ein Feuer schwelt in der Ferne unter einem sternlosen Himmel, der Atem eines Drachen oder einer Raffinerie. Die Mutter betrachtet es einen kurzen Augenblick, ehe es hinter einer Linie kahler Bäume verschwindet, dann richtet sie den Blick auf den Vater, der die Straße fixiert, starr, mit der linken Hand das Steuer umschließend, ohne auch nur mit den Augen zu blinzeln. Nur der Kaumuskel spannt sich für Momente unter der Haut seiner Wange an, die ein leichter Stoppelbart verdunkelt.
Später machen sie Halt an einer Tankstelle und das Klappern der Autotüren weckt das Kind.
»Gibst du mir eine Zigarette?«, bittet die Mutter.
Der Vater zeigt auf die Ablage und läuft um das Fahrzeug herum. Durch das Rückfenster sieht der Sohn seinen Atem sich im knisternden Licht einer Neonlampe weiß kräuseln. Der Zähler rattert durch, während die Kraftstoffpumpe summend den Bauch des Kombis füllt.
Die Mutter hat sich etwas vom Wagen entfernt, zieht den Kragen ihres Parkas enger um den Hals. Sie zündet sich eine Zigarette an, stößt den ersten Zug langsam aus – sie hält den Filter zwischen den letzten Fingergliedern des Zeige- und des Mittelfingers, fast auf Höhe der Nägel –, läuft einen mit blutleerem Gras bewachsenen Mittelstreifen entlang, ehe sie wieder zurückkommt. Sie führt die Zigarette an die Lippen, wirft kurze Blicke um sich, die auf den im Geäst der Bäume und in den Ligustersträuchern nistenden Schatten hängen bleiben.
Das Kind öffnet die Autotür, steigt aus dem Fahrzeug, atmet die Benzindämpfe ein. Es streckt sich, läuft hin zur Mutter, die es sieht, ihre Zigarettenkippe auf den Boden wirft und mit der Schuhsohle austritt. Im Fallen lässt die Kippe winzige Glutfunken umherwirbeln, die mit doppeltem Eifer verglühen. Der Junge kuschelt sich eng an die Mutter.
Schwach beleuchtet vom Licht der im Nebel wie irgendein Geisterschiff der Handelsmarine aussehenden Tankstelle reden sie nicht. Das Kind atmet den Duft nach Waschpulver und Tabak ihres Parkas ein. Sie fährt mit ihrer Handfläche durch das rote Haar des Kindes, lässt sie auf seinem Nacken liegen.
»Wir müssen weiter«, sagt der Vater.
Sie nickt und ihre Hand gleitet vom Nacken zur Wange des Sohnes.
»Ist es noch weit?«, fragt er.
»Ich weiß es nicht«, antwortet sie. »Noch ein paar Stunden.«
Sie gehen zurück zum Auto und fahren weiter. Während sie auf einer Landstraße zügig vorankommen, liegt vor ihnen bald nichts mehr als vollkommene Finsternis, die der Lichtstrahl der Scheinwerfer zwar zu durchteilen vermag, die sich aber sogleich wieder in sich verschließt. Nebelfetzen tauchen von Neuem auf, bleiche, auf dem Asphalt schwebende Gespenster, gegen die der Kombi angeht und die die Nacht wieder verschluckt.
Sie fahren durch ein im Licht der Scheinwerfer bruchstückhaft wahrgenommenes Tal: Nadelholzwälder, Pflöcke aus Akazienholz, die undefinierbare, mit Reif überzogene Koppeln verstacheldrahten, große Bauernhöfe aus Stein mit Schieferdächern, manchmal in Weilern zusammengeschlossen, deren eingefasste Gebäude in der Nacht an Bunker erinnern oder an die letzten Überreste einer verlorenen Zivilisation.
Je enger das Tal wird, desto mehr schlafende Kolosse tauchen vor ihnen auf, Kalksteinmassive mit unsichtbaren Gipfeln, monumentale Schatten, undurchdringlicher als die Nacht selbst; es scheint, als rase der Kombi auf eine undurchdringliche Mauer zu, die allein von der Hand eines Gottes hatte errichtet werden können.
Das Fahrzeug stürzt sich in einen Tunnel und das diffuse Licht der Scheinwerfer wird von den Bogen aus nacktem Beton geschnappt, reflektiert und projiziert einen Streifen gelblicher Helligkeit in den Innenraum, der die Gesichter des Vaters und der Mutter konturiert. Über ihnen zieht die unvorstellbare Masse der Berge vorbei, Zehntausende Tonnen ineinandergeschobenes, sich überlappendes magmatisches Gestein, aus Granit, aus Quarz, aus Glimmer und fossilem Schluff. Das auf der Rückbank liegende Kind hält den Atem an und fragt sich, wie der Tunnel allein dieses Gewicht tragen kann. Wäre es nicht möglich, dass der Berg zusammenbricht und sie unter sich begräbt?
Sie tauchen in ein neues Tal ein und der Lichtstrahl der Scheinwerfer stößt gegen eine Wand dichten Nebels, die den Vater zwingt, das Tempo zu drosseln.
Beschilderungen blitzen kurz auf – Signalbojen auf ruhiger See –, ein Kreisverkehr, eine Straße, die durch kleine, an der Strecke gelegene Dörfer führt, mit ihren schummrigen, rechtwinklig verlaufenden Gassen, dem sich immer wiederholenden Platz vor der Kirche, flankiert direkt auf dem nackten Asphalt von Platanenblättrigen Maulbeerbäumen mit von Taubenkot betüpfelten Ästen, die Kirche ebenso unheimlich und ernst wie ein Dolmen mit dem immergleichen Spitzbogenportal und ihrem in die Nacht ragenden Kirchturm.
Die Dörfer verschwinden der Reihe nach und der Kombi fährt weiter auf einer Serpentinenstraße, vorbei an abschüssigen Weiden, auf denen die verschwommene Masse von sich am steinigen Boden festkrallenden Herden und schweren, unter Planen angehäuften Heuballen döst, manche liegen verlassen neben einer Futterkrippe oder einer alten emaillierten, als Tränke dienenden Metallwanne, die Schnüre gerissen und der Ballen aufgelöst, von Feuchtigkeit durchtränkt; hier und da neue Wohngebäude, Milchbauernhöfe oder alte Schafställe, die sich eng an den Berg schmiegen, direkt aus dem Berg gehauen sind, mit ihren matten Bruchsteinen, moosbewachsenen Dächern und Fenstern so klaffend und schwarz wie Abgründe.
Das Kind erkennt am Straßenrand flüchtig ein Wegkreuz, das den bleichen Körper eines Christus mit metallener, von Flechten oder Rost überzogener Haut trägt. Die letzten Nebelfetzen lösen sich plötzlich auf und die Umrisse des Massivs treten hervor. Die Nacht trägt nun die Erwartung des Tagesanbruchs in sich, diese winzige Veränderung, die die Konturen der Welt herauslöst, ohne dass sie schon fassbar wären, sodass nur verschiedene Grade der Dunkelheit aufscheinen. Ein bisher unsichtbarer Schleier reißt auf; alles, was sich in der Kulisse der Nacht verschanzt hielt, wird plötzlich in einen bläulichen Schein getaucht, der nicht von außerhalb der Dinge zu kommen, sondern vielmehr von ihnen selbst auszugehen scheint, ein fahles, aus den Steinen, dem Asphalt, den Kiefernstämmen und den Baumkronen sickerndes Leuchten.
Der Vater lenkt den Kombi auf einen Schotterweg, der in eine mit Buchen, Traubeneichen und Nadelbäumen bewaldete Schlucht führt. Unterhalb schlängelt sich lautlos ein kleiner Wildbach, ein schwarzes, lebendiges Wasser kräuselt sich auf den Felsen, die aus ihm hervorragen, und im unbeweglichen Unterholz liegt auch etwas in der Schwebe, eine Ungeduld zittert, die Nacht zieht sich zurück, bildet weite, schattige Nischen unter dem Geäst der Bäume, in denen sich Vogelschwärme regen und rascheln.
»Ach du Scheiße«, sagt der Vater und tritt das Bremspedal durch.
Vor ihnen taucht der Stamm einer Kiefer im Scheinwerferlicht auf. Er öffnet die Autotür und steigt aus.
»Was ist los?«, fragt das Kind.
»Ein umgestürzter Baum liegt quer über dem Weg«, antwortet die Mutter.
Sie beobachten, wie der Vater den braunen Stamm inspiziert, einen Fuß auf die glänzende Rinde setzt und sich mit aller Kraft dagegenstemmt, aber die Kiefernspitze ist zwischen zwei Eichen auf der anderen Seite des Weges eingeklemmt. Er geht zurück zum Auto und setzt sich wieder hinter das Lenkrad.
»Wir können nicht weiterfahren. Ich habe nichts, um ihn zerlegen zu können.«
»Können wir ihn nicht zu zweit wegschieben?«, fragt die Mutter.
»Unmöglich, er ist nicht ganz entwurzelt. Wir gehen zu Fuß weiter.«
Der Vater lenkt den Kombi zur Böschung, die Reifen drehen in der lockeren Erde durch und schleudern zwei Garben aus Humus und Geröll auf den Weg. Nach einem Schlenker rutscht der Wagen in eine offene Schneise im Unterholz, ein dunkler Farnhain. Der Vater zieht die Handbremse an, legt den ersten Gang ein und schaltet die Zündung aus.
»Nehmt die Sachen«, sagt er.
Sie steigen aus dem Auto.
Der Vater öffnet den Kofferraum und zieht einen ersten Reisesack heraus, den er der Mutter reicht. Sie greift danach und trägt ihn mühsam zum Fußweg. Dort legt sie ihn zu ihren Füßen ab.
Der Vater übergibt dem Sohn einen zweiten, kleineren Rucksack, der aber offensichtlich schwer ist, zumindest für den zarten Körperbau eines Neunjährigen, denn als der Vater ihn auffordert, sich umzudrehen, und ihm hilft, seine Arme durch die Gurte zu stecken, keucht der Sohn und knickt unter der Last ein, bevor er vorsichtig die Böschung hinuntergeht, um zur Mutter zu gelangen.
Der Vater holt schließlich aus dem Kofferraum des Autos einen letzten Seesack im Militärstil mit Seitentaschen und Gurten hervor, viel größer als die beiden anderen, und trägt ihn, das Gesicht dabei vor Anstrengung verzogen, bis zum Stamm einer Kiefer, gegen den er ihn lehnt.
Er kehrt zum Fahrzeug zurück, sucht nach einem Tarnnetz und einer Taschenlampe, deren Batterie er überprüft. Ein gewaltiger Lichtstrahl zerteilt das Halbdunkel des Unterholzes, enthüllt eine Masse von Stämmen und das steile Gefälle des Geländes.
Der Vater schlägt die Türen des Kombi zu, versperrt sie mit der Zentralverriegelung, steckt den Griff der Taschenlampe in die Gesäßtasche seiner Jeans. Er entfaltet das Tarnnetz, zieht es über die gesamte Karosserie des Kombis und inspiziert die Umgebung.
Er zertrampelt die braun gewordenen Wedel der Farne und den dichten Humus, aus dem diese sich versorgen, bewegt sich ein paar Schritte vorwärts, räumt alte, am Fuß der Bäume liegende und von Lianen und Moosen begrabene Äste aus dem Weg. Einige sind verrottet und zerbrechen ihm zwischen den Händen, sobald er an ihnen zieht, andere ragen aus dem Humus hervor, enthüllen kräftige Verzweigungen, als würde er große Holzgewächse ausreißen.
Der Vater zieht sie hin zum Fahrzeug und versucht, sie quer über der Karosserie so anzuordnen, dass sie den Anblick vom Weg aus teilweise verdecken.
Die Mutter und das Kind beobachten ihn von unten. Der Vater wühlt auf dem Boden nach zwei Steinen, die er unter die Hinterreifen des Kombis klemmt und denen er ein paar heftige Fußtritte verpasst. Er lädt sich den Seesack auf den Rücken und kommt nun seinerseits zum Weg, von dem aus sie für einen Moment die Form des Kombis begutachten, den das Tarnnetz und die Äste mit den Schatten verschmelzen lassen.
Der Vater schnieft, wischt sich mit dem Handrücken der rechten Hand die Nase und sagt:
»Los geht’s.«
Er macht sich auf den Weg, die Mutter und der Sohn folgen ihm. Der Junge betrachtet um sich herum die Stille im Unterholz, wo nichts raschelt, sich nichts regt. Er nimmt den Geruch des Berges bewusst wahr, ein durchdringender Duft erfüllt von pflanzlicher Fäulnis, von Rinden, Baumpilzen und wasserdurchtränkten Moosen, von wirbellosen, versteckt unter alten Holzstrünken kriechenden Wesen und brüchigem Gestein in den Bachbetten.
Dieser Duft, der Junge zieht ihn mit jedem Schritt ein, er ist davon wie betäubt, und es erfordert seine größte Anstrengung, sich auf das Tempo des Vaters zu konzentrieren, dessen Sohlen unbarmherzig den steinigen Boden zerstampfen, um trotz des ihn erfassenden Schwindels nicht aus dem Marschrhythmus zu geraten.
Der Weg biegt ab nach Osten über den Nordhang des Berges und eine Schneise im Baumbestand enthüllt zu ihrer Linken den von der Morgendämmerung aufgerissenen Horizont, über dem sich nun die kalkhaltigen Dolomitsteine und die steil abfallenden Hänge zum nebligen Tal hin abheben. Mutter, Vater und Kind drehen alle drei ihre Gesichter diesem Himmelsaquarell zu und scheinen ihren Blick nicht davon abwenden zu können, so sehr überwältigt sie das Gefühl der Unermesslichkeit der Welt und, gleichzeitig, das ihrer eigenen unendlichen Winzigkeit.