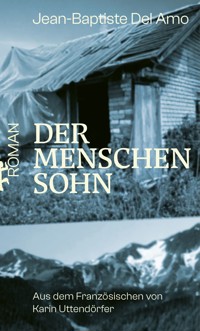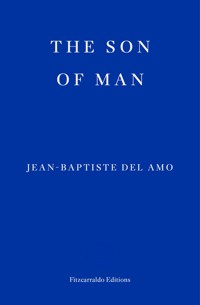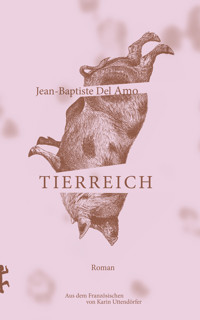
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während Europa von Kriegen und Umwälzungen erschüttert wird, kämpft eine Familie von Schweinezüchtern um ihr Fortbestehen - und nutzt die in immer größerem Maßstab stattfindende Ausbeutung des Rohstoffs Tier, um sich in unsere heutige, hochindustrialisierte Welt hinüberzuretten. Éléonore, Kind eines kranken Vaters und einer lieblosen Mutter, erbt Anfang des 20. Jahrhunderts von ihren Vorfahren Schweine und die Gewissheit, dass Gewalt gegen Mensch und Tier zum Leben dazugehört. Mit Disziplin und unbändiger Härte gegen sich selbst allen Schicksalsschlägen trotzend, hält sie den landwirtschaftlichen Betrieb aufrecht und versteht es, ihn über die Jahrzehnte hinweg zu vergrößern und später ihrem Sohn Henri zu übergeben. Achtzigjährig erlebt die erschöpfte Matriarchin schließlich, wie dieser mit ihren Enkeln Serge und Joël den familiären Zuchtbetrieb zu einer gigantischen, die Ressource Tier grausam ausbeutenden Tierfabrik ausbauen. Das anonymisierte Elend der Schweine spiegelt nicht nur den Wahnsinn dessen, was die Menschheit unter Fortschritt versteht, sondern wirft auch die Frage auf: Wer sind die eigentlichen Bestien?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Baptiste Del Amo
TIERREICH
Aus dem Französischen vonKarin Uttendörfer
Roman
Für Sébastien,für meine Eltern und meine Schwester
INHALT
Diese verdammte Erde (1898–1914)
Post tenebras lux (1914–1917)
Das Rudel (1981)
Der Untergang (1981)
DIESE VERDAMMTE ERDE(1898–1914)
Kaum dass der Frühling sich zeigt und bis spät in den Herbst hinein setzt er sich abends auf die kleine Bank aus genageltem und wurmstichigem Holz, mit der abschüssigen Sitzfläche, unter dem Fenster, dessen Rahmen in der Nacht ein kleines Schattenspiel auf der Steinfassade auslöst. Drinnen auf dem Tisch aus massiver Eiche hechelt eine Öllampe, und das ewig knisternde Feuer im Kamin wirft auf die mit Salpeter überzogenen Wände den geschäftigen Schattenriss der Ehefrau, schwingt ihn hinauf zu den Deckenbalken oder bricht ihn in einer Zimmerecke, und dieses gelbe, flackernde Licht bläht den großen Raum auf, durchbricht dann die Dunkelheit des Hofes und zeichnet den Vater im Umriss, bewegungslos und schwarz, in einer Art Gegenlicht. Im Wechsel der Jahreszeiten erwartet er die Nacht auf dieser Holzbank, derselben, auf der er bereits seinen Vater vor ihm hat sitzen sehen und deren moosbewachsene und mit den Jahren morsch gewordene Füße immer mehr nachgeben. Wenn er dort sitzt, ragen die Knie bis hinauf an seinen Bauch, sodass er Schwierigkeiten hat, wieder hochzukommen, dennoch hat er nie daran gedacht, die Bank durch eine neue zu ersetzen, und bliebe von ihr auch nur ein letztes heiles Brett am Boden. Er glaubt, dass die Dinge so lange wie möglich so bleiben sollten, wie er sie immer gekannt hat, so wie andere vor ihm sie als gut erachtet haben oder so wie ihr Gebrauch sie eben hat werden lassen.
Wenn er vom Feld zurückkommt, zieht er sich gegen den Türpfosten gestützt die Schuhe aus, kratzt den Dreck sorgfältig von den Sohlen, bleibt auf der Zimmerschwelle stehen, wo er die feuchte Luft einsaugt, den Atem der Tiere, die strengen Dünste von Ragout und Suppe, von denen die Fenster beschlagen sind, so wie er einst als Kind stehen geblieben war und wartete, bis seine Mutter ihm bedeutete, er solle sich an den Tisch setzen, oder sein Vater zu ihm kam und ihn mit einem kleinen Stoß gegen die Schulter zur Eile antrieb. Sein langer und magerer Körper ist nach vorne gebeugt und weist am Nackenansatz eine skurrile Wölbung auf. Sein Hals ist so sonnengegerbt, dass er selbst im Winter nicht heller wird und für immer von einem geräucherten, dreckigen Leder umhüllt und wie gebrochen wirkt. Ähnlich einer Knochenzyste steht der erste Wirbel zwischen den Schultern hervor. Er nimmt den ausgebeulten Hut ab, der seinen schon kahlen, von der Sonne fleckigen Schädel bedeckt, hält ihn einen Augenblick lang in den Händen, als versuchte er, sich der Geste zu erinnern, die er nun ausführen soll, oder als hoffte er noch immer auf die Anweisung jener Mutter, die schon lange tot ist, von der Erde verschlungen und verdaut. Angesichts des beharrlichen Schweigens der Ehefrau entschließt er sich am Ende doch weiterzugehen, eingehüllt in den eigenen Gestank und den Gestank des Viehs, hin zum Schrankbett, dessen Tür er öffnet. Er setzt sich auf den Matratzenrand oder stützt sich erneut an der geschnitzten Holztür ab und knöpft zwischen zwei Hustenanfällen sein verklebtes Hemd auf. Am Ende des Tages ist ihm nicht nur das Gewicht seines Körpers unerträglich, von dem die Krankheit indes gewissenhaft alles Fett und Fleisch abgenagt hat, sondern allein schon das Aufgerichtetsein, und es scheint, als drohe er jeden Augenblick umzufallen, auf den Boden hinabzusegeln wie ein welkes Blatt, dabei zunächst die stickige Luft des Zimmers fegend, von rechts nach links und von links nach rechts, um sich dann einfach auf dem Boden abzulegen oder unter das Bett zu gleiten.
Auf dem Feuer, in einem gusseisernen Kessel, ist das Wasser inzwischen erhitzt worden, und die Erzeugerin reicht Éléonore den Krug mit kaltem Wasser. Das Mädchen macht nur kleine Schritte, denn es fürchtet, das Gefäß zum Überlaufen zu bringen, aus dem trotz aller Vorsicht Wassertropfen erst die Hände, dann die Unterarme entlanglaufen und die hochgekrempelten Ärmel ihrer Bluse durchnässen, während sie feierlich auf den Vater zugeht. Sie spürt, wie ihr Nacken unter dem vorwurfsvollen Blick der Erzeugerin zittert, die dicht hinter ihr ist und droht, sie mit dem kochend heißen Wasser aus der Schüssel zu übergießen, wenn sie sich nicht beeilt. Im Halbdunkel gelandet wie ein großer Vogel, die Ellbogen auf den Knien, die Arme und Hände schlaff vor sich baumelnd, ist der Vater in die Betrachtung der Holzmaserung des Schranks versunken oder in die des auf dem Waschtisch brennenden Dochts, der gegen die Dunkelheit ankämpft. Das spärliche Licht der Flamme reflektiert sich im Oval des an die Wand genagelten Spiegels und lässt vom Zimmer kaum mehr als ein Zerrbild übrig. Durch eine Öffnung in der Lehmmauer, auf Hüfthöhe, stecken zwei Kühe ihre Köpfe und wiederkäuenden Mäuler. Der Dunst ihrer trägen Körper und der Exkremente, die sie unter sich lassen, wärmt die Menschen. In ihren bläulichen Pupillen spiegeln sich die kleinen Szenen, die diese beim Feuerschein des Kamins darbieten. Der Anblick der Ehefrau und des Kindes scheint den Vater aus seiner nebelhaften Träumerei zu reißen und zurück in diesen schmächtigen, von Venen durchzogenen Körper zu führen. Wie gegen seinen Willen findet er die Kraft, sich wieder zu bewegen. Er rappelt sich von seinem kläglichen Lager hoch, zeigt den bleichen Rücken, richtet den mit grauem Flaum bedeckten Oberkörper wieder auf, in den Furchen von Rippen und Schlüsselbeinen gefangen wie das Tollkorn im Getreide. Der Bauch ist eingefallen, gelbgefärbt vom Kerzenlicht. Er lockert die Arme mit den schwieligen Ellbogen und deutet manchmal sogar ein Lächeln an.
Die Erzeugerin schüttet das heiße Wasser in die auf den Waschtisch gestellte Wanne. Sie nimmt den Krug aus Éléonores Händen, stellt ihn auf die Ablage, ehe sie zurück in ihre Küche geht, ohne den Vater eines Blicks zu würdigen, bemüht, ihren Augen das Bild des Mannes mit dem nackten und dürren Oberkörper zu ersparen, der ebenso abgemagert ist wie der direkt an die Wand am Fußende des Bettes genagelte Jesus Christus. Oben vom Kreuz herab wacht Er über ihren Schlaf und erscheint ihr in ihren späten und schläfrigen Gebeten, lediglich angekündigt durch einen Lichtstrahl des Mondes oder den hüstelnden Rest einer Kerze, deren Schein sich durch den Türspalt des Schrankbetts einschleicht, ein zu Tode gekreuzigtes Abbild des neben ihr eingeschlafenen Vaters, von dem sie inzwischen sorgsam Abstand hält, weil sie seine Nachtschweiße, seine spitzen Knochen, seinen pfeifenden Atem nicht mehr ertragen kann. Aber es kommt vor, dass sie, wenn sie sich von diesem Mann abwendet, der sie geheiratet und geschwängert hat, das Gefühl überfällt, sie verrate dadurch ihren Glauben und sie wende sich vom Sohn, ja von Gott selbst ab. Von diesem Schuldgefühl getrieben, wirft sie ihm, dem Ehemann, also einen raschen Blick zu, eine schroffe und harte Geste des Mitgefühls, und steht wieder auf, um die Wanne mit dem blutigen Auswurf, den er die ganze Nacht über aushustet, zu leeren, ihm einen Senfwickel zu bereiten oder einen Thymiantee mit Honig und Schnaps, den er, an den Kopfteil des Bettes gelehnt, von seinen Kopfkissen gestützt, in kleinen Schlucken hinunterschlürft, beinahe gerührt von dieser Fürsorge und sorgsam bedacht, nicht zu schnell zu trinken, um ihr seine Dankbarkeit zu zeigen, so als ob er diese bitteren und unwirksamen Abkochungen genösse, während sie von einem Bein aufs andere tritt. Denn schon hat sich das Bild des Vaters am Kreuz verflüchtigt, mit ihm auch das Schuldgefühl, und jetzt will sie so schnell wie möglich in ihr Bett zurück und im Schlaf versinken. Sie wendet sich ab, mit der Tasse oder der Wanne in der Hand, und schimpft so leise vor sich hin, dass er ihre Worte für Klagen hält, gegen seine kränkelnde Natur, gegen diese chronische Krankheit, die seit beinahe zehn Jahren seine Lungen zerfrisst und aus einem einst robusten Mann dieses schmächtige und schwachbrüstige Würstchen macht, das nur noch fürs Sanatorium taugt; dann gegen ihr eigenes Pech oder die Hartnäckigkeit eines Schicksals, gegen das sie ankämpft, sie, die bereits eine gebrechliche Mutter gepflegt und beide Elternteile begraben hat.
Während der Vater sich über die dampfende Wanne beugt, aus der er mit den Händen Wasser schöpft und zu seinem Gesicht führt, hält Éléonore sich im Hintergrund, achtet aber auf jede einzelne der Verrichtungen dieser Waschung, die Abend für Abend im Lichtkreis der Lampe in gleicher Abfolge und Geschwindigkeit ausgeführt wird. Befiehlt die Erzeugerin ihr, sich hinzusetzen, beobachtet sie aus den Augenwinkeln die Wölbung dieses Rückens, den Rosenkranz der Wirbelsäule, den seifigen, über die Haut streichenden Waschlappen, die schmerzenden Muskeln, die Gesten, mit denen er ein frisches Hemd anzieht. Von einer fragilen Grazie belebt, gleiten seine Finger die Knopfleiste entlang wie die zittrigen Beinchen von Nachtfaltern, von Totenkopfschwärmern, deren Puppen in den Kartoffelfeldern ausschlüpfen. Dann steht er auf, setzt sich an den Tisch, und während die Erzeugerin sich ebenfalls setzt, führt er seine gefalteten Hände mit fest verschränkten Fingergliedern vors Gesicht, sein Blick verschwindet hinter den Fingerrücken mit den stark hervortretenden Gelenken, den schwarzen Nägeln. Mit einer vom Husten ganz rauen Stimme sagt er ein Tischgebet auf, und endlich essen sie, allein ihr Kauen, die auf den Tellern kratzenden Bestecke und das Gesumme der Fliegen, die von ihren Mundwinkeln zu verjagen sie sich gar nicht mehr die Mühe machen, durchbrechen die Stille, während die Erzeugerin wiederholt versucht, diesen gegen ihre Stimmritze drückenden Kiesel und die Gereiztheit, die das speicheltriefende Röcheln, das Knirschen der Backenzähne aus dem Mund des Ehemanns in ihr auslösen, wieder hinunterzuschlucken.
Von allen Körperfunktionen ist es die Nahrungsaufnahme, die die Erzeugerin zutiefst verabscheut, sie, die nicht zögert, Rock und Unterrock anzuheben, um sich mit gespreizten Beinen zu erleichtern, wo immer sie sich befindet, mitten auf das Feld, in die Wasserrinne einer Dorfstraße oder direkt auf den Misthaufen im Hof, wo ihre Pisse vermischt mit der der Tiere den Boden entlangrinnt, und die, sollte ihr Bedürfnis ein anderes sein, sich nur rasch hinter einen Busch verzieht, um sich hinzukauern und zu kacken. Sie nimmt nur magere Rationen zu sich, karge Bissen, widerwillig hinuntergeschluckt mit vor Abscheu oder sofortigem Überdruss verzogenem Gesicht.
Noch mehr widert sie der Appetit der anderen an. Sie geißelt das Kind und den Mann, die gelernt haben, mit gesenktem Kopf zu essen, und während sie das Mädchen misstrauisch beäugt, gemahnt sie den Vater, wenn er unterwürfig um ein weiteres Glas Wein bittet, daran, wie der berauschte Noah sich vor seinen Söhnen entblößte oder wie Lot Inzest beging. Sich selbst verordnet sie tagelange, ja wochenlange Fastenkuren. Nur ein paar Mundvoll Wasser gestattet sie sich, wenn der Durst allzu quälend wird. Im Sommer beschließt sie, aus Gründen der Sparsamkeit, sich nur noch von Beeren oder Früchten aus dem Obstgarten zu ernähren. Wenn sie dann im Innern der Pflaume oder des Apfels auf einen Wurm stößt, besieht sie ihn, zeigt ihn herum und isst ihn schließlich auf. Sie findet, er schmecke nach Opfer. Derart ausgetrocknet ist sie, dass sie nur noch eine blutleere, an knotigen Muskeln sitzende und hervorstechende Knochen überziehende Hauthülle abgibt. Einzig nach der Eucharistie in der Sonntagsmesse, wenn sie vor dem Altar die Kommunion erhält, sieht Éléonore sie genießen und sich ergötzen. Verzückt lutscht sie da den Körper Christi, dann geht sie mit hochmütiger Miene in ihre Bank zurück und schielt begehrlich zu der Pyxis hin, in der Vater Antoine standhaft die Hostien aufbewahrt. Nach dem Gottesdienst, während die Leute um sie herum miteinander plaudern, hält sie auf dem Kirchplatz für einige Augenblicke inne, hoheitsvoll, als ob sie sich aus einem Wachtraum reißen müsste oder die Kommunion, die von allen, wahrhaftig aber nur von ihr allein empfangen wurde, ihr eine außerordentliche Wichtigkeit verliehe und sie von den anderen Dorfbewohnern abhöbe. Sie löst mit kleinen Zungenschlägen die letzten Krümel ungesäuerten Brots von ihrem Gaumen, dann nimmt sie, ihre Tochter am Arm mit sich zerrend, wieder den Weg zurück in die Hügel, ohne auch nur mit einer Person ein Wort gewechselt zu haben, während der Vater diese kostbare Stunde Freiheit, die sie ihm zugesteht, beim Schopfe packt und loszieht, um die Cafés mit den anderen Männern aus dem Dorf abzugrasen. Einmal im Jahr verspürt sie das Bedürfnis, eine Wallfahrt nach Cahuzac im Gimoès zu unternehmen, wo sie zu Unserer lieben Frau von den sieben Schmerzen, Beata Maria Virgo Perdolens, betet, deren im Mittelalter von einem Bauern entdeckte Statue Wunder vollbringen soll und der sie sich durch das eine oder andere Geheimnis eng verbunden fühlt. Doch wenn dann im Advent junge Burschen an ihre Tür klopfen, um das Aguillonné zu singen, das Glück und Gesundheit fürs neue Jahr verheißt, sträubt sie sich, ihnen zu öffnen, und klagt, dass sie dann im Gegenzug Schnaps oder ein paar Eier vergeuden müsse. Sie allein weiß, was echten Glauben von Aberglauben unterscheidet. Auf dem Markt trifft sie manchmal auf Wahrsagerinnen: Auch hier zerrt sie das Kind an der Hand mit sich fort, riskiert, ihm die Schulter auszukugeln, wobei sie über ihre eigene einen Blick voller Neid, Wut und Bedauern in Richtung der Prophetin wirft.
Am Ende der Mahlzeit stößt der Vater den Stuhl nach hinten und erhebt sich mit einem tiefen Seufzer, er zieht den Mantel aus Wolle über und setzt sich schließlich auf die Holzbank, wo er seine Stummelpfeife stopft und anzündet, deren Glut sogleich einen rotglühenden Schimmer auf seinen spitzen Nasenrücken und bis in die Vertiefung der Augenhöhlen wirft. Éléonore bringt ihm einen nach Nelken duftenden Glühwein, ein Glas Schnaps oder Armagnac, dann setzt sie sich neben ihn auf die kleine Bank aus genageltem und wurmstichigem Holz und saugt den beißenden Tabakgeruch ein, der in der Dämmerung oder der schwarzen Nacht aufsteigt und sich mit den Aromen der vom Regen aufgeweichten oder am Ende brütend heißer Tage einen Geruch nach aufgebrochenen Erdspalten und verdorrten Hainen ausströmenden Böden vermischt. In der Ferne zieht eine Herde Schafe durch die Dämmerung, ihre Glocken bimmeln leise. Die Erzeugerin bleibt in der Nähe ihres Feuers und wickelt Flachs auf einen Spinnrocken. Der Vater spricht nicht, aber er akzeptiert die zierliche und zarte Anwesenheit Éléonores, den Arm, der seinen leicht berührt. Sie gibt sich Mühe, seine Einkehr zu teilen und so wie er die Nacht und die Stille des Hofes zu ergründen, die purpurne und noch bläuliche Kulisse des Himmels, hinter der schon schwarzen Linie des Dachfirsts der Wirtschaftsgebäude, den Wipfeln der großen Eichen und Kastanien, und dazu die gedämpften Laute der Tiere, das hinter den Gattern des Hühnerstalls oder auf der Weide dösende Kleinvieh, das Grunzen des Schweins im Koben und das Glucken der Hennen. In den kühlen Nächten des Spätsommers, wenn der klare Himmel eine majestätische und sternenübersäte Kuppel bildet, fröstelt ihr, und sie steckt ihre Füße unter die bebende Flanke des Hundes, der vor ihnen ausgestreckt liegt, kuschelt sich an den Vater, und er hebt manchmal den Arm, damit sie den Kopf in seine Achselhöhle schmiegen kann.
Dieser Körper ist ihr fremd, ebenso wie das Wesen, das ihn ausmacht, dieser wortkarge und kränkliche Vater, mit dem sie, seit sie auf diese Welt gekommen ist, nicht mehr als hundert Worte gewechselt hat, dieser armselige Bauer, der schuftet bis zum Umfallen und dadurch sein Ende beschleunigt, als ob er es eilig hätte, es hinter sich zu bringen, aber erst nach der Ernte, nach der Aussaat, nach dem Pflügen, nach … Die Erzeugerin zuckt die Schultern, seufzt. Sie sagt »wir werden sehen«, »so Gott will«, »dass der Herr dich erhöre und sich unser erbarme«. Sie fürchtet, dass er keine x-te Frist bekommt, denn was wird dann aus ihr, die Vollwaise ist und ein Kind zu ernähren hat? Sie spricht auch von den Mühen, die sie beim Gebären hatte, dem Unglück, dass sie zu alt dafür war, schon achtundzwanzig. Und dann nicht mal ein Junge, der von Kindesbeinen an dem Vater eine echte Hilfe gewesen wäre, diesem beherzten und unermüdlichen Mann, der aber keinerlei Ehrgeiz bewies und nur eine spröde Erde hinterlassen wird, einen dieser Familienbauernhöfe mit kargen Erträgen. Früher einmal besaß die Familie des Ehemanns Weinberge, aber die dramatischen Verwüstungen der Reblaus in den Weinbaugebieten hatten ihre wenigen zerstückelten und steinigen Parzellen nicht verschont, und der Vorfahr, der Vater des Vaters, war dann von einem Tag auf den anderen und ohne einen Mucks verstorben. Er brach ganz einfach zu Füßen seiner Kuh zusammen, die man in eben dem Graben weidend fand, in den sie den Pflug hineingezerrt hatte, während er in den Erdfurchen lag, trocken und verschrumpelt wie ein toter Rebstock. Nichts oder beinahe nichts scheint die Landwirtschaftskrise und die Entwertung des Getreides überlebt zu haben. Das Ödland breitet sich immer mehr aus, die jungen Leute gehen fort, die Mädchen streben eine Arbeit als Amme oder Dienstmädchen in bürgerlichen Haushalten in der Stadt an. Und die Burschen können in den Steinbrüchen oder auf dem Bau ihre von der Feldarbeit gut entwickelten Arme zu einem besseren Preis anbieten. Sie sagt manchmal, dass bald nur noch sie allein übrig bleiben werden in dieser feindseligen Landschaft, Unbelehrbare, die eine widerspenstige Erde aufhacken, welche sie früher oder später umbringen wird.
Éléonore sitzt nur da, unbeweglich, eingekuschelt in den Geruch des Vaters, seinen Atem, verpestet von Tabak, Kampfer und den Tinkturen, die er inhaliert und auf ein Taschentuch träufelt, das den ganzen Tag in seinem Ärmel steckt. Sie spürt die harte Wölbung seiner Rippen unter dem Hemdstoff, wenn er tief einatmet oder von einem Hustenanfall geschüttelt wird, wenn er seinen Auswurf auf den Boden spuckt. Das Kind sinkt etwas in sich zusammen, döst weg. Eines nach dem anderen stürzen die Steingebäude des Gehöfts ein, dann der Boden unter ihnen, und es bleiben nur sie selbst, der Vater und der unsichtbare Bracke zu ihren Füßen in der nunmehr dichten, wässrigen Nacht, die ihr in die Nase dringt und ihre Lungen bläht. Sie allein, entrückt in einer feierlichen Raumzeitsphäre, wo die Gesänge der Insekten und der Raubvögel aus alten, längst vergangenen Zeiten zu kommen scheinen, wie das Leuchten schon toter Sterne über ihnen. Schließlich, wenn die Pfeife erloschen ist, sammelt der Vater seine letzten Kräfte, um das eigene Gewicht hochzustemmen und dazu Éléonore, deren Beine sich sogleich um seine Taille, deren Arme sich um seinen Hals schlingen, während ihr Kinn auf seiner Schulter ruht. Er legt sie auf das kleine, einer Truhe ähnelnde Bett neben der Schlafstatt der Eltern. Dann deckt er sie so behutsam zu, dass sie sich nie daran erinnert, wie sie zurück ins Haus gekommen ist, und am nächsten Morgen beim Erwachen zweifelt, ob sie diese Momente tatsächlich mit ihm geteilt hat.
Die Erzeugerin, eine dürre Frau mit rotem Nacken und abgearbeiteten Händen, schenkt ihrer Tochter keine überflüssige Aufmerksamkeit. Sie beschränkt sich auf ihre Erziehung, vermittelt ihr das Wissen über die alltäglichen Aufgaben, die ihrem Geschlecht obliegen, und das Mädchen hat früh gelernt, ihr bei all ihren Arbeiten zu folgen und die entsprechenden Handgriffe und Haltungen nachzuahmen. Mit fünf Jahren hält sie sich aufrecht und streng wie eine Bäuerin, die Füße fest auf der Erde, die Fäuste gegen die schmalen Hüften gestemmt. Sie schlägt die Wäsche, buttert den Rahm und schöpft Wasser aus dem Brunnen oder den nahen Quellen, ohne dafür auf Anerkennung oder Zuneigung zu hoffen. Vor Éléonores Geburt hat der Vater die Erzeugerin zweimal geschwängert, doch ihr Monatsfluss, an sich kümmerlich und unregelmäßig, versiegte nicht während dieser Monate, in denen sie, wie sie im Nachhinein versteht, schwanger gewesen war, obwohl ihr Bauch nur eine leichte Rundung aufwies. Trotz ihrer Magerkeit war sie ein dickbäuchiges Kind gewesen, mit hart angespannten Organen und krampfhaften Parasitosen, die sie sich durch das Spielen mit Erde und Mist oder durch den Verzehr von verwurmtem Fleisch zugezogen hatte und die ihre Mutter vergeblich mit Knoblauchabkochungen zu behandeln versuchte.
Eines frühen Morgens im Oktober, sie ist alleine im Koben und versorgt die trächtige Sau, wird sie mitten im Schweinegatter von einem jähen Schmerz gepackt, und sie sinkt auf die Knie, ohne auch nur einen Schrei von sich zu geben, auf das Heu, das sie gerade auf dem Boden verteilt hat und dessen weißer und duftender Staub noch in Spiralen aufwirbelt. Fruchtwasser läuft ihr über Schenkel und Strümpfe. Das Tier, von seinen eigenen Wehen geplagt, umkreist sie immer wieder, stößt dabei lange Klagelaute aus, sein enormer Bauch wabbelt beim Laufen von einer Seite zur anderen, die Zitzen sind von Milch schon angeschwollen, die Lippen der prallen Vulva bereits leicht geöffnet; und erst auf den Knien, dann auf der Seite liegend, wirft die Erzeugerin, wie eine Hündin, wie eine Sau, zuckend, hochrot, von ihrer Stirn perlt der Schweiß. Mit einer Hand tastet sie zwischen den Schenkeln nach dem klebrigen Brocken, der sie zerreißt. Sie drückt ihre Finger hinein in die Fontanelle, zieht die Missgeburt heraus und schleudert sie weit von sich. Mit einer Hand packt sie die bläuliche Schnur, die sie fesselt, und zieht aus ihrem Leib den Plazentasack, der mit einem Klatsch zu Boden fällt. Sie starrt auf den kleinen, von einer käsigen Schmiere überzogenen Körper, einem gelblichen Wurm ähnlich oder der grau und goldbraun glänzenden Larve eines Kartoffelkäfers, die man aus der fetten Erde und den Wurzeln zupft, von denen sie sich ernährt. Der Tag gleitet zwischen die losen Planken, malt Streifen in die saure und staubige Atmosphäre, in den tristen, vom Geruch nach Abdeckerei getränkten Halbschatten, berührt dann das reglose Gebilde im Heu. Die Erzeugerin rappelt sich wieder hoch, in zwei Teile zerrissen, eine Hand unter ihren Röcken, auf dem aufgewühlten bebenden Fleisch ihres Geschlechts. Sie weicht entsetzt zurück, verlässt das Gehege, wobei sie darauf achtet, den Riegel herunterzuklappen, und überlässt der Sau die Nachgeburt und ebenso ihre Frucht. Sie verharrt lange wie erstarrt, schweratmend, mit dem Rücken an eine Mauer des Stalls gelehnt. Vor ihren Augen flimmernde gleißende Linien. Dann verlässt sie den Hof und nimmt die Straße in Richtung Puy-Larroque, humpelnd in einem dichten Sprühregen, der über ihre Schläfen und ihre von den Lochien braun gefärbten Röcke rinnt. Sie überquert den Dorfplatz, ohne irgendjemanden eines Blickes zu würdigen. Diejenigen, die sie vorbeigehen sehen, bemerken den schmutzigen Rock, den sie mit der Faust umschließt, ihr totenbleiches Gesicht und den fest zusammengepressten Mund mit Lippen weiß wie eine alte Wundnaht. Die braunen, unter dem Kopftuch hervorquellenden Haare kleben ihr an Schläfen und Nacken. Sie stößt die Kirchentür auf und sinkt vor dem Kreuz auf die Knie.
In einem heftigen Schlagregen kehrt sie zum Anwesen zurück und geht, unter dem stoischen Blick der reglos im Regenguss ausharrenden Kühe, an den Gräben entlang, die Strickjacke mit beiden Händen über dem platten Busen krampfhaft zusammenhaltend. Mit eingezogenem Kopf schleppt sie ihre schlammigen Holzpantinen über den Weg, psalmodiert ein Ave Maria, skandiert von ihren Atemstößen und dem Reiben der Holzsohlen auf dem aufgeweichten Boden. Als sie den Hof überquert, sieht sie von Weitem die Umrisse zweier Männer am Eingang des Schweinestalls. Sie bleibt stehen, gelähmt vor purer Angst. Ihr Herz, das im ersten Augenblick ausgesetzt hat, schlägt nun bis zum Hals. Der starke Regen versieht einen schieferfarbenen Himmel mit Streifen, die Luft scheint von tausend Nadeln zerstochen. Die Umrisse tauchen an der braunen Masse der Stallmauer auf, wie aufgelöst, sodass sie zunächst nicht erkennen kann, ob die Männer ihr die Vorderseite oder den Rücken zuwenden. Schließlich erahnt sie die Gesten der Hände, den Schwall ihres Atemhauchs, den gleichermaßen zerhackten Klang ihrer Stimmen. Sie wagt einen Schritt, eine Bewegung des Beins, fast wie betäubt oder unter dem Befehl eines tiefer liegenden Willens, ehe sie zum Haus stürzt, wo sie sich in fliegender Hast auszieht, ihre Strümpfe und den Unterrock ins Feuer wirft, die zischeln in der Glut wie ein Schlangenknoten, bevor sie unter dem trägen Blick zweier Kühe zu brennen beginnen. Sie bespritzt sich mit Spülwasser, dann wischt sie sich mit einem Lappen ab, den sie zwischen ihre Schenkel gleiten lässt, und zieht sich saubere und trockene Kleidung über.
Sie setzt sich an den Tisch, auf die Bank. Sie überwacht das Fenster, hinter dem es wie aus Kübeln schüttet und der Regen vom schlammigen Boden des Innenhofs aufspritzt. Im Fensterrahmen erscheinen die Umrisse der Männer, und sie erkennt den hinkenden Gang von Albert Brisard, einem Einheimischen mit Klumpfuß, der von einem Bauernhof zum anderen zieht und seine Dienste anbietet. Sie rührt sich nicht, als sie näher kommen. Sie umklammert auf ihren Schenkeln einen Rosenkranz, zwischen ihren Händen mit den weiß hervortretenden Handgelenken, sagt stockend lateinische Verse auf: »… Du, der Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser; Du, der Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, nimm an unser Gebet; Du, der Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme Dich unser …«
Als die Männer die Tür öffnen, erhebt sie sich abrupt und steht stocksteif und schweigend am Rand des Tisches. Eine Windböe fegt über den Hof und pfeift in das Zimmer herein, sprüht ihr einen Hauch Nieselregen ins Gesicht und den Geruch der Männer, die ihre Regenmäntel ausziehen, nach Luft schnappen und sich die Gesichter trockenwischen. Der Ehemann sagt: »Da bist du also.« Sie bleiben einen Augenblick im feuchten und verräucherten Halbdunkel stehen, dann fordert der Ehemann Brisard auf, Platz zu nehmen, und sie setzen sich an den Tisch. Sie läuft zum Büfett, wo sie den Rosenkranz ablegt und die Flasche Armagnac und zwei Gläser herausholt, die sie vor die Männer stellt und bis zum Rand füllt. Der Flaschenhals klirrt so heftig am Glasrand, dass sie ihren Unterarm mit einer Hand abstützen muss.
»Wo warst du denn?«, fragt der Ehemann.
»Ich hatte im Dorf zu tun«, antwortet sie.
»Obwohl die Sau kurz davor war zu werfen?«
»Ich habe ihr das Heu zurechtgemacht, aber es sah noch nicht danach aus.«
»Sie hat sie gefressen, es war nichts mehr zu retten«, antwortet er.
»Ja, ja«, sagt Brisard und steckt seinen großen Schnurrbart in den Schnaps.
Die Männer leeren ihre Gläser, und sie gießt ihnen nach, sie leeren die Gläser erneut, und sie gießt ein zweites Mal nach, dann verschließt sie die Flasche wieder und stellt sie zurück ins Büfett. Sie setzt sich etwas abseits auf den Kornkasten.
»Auch deine Sau nicht«, fährt Brisard fort, mit von einem Rülpser aufgeblähten Backen. »Ich garantier’ dir, dass sie’s wieder macht … Sie hat das jetzt wie im Blut. Wenn du sie verschonst und noch mal decken lässt, auch wenn du sie ankettest, damit sie den Ferkeln nichts tun kann, kannste sicher sein, die werden auch von dem Übel befallen, und die Weibchen fressen später ihren Wurf genauso auf. Das ist wie ein Makel, ein Laster … Ich hab’ das schon mit eigenen Augen gesehen. Kannst sie nur noch schlachten.«
Er nickt bekräftigend und schnieft, wischt sich die Nase mit dem Handrücken ab, auf dem der Rotz eine glänzende Spur hinterlässt, und führt das leere Glas an die Lippen, hebt es hoch und beugt den Kopf nach hinten, um noch den letzten Tropfen Alkohol zu erwischen.
Er sagt: »Ja, ja.«
»Dabei kriegen unsre Tiere genug Futter«, antwortet der Ehemann.
»Vielleicht ist es ja, um den Blutverlust auszugleichen. Oder wegen der Schmerzen, die sie dabei haben … Am besten, man sammelt die Nachgeburt gleich auf und streut, direkt wenn es blutig wird, frisches Heu nach. Sobald die Jungen die Sau um die Erstmilch erleichtert haben, ist nicht mehr viel zu befürchten.«
Dann wirft er über die Schulter einen Blick nach draußen und steht auf: »Sieht aus, als ob es aufgehört hat zu regnen. Reden wir nächstes Mal weiter.«
Der Ehemann nickt zustimmend, steht ebenfalls auf und begleitet ihn bis zur Türschwelle. Sie schauen ihm zu, wie er seinen Mantel wieder anzieht, seine Mütze auswringt, aus der ein brauner Saft auf die grauglänzenden Pflastersteine im Hof rinnt, sie sich auf den Kopf setzt und sich mit einem einfachen Kopfnicken verabschiedet und davonmacht. Missmutig streift sich der Ehemann ein Regencape aus Leder über, steigt in seine mit Nägeln beschlagenen Stiefel und geht los in Richtung Schweinestall. Die Ehefrau schließt die Tür wieder. Sie beobachtet den noch starken Rücken dieses Mannes, den sie wohl als den ihren betrachten muss, seinen weit ausholenden, langsamen Gang unter dem jetzt von schwarzen, lose umherziehenden Wolken durchzogenen Himmel, dann wendet sie sich ab, schafft es gerade noch zum Bett, wo sie sich, an allen Gliedern zitternd, ausstreckt und sogleich in den Schlaf sinkt.
Am selben Abend schon erscheint ihr das Ereignis weit entfernt. Es bleibt davon nichts weiter als eine schwache Erinnerung, ein Eindruck, wie ihn ein Traum hinterlässt, der im Wachzustand wieder hochkommt, jedoch noch verschwommener; ein unbestimmtes Gefühl, das durch irgendein Detail wieder aufbricht und in sich die Gesamtheit des Traums oder die Erinnerung des Traums enthält, ein Faden, der sich auflöst, sobald sie versucht, ihn an die Oberfläche ihres Bewusstseins zu ziehen, und wenn sie sich auch noch eine Zeit lang an einen ganz eigenartigen körperlichen Zustand erinnert, an eine bodenlose Leere, so klingt diese Empfindung doch von Tag zu Tag mehr ab, bis alles oder fast alles von dieser Geburt auf dem Boden eines Schweinekobens ausgelöscht ist. Die kindsmörderische Sau wird in die Mast gegeben, und von einem Nachbarhof lässt man einen Zuchteber kommen, der das andere Weibchen deckt, das dann drei Monate, drei Wochen und drei Tage später abferkelt. Auf Anraten Albert Brisards und als Vorsichtsmaßnahme reibt man die Ferkel mit einer bitteren Abkochung von Koloquinten und Wacholder ein. Der Vorfall gerät in Vergessenheit.
Jedes Wochenende, nachdem er auf der kleinen Bank aus genageltem und wurmstichigem Holz seine Pfeife geraucht, sein Glas Schnaps oder seinen Glühwein getrunken und dabei beobachtet hat, wie der Tag über den moosbewachsenen Dächern des Gehöfts, auf denen Ringeltaubenpärchen vor sich hin dösen, zur Neige geht, sucht der Ehemann das Ehebett auf. Im Schein der Lampe entkleidet er sich, zieht ein Nachthemd über, dann schlüpft er unter die Decke, schließt die Tür und versucht den Körper seiner auf dem Bauch oder auf der Seite liegenden Frau zu umarmen, die sich schlafend stellt oder eine ablehnende Benommenheit vorgibt. Er hat keinerlei Grund zu glauben, dass sie der Begattung zustimmt, außer dass sie wohl oder übel die holprigen Gesten erträgt, mit denen er hektisch ihrer beider Hemden zerknittert, ihre kleinen Brüste packt oder ihre Schultern umfasst, ungeschickt zwischen ihren Schenkeln herumfuhrwerkt, dort ein langes, hartes Geschlecht platziert, so knorrig wie ein Knochen oder wie eine dieser Ochsensehnen, die in der Sonne getrocknet werden und aus denen man Ruten herstellt. Mit geschlossenen Augen, stumm, hört sie dem grotesken Quietschen des Schrankbetts zu, dessen Wände jeden Augenblick in die Brüche zu gehen drohen. Sie registriert des Gewicht dieses Körpers, den Kontakt dieser Haut, seinen sauren Geruch nach ranzigem Schweiß, nach Erde und Mist, das wiederholte, bösartige Eindringen dieses Auswuchses in ihren Körper, den abgestandenen, üblen Geruch, wenn der Ehemann die Decke hebt und in seine Hand spuckt, um dieses schrumpelige Geschlecht zu befeuchten, den kariösen Atem, den er ihr ins Ohr röchelt, während er seinen weichen Schnurrbart an ihrer Wange reibt, ehe er in der Kopfkissenrolle eine gutturale Klage vergräbt, die an die eines Stückes Wild erinnert, das sich von einer Kugel getroffen noch durchs Unterholz schleppt, und in einer letzten Zuckung, die eine Agonie sein könnte, auf die Seite sinkt. Sie wartet, bis er eingeschlafen ist, um aufzustehen und über eine Wasserwanne gekauert ihren von kaltem Sperma besudelten Schritt auszuspülen, dann kniet sie vor dem Fußende des Betts nieder, die schwieligen Knie auf der festgestampften Erde, die Hände über der Stirn gefaltet, und flüstert ein Gebet.
Sieht sie zwei Hunde, die sich paaren, so stürzt sie sich mit einem Besen, einer Heugabel oder einem Stock bewaffnet auf sie. Mit dem Stiel schlägt sie dann wütend auf den Rücken des Rüden ein, bis dieser schließlich ablässt, und das Tier, im ersten Moment unfähig, sich zu befreien, kassiert jaulend die Schläge, während das Weibchen versucht, schnellstens die Flucht zu ergreifen, und ihm dabei manchmal den Penisknochen bricht. Die Erzeugerin steht dann da, ganz außer Atem, vor Wut schäumend, und wischt sich mit dem Ärmel die Stirn ab. Sie verachtet alle Tiere, oder beinahe alle, und wenn man zufällig einmal mitbekommt, wie sie sich von einem Kind anrühren lässt, dann weil dieses am Ende eines Stricks einen schmächtigen, halbtoten und mit Schlamm verschmierten, am Pfötchen gefesselten Welpen hinter sich herschleift oder eine am selben Strick festgebundene Taube in die Lüfte schleudert. Von Alphonse, dem sie schon öfter ordentlich das Kreuz versohlt hat, wird sie gemieden wie die Pest. Für die Kühe hingegen hegt sie eine gewisse Zuneigung, weil sie ihnen Milch abmelken kann, wobei sie die Zitzen mit ihren trockenen, extra mit Butter beschmierten Händen knetet. Der Zweck heiligt die Mittel, und sie schert sich wenig um die Wollust der für die Mast und die Zucht bestimmten Tiere. Wenn die Sau, die Kuh, die junge Stute zur Besamung geführt wird, dann schätzt sie die Farbe, die Öffnung, die Schwellung der Vulven ab, stimuliert wenn nötig den Zuchtbullen, packt mit energischer Hand die Schläuche und führt die spiral- oder lanzen- oder s-förmigen Penisse hin zu ihrem Bestimmungsort, bezwingt das sich verweigernde Weibchen und das widerwillige Männchen und wischt dann einfach auf der Kruppe, an ihren Röcken oder in einer Handvoll Heu den zähflüssigen Samen ab, der an ihren Händen klebt. Überall um sie herum bespringen und begatten sich die Tiere: Die Erpel mit dem spiralig gewundenen Penis beschlagen stürmisch die Enten mit den komplexen Vaginen, die Ganter ejakulieren in die Falten konzentrischer Genitale, der Pfau schlägt sein Rad und steigt auf die von seinem Gewicht bestürzte Henne, die Spermien perlen, tropfen, rinnen, explodieren und spritzen zwischen Federn und Fell, entreißen Schreie oder Gluckslaute einer kurzen, beneidenswerten Lust. Während ein paar Männer dabei zuschauen, wie ein Eber eine Sau nimmt, kommentiert Albert Brisard, der sich auf dem Gebiet bestens auskennt, auf Gaskognisch: »Bei diesen Dreckskerlen kann der Krampf eine halbe Stunde dauern.«
Dann wiederholt er es leiser, wie für sich selbst: »Eine halbe Stunde …«, und die Männer, in Gedanken versunken, schütteln langsam den Kopf, ohne das wild schäumende Tier aus den Augen zu lassen.
Im auf die Episode aus dem Schweinekoben folgenden Jahr, in der erdrückenden Hitze einer vom Geruch des Ginsters und der fettigen Wolle der Schafe erfüllten schwülen Sommernacht wird die Ehefrau von einem vernichtenden Gefühl geweckt. Sie setzt sich auf dem Bettrand auf, legt eine Hand auf ihren Bauch, mit fiebrigem, aber blindem Blick, und bestaunt die Fremdartigkeit ihres Fleisches, die unterirdischen Strömungen, die aus diesem unzugänglichen Körper wie herauszuquellen scheinen, sich über die Matratze ergießen, ihr die Waden entlanglaufen und auf den Boden tropfen. Sie steht auf, taumelt durch das Zimmer, geht in die Spülkammer, schließt die Tür hinter sich und kommt in derselben Wanne nieder, in der sie sich jede Woche den durchscheinenden Samen des Ehemanns abspült, während er im Nebenraum hinter den Wänden des Schrankbetts vor sich hin schnarcht. Die Sache geht schnell und fast schmerzlos, vielmehr in einem einzigen heftigen Stich, als ob sie – ihr Körper – sich eines Ballasts entledigte, sich von dieser reglosen und stummen Last befreite, die sie nun betrachtet, bevor sie von einem plötzlichen Entsetzen gepackt, das jegliches Denken auslöscht, sich in ein Schultertuch hüllt, die Wanne packt, in den Hof hinaustritt und in der Nacht in Richtung Schweinestall verschwindet, wo die dösigen Schweine unter den Haufen aus Futter und Nussbaumzweigen schlafen, mit denen sie ihre Koben auskleiden.
Am nächsten Tag in der Frühe, als die Morgendämmerung weit entfernt über den Feldern einen leuchtendblauen Riss öffnet und sich die schwarze und unerreichbare Kontur der Pyrenäen abzeichnet, nimmt sie das Fahrrad, fährt ins Dorf und überquert den einsamen Platz, auf dem die Kastanien mit den nur schemenhaften Kronen als riesige Schatten aufragen. Sie reißt die Kirchentür weit auf, der ein Atem nach kaltem Stein, Weihrauch und Myrrhe entströmt. Sie verschiebt die Bänke und den Betstuhl, kehrt und wischt dann auf Knien, mit schwarzer Seife, den Boden des Kirchenschiffs. Sie poliert den Beichtstuhl, das Retabel und die Holztäfelungen und staubt die Kerzen und den funkelnden Leib Jesu Christi ab. Sie reibt die scharlachrote Wunde auf seiner rechten Seite, solange bis sie glänzt. Als sie sich endlich schweißgebadet auf die Außentreppe setzt, bricht über den Kastanien der Tag an und ziseliert die gezackten Umrisse der Kastanienblätter. Drei Charolaiskühe mit ihren baumelnden Eutern und überdimensionierten Hinterbeinen stehen auf dem Platz herum und grasen, von ihrem Fell perlt der Tau, ihre mahlenden Kiefer und das zarte Bimmeln ihrer Glocken rhythmisieren das Tschirpen der Spatzen. Ihr Atem kondensiert und trägt der Erzeugerin in kleinen Schwaden den Geruch von Pansen und Methan zu, den die Tiere in regelmäßigen Abständen in die bleiche Luft rülpsen und furzen und der sich mit dem Duft nach Hefe und Brot aus dem Backofen der nahe liegenden Bäckerei mischt. Sie erhebt sich wieder, ohne auf das Knacken ihrer Gelenke zu achten, und überquert den Platz bis hin zum Waschhaus, wo sie sich am Rand des Beckens den Schweiß vom Gesicht wäscht. Sie trocknet sich mit ihrer Bluse ab und trinkt aus der hohlen Hand das trübe Wasser, von dem nun auch eine der Kühe trinkt, sie kommt gemächlich angelaufen, ihr Rücken und ihre knochige Kruppe dampfen. Ein Kälbchen zittert zwischen ihren Beinen. Es stößt einen nach Molke riechenden Atem aus und betrachtet die Bäuerin aus meergrün und fiebrig glänzenden Augen, in deren Pupillen diese ihr konvexes Spiegelbild erkennt, sowie das des Platzes hinter ihr, auf dem der unerschütterliche Rest der Herde noch immer weidet.
Als der Ehemann zum ersten Mal krank wird, hofft sie zunächst, sie bekomme eine Atempause. Doch wie bei diesen Eintagsfliegen, deren einziges Ziel, einmal geschlüpft, es ist, sich zu begatten und ihre Eier in Flüssen oder Sümpfen abzulegen, verschlimmert sich seine Glut und nimmt an Beharrlichkeit und Heftigkeit stetig zu. Vielleicht ahnt er die Schwere seiner Krankheit voraus und will instinktiv die Mängel seines Geschlechts und seines Bluts weitergeben. Als er sie im Frühjahr des Folgejahres erneut schwängert, glaubt sie, dass ihre Askese und die wiederholten Reueakte etwas Gnade beim Herrn gefunden haben, denn dieses Mal setzt ihre Menstruation aus. Wenn auch nur spärlich, so rundet sich ihr Bauch; und sie wird morgens von einer furchtbaren Übelkeit geweckt: Das, was sie in sich trägt, musste also ein Menschenkind sein und nicht eine dieser von ihrem Fleisch ausgetriebenen Kreaturen, einer dieser Schösslinge des Teufels, von denen sie heute kaum mehr glauben kann, dass sie real gewesen sind. Dennoch erlebt sie ihre eigene Verwandlung in eine trächtige und empfindsame Kreatur mit großer Distanz zu sich selbst, mit diesem nunmehr vertrauten Gefühl der Entfremdung, und sie schleppt ihre Schwangerschaft mit sich herum, als trüge sie die Last der Welt.
Als Éléonore das Licht der Welt erblickt, sind die Schwarzerdeböden hart gefroren, es herrscht strenger Frost, und die Tiere irren wie verlorene Seelen durch diese feindlichen Heiden auf der Suche nach Gräsern, die vom Reif völlig erstarrt sind. Im Kamin brennt ein Feuer, aber der Vater wartet in der Kälte, auf der kleinen genagelten und wurmstichigen Holzbank, unter dicken Wolldecken begraben. Er hält entschieden Abstand zu den Hebammen, die zwischen Spülkammer und Bett und Bett und Spülkammer hin- und wieder zurücklaufen, Aufgüsse aus Nelken und Himbeerstrauchblättern zubereiten, die das Zimmer mit ihrem Duft erfüllen, Laken auswringen, heißes Wasser in Zinkwannen schütten, ihre Stimme erheben, um die Gebärende zu ermuntern, noch stärker zu pressen oder auf ein Stück Leder zu beißen, das sie ihr zwischen die Zähne schieben. Mit ihren erfahrenen Händen kneten sie den trächtigen Bauch und drücken von oben, während ein Krampf die Gebärmutter verdreht. Éléonore kommt mit der Nabelschnur um den Hals auf die Welt, blau angelaufen und stumm, und die Frauen trennen die Nabelschnur mit dem Messer durch, packen das Kind an den Füßen, bis sie ihr den Schrei einer Ertrinkenden entreißen, waschen sie ab und legen sie, die reglos ist, als hinge sie am Galgen, auf den Bauch der Erzeugerin. Sie sieht mit an, wie das Kind hoch zu ihrem Busen robbt. Eine der Hebammen geht hinaus in den Hof und spricht mit dem Vater, der sich würdevoll wieder aufrichtet, aber an der Tür stehen bleibt und sich nicht über die Schwelle traut, auf seiner Schulter schmelzen kleinste Reifkristalle, die sogleich von den filzigen Decken aufgesogen werden. Er schaut auf die Ehefrau und das rot angelaufene Kind.
»Es ist ein Mädchen«, sagt sie.
Er nickt zustimmend und antwortet: »Ich werd’ mal die Tiere füttern«, dann geht er raus in die Nacht zum Pissen.
Die Hebammen hängen die Laken zum Trocknen am Kaminfeuer auf. Sie binden die Wolltücher unter ihren Gesichtern fest, und mit einer Hand den unter dem Kinn verknoteten Stoff haltend, gehen sie zurück nach Puy-Larroque. Die Gebärende bleibt allein mit dem Kind, so winzig, dass es in eine hohle Hand passt, doch von einer Art Urwissen belebt, kämpft es mit geschlossenen Fäustchen gegen die Brust, aus der es mit plötzlicher Lebensgier die Erstmilch saugen will. Einige Wochen lang liegt es kümmerlich in seinen Windeln, schafft es indes ab und zu, sich aus seiner anämischen Erstarrung zu lösen, um die grauen und wie blinden Augen auf das verstörte Gesicht der Erzeugerin zu richten, die vergeblich versucht, eine braune Brustwarze zwischen die kleinen bleichen Lippen zu stecken.
Man beeilt sich, das Kind, dessen Tage gezählt scheinen, taufen zu lassen. Von der Geburt beschmutzt, weigert sich die Erzeugerin, das Haus zu verlassen, und macht es sich zu einer Frage der Ehre, weder die Suppe zuzubereiten noch das Wasser aus dem Brunnen zu ziehen. Sie sitzt aufrecht, stumm und mit ernster Miene, Éléonore auf dem Schoss oder in einem Tragekorb neben sich, während der Vater einen Eintopf oder eine Maisgrütze, die er nach ihren Anweisungen zubereitet hat, umrührt. Und als die Bewohner der Nachbarhöfe sie besuchen und Geschenke mitbringen, um die Geburt des Kindes zu feiern, lehnt sie diese ab. Unter dem Blick des Christus mit der funkelnden Wunde wird die in ein weißes, gehäkeltes, mit Spitzen verziertes Baumwollkleid gewickelte Éléonore Gott dargeboten, in alleiniger Begleitung ihres zurückhaltenden, mit seinem Festanzug bekleideten Vaters. Er verachtet religiöses Empfinden und verurteilt insgeheim die Frömmelei der Erzeugerin. Wie die Seeleute sind auch die Bauern abergläubisch und gehen nur aus Höflichkeit in die Kirche. Dennoch spricht ihn die geheimnisvolle Schönheit des Gottesdienstes an, die Wiederholung der immer selben Gesten seit längst vergessenen Zeiten. Er steht neben dem Taufbecken und antwortet auf die Ermahnungen des Vaters Antoine, eines katharrisch pfeifenden Priesters, der sich in seine Albe schnäuzt und auf Gaskognisch predigt, damit seine Schäfchen ihn verstehen:
»Widersagt Ihr der Sünde?«
»Ich widersage.«
»Widersagt Ihr allem, was zum Bösen geführt hat?«
»Ich widersage.«
»Widersagt Ihr dem Satan, dem Urheber der Sünde?«
»Ich widersage.«
»Glaubt Ihr an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden?«
»Ja, ich glaube.«
Die Dörfler, aufgereiht wie die Hühner auf der Stange, stecken in abgewetzten, ausgebesserten Anzügen, in verblichenen Kleidern mit von Mottenkugeln aufgeplusterten Taschen, deren Geruch den von Kerzen und Weihrauch überdeckt, sie antworten im Chor: »Das ist unser Glaube, es ist der Glaube der Kirche, den wir stolz bekennen in Jesus Christus, unserem Herrn.«
Die Versorgung und Pflege der Tiere kommt der Erzeugerin zu, so wie die Feldarbeit und das Schlachten des Viehs seit Menschengedenken den Männern obliegen. Kaum dass die Pflastersteine sich bläulich färben, durchquert sie den Hof, den Henkel des Babykorbs aus Weide, in dem Éléonore schläft, in die Ellbogenbeuge geklemmt und einen Eimer mit Getreide und hartem Brot in der anderen Hand. So beendet das Kind seine Nacht im Geruch von Geflügelkot und Heustaub, in der pudrigen Wärme, die von den Flügeln der Hühner heranweht, und die Erzeugerin legt die warmen und duftenden Eier an seine Füßchen, in die Falten der Decke, läuft dann durch das Schweinegehege, watet in weicher Erde, hebt ihren Rock mit einer Hand und hält mit hochgereckten Zehen die Pantinen aus gespaltenem Holz fest. Im Koben säugt eine auf dem Heu der Länge nach ausgestreckte Sau friedlich einen Schwarm von Kleinen, die sich, dieses Vorrecht einzeln in einem ersten Kampf errungen, entlang ihrer haarigen Zitzen zusammendrängen und vor Zufriedenheit mit geschlossenen Augen quieken. Aus ihren gierigen Schnäuzchen fließt weißer Schaum. Die Erzeugerin betrachtet sie lange, dann entsinnt sie sich einer Fabel, die man sich noch heute am Kaminfeuer erzählt. Sie nimmt eines der Ferkel hoch, das sich in ihrer Hand wehrt und kleine schrille Schreie ausstößt, legt es in den Babykorb, zwischen die von Éléonores Körper warmen Decken, wo es eine Weile herumwühlt, ehe es eindöst. Sie legt ihr Töchterchen ins Heu, an den Bauch der Sau und hält zwischen zwei Fingern die Zitze des Tieres an den Mund des Kindes, das sogleich heftig zu saugen beginnt. Seine Fäustchen drücken die Milchdrüsen des überquellenden Gesäuges, an dem es sich festhält, und die Ferkel wärmen seinen kleinen roten und unbehaarten Körper. Die Erzeugerin lässt ihre Hände in den Babykorb gleiten. Sie umfasst den Hals des schlummernden Ferkels und dreht ihn mit einer entschlossenen Bewegung um, bis ein kurzes Knacken zu hören ist. Als sie durch den Hof zurückgeht, bleibt sie vor dem Misthaufen stehen, bohrt mit der Fußspitze ein Loch hinein, in das sie den kleinen Kadaver legt, ehe sie es wieder verschmiert.
Sie ziehen nur ein oder zwei Schweine auf, denn mehr könnten sie nicht ernähren. Das erste ist für sie selbst bestimmt, das zweite für den Verkauf. Jedes Jahr zum Fettmarkt verladen sie das Tier, das sie die vorhergehenden Tage nochmals extra gestopft haben, zum Transport in einem Holzkäfig auf den Pferdekarren. Auf der Ladefläche sitzt die Erzeugerin neben ihm und füttert es durch die Gitterlatten mit gekochten Kartoffeln, um das Tier zu beruhigen und so zu verhindern, dass es auf dem ihm zusetzenden Weg an Gewicht verliert, indem es abkotet. Sofern das Tier eine gute Konstitution hat und sie es richtig versorgen, wiegt es zweihundert Kilo, mitunter sogar mehr, und sie erzielen dafür tausend bis eintausendeinhundert Francs, für die sie wieder zwei junge Schweine beim Farcher kaufen, einem Kerl mit hochrotem Gesicht und einer roten Baskenmütze auf dem Kopf, elegant in einen Paletot, Knickerbocker aus Samt und ein Paar Lederstiefel gekleidet. Der Mann verdient ein Vermögen am Handel mit Schweinen, die er woanders kauft, häufig im Ariège, dann hierher transportiert und weiterverkauft. In schlechten Jahren, wenn der Hof nicht genug Getreide und Pflanzenknollen produziert, mästen sie nur ein Schwein und bezahlen den Farcher im darauffolgenden Jahr mit Schinken. Sie wählen also eines der Ferkel, die der Händler feilbietet und mit Essig und rotem Ocker abreibt, um sie schöner aussehen zu lassen, als wären sie prall mit Blut gefüllt. So wird das Schwein, sobald es verschwunden ist, ein gewöhnlicher Phönix, unaufhörlich aus seiner Asche neu geboren; kaum dass ein paar Tage vergangen sind, ist der Stall wieder belegt. In den guten Jahren besitzen sie eine Sau, die sie decken lassen können. Die Ferkel verkaufen sie direkt nach dem Absetzen vom Muttertier, um sie nicht ernähren zu müssen. Der Farcher kommt und nimmt sie mit.
Endlich ist die Stunde des Muttersegens gekommen. An diesem Tag steht die Erzeugerin noch vor dem Morgengrauen auf und vollzieht feierlich im Schein einer Kerze die vorgesehenen Waschungen. Sie bürstet ihr Haar, bindet es am Hinterkopf zusammen. Sie träufelt ein paar Tropfen Öl in ihre Handfläche und streicht es sorgfältig glatt. Sie bedeckt ihren Stirnansatz mit einem weißen Baumwollschal, verknotet ihn unter dem Kinn. Sie zieht eine Bluse an, ein Wollkleid, betrachtet dann im Wandspiegel ihr durch den Schal in die Länge gezogenes Spiegelbild. Im Lauf der Jahre ist der Mund zu einem schmalen Strich geworden, die Haut verdickt und mit durchscheinendem Flaum bedeckt, die Wangen sind bis auf die Jochbeine eingefallen. Es scheint, dass sie die Totenmaske ihrer armen Mutter trägt, deren Gebeine auf dem Friedhof eines Nachbardorfes ruhen, vermengt mit anderen, mit verrotteten Sargbrettern und verwestem Taft. Sie wendet den Blick ab. Im Kornkasten wählt sie den dicksten Brotlaib und wickelt ihn in ein Küchentuch, dann beugt sie sich über den Babykorb, nimmt das Kind in seinen Windeln und legt es neben den Brotlaib in den geflochtenen Henkelkorb. Als die Erzeugerin über die kleine Holzbrücke in Richtung Puy-Larroque geht, flackert die Venus noch, in Zacken durchdringt der Tag den Himmel und hebt die Umrisse der Welt hervor. Zwischen Binsenbüscheln und den scharfkantigen Blätterhalmen der Seggen sieht sie Nutrias die Flucht ergreifen. Die von den Gräsern abperlende Feuchtigkeit der Nacht berauscht ihre Unterröcke, und je weiter sie sich vom Hof entfernt, desto leichter wird ihr Herz. Im Korb ist Éléonore wach geworden, sie bleibt aber ruhig, ihre trüben Augen blicken von unten in das längliche und verschwommene Gesicht, die dichtbelaubten Äste, die über ihr mit ihren dunklen Blattaderungen auftauchen. Als sie von Hunger gequält zu weinen beginnt, geht die Erzeugerin weiter bis zum Fuß des Bildstocks, dessen Sockel von silbrigen Flechten überwachsen ist. Sie stellt den Weidenkorb ab, knöpft sich die Bluse auf und bietet dem Kind, das inzwischen saugen gelernt hat, ihre magere Brust an. Sie bleibt in der feuchten und frischen Morgendämmerung sitzen, im Duft der Moose, Mulden und Platanen, die den Bildstock umgeben. Zarte Umrisse von Rehen gleiten durch den über den Feldern ruhenden Nebel, und sie überkommt das Gefühl, allein auf dieser Welt sein. Ein bis auf die Knochen abgemagerter Hund läuft vorbei, etwas Unförmiges, Schwarzes im Maul – vielleicht den Kadaver eines Raben –, er trappelt davon, den Geruch von Aas zurücklassend, dann später, als die Sonne zwischen zwei kleinen Tälern warmer Erde hervorbricht, taucht am Ende der Straße ein von einem Maulesel gezogener und von einem Kind gelenkter Karren auf, der in ihre Richtung heraufgefahren kommt. Als er an ihr vorbeifährt, wendet das Kind ihr sein affenähnliches Gesicht zu, mit der von grünem Rotz verschmierten Nase und dem schnauzenartig vorstehenden Kiefer, und sie erkennt den blutschänderischen Sprössling der Bernards. Er entfernt sich, verschwindet dann, schlägt was das Zeug hält mit einer Haselnussrute auf die Kruppe des Maultiers, das den Kopf hebt, schwer atmet, mit den Augen rollt, während es den mit Rote Beete und Kartoffeln beladenen Karren durchs Geröll zieht.
Éléonore schläft wieder ein, und die Erzeugerin legt sie zurück in den Weidenkorb, wischt sich mit ihrem Tuch den Speichel von der Brust, Kinn und Hals des Kindes sind mit Milchschorf übersät, sie knöpft die Bluse wieder zu, steht auf und setzt ihren Weg nach Puy-Larroque fort. An der Kirche angelangt kniet sie vor der Eingangstür im Schatten des Portalvorbaus nieder, völlig unberührt vom ständigen Kommen und Gehen der Frauen, die mit ihren Krügen in der Hand Wasser aus dem Brunnen schöpfen, von den Männern, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf die Felder ziehen und den braunen Saft vom ersten Priem des Tages auf den Boden spucken. Wird sie bemerkt und gegrüßt, hütet sie sich wohl zu antworten und scheint sich noch inbrünstiger in ihr Gebet zu versenken, will auf keinen Fall, dass man sie anspricht. Sie wartet lange, malträtiert auf dem Stein ihre mageren Knie, bis sich die Tür endlich in Gestalt Vater Antoines öffnet, der erst sie betrachtet, dann seinen Blick über das Portal gleiten lässt.
»Bist du alleine gekommen?«
Sein Atem stinkt nach Messwein und unruhigem Schlaf. Sie erhebt den Kopf und nickt, worauf der Pfarrer fragt: »Wo ist denn die andere, die, die dich begleiten sollte?«
»Ich habe niemanden dabei«, erwidert die Erzeugerin, während sie sich mit schmerzvoll verzogenem Gesicht erhebt.
Vater Antoine stößt einen verärgerten Pfiff zwischen den Zähnen hervor, dann entdeckt er eine junge Frau, weiß und fettig, die nicht weit entfernt vorübergeht, und ruft ihr zu: »Sei so gut, Suzanne, komm doch mal her.«
Das Mädchen nähert sich und geht die drei Stufen des Vorbaus empor. Sie mustert die Erzeugerin, das schlafende Kind im Korb, dann den Priester.
»Tritt ein«, sagt der Mann des Glaubens, »und bring ihr das heilige Wasser.«
Die junge Frau betritt die Kirche hinter Vater Antoine, der sich wegdreht und mit großen Schritten und raschelnder Albe das Kirchenschiff entlangeilt, dann taucht sie wieder auf und bietet der Erzeugerin ihre zu einer Kuhle geformten Hände dar, in denen das Weihwasser in Hornhautfalten und kurzen, sehr tief eingerissenen Lebenslinien steht. Die Erzeugerin stellt den Korb auf den Boden, taucht Zeigefinger und Mittelfinger in dieses lederne Weihwasserbecken, bekreuzigt sich zwei Mal, worauf die junge Frau die Hände öffnet und das restliche Wasser auf die Spitzen ihrer Holzpantinen und den trüben Stein des Portalvorbaus rinnt. Sie bekreuzigt sich ihrerseits, wischt sich die Handflächen an ihren Röcken ab und geht in die Kirche hinein. Ihre Stirn glänzt, und Tropfen geweihten Wassers kullern über die Wölbung ihrer Stupsnase. Vater Antoine wartet vor der kleinen Kapelle, die Schultern umhüllt von einer goldbestickten Stola. Ein magerer Messdiener, bleich und feierlich wie eine Kirchenkerze, steht aufrecht neben ihm. Der Priester hält der Erzeugerin die Enden der Stola entgegen: »Tritt ein in den Tempel Gottes, bete an den Sohn der allerseligsten Jungfrau Maria, welcher dir die Fruchtbarkeit verliehen hat.«
Sie stürzt in die Kirche, kniet vor dem Altar nieder, die Hände auf der Stirn gefaltet und rezitiert ihr Dankgebet, ihre geistlichen Ermahnungen vermischt mit denen des Pfarrers, der deklamiert: »Herr, Erbarme Dich, Christe, Erbarme Dich, Herr, Erbarme Dich … Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel … Behüte Herr Deine Dienerin, die auf Dich hofft, sende ihr Hilfe von Deinem Heiligtum …«
Sie beten zusammen, die gute Suzanne murmelt ebenfalls, und er segnet die Erzeugerin, die unter dem Weihwasser, mit dem er sie besprengt, erzittert: »Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus sancti, descendat super te, et maneat semper. Amen.«
Darauf segnet er das Brot, und die Erzeugerin erhebt sich, überempfindsam, exaltiert. Sie bläst die Kerze aus, die sie während der Zeremonie in den Händen hielt. Sie bricht den Laib Brot und reicht dem Messdiener ein Stück. Von einem Anfall großer Dankbarkeit überwältigt schickt sie sich an, ihm übers Haar zu streichen, aber der Junge entzieht sich ihr.
Eine Nussbaumrute in der Hand, gefolgt von Alphonse, führt Éléonore die beiden Schweine den Feldweg entlang in den Flaumeichenwald. Sie setzt sich zwischen die moosbewachsenen Wurzeln oder die blätterlosen Äste eines umgekippten Baums, während die Schweine sich an Eicheln, Kastanien, die sie aus ihrer Stachelhaut herausklauben, und an Schnecken laben. Blauschimmernde Mistkäfer krabbeln ihr über die Wollstrümpfe, und Dohlen breiten ihre schillernden Flügel aus, um in den Baumkronen ihr Gleichgewicht zu halten. Sie stoßen einen kurzen Ruf aus und nehmen ihren Flug in den schiefergrauen Himmel wieder auf. Éléonore streckt sich auf der Blätterschicht aus, von wo ein Geruch nach verfaulten Pflanzen, totem Flaschenbovist und Regenwurmlosung aufsteigt. Sie findet einen Augenblick der Ruhe, weitab vom Hof, von der Gegenwart der Erzeugerin. Als ein feiner Regen zu fallen beginnt, rührt sie sich nicht, beobachtet vielmehr die Äste, deren rot gefärbte Blätter in Spiralen herabsegeln. Sie lässt die winzigen Tropfen über ihr Gesicht und den Stoff ihres Kleides perlen, und sie stellt sich vor, wie sie nach und nach verschwindet, bedeckt wird von Flechten, von Insekten und Wirbellosen, die Gänge zu ihr bohren würden, durch die sie atmen, trinken und von ihrer mineralischen Unbeweglichkeit aus die Welt wahrnehmen könnte. Der alte Bracke hält für sie Wache, umkreist die Schweine und treibt sie, wenn nötig kläffend, wieder zurück. Sein ungleichmäßiger arthritischer Schritt drückt das Laub zusammen, aus dem wie aus einem Beinhaus zerborstene oder von der Zeit kalzinierte Stämme und die Januarschneeglöckchen hervorbrechen. An den kältesten Tagen spürt sie die Erstarrung ihrer Finger, ihrer Nase, ein Schmerz puckert heiß in den Ohrmuscheln, aber sie verbietet sich jede Bewegung, und um nichts in der Welt würde sie früher nach Hause gehen. Sie liebt die Ruhe des Eichenwaldes, das Gefühl ihrer tiefen Einsamkeit, die Gegenwart der Schweine, ihr zufriedenes Grunzen, die Schreie und das Flügelrascheln unsichtbarer Vögel, den Umriss der Kapelle, von der sie durch die Farne und Bäume eine von dichten, fransigen Efeuranken geschmückte Mauer erblickt. Als der Regen stärker wird, geht sie den alten Weg hoch, der inzwischen von Brombeersträuchern überwuchert ist, durch die sie sich einen Durchgang erzwingt. Die Tiere sind etwas voraus, und sie tritt hinter ihnen durch das Portal mit dem Spitzbogen, die Türen aus vermodertem Holz, ein aus der Türangel gefallenes Stück liegt auf den steinernen Bodenplatten, zwischen ihnen keimen im Frühjahr die Triebe von Gräsern, die der Wind bis hierher geweht hat, ganze Laubberge hat er angeweht, die sich im Chor aufhäufen und in denen Scharen von Spitzmäusen hausen. Die Schweine wühlen auf der Suche nach Larven in den Trümmern und im Schutt, auf den Generationen von Raubvögeln und Tauben abgekotet und dabei die gelockerten oder eingeschlagenen Bretter alter Kirchenbänke mit Guano bedeckt haben, in einem plötzlichen Flügelschlag und einem Gurren aus der Höhe poröser, von Rüsselkäfern befallener Balken schwingen die Vögel sich nun empor, lösen einen Sägemehlregen aus, der durch das Licht wirbelt, das die wenigen übrig gebliebenen, mit Staub, Pflanzensaftspritzern und Pollen überzogenen Kirchenfenster reflektieren. Der Geruch der alten Kapelle scheint von einer Wunde in der Erde auszuströmen: ein übler Gestank nach Grotte, Quarz, Ton und Schlamm. Vielfarbig schimmernde Lichtstreifen gleiten über den Aushub, als der Tag allmählich durch das Geflecht aus Zweigen dringt. Éléonore hebt das von Waldkäuzen ausgewürgte Gewölle vom Boden auf, das sie später in lauwarmes Wasser legen wird, um die Knochen der Nagetiere herauszulösen, weiß und zerbrechlich, und das sie jetzt in die Tasche ihres Kleides steckt, dann geht sie schließlich auf den Hof zurück, die Schweine mit vollem Bauch folgen ihr nur widerwillig. An schönen Tagen sammelt sie, ausgestattet mit einer Sichel, für sie am Wegesrand Brennnesseln und in den Brachen Disteln und Triebe von wildem Spinat, Zwiebelstängel und Zwiebeln, Löwenzahn und Sauerampfer, Beifußspitzen und Mohnblüten, die das Blut der Tiere verflüssigen und erneuern. Éléonore transportiert die Wildkräuter im hochgehobenen Saum ihres Kleides, und die Erzeugerin hackt sie auf dem Küchentisch klein, ehe sie sie in dem Brei mitkocht, der für die Schweine bestimmt ist.
Die ersten Jahre verstreichen zwischen der Pflicht, die Tiere zu versorgen, und den Tagen voller Langeweile in einem mit einem Holzofen beheizten Schulzimmer der Gemeindeschule, dessen Fenster auf einen Hof mit Lehmboden zeigen, der sich beim ersten Regen in eine Schlammsuhle verwandelt. Wenn der Schnapsbrenner seinen Destillierkolben auf dem Dorfplatz aufstellt, erfüllen die Alkoholdämpfe bald den Hof und berauschen die Pause der Schüler. Kaum sechs Jahre, ist ihre Haut an Händen und Füßen von tiefen Rissen durchzogen, aus denen sie mit einer Nadel beim Schein einer Kerze Kieselsteinchen und Gräser, die sich dort festgesetzt haben und manchmal heftiges Bluten verursachen, herausziehen muss. Auch ihre Daumen sind aufgesprungen, die Fingernägel schwarz. Nichts scheint ihr lieber zu sein als die schweißnasse Flanke der Stute, die sie, in der stillen Pferdebox des Stalls, wo flinke Feldmäuse die Balken entlangflitzen, nach der Feldarbeit striegelt und dann mit einer Handvoll Stroh trockenreibt. Und nichts scheint ihr verlockender als das Halbdunkel der Futterküche, der säuerliche Geruch aus dem Topf, in dem Kartoffeln, Gemüsekraut und saure Milch vor sich hin schmoren, nicht einmal die Kinderspiele, die Astragale, die auf den harten Boden geworfen und von den Wurzeln der am Rand des Schulhofs stehenden Nussbäume aufgefangen werden, oder Himmel und Hölle, bei dem die Mädchen in ihren Schuluniformen sich die Schuhsohlen ruinieren.
An einem windigen Tag läuft sie durch ein Feld hin zum Vater und zu den beiden Kühen, deren Hörner in ein Stirnjoch eingespannt sind. Der Vater führt den Pflug am Pflugsterz und schlägt mit einer Rute aus Stechpalme auf die spitzen Kruppen, stößt dabei Schreie aus, die fetzenweise an ihr Ohr dringen. Éléonores Füße bleiben in den gezogenen Furchen stecken; der Wind peitscht ihr die verknoteten Haare ins Gesicht. Sie beobachtet, wie der Vater das Gespann anhält, sich bückt, eine glänzende Erdscholle hochhebt, sie an seine Nase hält und langsam ihren Duft einsaugt, dann die Scholle in seiner großen Hand hin und her wendet, um sie behutsam zwischen seinen braunen Fingern zu zerbröckeln. Krumen trockener und ockerfarbener Erde verfangen sich in den Härchen auf seiner Handoberfläche. Das Mädchen erfasst die Intimität dieses Augenblicks zwischen dem Mann und der Erde, seine dunkle Sinnlichkeit, und sie erstarrt aus der Entfernung, im Kielwasser des Vaters. Später, am Rand desselben Feldes, nach dem Regen und in Abwesenheit des Bauern, nimmt sie ihrerseits diese kalte Erde in die Hand, schwarz und knetbar, sie formt eine Art Phallus, dann hebt sie ihren Rock hoch, geht in die Hocke und führt ihn an die geschwungenen und nackten Lippen ihres Geschlechts.