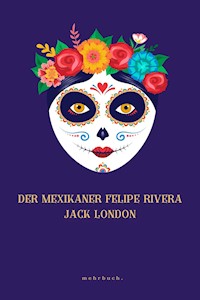
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Der junge Felipe Rivera bietet sich einer Gruppe von Revolutionären unter der Leitung von Paulino Vera als Helfer an. Sein verschlossenes Wesen erregt aber zunächst Misstrauen und er wird verdächtigt, lediglich für das Regimes von Porfirio Díaz spionieren zu wollen. Rivera verrichtet zunächst kleinere Arbeiten, fällt aber wiederholt dadurch auf, dass er, wenn es der Bewegung an Geld mangelt, für kurze Zeit verschwindet und anschließend mit einer entsprechenden Summe zurückkehrt. Außerdem tötet er den Bundesanwalt Juan Alvarado, der aktiv gegen die Aufständischen vorging.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Mexikaner Felipe Rivera
Jack London
Jack London
Der Mexikaner Felipe Rivera
Niemand kannte seine Geschichte –, seine Mitverschworenen am allerwenigsten. Er war ihr ›kleines Geheimnis‹, ihr ›großer Patriot‹, und auf seine Weise arbeitete er ebensosehr an der kommenden mexikanischen Revolution wie sie. Es dauerte lange, bis sie das erkannten, denn nicht einer in der Junta konnte ihn leiden. An dem Tage, als er zum ersten Mal ihre von geschäftigen Menschen überfüllten Räume betrat, hatten ihn alle im Verdacht, ein Spion, ein Spitzel im Geheimdienst des Diaz zu sein. Zu viele von seinen Kameraden saßen rings in den Vereinigten Staaten in Zivil- und Militärgefängnissen, und andere wieder waren gerade in dieser Zeit in Ketten über die Grenze geschafft und an die Wand gestellt worden.
Auf den ersten Blick machte der junge Bursche keinen guten Eindruck auf sie. Er war nicht mehr als achtzehn Jahre alt, nicht besonders groß und erklärte, Felipe Rivera zu heißen und für die Revolution arbeiten zu wollen. Das war alles –, kein Wort mehr. Er blieb abwartend stehen. Kein Lächeln war um seinen Mund, keine Liebenswürdigkeit in seinen Augen. Den großen, schneidigen Paulino Vera schauderte es innerlich. Hier war etwas Abstoßendes, Furchtbares, Unergründliches. Etwas Giftiges, Schlangenartiges war in den schwarzen Augen des Knaben. Sie brannten wie kaltes Feuer und gleichsam in einer ungeheuren, geschliffenen Erbitterung. Von den Gesichtern der Verschworenen ließ er den Blick zu der Schreibmaschine schweifen, an der die kleine Frau Sethby, eifrig arbeitend, saß. Seine Augen suchten die ihren, aber nur für eine Sekunde –, sie blickte zufällig auf –,, und auch sie hatte ein unbestimmbares seltsames Gefühl, das sie ihre Arbeit unterbrechen ließ. Sie mußte das Geschriebene noch einmal durchlesen, um den Brief, an dem sie arbeitete, fertig tippen zu können.
Paulino Vera sah Arrellano und Ramos fragend an, und sie sahen sich gegenseitig ratlos an. In ihrem Blick war Unsicherheit und Zweifel. Dieser schmächtige Besucher war der Unbekannte, und alles drohende Unbehagen des Unbekannten umgab ihn. Man konnte aus ihm nicht klug werden, er war so ganz jenseits des Horizontes dieser ehrenwerten, schlichten Verschwörer. Ihr wilder Haß gegen Diaz und seine Tyrannei war der Haß ehrenwerter, schlichter Patrioten. Hier aber war etwas anderes und Stärkeres, sie wußten freilich nicht recht, was. Aber Vera, der stets der Entschlossenste und Tatkräftigste war, packte den Stier bei den Hörnern.
»Schön«, sagte er kühl. »Sie sagen, daß Sie für die Revolution arbeiten wollen. Ziehen Sie sich den Rock aus! Hängen Sie ihn dorthin. Ich werde Ihnen zeigen –, kommen Sie –,, wo die Eimer und Wischlappen sind. Der Fußboden ist schmutzig. Sie können gleich anfangen, ihn hier und in den andern Zimmern aufzuwischen. Auch die Spucknäpfe müssen gereinigt werden. Und außerdem die Fenster.«
»Ist es für die Revolution?« fragte der Bursche.
»Für die Revolution«, antwortete Vera.
Rivera sah sie alle kalt und mißtrauisch an und zog sich dann den Rock aus.
»Es ist gut«, sagte er.
Weiter nichts. Tag für Tag kam er zu seiner Arbeit –, fegte, schrubbte und machte rein. Er nahm die Asche aus dem Ofen, holte Kohlen und Holz und machte Feuer und war der erste im Büro.
»Kann ich hier schlafen?« fragte er einmal.
Aha! Das war es –, die Hand Diaz' kam zum Vorschein. Wenn er in den Räumen der Junta schlief, bedeutete das, daß er Zutritt zu ihren Geheimnissen, zu den Namenlisten, zu den Adressen der Kameraden in Mexiko erlangte. Die Bitte wurde abgeschlagen, und Rivera kam nie mehr darauf zu sprechen. Er schlief, sie wußten nicht, wo, und aß, sie wußten nicht, wo und was. Einmal bot Arrellano ihm ein paar Dollars an. Rivera lehnte das Geld ab. Als Vera hinzutrat und es ihm aufzunötigen versuchte, sagte er: »Ich arbeite für die Revolution.«
Eine Revolution vorzubereiten kostet Geld, und die Junta befand sich stets in Geldverlegenheit. Die Mitglieder hungerten und rackerten sich ab, der längste Arbeitstag war ihnen nicht lang genug, und doch sah es zuweilen so aus, als stünde und fiele alles mit der Frage, wie sie sich nur einige Dollars verschaffen sollten.
Einmal –, es war das erste Mal, daß sie zwei Monate mit der Miete im Rückstand waren und der Wirt sie hinauszusetzen drohte –, war es Felipe Rivera, der Reinmachejunge in der schäbigen, abgetragenen Kleidung, der sechzig Dollar in Gold auf May Sethbys Pult legte. Und ebenso bei anderen Gelegenheiten. Dreihundert auf den geschäftigen Schreibmaschinen geklapperte Briefe (Bitten um Unterstützung, um Anerkennung befreundeter Gruppen, Ersuchen an Schriftsteller um wohlwollende Erwähnung und so weiter) blieben liegen und warteten auf die Frankierung. Veras Uhr verschwand –, die alte goldene Repetieruhr, die er von seinem Vater geerbt hatte. Der glatte goldene Ring an May Sethbys Ringfinger verschwand ebenfalls. Es war zum Verzweifeln. Ramos und Arrellano zerrten wütend an ihren langen Schnurrbärten. Die Briefe mußten abgehen, und auf der Post gab es keinen Kredit beim Kauf von Briefmarken. Da setzte Rivera den Hut auf und ging fort. Als er wiederkam, legte er tausend Briefmarken zu zwei Cent auf May Sethbys Pult.
»Ich möchte wissen, ob das verfluchte Geld von Diaz ist«, sagte Vera zu den Kameraden.
Sie zogen die Brauen hoch, wagten aber nicht, die Frage zu beantworten. Und immer war es Felipe Rivera, der, wenn es erforderlich war, der Junta Gold und Silber verschaffte.
Aber sie liebten ihn nicht, und sie kannten ihn nicht. Er ging seine eigenen Wege, schenkte ihnen kein Vertrauen und wies alle Annäherungsversuche zurück. Und trotz seiner Jugend brachte keiner den Mut auf, ihn auszufragen.
»Er ist überhaupt kein Mensch«, sagte Ramos.
»Seine Seele ist ausgedörrt«, sagte May Sethby. »Er kann nicht lachen. Er gleicht einem Toten und ist doch furchtbar lebendig.«
»Er ist durch die Hölle gegangen«, sagte Vera. »So sieht man nur aus, wenn man durch die Hölle gegangen ist –, und dabei ist er noch so jung.«
Felipe sprach nie, fragte nie, schlug nie etwas vor. Er lauschte ausdruckslos wie ein toter Gegenstand, aber seine Augen leuchteten in kaltem Glanz, wenn die andern laut und leidenschaftlich von Mexiko sprachen. Dann glitten seine Augen von Gesicht zu Gesicht, von Redner zu Redner, bohrend und forschend und mit einem Schimmer wie funkelndes Eis, das sie störte und aus der Fassung brachte.
»Er ist kein Spion«, vertraute Vera May Sethby an. »Er ist Patriot –, glaub mir, der größte Patriot von uns allen. Ich weiß es, ich fühle es, mit meinem Herzen und meinem Verstand fühle ich es. Aber von ihm selber weiß ich nicht das geringste.«
»Er hat ein gefährliches Temperament«, sagte May Sethby.
»Ich weiß«, sagte Vera schaudernd. »Er hat mich mit diesen Augen angesehen. Die sprechen nicht von Liebe, sie drohen und sind wild wie die eines Tigers. Wenn ich unsere Sache im Stich lasse, dann würde er mich töten, das weiß ich. Er hat kein Herz. Er ist unbarmherzig wie Stahl, scharf und kalt wie Frost. Ich fürchte weder Diaz noch all seine Mörder, aber vor diesem Rivera habe ich Angst. Es ist wahr. Ich habe Angst.«
Dennoch war es Vera, der die andern überredete, Rivera die erste Vertrauen erheischende Aufgabe zu stellen. Die Verbindung zwischen Los Angeles und Niederkalifornien war unterbrochen. Drei von den Kameraden hatten ihre eigenen Gräber graben müssen und waren dann erschossen worden. Zwei weitere saßen als Gefangene der Vereinigten Staaten in Los Angeles. Juan Alvarado, der Bundesgeneral, durchkreuzte all ihre Pläne. Sie konnten nicht mehr mit den aktiven Revolutionären und mit den erwachenden Kameraden in Niederkalifornien in Verbindung kommen.
Der junge Rivera erhielt seine Anweisungen und wurde nach dem Süden geschickt. Als er wiederkam, war die Verbindung wieder hergestellt und Juan Alvarado tot. Er war mit einem Dolch in der Brust in seinem Bett gefunden worden. Das ging über die Rivera erteilten Anweisungen hinaus; aber man fragte ihn nicht, und er sagte nichts. Aber sie sahen sich an und dachten sich ihr Teil.
»Ich habe es euch gesagt«, meinte Vera. »Diaz hat von diesem jungen Mann mehr zu fürchten als von irgendeinem sonst. Er ist unversöhnlich.«
Das gefährliche Temperament, von dem May Sethby gesprochen und das jeder von ihnen bemerkt hatte, offenbarte sich auch in anderer Beziehung. Bald erschien er mit zerrissener Lippe, bald mit einer blau und braun geschlagenen Backe, bald mit einem geschwollenen Ohr. Es war klar, daß er irgendwo in der Welt, wo er aß und schlief und sich Geld verschaffte und ein Leben führte, von dem sie nichts wußten, daß er in jener Welt oft Streit hatte. Nach einiger Zeit wurde er Setzer an dem revolutionären Wochenblättchen, das sie herausgaben. Gelegentlich war es ihm nicht möglich, zu setzen, weil seine Fingerknöchel abgeschürft und zerschlagen, seine Daumen zerquetscht und hilflos waren oder weil seine Arme schlaff herabhängen, während sein Gesicht sich in stummem Schmerz verzerrte.
»Ein Straßenjunge«, sagte Arrellano.
»Ein Säufer und Raufbold«, sagte Ramos.
»Aber wo kriegt er das Geld her?« fragte Vera. »Ich habe gerade eben erfahren, daß er die Papierrechnung bezahlt hat –, hundertvierzig Dollar.«
»Er ist ja oft weg«, sagte May Sethby, »und gibt nie eine Erklärung dafür.«
»Wir sollten ihn beobachten«, schlug Ramos vor.
»Der Spion möchte ich nicht sein«, sagte Vera. »Ich fürchte, ihr würdet mich nie wiedersehen, außer bei meiner Beerdigung.«





























