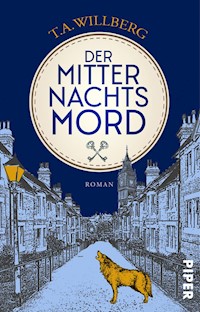
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
London, 1958: Verborgen unter den Straßen der Stadt liegt die geheimnisvolle Welt von Miss Bricketts Detektivbüro, ein Labyrinth aus Tunneln und unterirdischen Hallen. Nachdem Miss Bricketts Assistentin um Mitternacht in der Bibliothek des Detektivbüros ermordet wird, erhält die junge Detektivin Marion Lane den Auftrag, den Fall aufzuklären. Schnell ist für sie klar, dass der Mörder aus Miss Bricketts eigenen Reihen stammen muss, denn die Bibliothek war akribisch von der Außenwelt abgeschottet … was jeden Mitarbeiter zu einem Verdächtigen macht. Meisterhaft klug und spannungsgeladen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels » Der Mitternachtsmord « an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen.
Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
© T. A. Willberg OÜ 2021
Titel der englischen Originalausgabe:
»Marion Lane and the Midnight Murder«, Trapeze, London 2021
Covergestaltung: t.mutzenbach design, München
Covermotiv: t. mutzenbach design unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Eins
Der geheime Dieb
Zwei
Willow Street 16
Drei
Das andere Miss Brickett’s
Vier
In der Technischen Abteilung
Fünf
Der Spitzel
Sechs
Die Erinnerung
Sieben
Eine verzweifelte Nachricht
Acht
Der Spion im Korridor
Neun
Bills Geheimnis
Zehn
Die Aufnahmezeremonie
Elf
Dolores’ Ultimatum
Zwölf
Die rauchende Uhr
Dreizehn
Professor Gillroths Warnung
Vierzehn
Das Zuvor
Fünfzehn
Unter dem Pausenraum
Sechzehn
Der Grauadler
Siebzehn
Die Lüge und das Hochseil
Achtzehn
Der brennende Raum
Neunzehn
Der Sieben-Jahres-Safe
Zwanzig
Die Geschichte der Verwahrerin
Einundzwanzig
Haus des Schreckens
Zweiundzwanzig
Teufelsblut
Dreiundzwanzig
Sir George Cavendishs Erbe
Vierundzwanzig
Die Wiedervereinigung
Danksagung
Die Kriegsapparaturen, die als Inspiration für Miss Brickett’s gedient haben
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Marion, Werner und Ben
Eins
Der geheime Dieb
Irgendwo in London.
Freitag, 11. April 1958
23.40 Uhr
Dunstschwaden stiegen vom warmen Straßenpflaster auf. In den Gassen war es still in dieser Nacht. Ein Ort, wie geschaffen für die Weitergabe eines Geheimnisses. Die Frau mit dem roten Kopftuch sah sich um. Natürlich war ihr niemand gefolgt, doch sie wollte ganz sicher sein.
Drei Yards vor der Straßenlaterne blieb sie stehen und zog eine Stablampe und einen versiegelten Umschlag aus ihrer Tasche. Sie wusste genau, wo der geheime Briefkasten verborgen war – links, auf Schulterhöhe, hinter dem Ziegelstein, der etwas anders aussah als die anderen. Dies war nicht der Grund für ihr Zögern. Was sie in dieser Nacht vorhatte, würde die Zukunft eines anderen Menschen verändern.
Sie umfasste den Griff der Taschenlampe fester, während sie mit sich rang. So vieles sprach dafür, sich einfach umzudrehen und wieder davonzugehen. Die möglichen Konsequenzen dessen, was sie plante, waren zahlreich und beängstigend. Trotzdem … Wenn es etwas gab, woran sie aus tiefstem Herzen glaubte, etwas, das wichtiger war als alles andere, dann war es die Wahrheit.
Sieben Jahre lang hatte sie ein abscheuliches Geheimnis gewahrt. Sieben Jahre lang hatte sie den Mund gehalten, an den bindenden Schwur ihrer Zunft gefesselt. Nun jedoch spürte sie es stärker denn je – wie das Geheimnis sie allmählich verschlang, wie unerträglich die Bürde geworden war. Wenn sie dies hier heute Nacht nicht tat, würde sie sich selbst vielleicht niemals verzeihen.
In der dunklen, stillen Gasse nickte sie sich selbst zu. Ja, die Wahrheit war das Risiko wert. Doch sie musste sich beeilen, denn die Nacht zog rasch vorüber. Sie richtete den Strahl der Taschenlampe auf die gegenüberliegende Wand, und da war er – ein einzelner grauer Ziegelstein, der das Licht reflektierte. Denn es war überhaupt kein Ziegelstein, es war Metall. Mit dem Griff der Taschenlampe schlug sie leicht dagegen.
Einmal. Nichts.
Ein zweites Mal – etwas kräftiger –, und der schmutzig graue Quader sank in die Mauer zurück. Es klickte leise, und dort, wo gerade noch der falsche Ziegelstein gewesen war, schob sich eine schmale Metallplatte aus der Wand.
Ein Windstoß erhob sich und fegte durch die Gasse, trotzdem brach der Frau mit dem roten Kopftuch der Schweiß aus. Sie legte den Brief auf die Metallplatte und sah zu, wie beides in die Mauer zurückglitt und schließlich verschwand. Sie stieß einen langen Atemzug aus und wischte sich über die Stirn – nun musste sie das Geheimnis nicht länger allein tragen.
Sie wusste genau, wo der Umschlag landen würde. Bei diesen Leuten unter der Erde, jenen mysteriösen Gestalten, die in den Schatten weilten: die Inquirer. Eine Gruppe von Privatdetektiven, die unter den Straßen Londons in einem Labyrinth aus verzweigten Tunneln und uralten Gängen lebte. Den Eingang zu diesem Netzwerk hatte bisher niemand finden können. Für die Londoner waren die Inquirer eine Art Mythos. Eine gewisperte Legende von etwas, das es vielleicht oder vielleicht auch nicht wirklich gab, je nachdem, wen man fragte. Unter jenen, die an die Geschichten glaubten, hatten sich die Inquirer allerdings einen eher zweifelhaften Ruf erworben. Sie seien wie Geister, sagten manche. Spürhunde, die über die Stadt wachten. Namenlos. Stumm. Auf ewig an ein Dasein in Finsternis gebunden. Und während praktisch jeder von den mehr als hundert geheimen Postfächern (oder Briefkästen, wie sie genannt wurden) gehört hatte, die sich versteckt und getarnt über ganz London verteilten und in denen man einen möglichen Verdacht auf kriminelles Vorgehen, Hinweise oder Aufträge platzieren konnte, wusste niemand so recht, was danach geschah.
Wo landeten die Briefe? Wie kamen sie dorthin, und wer bekam sie zu lesen? Alle paar Monate trieben neue Gerüchte an die Oberfläche. Die Briefe werden an einer Schnur durch die Wand und direkt in den Raum dahinter gezogen – dies war eine sehr beliebte Erklärung, bis jemand eine Mauer einriss, in der ein Briefkasten vermutet wurde, und dabei die gesamte Südwand von Mr Silvertons Garage dem Erdboden gleichmachte. Keine Schnur, kein Geheimraum, nur ein Haufen Ziegelsteine und ein Metallrohr, das im Boden verschwand – eine Wasserleitung wahrscheinlich.
Auch was die Effektivität der ermittlerischen Fähigkeiten der Inquirer betraf, gab es Zweifel, da viele der Leute, die angeblich einen warnenden Hinweis abgeschickt hatten, seither vergeblich darauf warteten, dass sich diesbezüglich etwas tat. Vernünftigere Personen wiesen jedoch darauf hin, dies läge schlicht daran, dass die Inquirer weder über die Zeit noch über die nötigen Mittel verfügten, um sich mit Angelegenheiten persönlicher Natur zu beschäftigen – untreue Ehemänner, entlaufene Haustiere und dergleichen.
Die Frage nach besagten Mitteln war wiederum ein weiteres heiß diskutiertes Streitthema. Wie konnten die Inquirer, die nie einen Penny (oder ein Dankeschön) für ihre Dienste verlangten, ein so ausgefeiltes und offenbar reibungslos funktionierendes Netzwerk finanzieren?
Die Frau mit dem roten Kopftuch zog es vor, nicht darüber nachzugrübeln. Sie war zufrieden mit der Gewissheit, dass die Inquirer kein Mythos waren. Da sie das ausgesprochene Pech gehabt hatte, einigen von ihnen persönlich zu begegnen, wusste sie nur allzu genau, dass die Inquirer ebenso echt waren wie das schmutzige Straßenpflaster unter ihren Füßen. Nach ihrer Meinung gefragt, hätte sie allerdings gesagt, dass die Inquirer mehr Probleme verursachten, als sie zu lösen vorgaben. Genau wie alle anderen hatte sie die Geschichten gehört – korrupte Geschäftsleute, die zur Rechenschaft gezogen worden waren; vermisste Kinder, die zu ihren Eltern hatten zurückkehren können; zu einem Geständnis gezwungene Verbrecher –, aber hatte jemals jemand nach dem Wie gefragt? Hatte jemals jemand ein wenig tiefer geschürft, dort, wo Knochen verscharrt und Lügen begraben worden waren?
Tatsächlich wäre die Frau mit dem roten Kopftuch nie auf den Gedanken gekommen, Kontakt zu den Inquirern aufzunehmen, wäre nicht einer von ihnen selbst in die Angelegenheit verwickelt.
Missbilligend schnalzte sie mit der Zunge, während sie die Straße zurücklief. Sie hoffte, endgültig mit den Inquirern und ihren fragwürdigen Methoden fertig zu sein, und sie war erleichtert darüber, sich nun wieder auf dem Weg zurück zu ihrem Sessel beim Kamin zu befinden. Wo eine Tasse mit dampfend heißem Tee auf sie wartete. Und vielleicht auch eine Scheibe Früchtebrot.
Der Transportzylinder, in dem sich der Brief befand, schoss eine meilenlange pneumatische Röhre entlang, von seinem Ursprungsort hinab in das dunkle, tiefe Verlies der Registratur – wo er aus dem Ende des Rohrs fein säuberlich in den zugehörigen Empfangsbehälter fiel, als hätte ihn ein magischer unsichtbarer Postbote soeben ausgeliefert.
Ein Glöckchen klingelte, als der Brief in Empfangsbehälter fünfundfünfzig landete.
Michelle White riss die Augen auf und war mit einem Schlag hellwach, nachdem sie fast eingedöst war. Blinzelnd sah sie zu dem blinkenden gelben Licht auf dem Kontrollbrett über ihr hinauf. Es war ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sämtliche Briefe umgehend sortiert wurden: Jene, die alle Anforderungen der Inquirer erfüllten, mussten nach Datum eingeordnet und für spätere Ermittlungen im Posteingangskorb der Inquirer abgelegt werden. Jene, die nicht direkt in den Papierkorb wanderten, und jene, bei denen sie noch nicht sicher war, was sie mit ihnen anfangen sollte, wanderten auf einen turmhohen Stapel auf dem Schreibtisch. Während der vergangenen Wochen hatte es jedoch verhältnismäßig wenige Verbrechen und Bosheiten in London gegeben, weshalb Michelle White die Registratur eher gemächlich durchquerte, da sie erwartete, dass es in dem Brief um irgendwelche Belanglosigkeiten ging.
Sie hob den Deckel von Empfangsbehälter fünfundfünfzig, dem Endpunkt der sechs Meilen langen Röhre, die von einem verborgenen Briefkasten in der Passing Alley in Farringdon hierherführte.
Normalerweise waren die Umschläge und Briefe, die sie aus den Empfangsbehältern holte, an die Detektei im Allgemeinen adressiert: »Liebe Leute unter der Erde« oder etwas in der Art.
An diesem Abend war es jedoch anders.
»An Miss M. White, Inquirer«.
Was merkwürdig war, trotzdem konnte sie ein Lächeln bei dieser Vorstellung nicht unterdrücken. Früher einmal hatte Michelle davon geträumt, Ermittlerin zu werden. Tatsächlich war sie nah an die Verwirklichung ihres Traums herangekommen, aber sie war einfach nicht gut genug gewesen. Nicht klug genug, nicht mutig oder talentiert genug. Von allem eben nicht genug.
Vor zehn Jahren hatte man sie im Alter von zweiundzwanzig Jahren aus einer Textilfabrik rekrutiert, wo sie quälend lange Stunden als Assistentin in der Güteprüfung verbracht hatte. Doch wie auch alle anderen, die in dem sonnenlosen Labyrinth arbeiteten, hatte Michelle rasch und ohne lange zu überlegen die Freiheiten ihres früheren glanzlosen Lebens im Austausch für die Möglichkeit aufgegeben, eine neue und aufregende Laufbahn als Inquirer anzutreten, wo sie hoffte, ihre sehr speziellen Fähigkeiten endlich angemessen einsetzen zu können.
Allerdings hatten sich die Dinge nicht ganz so entwickelt wie erwartet, weshalb Michelle schließlich hier gelandet war – anstatt die Straßen Londons auf der Suche nach Kriminellen und Gesetzesbrechern zu durchstreifen – und ihre Abende als Registraturassistentin mit der Spätschicht in der langweiligsten Abteilung der Einrichtung verbrachte. Hätte es da nicht noch ihre andere, sehr viel erfüllendere Rolle gegeben – die der Ersten Grenzwächterin, Wahrerin des Geheimnisses –, dann hätte sie möglicherweise schon vor Jahren gekündigt.
Nun, während sie den Briefumschlag in ihrer Hand anstarrte, fragte sich Michelle jedoch, woher der Absender wusste, wo sie arbeitete, und warum er oder sie ausgerechnet Michelle als würdige Adressatin seiner oder ihrer Sorgen auserkoren hatte. Mit dem Daumen strich sie über die Wörter – Miss M. White, Inquirer –, als könnte sie deren Bedeutung über die Haut aufnehmen und wahr werden lassen.
Kurz zögerte sie, den Umschlag zu öffnen, weil sie fürchtete, es könnte sich um einen Scherz handeln. Vielleicht spielte ihr einer der jungen Lehrlinge einen Streich. Bei diesem Gedanken biss sie die Zähne zusammen, atmete tief durch und gab die Details des Briefs in das Verzeichnis ein: Zeit und Datum des Briefeingangs, Nummer des Empfangsbehälters sowie ihre eigenen Initialen. Als sie dann jedoch den Umschlag öffnete und die letzten Zeilen las – den Grund der Ermittlungsanfrage –, beschleunigte sich ihr Atem.
Der Brief war kurz. Ein Name, eine Zeit, ein Ort und eine schlichte Enthüllung. Trotzdem entfesselten die wenigen Worte eine Kaskade der Angst.
Vor mehreren Wochen war etwas aus ihrer Handtasche verschwunden – etwas von unschätzbarem Wert, etwas Unersetzliches, etwas, das ein längst jenseits der Grenze vergrabenes Geheimnis wieder ans Licht zerren konnte. Erst hatte sie genau zu wissen geglaubt, wer es sich geholt hatte, und zahllose Nächte hatte sie sich ruhelos umhergewälzt, voller Sorge, der gemeine Dieb könnte zurückkehren und nach dem dazugehörigen Stück suchen, das sie in ihrem Privatbüro unter Verschluss hielt. Damit könnte das Geheimnis enthüllt werden.
Wenn man dem Brief, den sie soeben erhalten hatte, jedoch trauen konnte, dann waren Michelles Ängste überflüssig gewesen. Denn das Geheimnis war längst aufgedeckt. Sie wusste nicht, wie oder warum. Wenn sie den Anweisungen in dem Brief folgte, dann würde sie es aber vielleicht bald herausfinden.
Alarmglocken schrillten in ihrem Kopf, doch Michelle hatte sich bereits entschieden. Natürlich könnte sie mit dem Brief zu jemandem gehen, der qualifizierter war als sie selbst, doch das Schreiben war an sie adressiert – wer auch immer der Absender sein mochte, hatte es ihr anvertraut, dieses kostbare und dringliche Geheimnis. Außerdem war Miss White, ganz wie es auf dem Umschlag stand, und wenn auch nur für diese eine Nacht, ein Inquirer.
Wie sie in dem Schreiben angewiesen worden war, riss sie ein Streichholz an und hielt das Papier an die Flamme. Nachdem es zu Asche verbrannt war, packte sie ihre Sachen zusammen, griff nach ihrer Handtasche, schloss das Büro ab und eilte die Treppe hinauf in Richtung Bibliothek. Vor dem Eingang zum Verschlussraum blieb sie stehen, auf der anderen Seite des gewaltigen Saals voller prächtiger Bücherreihen. Wie erwartet war die Tür nur angelehnt.
Sie trat ein, hielt aber sofort inne, als eine schneidend kalte Woge an ihr vorüberwehte. Wie seltsam. Sie rieb sich die Augen und sah sich in dem schwach erleuchteten Raum um. Hunderte von stählernen Schließfächern umgaben sie, in denen die Detektei ihre heiligsten Akten und Dokumente aufbewahrte. Im Verschlussraum mit seinen dicken Mauern und der hohen Decke war es immer kühl, in dieser Nacht kam er ihr jedoch besonders frostig vor.
Knack.
Etwas spaltete sich von der Wand hinter ihr ab. Sie drehte sich zu dem Geräusch um, sah jedoch nur einen Schatten, der sich durch den Raum bewegte, und etwas, das aussah wie ein großer schwarzer Kasten, der aus der Wand gelöst wurde. Sie zögerte, dann trat sie etwas näher heran. Da war es wieder – eine Welle kalter Luft tanzte vor ihr. Mit dem Ärmel wischte sie sich über die Augen – ganz sicher musste dies ein Streich sein, denn alles hatte sich in ein fremdartiges, verschwommenes Nichts verwandelt. Panik packte sie, ihre Gedanken wurden ebenso unscharf wie ihre Sicht. In ihrem Kopf drehte sich alles, und ihre Arme und Beine kribbelten. Dies hätte der Moment sein können, in dem Michelle um ihr Leben rannte, hinaus aus dem Verschlussraum und fort von dem Bösen, von dem sie nun wusste, dass es hier auf sie gewartet hatte. Doch das Grauen hatte sie erstarren lassen. Sie konnte ihre Beine einfach nicht dazu bringen, sich zu bewegen, nicht einmal, als sie schnelle Schritte vernahm, hinter ihr, vor ihr. Nicht einmal, als sie einen Lufthauch über ihren Hals streichen spürte.
»Was passiert hier«, krächzte sie, und es klang eher verblüfft. »Ich weiß, dass du hier bist … ich weiß, dass du es warst …« Ihre Stimme verlor sich, da die Wörter in ihrem Kopf keinen Sinn mehr ergaben.
Sie ließ ihre Handtasche fallen. Etwas Hartes rollte heraus und über den Boden davon. Sie war zu verwirrt, um zu begreifen, was es war.
In einem lang gezogenen Moment, der ewig anzudauern schien, wurden Michelles Sinne dumpf und zähflüssig. Sie konnte ihren Augen und Ohren nicht länger trauen. Vielleicht sah sie eine formlose Gestalt vor sich, die sich hinabbeugte und möglicherweise etwas vom Boden aufhob. Sicherlich fühlte sie jedoch das scharfe Brennen einer kalten, gezackten Klinge, die schnell und leicht durch die zarte Haut an ihrer Kehle schnitt.
Wärme, Dunkelheit, dann nichts mehr.
Zwei
Willow Street 16
Marion Lane hielt einen Schraubenzieher in der Hand und zog die letzte Stahlfeder fest, wodurch sie den Aufzieh-Nektarvogel aus einem Häuflein Metall in sein glorreiches früheres Selbst zurückverwandelte. Sie wendete den Vogel, drehte den unter dem linken Flügel verborgenen Aufziehschlüssel und wartete. Und es geschah – nichts. Genau wie vorher.
Mit einem unwilligen Laut stellte sie den Vogel auf ihrem Fensterbrett ab, legte ihre Ledertasche mit dem Werkzeug beiseite und blickte auf die Straße hinunter. Wie immer gab es nicht viel zu sehen, auch an diesem tristen Morgen nicht: eine einsame Katze, die herumstreunte, Müll, der sich auf dem Asphalt gesammelt hatte, der Milchmann, der frische Flaschen auf die Türschwellen stellte. Und natürlich das »Zu verkaufen«-Schild, das seit fast eineinhalb Jahren an ihrer Haustür hing.
Genau hier, im übel riechenden Herzen des East Ends, in einem maroden zweistöckigen Reihenhaus in der Willow Street, hatte Marion ihr ganzes bisheriges Leben verbracht. Dreiundzwanzig Jahre lang hatte sie innerhalb der Grenzen dessen gelebt, was sie kannte, und sie hatte nicht gewagt, sich auch nur vorzustellen, dass noch ein anderes Leben auf sie warten könnte – ein Leben jenseits des Banalen und Gewöhnlichen. Eine andere Welt, eine Welt, in die sie wirklich gehörte.
Und obwohl Marion diese neue Welt vor vier Monaten tatsächlich gefunden hatte, schien sich ihr Leben oberflächlich betrachtet kein bisschen verändert zu haben. Sie lebte immer noch zusammen mit ihrer Großmutter in der Willow Street, in einem Schlafzimmer voller außerordentlich gewöhnlicher Dinge. Abgesehen natürlich von dem goldenen Nektarvogel.
In einer Ecke stand ein ganz normales Bett, auf dem eine halb ausgepackte Aktentasche lag. Es gab eine ganz normale Kommode direkt gegenüber, mit einem Stapel unbeschriftetem Papier darauf, außerdem ein paar Bücher und zwei gerahmte Fotografien: eine von Marions Vater, den sie kaum gekannt hatte, da er kurz nach ihrem fünften Geburtstag im Krieg gestorben war, und eine von Marion und ihrer Mutter Alice. Dieses zweite Foto war an Marions sechzehntem Geburtstag aufgenommen worden, und es war für keine der beiden Frauen sonderlich schmeichelhaft – das Licht war schlecht, der Aufnahmewinkel ungeschickt und unnatürlich –, aber dennoch war es für Marion die letzte schöne Erinnerung, die sie an ihre Mutter hatte. Ein flüchtiger Moment, in dem Alice wenigstens so getan hatte, als wäre sie glücklich.
Ein Strahl der blassen Morgensonne fiel durch das Fenster ihres Schlafzimmers und ließ die Schwanzfedern des Vogels aufleuchten, was Marion in die Gegenwart zurückholte. Es war ein Fehler gewesen, Bill anzubieten, dass sie versuchen würde herauszufinden, was mit dem Ding nicht in Ordnung war, auch wenn ihr Plan ihr in jenem Augenblick todsicher vorgekommen war. Immerhin hatte Marion ein Händchen für Mechanik, also hatte sie den Vogel über das Wochenende mit nach Hause genommen, um ihn auseinanderzubauen. Sie hatte nach losen Verbindungen, einer verstellten Schraube, einer unausgewogenen Gewichtung suchen und sich Notizen darüber machen wollen, was sie dabei fand.
In der Zwischenzeit würde sich Bill fünf Meilen von hier entfernt in seiner genauso muffigen und erbärmlichen Bleibe in einem Haufen kurioser Fachbücher vergraben, in der Hoffnung, über irgendeinen möglichen Grund zu stolpern, weshalb ein Aufziehvogel vielleicht nicht mehr funktionierte. Am Montag würden sie sich dann treffen und über die möglichen Antworten diskutieren, und dieses, ihr erstes gemeinsames Projekt würde ein Erfolg werden. Sie hatte angenommen, dass es wenigstens für sie eine leichte Aufgabe werden würde. Dieser Nektarvogel-Apparat mit seiner schimmernden Hülle und dem komplizierten und fragilen Kern zog sie auf besondere Weise an, und mittlerweile war sie mit seinem Innenleben äußerst vertraut. Trotzdem wurde sie ein weiteres Mal daran erinnert, dass nichts in ihrem neuen Job so leicht war, wie es aussehen mochte.
Seit vier Monaten schon arbeiteten Marion und Bill als Lehrlinge in einem obskuren Buchladen, von dem kaum jemand je etwas gehört hatte, am Ende einer namenlosen Sackgasse direkt hinter dem Eel-Brook-Common-Gemeinland in Fulham: »Miss Brickett’s gebrauchte Bücher und Kuriositäten«. Das gesamte Mobiliar des Ladens bestand aus einem Sekretär, der als Empfangstisch genutzt wurde, auch wenn er in dieser Funktion vollkommen überflüssig war, denn Kundschaft gab es bei Miss Brickett’s nicht. Natürlich diente der Sekretär noch einem anderen, praktischen Zweck, dieser jedoch war – genau wie die Existenz des Aufzieh-Nektarvogels – ein Geheimnis, das Marion und Bill keinesfalls preisgeben durften.
In diesem Moment schwang die Schlafzimmertür auf, und Marions Großmutter Dolores Hacksworth kam herein. Misstrauisch betrachtete sie den glänzenden Nektarvogel und schien schon drauf und dran zu sein, zu fragen, was das für ein Ding war, doch glücklicherweise lenkte sie ein offenbar sehr viel alarmierenderer Anblick ab.
»Also wirklich, Liebes«, sagte Dolores mit jenem missfälligen Stirnrunzeln, das sie so oft zur Schau trug. »Was hast du nur mit deinem Haar angestellt?«
Marion strich sich den Wust aus unbändigen braunen Locken glatt, dem sie nie irgendwelche Aufmerksamkeit schenkte. Genauso wenig wie dem Rest ihrer äußerlichen Erscheinung. »Eigentlich habe ich gar nichts damit angestellt. Ich bin einfach aufgestanden.«
»Tja, das ist eben der Punkt, nicht wahr?«, kommentierte Dolores, während sie Marions Locken akribisch musterte. »Stumpf und leblos, Liebes. Außerdem bist du viel zu dünn. Was in aller Welt isst du überhaupt in diesem Buchladen?«
Marion überlegte, ob sie darauf hinweisen sollte, dass ihr Haar genauso stumpf und leblos gewesen war, als sie noch sieben Tage die Woche dreimal täglich Dolores’ selbst gekochtes Essen zu sich genommen hatte. Dann allerdings entschied sie sich dagegen, da vor ihr noch ganze achtundvierzig Stunden lagen, in denen sie Dolores pausenlos ausgeliefert sein würde. Sie musste ihre Kräfte sparen. »Geh dich doch wenigstens kämmen, Liebes«, fuhr Dolores fort, »und …« Da fiel ihr Blick auf den noch versiegelten Briefumschlag auf Marions Nachttisch. »Oh, Herrgott noch mal, du hast Mr Smithers’ Brief immer noch nicht beantwortet? Wahrscheinlich ist es eine Einladung zu seinem Geburtstag, der deine letzte Chance sein könnte, Eindruck auf ihn zu machen.« Sie sah Marion an, wobei sie ihr Kinn an die Brust zog, sodass ihr Hals darunter Falten schlug.
»Ich war diese Woche sehr beschäftigt.«
Vor Ärger wurde Dolores’ Gesicht ganz rot. »Beschäftigt?«
»Ja …« Marion zögerte. Es war keine Lüge, sie war tatsächlich sehr beschäftigt gewesen, besonders nach dem Mittwoch, an dem man Marion, Bill und Jessica (die ebenfalls zu den Lehrlingen gehörte) damit beauftragt hatte, ein paar Kisten mit Waren für Miss Brickett’s Werkstatt durchzusehen, was leider dazu geführt hatte, dass eine dieser Waren aus der Kiste entkommen war und sich, wie sich herausstellte, partout nicht wieder hatte einfangen (und ausschalten) lassen wollen. Darüber durfte Marion allerdings nicht sprechen, also erfand sie wie sonst auch eine langweilige Ausrede: »Eines der Bücherregale ist zusammengebrochen … es hat zwei Tage gedauert, es zu reparieren, und dann noch einen Tag, um es wieder einzuräumen.«
Dolores stieß ein nasales, herablassendes Lachen aus. »Zwei Tage, um es zu reparieren?«
Marion holte tief Luft und zählte bis fünf, bevor sie antwortete. Das hatte sie vor Kurzem in irgendeiner Ausgabe von Dolores’ Zeitschrift »Die gute Hausfrau« gelesen. Angeblich half es einem dabei, Haltung zu bewahren, wie es eine Lady stets tun sollte. »Ja. Zwei Tage und noch ein bisschen länger.«
Dolores musterte sie nun noch genauer. Sie glaubte ihr kein Wort, so viel war deutlich. »Tja, wie auch immer«, sagte sie schließlich reserviert. »Du brauchst dich bei diesem Mann jedenfalls nicht so zu zieren. Mr Smithers hat dir den Brief schon vor zwei Wochen geschickt. Er ist sehr angetan von dir, weißt du.«
»Ja, das habe ich begriffen. Aber leider bin ich nicht sehr angetan von ihm.«
»Ist dir bewusst, dass er einmal das Familiengeschäft übernehmen wird? ›Smithers Möbel und Zubehör‹. Weißt du, wie gut es dem Unternehmen finanziell geht? Du könntest ein sehr komfortables Leben haben. Nicht jeder bekommt eine solche Chance, und ich glaube wirklich …«
»Wir sind einander nur ein einziges Mal begegnet«, fiel ihr Marion ins Wort, da sie sich nicht auf eine weitere, ausgedehnte Diskussion über Mr Smithers’ Potenzial einlassen wollte. »Er hatte überhaupt kein Interesse an irgendetwas, das ich gesagt habe. Hauptsächlich hat er über das Wetter geredet. Außerdem bin ich nicht mal ganz vierundzwanzig.«
Dolores’ Augen wurden zu schmalen Schlitzen. »Vierundzwanzig? Genau darum geht es, Mädchen! Ich war siebzehn, als ich geheiratet habe, und deine Mutter war …« Sie hielt inne. Ein kurzes, unangenehmes Schweigen. »Ich wünschte nur, du würdest mir eine Chance geben.«
»Dir?«
»Ja, mir. Ich versuche mein Bestes, um dir zu helfen, ich tue, was ich kann. Aber du machst dich nur darüber lustig.«
Marions Brust wurde eng, und sie rieb über das abgetragene Leder ihrer Armbanduhr. Das letzte Geschenk ihrer Mutter. Sie wusste, was als Nächstes kommen würde – ein Vortrag darüber, wie gütig ihre Großmutter doch gewesen war, weil sie nach Alice’ Tod hier eingezogen war. Dass sie großzügigerweise die Rechnungen zahlte, das Essen kaufte und sogar versuchte, einen Ehemann für Marion zu finden. Alles Dinge, für die Marion dankbar sein sollte. Alles Dinge, die sich Alice für ihre Tochter gewünscht hätte. Doch das stimmte nicht. Es gab nur eines, das sich Alice für Marion gewünscht hatte, und das war weder eine Heirat noch ein Ehemann oder ein Leben nach gesellschaftlichen Normen. Es war etwas, das Alice selbst nie wirklich gehabt hatte. Glück.
Marion stand auf und richtete den Blick wieder auf den Nektarvogel, um die Tränen zurückzuhalten. »Ich mache mich nicht darüber lustig. Ich mag mein Leben so, wie es ist. Ich wünschte nur, du würdest das akzeptieren.«
Dolores schwieg. Vielleicht zählte sie gerade bis fünf? Dann: »Willst du wirklich den Rest deines Lebens in einem Buchladen verbringen? Das ist dir genug?«
Marion wollte so vieles erwidern. Sie wollte scharfe, kluge Antworten geben, bei denen sich Dolores dumm und unbedeutend vorkommen würde, genau so, wie sich Marion in diesem Moment fühlte. Doch wie immer blieben ihr die Worte im Hals stecken, voll ausformuliert und ganz und gar unausgesprochen.
»Tja, ganz genau, dachte ich es mir doch«, sagte Dolores. Ein weiteres Mal hatte sie gewonnen.
Es war ein unvorhergesehener Glücksfall, dass genau in dem Moment, in dem Dolores weitersprechen wollte, die Türklingel läutete.
Dolores’ Blick schoss zum Fenster.
Es klingelte ein zweites Mal.
»Schau nach, wer das ist!«, fauchte sie.
Marion trat zum Fenster und spähte auf die Straße hinab. Vor der Eingangstür stand der Mensch, den sie dort am allerwenigsten erwartet hätte: Frank Stone.
»Und?«, fragte Dolores.
Marion zog den Kopf zurück. »Ich glaube, es ist für mich.«
»Für dich?« Nun kam Dolores ebenfalls zum Fenster.
Dolores und Frank waren einander schon ein paarmal begegnet, da er früher ein Freund von Marions Mutter gewesen war. Außerdem hatten sie sich gesehen, als Frank ihnen beiden vor vier Monaten einen Besuch abgestattet hatte, um Marion den Job im Buchladen anzubieten. Leider – da dies schon das zweite Mal gewesen war, dass sich Marion geradezu auf das Angebot einer nicht sonderlich lukrativen Arbeit gestürzt hatte – war Dolores von Franks Vorschlag alles andere als begeistert gewesen.
Als Marion achtzehn Jahre alt gewesen war, zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter und Dolores’ Einzug, hatte sie verzweifelt versucht, den langen, sinnlosen Tagen in der Willow Street 16 zu entfliehen. Da sie jedoch keine solide Ausbildung und keine nennenswerten Talente vorweisen konnte, waren die Möglichkeiten begrenzt gewesen. Für eine Frau sogar fast nicht existent.
Nachdem sie sich viele Monate umsonst bemüht hatte, war ihr allerdings schließlich eine Bürotätigkeit in einer schäbigen Autowerkstatt angeboten worden. Der Besitzer der Werkstatt, Felix, war ein freundlicher, aber weltfremder Mann gewesen, der sich einfach weigerte, sein einst florierendes Geschäft in den tristen Jahren nach dem Krieg aufzugeben. Infolge der steigenden Steuern, der Nahrungsmittelknappheit und der Trauer, die so viele Menschen ausgehöhlt hatte, gab es nur noch wenige, die ein Auto besaßen, und noch weniger von ihnen konnten es sich leisten, es professionell reparieren und warten zu lassen.
Dennoch war Felix beharrlich geblieben, und auch wenn sein Traum von einem Ansturm an Kundschaft niemals wieder wahr wurde, fand er wenigstens in Marion mehr, als er erwartet hatte: eine begabte und unermüdliche Assistentin, die bereit war, jede Arbeit anzupacken, die gerade anstand. Also hatte Felix damit begonnen, seine Leidenschaft für Metall, Öl und Gummi an Marion weiterzugeben. Während der nächsten fünf Jahre ihres Lebens hatte sie ihre Tage damit verbracht, Radmuttern festzuziehen, Motoren wiederzubeleben, Zündkerzen zu wechseln und Verteilerkappen auszutauschen. Und inmitten des Chaos’ und der Armut des Nachkriegslondons fand Marion, genau wie Felix vor ihr, Trost in der stillen Beständigkeit gut geölter Getriebe, sich drehender Schrauben und aufgewickelter Spulen. Die Logik der Maschinen wurde für Marion die einzige Form von Geborgenheit in einer ansonsten rauen und harschen Wirklichkeit.
Als Marion jedoch dreiundzwanzig wurde, verschlechterte sich Felix’ Gesundheitszustand auf einmal dramatisch, und nach so vielen Jahren voller Schufterei und Enttäuschungen gab sein Herz schließlich den Dienst auf. Am 8. Juli 1957 schloss die Werkstatt, und Marion war wieder arbeitslos, abgewiesen und allein.
Oder jedenfalls hatte sie das geglaubt.
Wie hätte sie ahnen können, dass durchaus nicht unbemerkt geblieben war, welche Fähigkeiten Felix an sie weitergegeben hatte? Weit unter den Straßen auf der anderen Seite Londons waren bereits Vorkehrungen für Marions Zukunft getroffen worden. Sehr zu Dolores’ Verzweiflung.
Frank klingelte ein drittes Mal an der Tür, dann klopfte er.
»Ach, um Himmels willen!«, rief Dolores. »Was will er hier?«
»Keine Ahnung«, antwortete Marion aufrichtig und versuchte dabei, so beiläufig und wenig überrascht wie nur möglich zu klingen, gar nicht so, wie sie sich fühlte. Sie eilte an ihrer Großmutter vorbei die Treppe hinab und zur Haustür.
Auf der Schwelle stand tatsächlich Frank, Beauftragter für die Nachwuchsanwerbung im Buchladen und Leiter des Ausbildungsprogramms. Wie schon an dem Tag, an dem sie einander kennengelernt hatten, trug er einen Bowler und einen Chesterfield-Mantel.
»Was machst du hier?«, fragte sie gedämpft.
»Guten Morgen, Marion«, sagte er mit einem Anflug von Ungeduld in der Stimme. Er nahm seinen Hut ab und spähte über ihre Schulter.
Dolores, die überraschend schnell und leise für ihr Alter die Treppe heruntergekommen war, schob Marion entschieden beiseite. Ärgerlich betrachtete sie Frank. »Kann ich Ihnen helfen?«
Frank lächelte, und wie immer überkam Marion eine tiefe Wärme, ein Gefühl von Stärke und Ruhe, das jede Zelle ihres Körpers erfüllte. Eine Wirkung, wie sie vielleicht auch ein Vater auf sie hätte.
Frank streckte zur Begrüßung die Hand aus. »Guten Morgen, Mrs Hacksworth!«
Dolores schürzte die schmalen roten Lippen und ging ohne Vorwarnung zum Angriff über. »Marion hat an dem Tag, an dem Sie ihr die Arbeitsstelle angeboten haben, einen Heiratsantrag erhalten. Mr Smithers von Smithers Möbel und Zubehör. Sie haben gerade ein fantastisches Verkaufsjahr, und er hat Marion sogar eine Beteiligung angeboten. Haben Sie das gewusst?«
Frank lächelte immer noch, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so strahlend. »Das wusste ich nicht. Wie wunderbar!«
Dolores schniefte. »Das war es allerdings.«
»Dann hat er seine Meinung also geändert?«
»Natürlich hat er das! Welcher Mann wäre noch an einer Frau interessiert, die zwölf Stunden täglich in irgendeinem lächerlichen Buchladen arbeitet? Für ein Almosen, wie ich hinzufügen möchte.«
»Ach ja«, sagte Frank nachdenklich. »Ich verstehe, dass das ein wenig abschreckend wirken kann, aber wissen Sie, ich bin ganz sicher …«
»Ihre Meinung interessiert mich nicht.« Sie holte tief Luft. »Warum sind Sie hier?«
Frank schob die Hand in die Tasche, die er über der Schulter trug, und zog einen Briefumschlag hervor. »Tatsächlich bin ich hier, um mit Ihnen zu sprechen, Mrs Hacksworth.«
Nach einem langen Schweigen, während dem sich Marions Herzschlag verdoppelte, fuhr Frank schließlich fort. Dieses Mal sah er nur Marion an.
»Nur ein paar Formalitäten«, sagte er, was wahrscheinlich beruhigend klingen sollte. »Wir brauchen einen nächsten Angehörigen, der einige Papiere unterzeichnet.«
»Einige Papiere? Welche denn zum Beispiel? Wenn Sie glauben, dass ich …« Abrupt verstummte Dolores, und das, obwohl sich Marion schon ganz sicher gewesen war, dies würde der Auftakt zu einer ausgedehnten Tirade darüber werden, dass Dolores ganz sicher nichts tun würde, was Frank von ihr verlangen könnte. Warum sie so plötzlich schwieg, begriff Marion nicht, doch sie bemerkte, dass Dolores’ Blick auf einer handschriftlichen Notiz auf einem Blatt ruhte, das aus Franks Umschlag hervorlugte. Bevor Marion jedoch erkennen konnte, worum es sich dabei handelte, schob Frank den Umschlag wieder unter seinen Mantel.
»Wie wäre es mit einem Tee?«, fragte er.
In einer raschen Bewegung nickte Dolores und machte gleichzeitig kehrt, um Frank und Marion in die Küche zu führen.
»Ach, Marion, bevor ich es vergesse«, sagte Frank, sobald Dolores und er sich an den Tisch gesetzt hatten. »Könntest du mir den Ersatzschlüssel holen, den ich dir letzte Woche für den Buchladen gegeben habe? Offenbar habe ich meinen eigenen verlegt …«
Nach einem Augenblick, in dem sich Marion vor lauter Schreck nicht hatte rühren können, eilte sie die Treppe hinauf. Frank mit Dolores allein zu lassen, war furchtbar beängstigend. Was, wenn es Dolores in der Zeit, die Marion brauchte, um den Schlüssel zu holen, irgendwie gelang, Frank davon zu überzeugen, es wäre ein Fehler, Marion anzuheuern, und sie wirklich besser heiraten und ohne Arbeit weiterleben sollte? Was, wenn ihre Großmutter in diesem Moment dabei war, das Einzige in Marions Leben zu zerstören, das ihr je etwas bedeutet hatte? Was, wenn ihr, gerade einmal vier Monate nachdem sie endlich eine Welt gefunden hatte, in die sie gehörte, alles wieder weggenommen werden würde?
Sie lief zu ihrem Bett hinüber und öffnete die Aktentasche, die noch immer unausgepackt vom Vorabend darauf lag. Unter einigen mehr schlecht als recht zusammengelegten Kleidern fand sie ein Fernglas mit seltsam geformten Linsen, eine tennisballgroße Lichtkugel (die stets in einem weichen Weiß schimmerte) und eine Broschüre mit dem Titel »Miss Brickett’s Strategien und Vorschriften«, die auf Seite dreiunddreißig bei dem Kapitel »Das erste Lehrjahr: allgemeines Verhalten und Vorgehen« ein Eselsohr aufwies.
Sie hielt inne. Inmitten des Durcheinanders konnte sie keinen Ersatzschlüssel entdecken, und nun, da sie darüber nachdachte, fiel ihr auch nicht ein, dass Frank ihr je einen gegeben hätte. Sie trat an die Tür und sah nach, ob an dem Schlüsselbund im Schloss ein solcher Schlüssel hing, wobei sie einige Unterhaltungsfetzen von unten aufschnappte.
»… Sie hätten uns allen viel Ärger ersparen können, wenn Sie gar nicht erst hier aufgetaucht wären«, sagte Dolores, deren Nebelhorn-Stimme problemlos bis in den ersten Stock hallte.
»Ich wusste, was ich tat. Und ich bereue es nicht, dies hier sind jedoch … unvorhergesehene Umstände.«
»Unvorhergesehen?« Unverhohlene Skepsis schwang in Dolores’ Frage mit. »In diesem Fall sollten Sie vielleicht eher darüber nachdenken, mich einzustellen. Ich habe vorhergesagt, dass es so kommen …«
»Das ist leider nicht möglich«, warf Frank ein. »Lassen Sie mich einfach bis Freitag wissen, ob alles arrangiert werden kann.«
»Nun gut.«
Darauf folgte eine kurze Stille.
»Danke! Und noch einmal, das alles tut mir sehr leid. Aber ich habe Ihnen meine Beweggründe so gut erklärt, wie ich kann.«
Stuhlbeine kratzten über den Boden, als die beiden aufstanden.
»Es war mir eine Freude, Sie wiederzusehen, Mrs Hacksworth.«
Marion war halb die Treppe hinunter, als Frank die Eingangstür wieder erreichte. »Frank? Ich konnte keinen Ersatzschlüssel finden. Aber ich kann dir meinen geben?«
»Oh nein, keine Sorge«, sagte er hastig, setzte sich den Bowler auf und öffnete die Tür. »Vielleicht warst es auch gar nicht du, der ich den Schlüssel gegeben habe. Wir sehen uns am Montag.« Nach einem knappen Nicken in Dolores’ Richtung trat er ins Freie hinaus. Als Marion schließlich die Tür erreicht hatte, erhaschte sie nur noch einen kurzen Blick auf Franks rotbraunen Mantel, dann war er auch schon um die letzte Ecke der Willow Street verschwunden.
»Was hat er zu dir gesagt?«, fragte sie, als sie die Küche betrat.
Dolores stand beim Waschbecken und spülte die Tassen. Marion sah, dass ihre Hände zitterten.
»Papiere.« Ein fast unverständliches Murmeln. »Papiere, die ich unterzeichnen soll. Notfallkontakte, Telefonnummern, so etwas eben.«
»Ich habe gehört, dass er etwas über …«
»Wofür zum Teufel braucht man in einem Buchladen einen Notfallkontakt?«, fuhr Dolores fort, als hätte sie Marion gar nicht gehört.
Marion erwiderte nichts. Sie konnte nichts sagen, ohne dabei vielleicht zu viel preiszugeben. Aber auch Dolores verschwieg ihr etwas. Schon an ihrem ersten Tag im Buchladen hatte Marion die Kontaktdaten ihrer Großmutter an Frank weitergegeben. An dem Tag, an dem sie auch diverse Geheimdokumente unterschrieben hatte, die sicherstellen sollten, dass sie niemals enthüllen würde, was sich hinter der Eingangstür von Miss Brickett’s gebrauchte Bücher und Kuriositäten befand.
Sie kehrte nach oben zurück und ließ diese seltsame Unruhe, die nun die Küche erfüllte, hinter sich. Sie setzte sich auf den Stuhl neben dem Fensterbrett und griff wieder nach dem Nektarvogel, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. In Gedanken war sie mit anderen, finstereren Dingen beschäftigt. Welche Dokumente es auch gewesen waren, die Frank an Dolores weitergegeben hatte, er wollte eindeutig nicht, dass Marion etwas darüber erfuhr. Doch was konnte das sein, was er zwar Dolores, nicht aber Marion anvertrauen konnte? Hatte sie im Buchladen irgendeine Regel gebrochen, ohne es zu wissen? Hatte sie irgendein bürokratisches Detail übersehen, das nun zu ihrer Entlassung führen konnte?
Vielleicht hätte sie sich noch tiefer in solch unguten Gedanken verloren, wenn der Aufziehvogel in ihren Händen nicht auf einmal zu zucken begonnen hätte. Irgendwie war es ihr gelungen, den kleinen Apparat zum Leben zu erwecken – genau das, was sie schon den ganzen Morgen über vergeblich versucht hatte. Der Vogel streckte seine Metallflügel aus, stieß gegen Marions Handflächen. Die scharfen Kanten gruben sich in ihre Haut, während der Vogel gegen ihren Griff kämpfte, und schließlich blieb ihr nichts anderes übrig, als ihn loszulassen. Mit zielstrebigen mechanischen Flügelschlägen schwang er sich empor und landete auf dem Deckenbalken über ihrem Bett. Wo er, sehr zu Marions Verdruss, das ganze Wochenende über blieb.
Drei
Das andere Miss Brickett’s
Marion schlüpfte in ihre gewohnte Uniform – ein grau-schwarz gestreifter, knielanger Bleistiftrock und eine weiße Baumwollbluse –, verabschiedete sich knapp von Dolores (die ihr seit Franks Besuch kaum in die Augen gesehen hatte) und trat auf die Straße hinaus. Wie an jedem Montag seit Jahresbeginn ließ sie die Tür der Willow Street 16 erleichtert hinter sich zufallen.
Nach einem kurzen Fußmarsch zur U-Bahn-Haltestelle Upton Park Station nahm Marion die District Line Richtung Wimbledon und stieg am Fulham Broadway aus. Von dort aus ging sie zu Fuß bis zum Westende des Eel-Brook-Common-Parks, bis sie schließlich bei einem baufälligen georgianischen Gebäude ankam, das durchaus etwas Gespenstisches an sich hatte: Miss Brickett’s gebrauchte Bücher und Kuriositäten – der Buchladen, der nichts mit dem Verkauf von Büchern zu tun hatte. Obwohl die Fassade des Geschäfts – schwarz gerahmte, nach außen gewölbte Fenster aus Milchglas und eine dunkelgrün gestrichene Wand, von der die Farbe bereits abblätterte – potenzielle Kunden eher abschrecken sollte, hatte sie auf Marion die genau gegenteilige Wirkung. Was aber vielleicht daran lag, dass jene, die sich davon angezogen fühlten, eben – genau wie der Buchladen selbst – anders waren. Nicht dazu passten.
Hier, in einer Welt aus düsteren Tunneln, die sich unter dem alten Geschäft verbarg, fand Marions Ausbildung wirklich statt. Für die nächsten drei Jahre würden sie und einige andere sorgfältig ausgewählte Rekruten eine anstrengende Probezeit durchlaufen, an deren Ende ihnen (falls sie sich denn als fähig und würdig erwiesen) eine Vollzeitstelle (mit der Möglichkeit auf Unterkunft und Verpflegung) bei Miss Brickett’s angeboten werden würde.
Die Ausbildungszeit sollte die Rekruten auf die trügerische Welt einer sehr speziellen Detektei vorbereiten. Zwar gab es in London auch noch andere Agenturen und Privatdetekteien, die ein Vermögen dafür verlangten, dass sie sich um die Fälle kümmerten, mit denen die Polizei nicht behelligt werden konnte, doch Miss Brickett’s diente der Stadt auf eine Art, wie es keine dieser anderen Organisationen konnte. Rekruten wurden darauf trainiert, Verdächtige zu verfolgen, ohne gesehen zu werden, Gespräche zu belauschen, ohne bemerkt zu werden, Gebäude ohne Einladung zu betreten. Man erwartete von ihnen, dass sie das Ungewöhnliche hinter einer Fassade nüchterner Normalität verbargen, dass sie mit dem Hintergrund des alltäglichen Londons verschmolzen und unsichtbar wurden für alle, die nicht wussten, wonach sie Ausschau halten mussten. Vielleicht war es aber vor allem Miss Brickett’s Sammlung erstaunlicher Gerätschaften – dort unten in den Tunneln entwickelt und zusammengetragen –, die diese Detektei und jene, die dort ausgebildet wurden, vom Rest unterschied.
Einen Moment lang blieb Marion einfach vor dem Geschäft stehen. Die Milchglasfenster schimmerten wie dunkle Juwelen in der Morgensonne, eine Ahnung des Geheimnisvollen, das sich dahinter verbarg. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass sie allein in der Sackgasse war, schob sie einen kleinen Messingschlüssel in ein Schloss unten an der Tür des Buchladens (eine undurchdringlich wirkende schmiedeeiserne Barriere, verziert mit seltsamen Gestalten, Ghulen, Uhren und anderen nicht näher definierbaren Abbildern). Der Schlüssel drehte sich einmal um dreihundertsechzig Grad im Uhrzeigersinn, dann noch einmal um neunzig Grad gegen den Uhrzeigersinn, und dann – wie üblich – spuckte ihn das Schlüsselloch wieder aus. Marion konnte ihn gerade noch auffangen. Als Nächstes zog sie einen größeren Silberschlüssel aus ihrer Tasche und öffnete damit ein zweites Schloss direkt unterhalb der Türklinke. Sie zog an einem als alte Gaslaterne getarnten Hebel, und endlich sprang die Tür mit einem Klicken auf.
Marion schob sich in den vollgestopften Verkaufsraum. Selbst von jemandem, der so wenig gepolstert war wie sie, erforderte es eine gewisse Finesse, sich zwischen den gefährlich überladenen Bücherregalen hindurchzuschlängeln. Außerdem war es ziemlich dunkel, da der Lichtschalter unpraktischerweise am anderen Ende des Raums angebracht war. Alles in allem war es also kein Wunder, dass sie über die Gestalt stolperte, die neben dem Empfangstresen lag.
»Gott, der Allmächtige!«, rief die Gestalt und fing Marion gerade noch auf, bevor sie sich den Kopf an der scharfen Kante des Empfangstresens einschlug. »Alles in Ordnung?«
Marion sammelte sich, stand auf und schaltete das Licht ein. »Mr Nicholas?«, fragte sie und riss vor Überraschung die Augen auf. »Ja … nichts passiert. Was in aller Welt machen Sie denn hier?« Was eine dumme Frage war, wie sie kurz darauf begriff, als sie Mr Nicholas – dem Sicherheitschef bei Mrs Brickett’s, einem rundlichen Mann mit schütter werdendem blondem Haar und einer gezackten Narbe durch die rechte Augenbraue – dabei zusah, wie er eine Decke und ein Kissen vom Boden aufhob.
»Das tut mir sehr leid«, sagte er und sah auf die Uhr. »Ich habe verschlafen.«
»Stimmt irgendetwas nicht?« Marion war sich sicher, dass die Antwort darauf nur »Ja« lauten konnte.
»Nein, nein, nur eine Vorsichtsmaßnahme. Nichts weiter.« Er zog sich einen dicken Wollmantel über. »Aber danke dafür, dass Sie mich geweckt haben. Schlimme Sache, das«, fügte er ein wenig leiser hinzu. »Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Miss Lane.« Er griff hinter den Empfangstresen, zog ein Schlüsselbund hervor und verließ den Buchladen, bevor Marion ihm noch weitere Fragen stellen konnte. Genau wie Frank beherrschte Mr Nicholas die Kunst eines raschen Abgangs längst in Perfektion.
»Schlimme Sache?«, murmelte Marion vor sich hin, während sie die Ecke hinter dem Empfangstresen umrundete. Mr Nicholas hatte einen Hang zum Dramatischen, rief sie sich in Erinnerung, vertrieb diese Gedanken aus ihrem Kopf und bog in einen kurzen Gang ein, an dessen Ende eine leere Wand und eine Kiste voller Bücher auf sie warteten. Sie ging in die Hocke und zog an dem vierten Dielenbrett von rechts, das einzige, in dessen Mitte ein Metallring befestigt war. Widerstrebend und laut knarrend schwang das Brett nach oben, und Marion stieg die Treppe darunter hinab in die Dunkelheit.
Unten angekommen durchquerte sie einen weiteren kurzen Korridor, der zu einer Stahltür führte. Im schwachen Dämmerlicht zog Marion ein silbernes Abzeichen aus ihrer Tasche, in das in filigraner Schrift der Buchstabe A eingraviert war, und drückte es in eine kleine Mulde in der Wand. Die Tür glitt beiseite, Marion heftete sich die silberne Mitarbeitermarke an die Brust und betrat den Fahrstuhl. Sie brauchte kein Stockwerk auszuwählen, denn der Fahrstuhl würde erst ganz unten wieder ruckelnd zum Stehen kommen. Tief unter dem Buchladen und den Straßen Londons. Ein weiteres Mal glitt die Tür auf, und vor Marion lag der elegante marmorgeflieste Eingang des wahren Miss Brickett’s: »Miss Brickett’s Ermittlungen und Recherchen«.
Der Große Gang, wie er genannt wurde, erinnerte an das Innere einer römischen Basilika. Es war ein gewaltiger Korridor, sowohl was die Breite als auch die Länge betraf. Die Kuppeldecke ruhte auf schimmernden hellen Marmorsäulen. An jeder dieser Säulen standen vier Fuß hohe Messinglaternen in Form von geflügelten Menschen, die mit ausgestreckten Händen ihr Licht großzügig in der Halle verbreiteten. Die Augen der Statuen folgten Marion, als sie an ihnen vorbeiging, drehbare Kameras, die jeden Besucher registrierten – und davon gab es viele.
Abgesehen von den Lehrlingen wurde die Detektei noch von einer ganzen Legion fester Angestellter bevölkert, die auch hier unten lebte: sieben Mitglieder des hohen Rats, sechs Abteilungsleiter sowie Assistenten, Mechaniker und eine Handvoll Leute, die sich um Reinigungs- und generelle Wartungsarbeiten kümmerte. Unter all diesen Menschen bewunderte Marion jedoch niemanden so sehr wie die Inquirer – die voll ausgebildeten Privatermittler der Detektei und damit die Einzigen, die ihren Namen vielleicht eines Tages auf der goldenen Gedenktafel am Ende des Großen Gangs wiederfinden würden. »Zu Ehren folgender Ermittler« stand darauf. Oft blieb Marion dort stehen, um die glänzende Tafel zu bewundern, und mehr als einmal hatte sie sich schon vorgestellt, ihren eigenen in Gold verewigten Namen dort zu lesen.
Der Anzahl an Namen und Daten auf der Tafel nach zu urteilen, waren die frühen Fünfzigerjahre die geschäftigste Zeit der Detektei gewesen – eine Epoche des Wiederaufbaus und der Transformation Londons und eine Phase, in der sich Miss Brickett’s den Respekt und die Bewunderung der Stadt verdient hatte.
Während der großen Smog-Katastrophe im Jahr 1952, während der ganz London in Dunkelheit und Chaos versank und die Luft voller giftiger Abgase und Angst war, war die Detektei von einer Woge panischer Hilferufe überflutet worden. Plündereien, Vandalismus und Gewalt auf der Straße. Also gingen die Inquirer, die seit Langem an Düsternis und harte Arbeit gewöhnt waren, auf die Straßen: eine Flut unsichtbarer Beschützer, bewaffnet mit Leuchtkugeln, die nach allen möglichen Widrigkeiten Ausschau hielten.
Welche Auswirkungen die Taten der Inquirer während der Smog-Katastrophe wirklich hatten, war unmöglich zu sagen. Doch für die ältere Dame, die ein freundlicher Gentleman mit einem seltsamen schimmernden Ball nach Hause führte, oder für die Familie, deren Juweliergeschäft von einer Gruppe Gestalten in Mänteln bewacht wurde, bedeutete es einfach alles.
Als sich der Smog endlich hob und die Luft wieder klar wurde, verbreiteten sich in der Stadt die Gerüchte über eine namenlose Macht, die an die Schatten gebunden war. Man wisperte sich im Vorbeigehen zu, wo sich die geheimen Briefkästen befanden, und in der ganzen Stadt wurde über die Effektivität der Inquirer gemurmelt und geflüstert.
In den darauffolgenden Jahren hatte die Detektei mehr Arbeit, als sie bewältigen konnte. Weitere Lehrlinge wurden angeworben und ausgebildet, Büros erweitert, neue Abteilungen eingerichtet und Ausrüstung entwickelt. Zum Dank an die gesichtslosen Beschützer malten Londoner gewaltige Wandbilder an Gebäude in der ganzen Stadt, die das öffentliche Symbol der geheimnisvollen Gruppe von Gesetzeswächtern zeigten: einen Halbkreis, der den Buchstaben I einfasste.
Als Marion jedoch an diesem Tag an der goldenen Gedenkplakette vorbeikam, richtete sich ihre Aufmerksamkeit nicht darauf, sondern auf die große Anschlagtafel. Daran wurden jeden Tag die neuen Arbeitspläne für die Lehrlinge angeheftet und Routinemeldungen veröffentlicht. Daneben hing heute allerdings noch eine eher ungewöhnliche Nachricht:
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass alle Herold-Stethoskope zurückgerufen werden und vom heutigen Tag an als Vorrichtungen der Liste 3 gelten. Daher wird jeder, in dessen Besitz ein Herold-Stethoskop gefunden wird, ohne dass er oder sie die dafür nötige Lizenz vorweisen kann, fristlos entlassen.
Vielen Dank
N. Brickett
»Typisch«, erklang eine mürrische Stimme hinter ihr. »Noch mehr Verbote, noch mehr Kontrolle.«
Als Marion sich umdrehte, erkannte sie David Eston – einen anderen Lehrling im ersten Jahr –, der hinter ihr stand. Er war stämmig, hatte kurz geschorenes braunes Haar, schmale Augen und einen Hang zu ungebremster Schadenfreude. Eine Woche nachdem sie einander begegnet waren, hatte es Marion aufgegeben, ihn mögen zu wollen. Er war nur ein paar Tage vor ihr angeworben worden, fort von einer schlecht bezahlten Anstellung in einer Metallfabrik, wie sie gehört hatte. Während Marion bei jedem anderen der Lehrlinge, die zusammen mit ihr ausgebildet wurden, mindestens eine einzigartige Eigenschaft, ein typisches Merkmal oder ein bestimmtes Talent hatte entdecken können, war bei David keine Spur davon zu erkennen.
»Als Nächstes rufen sie noch unsere Leuchtkugeln zurück und verlangen dafür eine Lizenz«, murrte er, wobei er seine eigene gläserne Kugel von einer Hand zur anderen warf.
Marion wandte sich wieder der Anschlagtafel zu und las die Nachricht dort ein weiteres Mal. So ungern sie es auch zugab, sie musste ihm zustimmen: Die Herold-Stethoskope – lange, dünne Messingrohre, mit denen man durch Wände hören konnte – schienen wirklich nicht auf die Liste 3 zu passen, die eine Art Verzeichnis für eingeschränkt zugängliche Ausrüstungsgegenstände war, versehen mit dem Hinweis: »Können bei unangemessenem Gebrauch ernsten Schaden verursachen.«
»Vielleicht hat es eine Art Unfall gegeben«, schlug sie vor, wobei sie jedoch mehr zu sich selbst sprach.
»Unfall? So klingt das aber nicht.«
Marion drehte den Kopf in Richtung des Alkovens zu ihrer Linken – dem Eingang zu einem der Büros für Führungskräfte.
»… eine Katastrophe«, sagte eine Frauenstimme, die vermutlich zu Nancy Brickett gehörte, der Leiterin und Gründerin der Detektei. »Ich will mir gar nicht vorstellen, was es für Konsequenzen nach sich ziehen würde, wenn die Polizei Wind davon bekommen sollte.«
»Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen«, gab eine zweite Stimme zurück – es war die von Frank. »Vielleicht meldet sich ja jemand.«
»Du erwartest ein Geständnis?«
Darauf folgte eine kurze Stille.
»Jemand hat ihr den Hals durchbohrt, Frank. Mitten durch den Kehlkopf, Herrgott noch mal. Wenn das nicht symbolisch ist, dann weiß ich auch …« Sie verstummte.
Weiteres Schweigen, gefolgt von einem lauten Klicken, als die Tür zum Alkoven zugezogen wurde.
Marion wandte sich wieder David zu. »Worum ging es da?« Ihre Stimme klang brüchig.
Ein merkwürdiger Ausdruck huschte über Davids Gesicht. Angst? Ekel? Sie konnte es nicht sagen. »Jemand hat Mist gebaut, und wir werden alle dafür bezahlen.« Er pflückte seinen Arbeitsplan von der Anschlagtafel, und schon war er ohne weitere Erklärung verschwunden.
Davids rätselhafte Andeutung geisterte durch Marions Kopf und rief eine unwillkommene Erinnerung wach: Franks überraschender Besuch in der Willow Street 16. Hatte Franks abweisende Art an diesem Tag etwas mit dem zu tun, was sie gerade gehört hatte? Hatte es irgendetwas mit ihr zu tun? Sie starrte die Bürotür an und war versucht, noch ein bisschen näher heranzutreten. Aber nein, das war doch albern. Sie war überängstlich – wie üblich. Sie stieß die Luft aus und nahm sich ebenfalls ihren Arbeitsplan von der Anschlagtafel.
Die Pläne wurden individuell für jeden Lehrling erstellt und morgens ausgehängt. Darauf war zu lesen, in welcher Abteilung man im Laufe des Tages eingesetzt werden sollte. An diesem Morgen wurde Marion zuerst im Auditorium zur Generalversammlung der Detektei erwartet, dann folgte die Technische Abteilung bis zum Mittagessen und schließlich die Informationsabteilung für den Rest des Nachmittags, wo sie die mit Sicherheit wichtigste Präsentation ihrer Karriere halten sollte. Sie steckte sich den Arbeitsplan in die Manteltasche und begann ihren gewundenen Weg zum Auditorium.
Die viele Meilen langen verschlungenen Tunnel und Korridore von Miss Brickett’s hatten angeblich schon lange vor der Gründung der Detektei vor zehn Jahren existiert, allerdings beruhte das, was die Lehrlinge darüber wussten, größtenteils auf Gerüchten, Legenden und nur sehr wenigen Fakten. Die am weitesten verbreitete Theorie lautete, dass die labyrinthartigen Gänge – die vielleicht schon zu Zeiten der Römer gebaut worden waren – im vierzehnten Jahrhundert von einer Gruppe in Ungnade gefallener und von der Kirche verbannter Alchimisten wiederentdeckt worden waren, die diese verborgenen Korridore genutzt hatte, um an ihren Formeln zu forschen und geheimnisvolle Mischungen zusammenzubrauen. Hätte man sie dabei entdeckt, wären sie vermutlich auf direktem Weg am Galgen gelandet. Allerdings schien niemand zu wissen, wer das riesige unterirdische Geflecht aus Tunneln schließlich modernisiert und instand gesetzt hatte. Wer ein Belüftungssystem installiert, Stützen eingebaut, Rohre verlegt und eine Lichtanlage eingerichtet hatte, und zu welchem Zweck.
Die offizielle Geschichte lautete, dass man das Labyrinth während des Kriegs als Luftschutzbunker gebraucht hatte, obwohl einige auch glaubten, dass es wahrscheinlich als Kommandozentrale oder sogar als Waffenlager gedient hatte. Was auch immer die Wahrheit sein mochte, Marion fühlte oft einen Anflug von Nervosität, wenn sie die vielen stillen Gänge durchquerte und daran dachte, wer wohl vor ihr hier gewesen sein mochte.
Was auch der Grund war, warum sie zögerte, als sich drei dunkle Tunneleingänge vor ihr auftaten. Sie dachte über ihre Möglichkeiten nach. Alle drei führten auf dem einen oder anderen Weg zum Auditorium. Der rechte Gang folgte allerdings einem verschlungenen Pfad, vorbei an einer Damentoilette und der Bibliothek, dann eine lange Treppe hinauf und eine weitere hinunter. Diesen Tunnel hätte sie sowieso nicht gewählt, auch dann nicht, wenn kein gewaltiges Holzschild davor genagelt worden wäre. »Kein Durchgang, unter keinen Umständen. Nehmen Sie eine alternative Route.«
Ohne weiteres Zögern wandte sie sich dem linken Gang zu, denn die einzige Alternative wäre der mittlere Tunnel gewesen. Ein schmaler Durchgang, der sich in alle möglichen Richtungen verzweigte, und jeder der von diesem Gang abgehenden Korridore war meilenlang und bestand aus Fels und Backstein, sodass es unmöglich war, sie voneinander zu unterscheiden. Sie wollte sich lieber nicht daran erinnern, was geschehen war, als sie diesen Tunnel einmal gewählt hatte, und der Hinweis möge genügen, dass sie erst Stunden später am anderen Ende wieder herausgekommen war, und zwar nicht einmal in der Nähe des Auditoriums, dafür aber mit einer handfesten Angst vor Ratten.
Erwartungsgemäß kam Marion zu früh beim Auditorium an. Trotzdem war der Saal schon recht voll, so wie an jedem Montagmorgen, da das gesamte Personal von Miss Brickett’s hier zur wöchentlichen Generalversammlung zusammenkam. Im Gegensatz zu den meisten anderen Montagen wirkte die Stimmung an diesem Morgen jedoch gedrückt, und Marion fragte sich, ob nicht nur David und sie die beunruhigende Unterhaltung zwischen Nancy und Frank mit angehört hatten.
Sie ging in einer der hinteren Reihen zu Bill Hobb, ihrem Partner bei dem Nektarvogel-Projekt und eigentlich auch bei sonst allem.
»Na endlich, setz dich.« Bill klopfte auf den freien Platz neben sich. Wie üblich sah er aus, als hätte er nur sehr wenig Zeit darauf verwendet, sich anzuziehen. Sein schwarzes Haar war zerzaust, seine Hose ungebügelt. Dünn und groß, wie er war, hätte er mit seinen feinen Gesichtszügen und seiner fast kränklichen Blässe eher hinter den Empfangstresen einer Bank gepasst als in eine Detektei. Und an diesem Tag wirkte er sogar noch etwas ungekämmter als sonst.
»Bin ich zu spät?«, Marion sah auf ihre Uhr. Es war noch nicht acht. Sie atmete auf.
Bill lächelte. »Warst du das jemals? Nein, ich meinte, endlich bist du hier, damit ich mich nicht mit denen da herumstreiten muss. Sie sind mal wieder voll dabei.« Er deutete auf die beiden Frauen, die eine Reihe vor ihnen saßen.





























