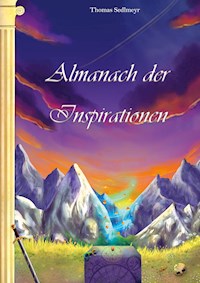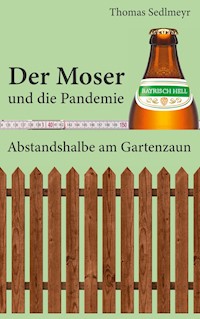
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Früher hat sich der Moser mit seinen Freunden meist im Wirtshaus oder in seinem Garten zum Grillen getroffen. Früher, das war noch vor Corona." Der Moser ist ein Original. Ein Eigenbrötler mit Herz, Grant und großem Durst, der aus der Peripherie des bayerischen Landes auf die Welt blickt. Im ersten Jahr der Pandemie trifft er sich mit seinen Freunden regelmäßig am Gartenzaun. Bei der ein oder anderen Abstandshalben nähern sie sich den großen und kleinen Fragen des Lebens: Was hat es mit der Einheit Olf und dem Popeldilemma auf sich? Warum ist der Hinterhofer damals zur Polizei gegangen? Wie steht es um die gesellschaftliche Statik? Und wieso sind Fabelwesen auch nur Ausdruck eines schlechten Gewissens? Dabei entsteht ein bunter Kosmos aus irrwitzigen Begebenheiten, skurrilen Geschichten und interessanten Gedanken - mal melancholisch, mal humorvoll, niemals oberflächlich und schon gar nicht bierernst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.“
Karl Valentin
INHALT
Vorwort
I.
Frühjahr oder der Schock
Der Thomas und sein Theorem
Berufung
Spiegelwelten
Die Krise als Büchse und Füllhorn
Klima und Corona
II.
Sommer oder die Atempause.
Die Macht der Gedanken
Radltour mit Folgen
Sommermärchen
Das große Blabla
Der falsche Polizist
III.
Herbst oder die Wiederkehr
Herbstnebel
Das große Grausen
Novembersonne
Die Rache der Nerze
IV.
Winter oder die Eissstarre
Schwermut und Leichtsinn
Kriseln
Das Weihnachtswunder
VORWORT
Früher hat sich der Moser mit seinen Freunden meist im Wirtshaus oder in seinem Garten zum Grillen getroffen. Früher, das war noch vor Corona.
Der Moser hat dabei regelmäßig so viel Bier getrunken, dass er einen leichten bis ordentlichen Suri davongetragen hat, und dabei hat er verbal viel von sich gegeben, meist mehr oder weniger Erwähnenswertes aus dem erweiterten Tagesgeschehen oder aber Dinge, die er irgendwo gelesen und dann nochmal durch die Windungen seines Gehirns gepresst hat – letzteres ein mit Blick auf die Evolution des menschlichen Geistes, der mit der Entwicklung des gesprochenen Wortes und dessen Transformation in Schrift einen gewaltigen Sprung abbekommen hatte, sowie den Verschriftlichungsprozess selbst zirkulärer Akt oder Schritt zurück, mit dem er die Bildung seiner Umwelt vorwärtsbringen wollte. Wobei er durchaus sprunghaft sein konnte.
Wenn der Moser sich also schon vor Corona mit seinen Freunden getroffen und geratscht und Bier getrunken hat und es in dem Buch auch genau darum geht, bloß dass der Moser sich nun am Gartenzaun und mit nur einem Freund trifft, wobei er immer den Abstand von 1 Meter 50 einhält, auf jeden Fall vor dem dritten Bier, weil nach dem dritten Bier kommt es schon mal vor, dass man einen Schritt vor- oder zurückschwankt, was sich dann im Prinzip wieder ausgleicht – wobei der Hinterhofer, der entgegen aller Einwände vom Moser zur Polizei gegangen ist, der würde das wahrscheinlich nicht gelten lassen, aber Polizist wollte der Moser grad auch nicht sein, also noch weniger –, dann könnte man natürlich sagen, dass das Corona nur vorgeschoben ist, weil es halt gerade ein Thema ist, das tatsächlich jeden betrifft und dem man sich auch nicht entziehen kann.
Aber einerseits gilt das ja nicht für die Geschichten vom Moser, denen man sich durchaus entziehen kann, wenn man das Buch einfach aus dem Fenster schmeißt und alle Freunde auf Facebook davor warnt, dass es jetzt etwas gibt, das eine Ausgangssperre noch deutlich verschlimmern kann, so dass sie sich dem von vornherein entziehen. Und andererseits kann man fragen, wer ich eigentlich bin, weil der Moser bin ich nämlich nicht, und als allwissender Erzähler bin ich auch gewissermaßen allmächtig – ich kann beispielsweise ellenlange Sätze schreiben, so dass sich irgendwann keiner mehr auskennt, am wenigsten der Drexler Andi, der ein Spezl vom Moser ist und bei allem, was länger als eine Überschrift ist, immer nur die Überschrift liest. Ich könnte sogar sagen, dass mir das alles ein zündelnder Buchsbaum diktiert hat oder dass das die Tagebücher eines Österreichers sind, was zugegeben ein bisschen deppert wäre.
Ich behaupte aber hiermit, dass es den Moser gibt oder zumindest geben könnte, dass ich mit ihm regelmäßig Bier am Gartenzaun getrunken habe oder dies jederzeit tun würde und alles, was der werte Leser hier liest, tatsächlich so passiert ist oder passieren hätte können. Und obwohl der Moser sich auch vor Corona schon viele Gedanken gemacht hat oder sicherlich hätte, hat das in der Krisenzeit auf jeden Fall zugenommen, weil er wie jeder nicht ins Wirtshaus gehen konnte, und jetzt reden wir von echten Tatsachen. Womit ich in aller Bescheidenheit hoffe, sämtliche Einwände für alle Zeit beiseite gewischt zu haben.
I.
Frühjahr oder der Schock
DER THOMAS
UND SEIN THEOREM
Zwischenmenschlich gesehen war die Corona-Krise vor allem eine Konnektivitätskrise. Wie so viele Leute nutzte auch der Moser freigewordene Zeit in der Krise dazu, zu lesen, und wie so viele Leute nutzte er dazu keine Bücher, sondern das Internet.
Im Grunde mochte der Moser Bücher ja lieber und sein guter Spezl Toni, der Architekt war, meistens aber mit seinem kleinen Segelboot über den Starnberger See schipperte und sich dabei vorstellte, er sei ein Pirat, der hatte, als er mit seinem gar nicht so piratenmäßigen Bauch, der ihm ein ebenso pregnantes wie prägnantes Aussehen verlieh und eindrucksvoll die diätetischen Vorteile von Rum gegenüber Weißbier demonstrierte, zwischen zwei Bücherstapeln steckengeblieben war, mal gesagt, dass eben diese Bücherstapel, die jeden freien Zentimeter füllten, das eigentliche statische Element in dem lustlos vor sich hin dekonstruierenden Heim des Mosers darstellten, das er im Übrigen, und deswegen war er ja eigentlich hier, monetär gar nicht schätzen könne, weil der Abriss und insbesondere die Entsorgung der Bücher den Grundstückspreis bei Weitem übersteigen würden. Ein Weißbier täte er aber noch nehmen.
Allerdings kannte der Moser diese Bücher schon alle, und die, die er vielleicht noch nicht kannte oder deren Inhalt er im Laufe der Zeit wieder vergessen hatte, immerhin war er jetzt auch schon gute 50 plus x, wie er immer sagte, also 60, die steckten fest zwischen den anderen, und rausholen wollte er sie nicht, wegen der Statik. Buchhandlungen und Büchereien waren im ersten Lockdown geschlossen, der Versand von Büchern wiederum stockte infolge der Priorisierung von Klopapier. Und so blieb ihm letztlich nur dieses Internet, um die eingeschränkte zwischenmenschliche Informationsvermittlung zu kompensieren. Was er dann auch recht exzessiv tat, wie so viele Leute.
Auf einem seiner Ausflüge, die oft bei einem Thema begannen und bei einem ganz anderen endeten – beispielsweise hatte er einmal bei den Seeschlachten des Ersten Weltkriegs begonnen und war über Plinius bei der Gewürznelke gelandet – und die ihm beileibe nicht nur zum Zeitvertreib, sondern vor allem als Inspiration für noch viel weiterführende Gedankenspaziergänge dienten, stieß er auf das Thomas-Theorem. Dieses lautete in seiner Quintessenz folgendermaßen: „Wenn die Menschen Situationen als wirklich definieren, sind sie in ihren Konsequenzen wirklich“.
Der Name war nun nicht, wie man vielleicht denken könnte, an den zweifelnden Apostel Thomas angelehnt, der quasi umgekehrt verfahren war, indem er seinen Finger auf die Wunden des Heilands gelegt hat, sondern stammte ganz profan von den beiden Autoren dieser sozialpsychologischen Grundannahme, einem US-amerikanischen Soziologenpaar mit Nachnamen Thomas. Die hatten ihre These am Beispiel eines paranoiden Mörders dargelegt, der Selbstgespräche von Passanten negativ auf sich bezog – eine pathologisch falsche Wahrnehmung der Situation, die seinen Opfern zum Verhängnis wurde und dem Theorem in ihrer Kausalität seine Prägnanz verlieh, schließlich ist der Tod nicht nur die letzte Konsequenz, in der die Wahrnehmung des unmittelbar Betroffenen aus wissenschaftlicher Sicht abrupt endet, sondern auch ein unumstößlicher Fakt und Fingerzeig, der die mittelbar Betroffenen mit einer für alle geltenden Wirklichkeit konfrontiert, nämlich der Endlichkeit des irdischen Daseins.
Der Moser dachte nun, dass die Aussage dieses Theorems einerseits offensichtlich war, weil viele ein und dasselbe ja völlig unterschiedlich sahen und die Leute ständig aneinander vorbeiredeten, was er in Anlehnung an einen Werbespot für Tampons gern mit der Sentenz „Die Geschichte der Kommunikation ist eine Geschichte voller Missverständnisse“ beschrieb, und das alles hatte deutlich wahrnehmbare Konsequenzen – zum Beispiel die, dass er dem Meier ab und an gern eine schmieren wollte, obwohl er ihn eigentlich mochte, womit sein Verhalten, gleichwohl durch Aggressionskontrolle ausgebremst, ganz klar von seiner persönlichen Definition der Situation abhängig war, die darin bestand, dass der Meier ihm mit seiner Demagogie mal wieder tierisch auf die Nerven ging, während der sich auf einem rhetorischen Höhenflug wähnte und deshalb unbeirrt weiterredete. Andererseits war die Erkenntnis jedoch tatsächlich bahnbrechend, weil die meisten, und da konnte der Moser sich selbst nicht ausschließen, die objektive Wahrheit für sich beanspruchten. Wodurch es zu einem klassischen Dilemma kam.
Der Moser schenkte sich ein Helles ein und schnupperte gedankenverloren am Schaum. Lebte etwa jeder in einer eigenen Welt? Und wenn dem wirklich so war, wo waren dann die Grenzen und die Berührungspunkte?
Fest stand, dass jeder die Dinge völlig anders wahrnahm, so dass sich die objektive Realität auf die Wahrnehmung einfacher Formen beschränkte. Nahm man eine Mass Bier als Exempel und Maß aller Dinge, dann konnte man sich sicher noch darauf einigen, dass diese ein zylinderförmiges Gefäß mit einer schlecht eingeschenkten Füllung aus Hopfen und Malz darstellte, die mit Wasser und Hefe zu einem beschwingenden Fluid himmlischen Ursprungs vergoren waren. Bei der Wahrnehmung der Größe des Gefäßes ging es aber schon los mit den Differenzen: Denn während diese Auswärtigen riesig erschien, war sie für den Bajuwaren, dem wiederum ein Kölsch-Glas als unwirklich oder zumindest Schmarrn erschien, da es nur einen Schluck einer Flüssigkeit enthielt, die den Namen Bier eigentlich gar nicht verdiente, auf Volksfesten ein gängiges Behältnis. Der Moser klammerte an dieser Stelle aus, dass die Definition eines Gefäßes dort mitunter um die einer Schlagwaffe erweitert wurde, was einen taktischen und taktilen Aspekt beinhaltete.
Angeregt nahm er einen kräftigen Schluck, stellte den Krug vor sich ab und schaute zu, wie sich die Wogen in seinem Inneren glätteten. Alles begann bei den Sinnen. Die Farbwahrnehmung, das hatte der Moser mal in einem schlauen Magazin gelesen, ging bei jedem schon leicht auseinander, ebenso das Hören und Fühlen, ganz zu schweigen vom Riechen und Schmecken. Bei allen Sinnen gab es individuelle Differenzen. Die Bandbreite der Faktoren reichte von der Filterung über die Intensität bis hin zur Kombination und Bewertung – abhängig von Rezeptoren, Nervensträngen und Gehirnarealen, eine komplexe innere Konnektivität, die wiederum eine Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt schuf und zugleich von Faktoren wie kultureller Prägung und Erinnerungen beeinflusst war – der wahrgenommenen Reize.
Die Schwierigkeit einer objektiven Beurteilung zeigte sich beispielsweise in dem Versuch einer Skalierung von Geruchsintensität in Olf, wobei 1 Olf dem Geruch eines Erwachsenen mit 1,8 m2 Hautfläche entspricht, der 0,7-mal am Tag badet und im Sitzen arbeitet. Diese hatte sich im Alltag nicht durchgesetzt, was der Moser verstehen konnte, denn der Ferdl duschte vielleicht zweimal die Woche und arbeitete als Fliesenleger, womit er an einem sommerlichen Mittwochabend eigentlich einige Olf zusammenbringen hätte müssen, hinzu kam, dass er als Kettenraucher einen Grundolfwert von 25 besaß. Dennoch konnte man nicht sagen, dass er stank. Dies lag zum einen daran, dass er größtenteils aus Muskeln bestand und einen schwarzen Gürtel in Taekwondo besaß. Zum anderen roch er schlicht nicht mehr als der Manni, der täglich duschte und sich dennoch mit jedem Tablett, das er über das Biergartenareal balancierte, olfaktorisch einem überbelegten Löwenkäfig annäherte, was er selber aber nicht roch und was ihm auch keiner sagte, weil der Manni sehr sensibel war.
Noch sehr viel deutlicher machten sich diese Unterschiede bei der gustatorischen Wahrnehmung bemerkbar. Der Moser imaginierte sich hierzu einen einfachen Versuchsaufbau: Würde man einen Wurstsalat bei der Rosi bestellen und in einer Runde herumgeben, so würde dieser zwar von allen eindeutig als Wurstsalat und nicht als Creme brulee erkannt. Die Reaktionen würden jedoch von zu sauer, zu salzig, zu süß und zu bitter bis hin zu perfekt reichen. Er nahm einen weiteren Schluck und ließ sich von der Rezenz am Gaumen zu seinem ursprünglichen Exempel zurückleiten.
Die Trixi mochte überhaupt kein Bier, sondern trank nur Rüscherl, und in der Zeit, in der sie mit dem Toni zusammen war, hatte der auch gesagt, dass ihm das Bier nicht mehr so schmecken würde, wobei er mit dem Moser schon noch welches getrunken hat, wenn die Trixi nicht dabei war, und der Moser hatte damals den Eindruck, dass es ihm durchaus schmeckte, weil sonst hätte er ja spätestens bei der dritten Halbe aufgehört, und letztlich hat die Trixi ihn dann ja auch verlassen.
Damit war man auch schon bei den Geschmäckern, die bekanntlich verschieden waren und über deren Singular sich so trefflich streiten ließ – und die vom Gustos über den Habitus bis hin zum Eros und der Frage Urne oder Sarg das breite Feld menschlicher Vorlieben und Abneigungen absteckten.
Der persönliche Geschmack war unweigerlich mit Assoziationen verbunden, also was der Einzelne mit dem Wort und damit auch mit der Sache Bier verband, denn ein Bier war ein Bier war ein Bier. Für den Moser bedeutete es beispielsweise Genuss, Gemütlichkeit und Rausch – jeder Begriff moserisch gesehen ein evolutionärer Schritt hin zu einem gelungenen Tag, für eine Marathonläuferin wie die Sonja jedoch an sich schon wieder negativ besetzt. Für sie war Bier untrennbar mit Gewichtszunahme, Trägheit und Stumpfsinn verbunden, hinzu kam die sich unterbewusst aufschwemmende Erinnerung an einen Wiesenbesuch vor zehn Jahren, der für sie auf dem Rauschberg geendet hatte, der bei nüchterner Betrachtung halt doch nur ein Kotzhügel war, und seitdem wurde der Sonja schon beim Geruch von Bier speiübel.
Jeder war ein eigener Planet, der durch den leeren Raum schwebte und ab und an auf andere Planeten traf, vielleicht auch eine Weile neben einem solchen her rotierte, oder, um im Bild zu bleiben, die Menschen waren wie die Kohlensäure im Bier, jeder eine Blubberblase, die neben den anderen aufstieg, bis sie an der Oberfläche zerplatzte oder, wenn man es religiös sehen wollte, in Schaum aufging und dann zerplatzte, um in den Himmel aufzusteigen – womit er das Gottesreich jetzt keinesfalls für den Klimawandel verantwortlich machen wollte, da war der Mensch schon selbst schuld und vor allem der Meier, der an sich schon den ökologischen Fußabdruck von hundert Thailändern hatte und dann noch jedes Jahr nach Thailand flog, um nach dem zwölften Chang-Bier in der Strandbar radebrechend denglischend zu beweisen, dass er eine ganz besondere Blubberblase war, was er sonst noch alles da unten machte, das wollte der Moser gar nicht wissen. Er schenkte sich nach und hielt den Krug prüfend gegen das Licht. Jeder eine Blubberblase aus ätherischem Kohlenstoff, die sich auf dem Weg nach oben bisweilen am Glas absetzte, mit anderen vereinigte und wieder trennte.
Der Moser erinnerte sich hier an die Schnittmenge in der Mengenleere, die ihnen der alte Lehrer Weißbauer beigebracht hatte, den er als Schüler ganz gern mochte, weil er manchmal Geschichten von zuhause erzählte. Auch wenn die Geschichten nie gut ausgingen, weil seine Frau darin eine Protagonisten- oder eher Antagonistenrolle spielte – sie muss eine wahrlich furchtbare Frau gewesen sein, zumindest hatte der Weißbauer das für sich als wirklich definiert und trug die Konsequenzen davon –, verlieh ihm das einen menschlichen Nimbus, der den anderen Lehrern in der Regel fehlte. Jedenfalls dachte der Moser kurz an die Kreise, die eine Schnittmenge bildeten, die man dann bunt ausmalte, wobei er die im Fall von der Anni eher schwarz ausmalen würde. Allerdings neigte der Mensch dazu, die Dinge im Rückblick rosarot zu verklären oder schwarzzumalen, und da der Moser mit seinen Gedanken nicht in emotionale Untiefen abdriften wollte, trank er einen Schluck Bier, um das Bild abzurunden.
Am Abend kam der Thomas auf ein Bier an den Gartenzaun. Der Moser hatte das Biergleichnis bis dahin um fünf objektiv wahrnehmbare Flaschen Bier erweitert, die aufgereiht vor ihm standen und den Fortschritt seiner Überlegungen versinnbildlichten.
Der Moser meinte zu ihm, dass er sich ernsthafte Gedanken über das Thomas-Theorem gemacht hätte, worauf der Thomas ihn kurz entsetzt anstarrte und dann gekränkt entgegnete, dass er keine Probleme mit dem Moser hätte, dass er nur deshalb gekommen sei, um mit dem Moser ein Bier zu trinken, und wenn es wegen der Anni wäre, die er ihm damals ausgespannt hätte, das sei jetzt schon fast 30 Jahre her und sie wäre eh eine dumme Matz gewesen. Er könnte eigentlich froh darüber sein, also so im Nachhinein. Der Moser kniff daraufhin die Augen zusammen, weil er wirklich gern mit dem Thomas Bier trank, es ihm aber manchmal körperliche Schmerzen bereitete, also nicht nur im Nachhinein, sondern auch ganz akut, so dass er sich manchmal schon fragte, ob der Thomas nicht ein chronischer Depp wäre. Er entgegnete dann aber, die Anni sei ihm schon lange wurst und außerdem hätte er Theorem und nicht Problem gesagt. Der Thomas meinte nun, dass er auch kein Theorem hätte, das ginge gar nicht, weil er sich jedes Mal einen Pariser überstülpen würde. Der Moser ließ es dabei bewenden und holte noch zwei Bier.
Als er wieder alleine war, dachte er sich, dass der Thomas eindeutig zu viel über Frauen und Sex nachdachte, was wohl daran lag, dass er beides schon lange nicht mehr gehabt hatte. Und dass es irgendwie schon auch bezeichnend war, dass das Theorem von einem Ehepaar aufgestellt worden war. Aber darüber würde er ein anderes Mal sinnieren.
BERUFUNG
Der Moser lebte in dem Haus, das er von seinen Eltern geerbt hatte und das mit ihm alterte, dabei wie er zunehmend Flecken und Risse bekam und von außen betrachtet einen ganz leichten Touch von Verwahrlosung hatte, der noch nicht abstoßend, sondern gerade noch interessant wirkte, weil er zeigte, dass der Bewohner auf Äußerlichkeiten einfach keinen so großen Wert legte, und somit ein Statement darstellte, das der Moser in seinem eigenen Auftreten untermauerte.
Auf die ab und an unausweichliche Frage, was der Moser denn beruflich so mache, hatte er drei Antworten parat, die er je nach Laune und Gegenüber zum Besten gab.
1. Ich bin Trinker. Das Casablanca-Zitat kam bei Cineasten immer gut an, bei allen anderen sorgte es für einen pikierten Abbruch des Gesprächs oder einen abrupten Themenwechsel, was dem Moser eh lieber war. Schließlich machte er eine ganze Menge sinnvoller Dinge, die jedoch größtenteils nicht in die denkbar eng gefassten Schubladen beruflicher Kategorien passten.
2. Ich bin Eigenbrötler. Das kam der Realität tatsächlich sehr nahe, denn in vielerlei Hinsicht buk der Moser seine eigenen Semmeln. Seine Eltern wollten einst, dass der Moser unbedingt studiere, und da der Moser partout nicht studieren wollte, hatte er Assyriologie studiert, was nicht nur seine beruflichen Perspektiven, sondern auch den weiteren Kontakt zu den Eltern ziemlich einschränkte, und der Moser war ihnen wirklich dankbar, dass sie ihm das Haus trotzdem vererbt hatten, denn das zeugte von wahrer Fürsorge oder zumindest Sorge. Nach dem Studium, für das er eine ganze Weile gebraucht hatte, da die Keilschriften sich schwertaten, seine Gehirnwindungen zu passieren, hatte er dies und das gemacht. Faul war der Moser dabei nie gewesen. Er hatte seiner Meinung nach eher zu viel und mitunter das Falsche geschuddelt, weshalb er sich jetzt auf das Wesentliche konzentrierte. Und dazu gehörte neben dem Studium des Lebens, das er selbstständig durch beständiges Nachdenken und im kommunikativen Austausch mit seinen Spezln betrieb, wobei Sprach- und Gedankenfluss durch regen Konsum von Gerstensaft, als dessen Entdecker neben den Sumerern bekanntlich ja auch die Assyrer gelten, angeregt wurden, ein entspannterer oder distanzierterer oder anderer Blick, nennen wir es eine Eigenbrötlerperspektive, auf den Broterwerb.
Faul war der Moser dabei immer noch nicht. So gedieh in seinem Garten jede Menge Obst und Gemüse, das er im Herbst einmachte, einlegte oder einfror. Zudem hielt er sich eine Schar Hühner, die ihn mit Eiern versorgte, von denen er einen Teil an seine Nachbarn verkaufte, was ihm monatlich steuerfreie Einnahmen von 30 Euro 40 bescherte – die 40 Cent gab ihm die alte Messnerin immer als Trinkgeld, weil der Moser ihr die Eier mit dem Radl vorbeibrachte und noch einen Eierlikör mit ihr trank –, wodurch zumindest die monatliche Telefonrechnung schon mal bezahlt war. Da das weder finanziell noch sinnstiftend ausreichte, fertigte er Holzwaren, die er direkt an Interessenten verkaufte, worauf ein altes Holzschild an seinem Gartenzaun hinwies, auf dem in ausgeblichenen roten Lettern stand „Holzkunst zu versaufen“. Ursprünglich hieß es natürlich „verkaufen“, jedoch war das „k“ mit der Zeit verblasst und im letzten Fasching, wahrscheinlich von Jugendlichen oder vom Meier, durch ein blaues „s“ ersetzt worden. Sein Warenangebot bestand aus Vogelhäusern, Insektenhotels und kleinen Kunstwerken, die dem Thomas zufolge einen assyrischen Einschlag hatten, wobei der Moser sich ziemlich sicher war, dass der Thomas keine Ahnung von den Assyrern hatte und diese wahrscheinlich für einen Indiostamm im Amazonas hielt.
Vor allem aber war der Moser bescheiden – bis auf den Bierposten, der sich zum Monatsende regelmäßig ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinen Krankenkassenbeiträgen lieferte, hatte er keine größeren Ausgaben. Womit er eigentlich eher ein Überlebenskünstler war, denn das Wichtigste beim Überleben ist bekanntlich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Diese materielle Bescheidenheit des Moser beruhte auf einer Mischung aus katholischer Prägung – als Kind fand er Heilige wie Augustinus und Franziskus beeindruckender als etwa einen Roy Black oder Rummenigge und es war für ihn völlig unverständlich, dass die Großkopferten die fleißigsten Kirchgänger waren und immer am nächsten zum Altar saßen, wo sie doch von Tugenden wie Demut und Bescheidenheit am weitesten entfernt waren, und wenn ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr ging, dann tat es ein Bentley schon zweimal nicht – und tatsächlicher Armut. Letztere ergab sich aus seinem Unwillen, sich in den warmen Schoß eines Angestelltenverhältnisses zu begeben, sprich einem Freiheitsbedürfnis, das seinen Preis hatte, indem es ihn von einigen sozialen Errungenschaften der Moderne wie bezahlten Urlaubs- und Krankheitstagen ausschloss, deren Preis wiederum in dem lag, was Marx als Selbstentfremdung bezeichnet hatte. Was dazu führte, dass der Moser sich zunehmend gegenüber den anderen entfremdete.