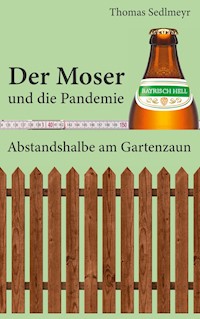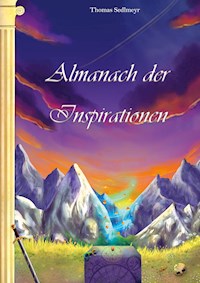
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Almanach der Inspirationen ist der perfekte Begleiter für alle Spielleiter und Fans von Fantasy-Tischrollenspielen. Das Buch beinhaltet zahlreiche Tipps für das Meistern. Eine große Auswahl kniffliger Rätsel, fieser Fallen und magischer Artefakte. Jede Menge Ideen für spannende Abenteuer und Kampagnen. Praktische Listen mit Namen, Eigenschaften, Berufen und Fähigkeiten. Und vieles mehr. Du bist auf der Suche nach Abenteuern? Dieses Spielleiter-Handbuch bietet Anfängern einen guten Einstieg in die Materie und reichlich Materialien und Inspirationen für fortgeschrittene und erfahrene Meister. Dabei ist es auf kein bestimmtes RPG festgelegt. Ob DSA, D&D, Midgard oder Pathfinder: Der Almanach ist prinzipiell für alle Rollenspielsysteme geeignet. Zeit zum Zocken!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
"Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Friedrich von Schiller
"Wir meinen, das Märchen und das Spiel gehöre zur Kindheit: wir Kurzsichtigen! Als ob wir in irgendeinem Lebensalter ohne Märchen und Spiel leben möchten!" Friedrich Nietzsche
"Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden, sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen!" Oliver Wendell Holmes
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Die Kunst des Meisterns
Rollenspielen – was ist das?
Vom Erzählen einer Geschichte
Motivation und Spielfluss
Fehler und Nörgelei
Charaktere
Namen
Eigenschaften
Fähigkeiten
Berufe und Titel
Das Abenteuer
Allgemeines
Das Basteln eines Abenteuers
Kampagne oder Abenteuer
Grundtypen von Abenteuern
Raum und Zeit
Karten
Räumliche Elemente
Unterwegs
Fortbewegungsmittel
Begegnungen
Ereignisse
Entdeckungen
Stimmungselemente
Kämpfe
Gegner
Flucht
Dungeons
Türen
Kleine Türenkunde
Verborgene Türen und Eingänge
Fallen
Dungeon-Fallen
Freiluft-Fallen
Rätsel
Klassische Rätsel und Rätselgedichte
Rätselverse
Geheimnachrichten und vertrackte Karten
Verschlüsselungen
Türrätsel
Situationsrätsel
NSCs und Abenteuervorschläge
Ausrüstung
Bares
Allgemeines
Währungen
Magisches
Waffen
Schutz
Artefakte
Hilfsmittel
Besondere Gegenstände
Tränke
Anhang
Vornamen
Angehängte Beinamen
Orte und Regionen
Charaktereigenschaften
Besondere Fähigkeiten
Übernatürliche Fähigkeiten
Berufe und Tätigkeiten
Räumliche Elemente
Vorwort
Du spielst gerne Rollen? Ich auch! Das Hobby Rollenspielen begleitet mich nun schon fast 30 Jahre durch alle Phasen meines Lebens. Dabei habe ich früh festgestellt, dass ich lieber den Part des Spielleiters übernehme. Der Grund: Es bereitet mir Freude, Geschichten auszudenken und zu erzählen. Außerdem mag ich die ganz unterschiedlichen Herausforderungen, die damit einhergehen: Das kreative Element bei der Erstellung eines Abenteuers, das Ausdenken und Kombinieren. Das kommunikative Element beim Erzählen, das Ausschmücken, den Aufbau von Spannung und Atmosphäre. Und nicht zuletzt das gruppendynamische Element beim wortwörtlichen "Meistern" eines Abenteuers – das Motivieren und Überraschen der Spieler, Abwägen und spontanes Reagieren, die Emotionen.
Dabei kommt man als Spielleiter auch schon mal ins Schwitzen. Manchmal fehlt es an Zeit für das Abenteuerbasteln, manchmal wartet man vergeblich auf die zündende Idee. Manchmal hat man beides, aber das Ausdenken von Namen oder Gegenständen nervt. Dieses Buch soll geplagten Meistern unter die Arme greifen. Seine Zutaten: Ein bisschen Theorie. Reichlich Tipps und Listen mit konkreten Vorschlägen. Und jede Menge Ideen sowie bildhafte Beispiele zur Inspiration. Darüber hinaus ist es hoffentlich eine vergnügliche Lektüre.
Zu den einzelnen Kapiteln: Die Hauptaufgabe des Spielleiters ist das Erzählen. Im ersten Kapitel geht es darum, was eine gute Geschichte und einen gelungenen Spieleabend ausmacht. Hier findest du Tipps rund um das Meistern.
Das zweite Kapitel dreht sich um die Charaktere. Hier findest du Wissenswertes zu Namen, Eigenschaften, Fähigkeiten, Berufen und Titeln.
Kapitel III widmet sich der Erstellung und den typischen Elementen eines Abenteuers. Dazu gehören unter anderem das Reisen, die Gestaltung der Umgebung, Begegnungen und Kämpfe. Hier findest du viele Rätsel und Fallen sowie Rahmenhandlungen für Abenteuer, die von vorgefertigten Nichtspielercharakteren erzählt werden.
Im vierten Kapitel wird die Ausrüstung unter die Lupe genommen. Hier findest du Beispiele für Währungen sowie zahlreiche magische Gegenstände und Tränke.
In Kapitel V (Anhang) wurden einige Listen ausgegliedert. Hier findest du nützliche Listen für die Erstellung deines Abenteuers.
Ich wünsche viel Freude beim Lesen – und möge das Würfelglück mit dir sein!
I. DIE KUNST DES MEISTERNS
"Die meisten Götter würfeln, aber das Schicksal spielt Schach, und zwar mit zwei Damen."
Terry Pratchett
Rollenspielen – was ist das?
Zu Beginn ein paar grundlegende Überlegungen, was Rollenspiel eigentlich ist – und was deine Rolle als Spielleiter aka Meister aka Schicksal ausmacht. Generell gilt: Bei einem Rollenspiel schlüpfen die Spieler in eine andere Rolle. Diese Spielform lässt sich bereits bei Kindern beobachten, man denke nur an "Mutter-Vater-Kind" oder "Räuber und Gendarm". Als pädagogische Methode wird das Rollenspiel in verschiedenen Therapieformen und in der Schule, aber auch im Wirtschaftsleben eingesetzt. Hier geht es vor allem darum, bestimmte Verhaltensmuster zu spiegeln, zu verändern oder zu trainieren. Inwieweit wir alle in unserem Alltag Rollen einnehmen, ist eine andere Frage. Und führt an dieser Stelle zu weit.
Speziell für Pen-&-Paper-Rollenspiele (auch: Tischrollenspiele) gilt: Diese besitzen ein festes Regelwerk. Jeder Spieler wählt eine bestimmte fiktive Rolle (den "Charakter") aus, deren wichtigste Eigenschaften und Fähigkeiten entlang der Regeln ermittelt und auf einem Zettel (dem "Charakterblatt" oder "Heldenzettel") notiert werden. Regeln rahmen auch die Erfolgschance bzw. den Erfolg oder Misserfolg bestimmter Aktionen, indem sie Zahlenwerte zueinander in Relation setzen und mit einem Zufallsfaktor (dem Würfel) verknüpfen. Für einen ersten Einstieg in die Rollenspieltheorie empfiehlt sich der gleichnamige Wikipedia-Artikel, in dem verschiedene Modelle und Spielertypen beschrieben werden.
Die Charaktere der Spieler sind Teil einer Geschichte, die in einer ebenfalls fiktiven Welt spielt. Im Mittelpunkt des Tischrollenspiels steht somit das Erzählen. Und hier kommst du ins Spiel: Als Spielleiter erzählst du die Geschichte. Diese Aufgabe ist mit bestimmten Herausforderungen verbunden: Ein guter Geschichtenerzähler reißt die Zuhörer mit und zieht sie in das Geschehen hinein. Er beschreibt die Dinge anschaulich, beherrscht das Spiel mit der Spannung. Und er hat einen Blick für Details, ohne das Ganze aus dem Auge zu verlieren.
Das Besondere am Rollenspiel ist nun, dass keine starre Geschichte erzählt wird, sondern diese im und durch das Spiel entsteht: Die Spieler steuern ihre Charaktere, die als Protagonisten maßgeblich das Geschehen steuern. Das Geschehen folgt dabei zwar einem Drehbuch (dem "Abenteuer" oder "Plot"), dieses gibt jedoch nur einen groben – und letztlich nicht verbindlichen – Rahmen vor. In dieser fließenden Geschichte erschaffen die Spieler durch ihre Entscheidungen und das Ausspielen ihrer Charaktere viele kleine Geschichten, die deine Rahmenhandlung füllen und mit ihr interagieren (ok, manchmal auch torpedieren). Diese Geschichten sind wiederum abhängig von Begegnungen – also von den Charakteren und fiesen Monstern, die du als Spielleiter ins Spiel bringst und steuerst. Kurzum: Aus dem Zusammenspiel von Spielleiter und Spielern ergibt sich die Geschichte.
Es handelt sich somit um eine interaktive Geschichte, was weitere Herausforderungen für den Spielleiter mit sich bringt. Zusätzlich zu den genannten erzählerischen Fähigkeiten benötigt er ein Gefühl für Situationen und Stimmungen, muss souverän und spontan auf Wendungen im Spiel reagieren können sowie jederzeit den Überblick behalten. Ein guter Spielleiter ist somit nicht nur ein guter Geschichtenerzähler, sondern auch ein guter Moderator.
Fängt man frisch mit dem Spielleiten an, hapert es in der Regel bei dem ein oder anderen Skill. Kein Problem – schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das alles lässt sich üben, in allem kann man sich verbessern. Irgendwann läuft es rund, und wenn es irgendwann mit einer Flasche Met intus läuft, hast du den Olymp der Meisterei erklommen.
Wie gesagt: Rollenspiel ist im Grunde eine interaktive Geschichte. Deshalb gelten für den Spielleiter als zentralem Erzähler alle Kriterien einer mündlichen Erzählung. Keine Angst, das soll jetzt keine trockene Grammatikstunde werden. Ich werde die klassischen Elemente eines guten Erzählstils Schritt für Schritt an rollenspieltauglichen Beispielen erläutern. Im Anschluss daran gebe ich einige Tipps für das Meistern bzw. Rollenspiel und gehe am Ende auf den Umgang mit Fehlern und Nörgelei ein. Routinierte Spielleiter können dieses Kapitel überspringen.
Vom Erzählen einer Geschichte
Ein guter mündlicher Erzählstil ist kein Hexenwerk, sondern das Ergebnis richtig angewandter Techniken und Kniffe. Hinzu kommen einige Besonderheiten, die durch den interaktiven Charakter der Geschichte im Rollenspiel bedingt sind. Ich habe die meiner Erfahrung nach wichtigsten Grundsätze als 9 goldene Regeln für Spielleiter formuliert:
Nutze das Potential der verschiedenen Wortarten.
Setze Stilmittel ein.
Sprich alle Sinneswahrnehmungen an.
Gehe bei Beschreibungen vom Groben ins Detail.
Passe die Ausführlichkeit einer Beschreibung an.
Achte auf innere Logik.
Verwende eine lebendige Ausdrucksweise.
Arbeite mit Spannungsbögen.
Wechsle ab und an die Erzählperspektive.
1. WORTARTEN: Jede Wortart kann dazu beitragen, eine Situation/Umgebung plastisch zu schildern. Deine Erzählung sollte dabei weder zu trocken noch zu überladen sein.
Substantive (Hauptwörter): Hier ist vor allem Abwechslung gefragt. Ein Weg ist immer ein Weg, kann aber – abhängig von seiner Beschaffenheit – als Straße, Gasse, Pfad, Hohlweg, Trampelpfad, Wildwechsel, Steig, Pass etc. tituliert werden.
Verben (Tätigkeitswörter): Natürlich kann man einfach sagen: Da ist ein Weg. Anschaulicher wird es jedoch, wenn die Verben weitere Informationen über die Beschaffenheit des Weges geben. Der Weg schlängelt sich (durch die Felder), windet sich (den Berg empor), läuft schnurgerade (am Fluss entlang), zieht sich endlos (durch die Steppe), führt (in den Wald), verliert sich (in der Ferne), fällt steil ab, steigt steil an, beschreibt eine Kurve, spaltet sich auf etc.
Adjektive (Eigenschaftswörter): Auch die Verwendung von Adjektiven macht eine Beschreibung plastischer und detaillierter: Der Weg kann beispielsweise staubig, matschig, steinig, schmal, breit, abschüssig, steil, ausgetreten oder rutschig sein. Er kann von Karren zerfurcht, vom Regen aufgeweicht, von Bäumen gesäumt, mit bunten Blättern übersät oder mit Schlaglöchern gespickt sein. Alte Eichen können ihren Schatten auf den Weg werfen und knorrige Wurzeln in ihn hineinwachsen.
Adverbien (Umstandswörter): Auch Adverbien geben einer Erzählung Würze. Der Weg endet jäh vor einer Felswand. Die Gäste verlassen hektisch die Taverne. Die Elfen kämpfen tapfer. Oder etwas nähert sich pfeilschnell, verschwindet schlagartig, wirkt seltsam.
2. STILMITTEL: Neben der Wortwahl tragen auch Stilmittel zu einer lebendigen und anschaulichen Erzählung bei. Typische Stilmittel sind beispielsweise Personifikationen ("Der Wind zerrt an euren Mänteln"), Metaphern ("Eine Flut von Orks ergießt sich aus der Höhle") und Vergleiche. Letztere heben vor allem Details hervor: Augen können so tief und klar wie ein Bergsee sein, ein Monster rasiermesserscharfe Zähne zeigen oder der Wirt einen Nacken wie ein Stier haben. Sie eignen sich aber auch hervorragend dazu, Größenverhältnisse zu veranschaulichen: Ein Hund so groß wie ein Kalb, ein Krake mit tellergroßen Augen, ein Krieger mit der Statur eines Bären.
3. SINNESWAHRNEHMUNGEN: Beschreibungen werden lebendig, indem sie verschiedene Bereiche der Wahrnehmung ansprechen. Beschränke dich also nicht auf das Visuelle, sondern gehe möglichst auch auf Geräusche, Gerüche, das Körperempfinden und den Geschmack von etwas ein: Beschreibe den schimmernden Lichtstrahl, der durch die Bäume fällt, das Vibrieren der Fensterscheibe nach einem Donnerschlag. Stille, die nur vom Knistern der Kerze durchbrochen wird. Den fischigen Geruch von abgestandenem Meerwasser, das in den Mulden eines gischtumtosten Felsens steht. Den sauren Geschmack des nordischen Weines. Die Hitze des Lavastroms, die den Helden den Schweiß auf die Stirn treibt. Den Gestank der Pechfackel, der in der Nase beißt. (→ Stimmungselemente)
4. VOM GROBEN INS DETAIL: Das richtige Maß beim Beschreiben liegt irgendwo zwischen Polizeibericht und Karl May. Sicher soll den Spielern nicht alles abgenommen werden – ihre Fantasie tut das Ihrige dazu. Aber zum einen schadet es nicht, die Fantasie anzuregen. Zum anderen agieren die Spieler miteinander und müssen dafür ein zumindest in den Eckpunkten vergleichbares Bild einer Situation haben. Besser man beschreibt eine Situation zu ausführlich, als dass Verwirrung unter den Spielern aufkommt.
Neben dem Maß ist auch die Zielrichtung entscheidend: Gute Beschreibungen gehen in der Regel vom Groben ins Detail. Zunächst ist es wichtig, dass die Spieler den Rahmen einer Situation erfassen: Wie sind die Lichtverhältnisse, wie groß ist ein Raum, was sticht hinsichtlich seiner Beschaffenheit und seines Inventars auf den ersten Blick ins Auge? Falls sich Personen darin befinden: Wie viele sind es ungefähr und was tun sie? Bei ausreichend Zeit und gebührender Aufmerksamkeit fällt noch einiges mehr auf.
Nehmen wir als Beispiel eine Begegnung. Die ersten Informationen betreffen in der Regel das Geschlecht, das grobe Alter, körperliche Auffälligkeiten sowie die Kleidung und Ausrüstung – in der Reihenfolge. Im Folgenden kann die Beschreibung jedoch stark in die Tiefe gehen: Wie ist die Mimik einer Figur und wie verhält sich diese im Gespräch? Spricht sie stockend, hastig, leise, laut? Welchen Eindruck vermittelt sie, wirkt sie verzweifelt, gehetzt, entspannt, gelangweilt, bedrohlich oder freundlich? Befinden sich Blutspritzer an der Kleidung des Gegenübers, riecht sein Atem nach Schnaps, fingert es am Griff seines Dolches herum?
In Ausnahmefällen kann man auch umgekehrt vom Detail ins Grobe gehen – beispielsweise wenn ein Abenteurer von dem Anblick der wunderschönen Prinzessin gebannt ist oder aus der Bewusstlosigkeit erwacht.
5. AUSFÜHRLICHKEIT ANPASSEN: Bei einer Beschreibung kommt es immer darauf an, wie viel du (oder eine von dir gespielte Figur) preisgeben willst. Befindet sich eine Geheimtür in einem Raum, macht es keinen Sinn zu sagen "Ihr befindet euch in einem Raum mit Geheimtür". Du hast hier zwei Möglichkeiten:
Du verschweigst die Geheimtür komplett. In diesem Fall müssen die Helden beispielsweise aus der Karte des Dungeons erschließen, dass es in dem Raum weitergehen muss. Vielleicht ist auch eine von ihnen verfolgte Person plötzlich wie vom Erdboden verschluckt oder sie haben alles abgelaufen, aber das, wonach sie suchen, noch nicht gefunden.
Du gibst (direkt bei der Beschreibung oder auf Nachfragen der Spieler hin) mehr oder weniger subtile Hinweise: "Ihr kommt in einen Raum, das Verlies scheint hier zu enden." "Der Raum ist leer, aber irgendetwas kommt euch komisch vor." "Eine Stelle der Wand ist heller als der Rest." "Die Blutspur endet an einer Wand." "An einer Stelle macht die Mauer einen leichten Bauch." "Der Waldläufer spürt einen leichten Luftzug."
Genauso ist es bei der Beschreibung von Figuren im Spiel. Kein NSC trägt ein Schild auf der Stirn, auf dem "Magier, mächtig, böse" steht. Die Beschreibung richtet sich danach, ob der Magier seine Profession nach außen hin zeigen will und wie genau die Spieler ihn mustern.
6. INNERE LOGIK: Du solltest immer darauf achten, dass deine Erzählung Hand und Fuß hat. Stellst du dir die Frage nicht, werden die Spieler sie dir stellen: Warum ist das so? Manche Spieler sind geradezu versessen darauf, dem Spielleiter Unstimmigkeiten nachzuweisen. Fehler passieren – auch (und angesichts seiner kognitiven Beanspruchung gerade) dem allmächtigen Meister. Man kann sie jedoch auf ein Minimum reduzieren, indem man das Abenteuer vorher im Kopf durchspielt.
Die innere Logik (beziehungsweise Kausalität) kann zudem viel zur Lebendigkeit der Welt beitragen – beispielsweise, wenn sich den Helden durch Beobachtung Dinge erschließen, hinter denen sich Geschichten verbergen. Ein konkretes Beispiel:
Die Gruppe marschiert seit Tagen den Fluss entlang. Um ein Haar hätte sie die kleine Taverne übersehen, die sich unweit des Ufers zwischen zwei alte Erlen schmiegt. Sie ist fast vollständig aus übereinandergestapelten Fässern gebaut, über der Tür hängt ein Schild "Zur dicken Luzi". Im Innern ist es schummrig. An drei Tischen aus Fassdeckeln sitzen einige Fallensteller und Flößer vor ihren Krügen. Der Wirt ist ein kleiner, aber kräftiger Mann mit Halbglatze. Seine wachen Augen mustern die Neuankömmlinge, während er seinen mächtigen Schnurrbart zwirbelt.
Fragen die Helden ihn, warum die Taverne aus Fässern gebaut ist, erzählt er – sofern es sich bei der Gruppe nicht um Halbdämonen, blutverschmierte Barbaren mit Halsketten aus Elfenohren oder irre dreinblickende Magier in schwarzen Roben handelt – die Geschichte hinter dieser Bewandtnis:
"Nun ja, bis vor drei Jahren war ich noch Flößer. Mein Floß war sogar eins der größten auf dem Fluss, würde ich sagen. Eines Tages kam ein Händler mit einem dicken Auftrag zu mir: 100 Fässer Wein und Bier sollte ich von Kerwingen nach Pollstadt bringen. Mein Floß war zwar eines der größten, aber mit 60 Fässern voll beladen. Also meinte ich zu ihm "Kein Problem, zwei Fuhren und die Sache ist erledigt". Aber zwei Fuhren wollte der Giersack nicht zahlen – wenn es nicht in einer ginge, dann würde er sich eben einen anderen suchen. Ich war damals knapp bei Kasse, und obwohl ich ein ungutes Gefühl hatte, hab ich irgendwann zähneknirschend zugestimmt. Das Floß hättet ihr sehen sollen! Die Fässer türmten sich haushoch und schon beim Ablegen wäre ich fast gekentert. Doch ich habe es noch einige Meilen flussabwärts geschafft. Ich war sogar schon kurz davor zu glauben, ich würde es ganz schaffen, da hat es mich in einer Kurve zerlegt – zack, voll gegen die Böschung, das Floß bricht auseinander und die ganze Ladung geht holterdipolter über Bord. Ein Wunder, dass ich das überlebt habe! Also ich hock pitschnass und geschockt am Ufer und denk mir "Schöne Scheiße!" Doch was passiert: Die ganzen Fässer und Floßteile sammeln sich an einem Baumstamm, der da quer im Wasser liegt. Ich hab ein Fass nach dem anderen aus dem Wasser gezogen und hierher gerollt. Stück für Stück. Das erste Fass Kerwinger Südhang habe ich bei einem Fallensteller gegen Werkzeug getauscht. Und aus allen anderen diese Taverne gebaut – Getränke inklusive!"
Haken die Helden nach, ob denn der Händler das so auf sich sitzen gelassen hat, zeigt der Wirt auf eine nagelbeschlagene Keule hinter der Theke: "Ein paarmal hat er Söldner geschickt. Aber für solche Fälle habe ich meine dicke Luzi. Die Fässer sind die gerechte Entschädigung für mein Floß – und wer was Anderes behauptet, der bekommt es mit meiner Luzi zu tun!"
Soweit ein recht ausführliches Beispiel. In der Regel ist die innere Logik der Erzählung einfacher gestrickt und fügt sich ohne viel Worte zusammen: Links und rechts liegen frisch gefällte Bäume im Wald. Eine Weile später treffen die Helden auf einige Holzfäller, die gerade Pause machen. Ein Mann tritt aus der Menge. Das ist der Anführer. Die Gruppe hat von einem Dorf gehört, das sich den Eindringlingen widersetzt. Von einem Hügel aus blickt sie in ein Tal mit drei Dörfern hinab – das besagte Dorf ist wohl das mit der halbfertigen Palisade.
Für Spieler ist es immer toll, Zusammenhänge oder "Alltagsrätsel" selbst zu erschließen.
7. LEBENDIGE AUSDRUCKSWEISE: Es kann viel zur Stimmung beitragen, die Stimme der Situation anzupassen. Du kannst mit der Lautstärke, der Sprechgeschwindigkeit sowie mit den Höhen und Tiefen der Stimme spielen. Leiserwerden erhöht die Spannung, plötzliche Lautstärke die Dramatik. Verwende bei deinen Nichtspielercharakteren (NSCs) die direkte Rede und lasse sie flüstern, stammeln, rufen, betteln, drohen oder betören. Setze bei Schilderungen oder in Dialogen bewusst Pausen ein.
Des Weiteren kannst du deine Erzählung ab und an durch Mimik und Gestik untermalen: Mache eine ausladende Armbewegung, um die Weite der Steppe zu beschreiben, veranschauliche die Größe von Dingen mit deinen Händen. Der Held hat den Barbarenkrieger in seinem jugendlichen Leichtsinn verspottet oder möchte in voller Platte auf einen Baum klettern? Ein Blick sagt oft mehr als tausend Worte.
8. SPANNUNGSBÖGEN: Es ist äußerst effektvoll, Dinge plötzlich und unerwartet passieren zu lassen. Allerdings solltest du diesen Effekt sparsam einsetzen, da er sonst an Wirksamkeit verliert. In der Regel macht es Sinn, einen Spannungsbogen langsam aufzubauen. Dies gilt sowohl für die Geschichte als solches als auch für einzelne Situationen: Dem Showdown eines Abenteuers geht das Suchen und Sammeln von Informationen oder Gegenständen voraus. Ebenso kann ein Gespräch allmählich aus dem Ruder laufen, ein rätselhafter Fluch schleichend Wirkung zeigen oder eine brisante Lage sich stufenweise verschärfen. Wenn sich eine Situation zuspitzt, steigt die Spannung. Du kannst Spannung aufbauen oder halten, sie (scheinbar oder tatsächlich) lösen und durch überraschende Wendungen steigern.
9. ERZÄHLPERSPEKTIVE: In der Regel erzählst du, was die Gruppe sieht. Deutlich unter die Haut kann es gehen, wenn du ab und an ihr Innenleben schilderst. Einige Beispielsätze: "Als der Drache seine Schwingen spreizt, werdet ihr von Panik ergriffen – eure Mägen krampfen sich zusammen, kalter Schweiß tritt euch auf die Stirn, und das Einzige, woran ihr denken könnt, ist Flucht." "Majestätisch breitet sich der Ozean vor euch aus. Ihr lasst euren Blick über das endlose Blau schweifen, lauscht dem Rauschen der Wellen und vergesst für einen kurzen Moment all die Mühsal, die vor und hinter euch liegt." "Unbarmherzig brennt die Sonne auf euch herab. Eure Augen sind verkrustet, eure Zungen kleben geschwollen am Gaumen. Und bei jedem Schritt jagt eine Welle des Schmerzes durch euren Körper. Eure Gedanken kreisen einzig und allein um Wasser – kaltes, klares Wasser."
Darüber hinaus solltest du regelmäßig speziell auf die Wahrnehmung, das Empfinden oder die Geschichte einzelner Charaktere eingehen. Ein solcher Wechsel der Erzählperspektive bereichert das Spiel auf vielfältige Weise: Er kann eine Situation lebensnaher und unmittelbarer erscheinen lassen. Er hebt einen Charakter kurz hervor, steigert dabei das Erleben des betroffenen Spielers und gibt ihm Impulse für sein Rollenspiel. Und er kann zum Abenteuer beitragen. Ein paar klassische Beispiele für subjektive Erfahrungen:
Höhlenkoller. Die Helden kämpfen sich seit Tagen durch einen endlosen Dungeon. Den Gefährten fällt auf, dass der Waldläufer immer schweigsamer wird. Ihm schilderst du die Situation folgendermaßen: "Du spürst einen Druck auf deiner Brust und das Atmen fällt dir schwer. Die Enge macht dir zunehmend zu schaffen – es ist, als würden sich die Wände auf dich zubewegen."
Liebeszauber. Nachdem der Dieb den lieblichen Wein der dubiosen Näherin Tara getrunken hat, ist er hin und weg von ihr. Das kannst du ihm beispielsweise so beschreiben: "Du hast noch nie eine so wunderschöne Frau gesehen. Es ist aber nicht nur ihre Schönheit, die dich anzieht – sie ist deine Seelenverwandte, die eine, auf die du dein ganzes Leben lang gewartet hast." Den Rest muss der Spieler ausspielen. Seinen Gefährten wird schnell klar, dass der Wein mit einem Liebestrank versetzt war. Sie teilen dies dem Dieb mit und reden beschwörend auf ihn ein. Ein guter Spieler lässt seinen Charakter angemessen reagieren. Tut er es nicht oder blickt dich fragend an, kannst du ihm die Situation nochmals verdeutlichen: "In deinem Kopf überschlagen sich die Gedanken. Was ist los, warum reden die anderen so schlecht über Tara? Sind sie nur neidisch – oder hat etwas Besitz von ihrem Geist ergriffen? Am Ende wollen sie ihr Böses, du musst sie beschützen!"
Backflash. Die Gruppe betritt das Heiligtum eines verfluchten Tempels. Du beschreibst zunächst den Raum: "Der Raum ist ungefähr 4 auf 4 m groß. In den Ecken stehen Kohlekessel, in deren spärlichem Licht verzerrte Fratzen wabern, die aus den Wänden gehauen sind. In der Mitte steht ein hüfthoher Opferstein aus Obsidian, dessen Seiten von einem Geflecht aus getrockneten Blutspuren überzogen sind."
Dann wendest du dich an den Priester in der Gruppe: "Du bist wie erstarrt. In deinem Inneren laufen in rascher Abfolge Bilder ab: Du siehst dich als Kind, deine Eltern, sie werden zu diesem Stein gezerrt. Deine Mutter schreit, bettelt und fleht, doch sie reißen sie von deinem Vater fort. Dann drücken muskulöse Arme ihn nach unten und ein Mann in einer schwarzen Kutte hebt ein Messer –"
Ahnung. Die Abenteurer nähern sich einer Ruine, als die Elfenmagierin plötzlich die Hand hebt und stehenbleibt. "Am Anfang ist es nur ein leichtes Prickeln an deinen Haarwurzeln, dann fangen deine Muskeln Feuer und du hörst das Blut in deinen Ohren rauschen. Du spürst die Anwesenheit von etwas Bösem, ein dunkles Wesen von großer Macht. Es ist der alte Feind, den dein Volk seit Anbeginn der Zeiten bekämpft. Jede Faser deines Körpers ist bis zum Zerreißen angespannt." Spieler: "Was ist es? Was ist es, das ich spüre?" Bedeutungsschwer: "Ein Dämon."
Weitere Einsatzmöglichkeiten: Seit Stunden grübeln die Helden über einem Rätsel. Sie wollen schon aufgeben, da hat der Magier einen Geistesblitz: Gab es nicht in einer Passage der Chroniken von Harm ein ähnliches Rätsel? Er erinnert sich zwar nur an einen einzelnen Lösungsschritt, der entsprechende Hinweis bringt jedoch neuen Schwung in die Rätselrunde. Der Perspektivwechsel bietet sich somit auch an, wenn die Gruppe feststeckt oder du eine Information vergessen hast.
Auch wenn sich ein Charakter zu weit von seiner Rolle entfernt, kannst du ihm mithilfe des Perspektivwechsels einen dezenten Hinweis geben: "Paladin. Dich stößt der Plan ab, die Gräber zu plündern. Das widerspricht nicht nur deinen Ordensregeln, die dir über zehn Jahre täglich eingetrichtert wurden – es könnte auch den Zorn der Götter wecken."
Wie man ein Abenteuer konkret erzählt, ist also einerseits von der Situation abhängig. Was beschreibt man von Anfang an detailliert, was erst, nachdem die Helden nachgefragt haben? Und es ist natürlich eine Sache des persönlichen Stils. Auch knappe, trockene Beschreibungen haben ihren Reiz und können fesselnd sein. Die spontane Ausrichtung der Sprache an der Atmosphäre (der Gefühlslage der Charaktere, der Landschaft etc.) ist die Königsklasse. In der Regel fährt man jedoch gut mit einem detaillierten und leicht ausschweifenden Erzählstil.
Ging es bisher vor allem um die Sprache, kommen wir nun zu ein paar allgemeinen Aspekten, die dazu beitragen können, Rollenspiel auf Dauer reizvoll zu gestalten.
Motivation und Spielfluss
Ein guter Erzählstil ist eine Sache, die interaktive Geschichte am Laufen zu halten eine andere. Im Lauf der Jahre habe ich mehr und weniger gelungene Spielabende erlebt. Den Unterschied machen meiner Erfahrung nach häufig die folgenden Punkte:
BALANCE ZWISCHEN STRUKTUR UND SPONTANITÄT: Ein grundlegender Fehler ist aus meiner Sicht eine zu starre Fixierung auf die Aufzeichnungen. Aber auch das Gegenteil ist nachteilig. Ich hole kurz etwas aus: Der Spielleiter, auch Meister, Schicksal oder dreckiger Bastard genannt, befindet sich immer auf einer Gratwanderung zwischen dem Erzählen und dem Gestalten einer Geschichte. Agiert er zu flexibel, können die Spieler die Folgen ihres Tuns nicht mehr ausreichend einschätzen. Es entsteht ein Mangel hinsichtlich der Verlässlichkeit von Aussagen (darunter fallen auch die Umrisse der Charaktere, ihre Stärken und Schwächen) und der Eindruck von Willkür. Agiert er hingegen zu starr, wird der Spielfluss ständig ausgebremst. Charaktere können sich nicht frei entwickeln und spontan agieren. Es entsteht ein Mangel hinsichtlich der Entscheidungsfreiheit und der Eindruck von Kalkulierbarkeit.
Beides läuft eigentlich auf dasselbe hinaus: Die Spieler haben nicht das Gefühl, ihre Geschicke selbst in der Hand zu haben. Ein guter Spielleiter findet deshalb eine Balance. Er hält sich überwiegend an seine Aufzeichnungen und das Regelwerk, zögert jedoch nicht, auf spontane Entwicklungen einzugehen und vom Plot/System abzuweichen, wenn es der Geschichte dient. Dies ist nicht einfach und erfordert einige Übung. Aber es lohnt sich.
SPIELFLUSS: Der Spielfluss ist entscheidend für die Atmosphäre. Bei längeren Pausen fallen die Spieler aus ihrer Rolle und aus Langeweile entsteht Unruhe. Konkret: Während der Spielleiter verzweifelt nach der Modifikation für Höhenunterschiede blättert, verlieren sich die Spieler in den Tiefen des Alltags. Und vom nächsten Termin für die Grillparty oder der heißen Kollegin ist es ein weiter Weg zurück in den Dungeon.
Deshalb gilt: Besser selbst einen Wurf/Wert festlegen, als zehn Minuten nachschlagen. Mit der Zeit speichert man nicht nur Seitenzahlen und diverse Werte, man entwickelt auch ein feines Gespür dafür, wann welche Probewürfe/Modifikationen angebracht sind.
STÖRFAKTOREN VERBANNEN: In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, störende Einflüsse möglichst vom Spieltisch fernzuhalten. Darunter fallen heutzutage vor allem Smartphones (zückt ein Spieler gar einen iPod, würde ich seinen Charakter sofort von Sirenen zerreißen lassen). Spieler, die ständig in WhatsApp abhängen, sind nicht bei der Sache und lenken auch die anderen ab. Dies sollte frühzeitig angesprochen werden. Im Grunde geht es dabei um Respekt: Alle Teilnehmer der Runde haben sich für das gemeinsame Spiel Zeit genommen und der Spielleiter obendrein viel Mühe in die Vorbereitung gesteckt. Jetzt geht es darum, das Beste daraus zu machen.
MODERATION: Der Spielleiter ist Moderator. Dies ist eine manchmal undankbare und immer anspruchsvolle Aufgabe, die jedoch auch sehr erfüllend sein kann. Beispiele für schlechte Moderatoren finden sich zuhauf im Fernsehen. Was macht einen guten Moderator aus? Zunächst hält er sich selbst im Hintergrund. Es geht nicht um ihn, es geht um die "Gäste", in unserem Fall die Spieler. Gleichzeitig muss das Format gewahrt bleiben und eine gute "Sendung" entstehen, in unserem Fall die Geschichte, das Abenteuer.
Wichtig ist zudem ein Gespür für das Miteinander. In der Regel spiegeln sich die Spieler- und die Heldengruppe. Schüchterne, zurückhaltende Spieler spielen eher stille Charaktere, aufgeweckte Spieler eher aktive. Kurz gesagt: Ist ein Spieler intro-/extrovertiert, ist dies (meist) auch sein Charakter. Dies ist an sich kein Problem. Wie in der Realität machen gerade unterschiedliche Charaktere den Reiz aus. Ein Problem entsteht – wie in jeder (Gruppen-)Kommunikation – dann, wenn "laute" Spieler die "leisen" deckeln. Manche Menschen sind zu höflich oder haben schlicht keine Lust, andere zu unterbrechen, geschweige denn sich akustisch gegen sie durchzusetzen. So kommt es zu (oft gravierend) unterschiedlichen Gesprächsanteilen.
Der Moderator versucht, diese im Ansatz zu nivellieren. Dabei sollte man seine Ziele nicht zu hoch stecken: Absolute Parität ist nicht möglich und auch nicht gewollt. Was der Spielleiter jedoch tun sollte, ist zu verhindern, dass nur ein Teil der Gruppe redet und der andere Teil schweigt. Dies kann er tun, indem er einzelne Spieler anspricht und fordert/fördert. Gleichzeitig ist es manchmal notwendig, allzu engagierte Spieler leicht auszubremsen.
DEZENTES LENKEN: Gesprächsanteile sind das eine. Gleichzeitig achtet ein Moderator darauf, dass die Gäste nicht zu weit vom Thema abweichen. Dabei geht er möglichst dezent vor: Er zwingt seine Gäste nicht, er schubst sie sanft zurück zum Kern des Gesprächs. Dies gilt auch für den Spielleiter. Wie bereits erwähnt, solltest du deinen Plot nicht zu starr verfolgen – kleine Abweichungen und Umwege sind durchaus ok. Manchmal verbringen Helden einen ganzen Spieleabend auf dem Markt, manchmal ignorieren sie jeglichen Nebenquest und preschen vor zum Endgegner. Weichen die Spieler jedoch allzu sehr vom eigentlichen Handlungsstrang ab oder ignorieren diesen komplett, musst du einschreiten. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie wieder auf Linie zu bringen.
Ein paar Beispiele: NSCs können zusätzliche Hinweise geben, den Weg weisen oder eine Belohnung in Aussicht stellen. Falsche Wege können durch Monster oder natürliche Hindernisse wie Schluchten, Flüsse, Erdrutsche, Lawinen und Überschwemmungen blockiert werden. Die Flucht vor einer feindlichen Übermacht kann Helden in die richtige Richtung treiben. Wie oben (→ Erzählperspektive) gezeigt, kann auch das Eingehen auf einzelne Charaktere zum Abenteuer beitragen. Motiviert man einen Charakter (z.B. mittels seiner Geschichte, Gesinnung oder Eigenschaften) für ein bestimmtes Ziel, zieht er den Rest der Gruppe in der Regel mit.
SPANNENDE CHARAKTERE: Apropos unterschiedliche Charaktere: Manche Spielergruppen bevorzugen Abenteuer à la Hack & Slay. Und es mag durchaus auch seinen Reiz haben, sich in Diablo-Manier durch Dungeons zu metzeln und magische Gegenstände einzusacken. Anderen ist das zu wenig. Ihnen geht es vor allem um das, was im Begriff "Rollenspiel" steckt: Um ein möglichst gutes Ausspielen der Rolle.
Hier wie dort neigen einige Spieler (sogenannte "Powergamer") dazu, dieses "gut" ausschließlich auf die Werte ihres Charakters zu beziehen. An sich kein Problem. Es ist völlig legitim, wenn Spieler die Möglichkeiten des Regelwerkes ausschöpfen, um einen möglichst mächtigen Helden zu kreieren. Es führt allerdings oft zu starren Stereotypen. Sehr viel interessanter sind komplexe Charaktere, die sich entwickeln.
Doch wie kann man als Spielleiter auf die Komplexität der Charaktere Einfluss nehmen? Nun, Spieler finden die Schwächen im System. Und der Spielleiter findet die Schwächen bei den Charakteren. Das heißt nicht, dass er sich darauf versteifen sollte – in erster Linie geht es darum, dass jeder Charakter seine speziellen Stärken einbringen kann und die Gruppe dadurch vorankommt. Unfehlbare Superhelden jedoch machen das Spiel auf Dauer langweilig und flach. Ein guter Spieler achtet deshalb von sich aus darauf, dass sein Charakter Ecken und Kanten hat. In manchen Regelsystemen können Schwächen wie bestimmte Ängste, Laster etc. (→ Eigenschaften) auch ausgewürfelt werden.
Gleichzeitig wohnen jeder Charakterklasse a priori bestimmte Schwächen inne: So bewegt sich ein Waldläufer in einer Großstadt unsicherer als im Wald, beim Anrennen eines Magiers gegen eine Tür bricht dessen Schulter vor dem Schloss und Zwerge stellen sich beim Weitsprung ungefähr so geschickt an wie Barbaren beim Gesellschaftstanz. Der Spielleiter sollte darauf achten, dass diese Schwächen auch ausgespielt werden bzw. zum Zuge kommen. Hierfür steht ihm (wie auch für die speziellen Stärken eines Charakters) das Instrument der Würfelprobe zur Verfügung – die von ihm jederzeit nach seinem Ermessen modifiziert werden kann.
DURCHSETZUNGSVERMÖGEN: Um noch einmal auf die Schwächen des Systems einzugehen: Jedes System hat Lücken und Schlupflöcher, dies liegt in der Natur der Sache. Als Spielleiter bist du jedoch nicht verpflichtet, diese einfach zu akzeptieren. Ein Regelbuch ist eben kein Dogma, auf das die Spieler in jedem Fall pochen können. Es ist lediglich eine Anleitung. Und als solche weist sie unklare, lückenhafte, missverständliche oder sogar falsche Formulierungen auf – nicht umsonst erscheinen von den meisten Regelwerken immer wieder neue Editionen. Tauchen offensichtliche Schwachpunkte auf, können (und müssen) diese korrigiert werden. Den Maßstab liefern hierbei Vernunft und Praktikabilität.
Allgemein gilt: Die Autorität des Spielleiters steht im Zweifelsfall immer über dem Regelwerk. Und die Autorität des Spielleiters ist in der Regel nicht infrage zu stellen (→ Fehler und Nörgelei). Dies gilt nicht nur für Regelstreitereien. Wer sich aufgrund des Lamentierens von Spielern auf einen Handel wie "Ok, es sind doch nur sieben Orks" oder "Nun gut, in der Truhe sind 7.000 statt 5.000 Goldmünzen" einlässt, der verankert das Element des Schacherns über kurz oder lang im Spiel. Durchsetzungsvermögen ist auch im Hinblick auf Störfaktoren und im Rahmen der Moderation vonnöten.
ERFAHRUNG UND SCHÄTZE: Was zaubert ein Leuchten in Spieleraugen? Richtig, Gold und magische Gegenstände. Will man sich dieses Leuchten als Spielleiter erhalten, sollte man mit Schätzen allerdings gut haushalten. Es ist wie im richtigen Leben: Hat man von etwas (zu) viel, verliert es an Reiz und Bedeutung. Beim Stufenaufstieg bzw. der Steigerung von Werten ist es ähnlich. Meiner Meinung nach ist es um einiges reizvoller, wenn Charaktere langsam besser werden. Dies gibt ihnen zum einen Zeit, sich zu entwickeln – steigt ein Held innerhalb von vier Abenteuern auf Stufe 10 auf, gleicht diese Entwicklung eher einer Virusinfektion als einem menschlichen Werdegang. Zum anderen bieten gerade die niedrigen Stufen die Möglichkeit für gutes Rollenspiel.
Allerdings sollte man auch nicht zu knausrig sein. Erfahrungspunkte, Schätze und magischer Krimskrams dienen in erster Linie als Motivation und Belohnung für die Spieler. Gleichzeitig erweitern sie die Möglichkeiten der Charaktere im Spiel. Setzt man sie sinnvoll und in der richtigen Dosierung ein, kann man diese Funktionen optimal nutzen. Bei Systemen mit dem klassischen Stufenprinzip empfehle ich als groben Richtwert einen Aufstieg nach zwei bis drei, auf den höheren Stufen vier Abenteuern.
MORALISCHE SITUATIONEN: Klar, eine Fantasywelt besteht in der Regel aus Gut und Böse. Eine gute Story bricht allerdings ab und an mit dieser Vereinfachung, stellt sie infrage und bringt Grautöne hinein. Scheue dich deshalb nicht, die Gruppe vor schwierige moralische Entscheidungen zu stellen. Richtig interessant wird es dann, wenn sich die Charaktere untereinander uneins sind – aus solchen Situationen erwächst oft das beste Rollenspiel. Einige Beispiele für moralisch herausfordernde Situationen:
Witwen und Waisen. Die Gruppe hat einen Übeltäter gefangen und an die Stadt ausgeliefert. Sie bekommen ihre Belohnung direkt nach der Hinrichtung. Als sie abziehen, kommen sie an einer weinenden (oder sie hysterisch beschimpfenden) Frau mit zwei traumatisierten Kindern vorbei – der Familie des Hingerichteten.
Alternativ: Die Helden werden Zeugen einer Hinrichtung auf dem Marktplatz. Als sie die Stadt verlassen, folgt ihnen ein kleines Mädchen mit struppigen Haaren. Die Kleine trägt nichts als Lumpen am ausgemergelten Leib und Tränen haben Spuren durch die Dreckschicht in ihrem Gesicht gezogen. Gewinnen die Helden ihr Vertrauen oder forschen nach, bringen sie in Erfahrung, dass sie die Tochter des/der Hingerichteten ist. Mit großen Augen blickt die Waise sie an. Wie werden sie reagieren?
Mediation. In einer abgelegenen Region von Nurwad steht der seit langem schwelende Konflikt zwischen Holzfällern und Waldelfen kurz vor der Eskalation: Die Elfen sind nicht bereit, eine weitere Abholzung des Silberwaldes hinzunehmen. Auf der einen Seite steht die Bewahrung des Waldes, uralte Heimat der Elfen und Lebensraum für zahlreiche Tiere und mystische Kreaturen. Auf der anderen Seite die Existenz der Holzfäller, die ihre Familien ernähren und Abgaben an den Grafen leisten müssen. Auf beiden Seiten gibt es radikale und gemäßigte Stimmen. Werden die Helden für eine Seite Partei ergreifen? Oder gibt es einen anderen Weg, den Konflikt zu beenden?
Zwiespältige Schurken. Die Helden haben den Räuber Glanis Rotbart gestellt, auf den ein beachtliches Kopfgeld ausgesetzt ist. Seine Bande bietet ein erbärmliches Bild: Der alte Piet Klumpfuß geht auf Krücken, Tara Goldhaar ist schwer von der Syphilis gezeichnet und der pockennarbige Luka hat noch keine 14 Winter gesehen. Beide Parteien haben ihre Waffen gezogen. Bevor es zum Kampf kommt, hält Glanis eine anklagende (und in Teilen sicher auch beleidigende) Ansprache, in der er die Not schildert, die ihn und seine Bande zu ihren Taten zwingt. Mögliche Motive sind Armut, Ausbeutung, Ausgrenzung, Verlust von Hab und Gut, Unterstützung von Witwen und Waisen, Rebellion etc.
Gold oder Leben. Die Gruppe befindet sich in einem großen Raum, in dessen Boden einige tiefe Löcher klaffen. Dagur der Dieb hat eben einen fußballgroßen Goldklumpen gefunden und hebt ihn ächzend auf. In diesem Moment schießt eine Klaue aus einem Loch und packt den Gefährten neben ihm. Keine Zeit, den dicken Goldklumpen abzulegen und die Waffe zu ziehen – wenn er nicht sofort handelt, wird der Gefährte in das Loch gerissen. Eine Möglichkeit wäre, den Goldklumpen in das Loch zu werfen, vielleicht ließe das Monster bei einem glücklichen Kopftreffer von seinem unglückseligen Opfer ab. Aber – es ist GOLD! Und hat der Gefährte ihn nicht letztens ganz wüst beschimpft???
DILEMMA: Manchmal gibt es nur die Wahl zwischen zwei schlechten Entscheidungen – das klassische Dilemma, auch Zwickmühle genannt. Eine solche Situation kann das Rollenspiel ebenfalls sehr bereichern: Zum einen herrscht ein hoher Entscheidungsdruck, unter dem sich die Gruppe einigen muss. Zum anderen bestehen sehr wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten darüber, welches Übel das kleinere ist, welches Opfer man bringen muss oder wie und auf welchen Schultern negative Folgen zu verteilen sind.
Ein Dilemma kann aber auch bei positiven Möglichkeiten entstehen, wie sich an dem mittelalterlichen Gleichnis von "Buridans Esel" zeigt. Die Kurzfassung: Ein Esel steht vor zwei völlig identischen und gleich weit entfernten Heuhaufen – für welchen wird er sich entscheiden? Dahinter steckt eigentlich eine philosophische Frage: Ist der Wille in der Lage, sich bei zwei völlig identischen Alternativen für eine zu entscheiden? Einige mittelalterliche Philosophen verneinten dies. Im Falle des Esels bedeutet dies, dass er verhungert, weil er sich nicht zwischen den beiden Heuhaufen entscheiden kann.
Bei einer Heldengruppe wird es sicherlich nicht so weit kommen. Aber es kann durchaus spannend und vergnüglich sein, sie bei Schätzen vor eine schwierige Wahl zu stellen. Man stelle sich zwei mächtige magische Waffen vor, zwischen denen sie sich entscheiden müssen. Zwei hilfreiche NSCs, von denen ein jeder sie begleiten würde, die sich aber auf den Tod hassen. Oder einen beachtlichen Haufen Gold neben dem Reliktstein, den sie zur Rettung des Dorfes benötigen – beides können sie nicht tragen, allerdings ist das Gewölbe gerade am Einstürzen.
NEUE WELTEN: Oft schleicht sich irgendwann eine gewisse Müdigkeit in eine Spielrunde ein. Eine Möglichkeit, dem zu begegnen: Auf in neue Welten! In der Regel wird einem Pen-&-Paper-System eine Welt "mitgeliefert". Man kann das Regelsystem aber auch für andere Welten nutzen. Wieso nicht in einer antiken Welt spielen, in der die Spieler auf mythische Götter und Helden treffen? Die Abenteuer der Argonauten nachspielen, Troja retten, vor dem Zorn des Zeus fliehen, Zentauren und Nymphen begegnen? Oder eine frühmittelalterliche Welt erkunden, die zerrissen ist zwischen dem Glauben an die alten nordischen Götter und dem erblühenden Christentum? Auf diese Weise wird Geschichte lebendig und erlebbar.
Zugegeben, der Aufwand ist nicht ganz ohne. Er bringt jedoch ziemlich sicher frischen Wind in die Runde. Alternativ kann man auch eine ganz eigene Welt entwerfen. Je nach Geschmack mit mehr oder weniger Fantasy, mehr oder weniger Magie, mehr oder weniger Monstern. In der Regel muss man sich nur hinsichtlich der Charakterklassen ein paar Gedanken und etwas Arbeit machen – die Regelwerke funktionieren.
CHRONIST: Mitunter vergehen einige Wochen, bis wieder alle Zeit zum Spielen haben. Das klassische Problem: Keiner weiß mehr, was genau passiert ist und an welcher Stelle man das Abenteuer beim letzten Mal unterbrochen hat. Der Name des Bösewichts? Irgendetwas mit A. Und war da nicht ein Basilisk? Nein, das war beim vorletzten Abenteuer ...
Die Erinnerung ist ein flüchtiger Geselle. Und Spieler wie Spielleiter sind auch nur Menschen. Eine ebenso einfache wie effektive Lösung: Man ernennt einen Spieler zum Chronisten. Dieser notiert alle wichtigen Ereignisse und Namen stichpunktartig in einem Büchlein, in dem er auch Karten, Zettel und die Charakterbögen aufbewahrt. So kann man bei Fragen jederzeit nachgucken und hat später eine schöne Erinnerung. Übrigens ist so mancher Fantasyroman aus genau solchen Aufzeichnungen entstanden.
In meiner Rollenspielgruppe ist es inzwischen ein festes Ritual, den Spielabend mit dem Vorlesen der Aufzeichnungen des letzten Zusammentreffens zu beginnen. Auf diese Weise ist man schnell wieder in medias res und kann ohne mühsames Brainstorming an den letzten Break anknüpfen.
Fehler und Nörgelei
"Never ignore coincidence. Unless, of course, you’re busy. In which case, always ignore coincidence."
Dr. Who
Wie jedes Verhältnis sollte auch das Verhältnis zwischen Spielleiter und Spielern von gegenseitigem Respekt geprägt sein. Dieser betrifft nicht zuletzt den Umgang mit Fehlern.
FEHLER: Ein Spieler darf durchaus auf einen Fehler hinweisen, beispielsweise wenn die Story nur so vor Ungereimtheiten strotzt oder die Tageszeit schlagartig eine andere ist. Ein Spielleiter darf durchaus auch einen Fehler eingestehen – schließlich hat er den bei Weitem anstrengendsten Part, muss sich eine Menge merken und auf vieles gleichzeitig achten. Wichtig ist, gelassen zu bleiben. Es ist meiner Erfahrung nach absolut kontraproduktiv, in endlose Diskussionen zu verfallen oder in der Story zurückzugehen.
Im einfachsten Fall korrigiert man sich: "Stimmt, es ist erst Mittag." "Oops, es sind drei Schlüssel, ja." Im häufigsten Fall erfindet man schnell eine passende Erklärung oder lässt ein Phänomen einfach offen. "Ihr seht nochmal nach und entdeckt den dritten Schlüssel auf dem Boden vor dem Altar." "Obwohl ihr euch nicht erklären könnt, wie das vonstattenging, irgendwie ist der Riese in den Dungeon gekommen. Vielleicht war ja Magie im Spiel." Manchmal kann man Erklärungsversuche der Spieler übernehmen. "Ihr habt richtig vermutet, einer der beiden Schlüssel passt bei zwei Türen …" Und auch Humor ist immer eine gute Wahl: "Es sind ja auch drei Schlüssel – der Barbar hat nur mal wieder Zwei und Drei verwechselt."
Extremere (Not-)Erklärungen können von einem Traum über Einbildung, Zauber, Illusion oder Gedächtnisverlust bis hin zur Gruppenhalluzination reichen. Im schlimmsten Fall wird der Fehler aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Oder (falls die Spieler den Fehler nicht bemerkt haben) man beißt in den sauren Apfel und verzichtet auf ein Element des Abenteuers. Hauptsache, es geht schnell weiter.
Als Spielleiter wiederum sollte man Ideen und Vorstellungen der Spieler ernst nehmen – ohne alles durchgehen zu lassen. Ist ein Plan schlicht unmöglich, weist man den Spieler dezent darauf hin oder lässt ihn gnadenlos scheitern. Hierfür braucht es eine gute Portion Fingerspitzengefühl: Ist klar, dass ein Spieler die Situation grob falsch einschätzt, hat man sie vielleicht nicht gut genug beschrieben. Das lässt sich in der Regel mit ein, zwei Sätzen gut nachholen. Ignoriert ein Spieler die Physik (und ist weder Erzmagier noch Superman), kann man ihm diese in der Theorie erklären ("10 Meter ist ziemlich hoch"), nochmals nachfragen ("Du willst also wirklich springen?") oder ihm die Auswirkungen plastisch vor Augen führen ("Die Beine deines Helden sind gebrochen und in Form einer Brezel verschlungen"). Hier muss man je nach Situation unterscheiden. Fehler passieren und lassen sich in der Regel problemlos korrigieren. Ein anderes Phänomen, das dem empfindlichen Meistermagen neben Schaumküssen und Teignüssen auf Dauer schwer zusetzen kann, das ist …
NÖRGELEI: Manche Spieler stören mehr, als dass sie zu einem atmosphärischen Spieleabend beitragen. Ist das immer so, stellt sich die Frage, ob die Gruppenkonstellation so passt. Manchmal fällt ein Spieler aber auch einfach so aus der Rolle – sei es, dass er zu wenig geschlafen oder zu viel getrunken hat, ihn etwas beschäftigt etc. Wie auch immer. Man kann an einem Abend einige Male kurz pausieren oder über Störungen hinwegsehen, man kann einige Male ermahnen, man kann versuchen, den Spieler mehr einzubinden. Funktioniert das alles nicht, ist es irgendwann Zeit für richtig fiese Meisterscheiße. Willkür? Neeeeein. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Banale Kausalität. Der schmerzhafte Fingerzeig des Schicksals. Ein paar Anregungen, wie ein Charakter unter einem unartigen Spieler leiden kann (für all diese Gemeinheiten gab es einen hinreichenden Anlass):
Krankheit: Dieser ständige Schmerz in der Nierengegend ist vielleicht nur eine leichte Entzündung – oder aber ein Nierenstein von der Größe eines Kohlkopfes. Oder: Der Charakter hält plötzlich ein Büschel seiner eigenen Haare in den Händen. Oder: Der morgendliche Stuhlgang des Helden bringt äußerst Beunruhigendes zutage. Oder: Die Wunde schien verheilt, jetzt zieht sich eine verdächtige Spur in Richtung Herz. Oder: Ihr trefft eine alte Frau, die euch warnt, in dem Teich zu baden, in dem ihr eben gebadet habt. Darin gebe es Parasiten, die über die Harnröhre in den Körper eindringen und dort – lassen wir das lieber.
Unfall: Die Wurzel hat er übersehen. Sein Fuß zeigt nun unübersehbar in die falsche Richtung. Oder: Welcher Vollidiot legt eine Bärenfalle mitten auf einen Waldweg??? Als du brüllend umfällst, gibt der Boden unter dir nach und du stürzt in eine Fallgrube. Oder: Baum fällt! … Ich sagte doch, der Baum fällt!
Zufall: Wie kommt mein Gesicht auf diesen Steckbrief? Ach komm! Oder: Vor euch taucht eine Gestalt auf. Als sie näherkommt, erkennst du, es ist dein Vater. – Aber auf meinem Charakterbogen steht, dass meine Eltern seit Jahren tot sind! – Tja … (die Optionen reichen hier vom Zombie über Familienverwicklungen bis hin zu keimendem Wahnsinn).
Sollten alle Stricke reißen, hilft oft eine einfache Frage: Willst du nächstes Mal meistern???
II. CHARAKTERE
"Du bist ein Freak, was soll`s? Willst du normal sein? Willst du etwa so sein wie alle anderen?"
Jonathan Byers / Stranger Things
Bei der Erstellung seines Charakters wählt ein Spieler in der Regel eine Rasse und eine Profession und würfelt anschließend seine Werte (wie Stärke oder Klugheit) aus. Dieses Grundgerüst wird nach und nach um die folgenden Punkte ergänzt: Name, Herkunft und (charakterliche) Eigenschaften. Optional sind bestimmte Fähigkeiten, erlernte Berufe und Titel. Zudem notiert sich der Spieler stichpunktartig sein Aussehen und die stark von der Meisterlaune abhängige Startausrüstung (→ Ausrüstung).
Die folgenden Tipps und Beispiele sowie die Listen im Anhang können bei der Charaktererstellung, bei der Generierung von NSCs oder bei der Ausarbeitung von Karten, Städten oder Dörfern hilfreich sein.
Namen
In der Regel macht es Spaß, sich Namen selbst auszudenken. Wenn es jedoch mal schnell gehen muss, wenn man Namen für einen ganzen Barbarenstamm braucht oder eine zündende Idee für ein Abenteuer hat und das Ausdenken von Namen einen nur aufhält, können folgende Vorschläge und Inspirationen hilfreich sein (auch geeignet für Charaktere, die beim dritten Abenteuer immer noch "Der Waldläufer" heißen).
1. PERSONEN: Personennamen können aus einem oder mehreren Teilen bestehen. Bei mehrteiligen Namen klingen oft Alliterationen gut, zum Beispiel: Fergus Fangzahn, Bjorn der Blauäugige, Adrian Andarino. Bildliche Beinamen passen in der Regel zum Erscheinungsbild, aber auch Kontraste haben ihren Reiz – beispielsweise wenn Randell Weitblick offensichtlich kurzsichtig oder Amara Goldhaar kahlköpfig ist.
Die Wahl und Zusammensetzung des Namens ist nicht zu unterschätzen: Sie trägt wesentlich dazu bei, wie ein Charakter wahrgenommen wird. Insbesondere Klang und Inhalt, aber auch die Länge eines Namens und mit ihm verbundene Konnotationen verstärken oder konterkarieren sein Auftreten bzw. seinen Ruf. Der Name kann einen Charakter beispielsweise eitel, bodenständig, sympathisch oder furchteinflößend wirken lassen – erst einmal unabhängig davon, wie er sich durch seine Worte und sein Handeln tatsächlich darstellt.
A) Vornamen
Listen mit zahlreichen männlichen und weiblichen Vornamen findest du im Anhang. Einige der Namen sind frei erfunden, die meisten waren oder sind noch gebräuchlich. Sie sind in drei Regionen unterteilt: Unter "Nordlande" stehen vor allem skandinavische und zum Teil friesische Namen. Unter "Mittellande" findest du – oft ebenfalls zu den Nordlanden passende – Vornamen mit althochdeutschen Wurzeln sowie walisische, keltische, slawische und angelsächsische Namen. Unter "Südlande" sind überwiegend lateinische, griechische, arabische, türkische, hebräische, japanische und indianische Vornamen aufgeführt. Die Einteilung bietet eine grobe Abgrenzung zur Orientierung. Die Übergänge sind jedoch fließend und viele Namen auch in anderen Regionen üblich beziehungsweise einsetzbar.
Ein Tipp: Google doch mal einige der Namen. Es ist sehr spannend, woher Namen kommen und was sie bedeuten. So bedeutet Sitara im Indianischen "Der Morgenstern" und im Persischen "Der Stern", Dagur "Der Tag" im Altnordischen und Tatsu "Drache" im Japanischen.
Hinter vielen Namen verbergen sich zudem alte Gottheiten oder spannende Geschichten aus der Welt der Sagen und Legenden. Ein paar Beispiele: Magni und Modi sind zwei Söhne des Gottes Thor, die er mit der Riesin Jarnsaxa gezeugt hat und die nach Ragnarök den Hammer Mjöllnir erben. Ceridwen ist in der walisischen Mythologie die Hüterin des magischen Kessels. Als ihr Diener Gwion von dem Zaubertrank darin nascht, liefern sich die beiden eine wilde Verfolgungsjagd, bei der sie mehrfach ihre Gestalt wechseln. Und Nungal war eine altsumerische Göttin, die "Herrin des Gefängnisses" – sie sollte Straftäter zur Reue bewegen.
B) Beinamen
Nachnamen im heutigen Sinne (also Familiennamen) gab es im Mittelalter nicht, ebenso wenig machen sie in den meisten Fantasywelten Sinn. Stattdessen tragen Charaktere in der Regel einen Beinamen, der sich auf ein individuelles Merkmal, ihren Beruf oder ihre Herkunft bezieht. Dabei lassen sich auch mehrere Elemente verbinden, zum Beispiel: Kapitän Babo Blaubart aus Nordwind oder Nora Trinkfest, die Seherin. Einige der Beinamen können alternativ als Einzelnamen verwendet werden.
Merkmale: Oft drücken sich im Beinamen spezifische geistige oder körperliche Auffälligkeiten, das Naturell, Vorlieben, Taten etc. aus. Diese können mit einem bestimmten Artikel (je nach Geschlecht "der" oder "die") angehängt werden:
(der oder die) Bärtige, Blauäugige, Bleiche, Bunte, Dicke, Dünne, Dunkle, Feiste, Flinke, Friedliche, Fröhliche, Gerechte, Gerissene, Grausame, Große, Großmütige, Haarige, Heilige, Kleine, Kluge, Krumme, Kühne, Laute, Mutige, Rote, Schielende, Schinder/-in, Schlächter/-in, Schlaue, Schnelle, Schöne, Starke, Verräter/-in, Wanderer, Weise, Zahnlose, Zerstörer/-in etc.
Sie können als Attribut vorangestellt werden: Der krumme Piet, die starke Xania, der schöne Sven, die weise Nora, der flinke Finn etc. (siehe auch → Eigenschaften)
Oder sie werden einfach an den Vornamen angehängt: Adlerauge, Beinhart, Feuersturm, Garstig, Klumpfuß, Schönhaar, Wirbelklinge, Wüterich etc. (weitere Beispiele siehe Anhang).
Beruf: Hier gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Das Einfachste ist, man kombiniert einen Beruf oder Titel (siehe → Berufe und Titel) mit einem Namen: Conn der Falkner, Roselda die Tänzerin, Schwertmeisterin Sieghild, Tim der Mälzer, Tuk der Mönch, Frenzo Freisänger, Müller Grimm, Lord Archibald, Herzogin Eleanore, Bauer Wolfram, Donar Drachentöter.
Der (angehängte oder alleinstehende) Beruf kann aber auch bildlich ausgedrückt sein: Bienenfreund, Borstenbrenner, Brausud, Dreispann, Federstreich, Gertenschneider, Griebenschmalz, Hackebeil, Hobelspan, Knochenbrecher, Kräuterliesl, Langfinger, Mühlenwirt, Pfannenstil, Pinselstrich, Rebenfleiß, Rossbauer, Rübenacker, Scherenschnitt, Waidfang etc.
Oder der Beiname betrifft die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung: von der Bruderschaft der Seraner, vom Orden der Kette, die Schildmaid, der Tempelritter, die Sonnenpriesterin, der Diener des Turms etc.
Herkunft: