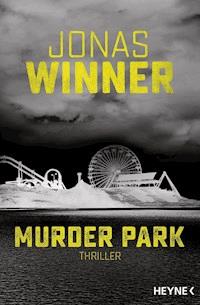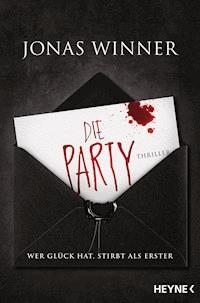12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie weit wirst du gehen?
Hedda Laurent ist gestorben. Die Familie ist in Trauer vereint: Ihr Mann, die vier Kinder mit ihren Familien und Heddas Bruder Ruben sind nach Berlin gekommen, um Abschied zu nehmen. Doch bei der Testamentseröffnung erleben sie eine böse Überraschung. Nur einer der Anwesenden wird Heddas beträchtliches Vermögen erben. Wer der Glückliche ist, soll ein Wettkampf entscheiden. 27 Aufgaben müssen die Angehörigen bewältigen. Nur einer kann gewinnen. Doch was ganz harmlos beginnt, droht bald zu eskalieren. Alte Konflikte und Verletzungen reißen wieder auf. Und das Spiel wird gefährlich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Hedda Laurent ist gestorben. Die Familie ist in Trauer vereint: Ihr Mann, die vier Kinder mit ihren Familien und Heddas Bruder Ruben sind nach Berlin gekommen, um Abschied zu nehmen. Doch bei der Testamentseröffnung erleben sie eine böse Überraschung. Nur einer der Anwesenden wird Heddas beträchtliches Vermögen erben. Wer der Glückliche ist, soll ein Wettkampf entscheiden. 27 Aufgaben müssen die Angehörigen bewältigen. Nur einer kann gewinnen. Doch was ganz harmlos beginnt, droht bald zu eskalieren. Alte Konflikte und Verletzungen reißen wieder auf. Und das Spiel wird gefährlich …
Der Autor
Jonas Winner wuchs in Berlin, Rom und den USA auf und studierte in Deutschland und Frankreich. Nach seiner Promotion über Spieltheorie arbeitete er zehn Jahre lang als Fernsehjournalist, danach folgten Drehbücher fürs deutsche Fernsehen und Romane. Besuchen Sie Jonas Winner auf jonaswinner.com und Facebook.
Lieferbare Titel
Murder Park
Die Party
JONAS WINNER
FÜR RACHE IST ES NIE ZU SPÄT
THRILLER
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Motto auf Seite 5 aus: Joyce Carol Oates, »Haunted. Tales of the Grotesque« (1994), deutsch: »Das Spukhaus«, DVA Stuttgart 1996, übersetzt von Renate Orth Guttmann.
Copyright © 2021 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock (UAEWork, JB Group, kilic inan)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-25135-2V002
www.heyne.de
»Und dies ist die verbotene Wahrheit, das unaussprechliche Tabu: dass das Böse nicht immer abstoßend ist, sondern häufig anziehend, dass es die Macht besitzt, uns nicht einfach zu Opfern zu machen, wie es Natur und Unfälle tun, sondern zu aktiven Komplizen.«
Joyce Carol Oates
Die Familie
1
Totensonntag, 00.10 Uhr
Ruben Glass
Der alte Mann konnte nicht mehr gut gehen, deshalb saß er meist in seinem Rollstuhl. Früher hatte er darauf geachtet, dass sein Haar immer modisch geschnitten war. Inzwischen ließ er es nur noch notdürftig von dem Marokkaner stutzen, der ihm in Paris den Haushalt führte. Die Gesichtszüge des Mannes aber ließen nach wie vor erkennen, dass sein Geist hellwach war. Ruben Glass war Zeit seines Lebens ein intelligenter Mensch gewesen, dessen Schlagfertigkeit und Geistesgegenwart ihn bei seiner Arbeit als Journalist rund um den Globus geführt hatten.
Das allerdings, was er jetzt dort vor sich auf dem niedrigen Tisch in dem Zimmer liegen sah, in dem man ihn untergebracht hatte, erschreckte ihn mehr als alles, was er jemals erlebt hatte.
Dabei sah das Foto ganz harmlos aus. Ein ausgeblichenes Familienfoto aus längst vergangenen Zeiten. Darauf ein Garten, eine Birke im Hintergrund, eine Villa. Sommer. Ein Sommer vor vielen Jahren. Auf dem Rasenplatz vor dem Haus hatten sich die Mitglieder einer Familie versammelt. Der Vater, der alle überragte, an seiner Seite eine zierliche Frau mit Bubikopf – vor ihnen ihre vier Kinder.
»Jannick, Sophia, Theo und Patricia.«
Ruben kannte die Namen der Kinder, es waren seine Nichten und Neffen, er selbst hatte nie Kinder gehabt. Familienleben – danach hatte ihm nie der Sinn gestanden. Er kannte die vier Kinder, er kannte die Eltern, Artur und Hedda, er kannte auch das Haus, vor dem sie standen, denn es war das Haus, in dem er selbst vor vielen Jahren aufgewachsen war und in das man ihn jetzt wieder gebeten hatte.
Und doch flößte ihm dieses Foto eine Angst ein, die eiskalt durch seine Adern kroch und sein Herz spürbar schneller schlagen ließ. Mit zitternder Hand legte er die Aufnahme zurück auf den Glastisch, richtete sich in seinem Rollstuhl auf und lauschte.
Das dumpfe Rauschen, das das Haus immer dann zu erfüllen schien, wenn man ganz still war.
Zwölf Minuten nach Mitternacht. Er brauchte dringend ein wenig Schlaf. Seine Nerven vibrierten vor Erschöpfung. Er war in sein Zimmer gekommen, um auszuruhen. Aber dann hatte er das Foto auf dem Tisch gesehen. Wer hatte es da hingelegt? Und warum?
Im gleichen Moment spürte er es. Dass jemand bei ihm war, hier in seinem Zimmer.
Millimeter für Millimeter drehte er sich in seinem Rollstuhl um. Blinzelte, um das Halbdunkel, in dem der Raum lag, zu durchdringen. Er hatte noch kein Licht angemacht, hatte das Foto nur in dem Schein betrachtet, der vom Fenster hereinkam.
Mit einem Mal konnte er die Umrisse einer Gestalt erkennen, die neben dem Fenster kauerte.
»Ich wusste es nicht, das musst du mir glauben!« Er wischte sich über die Lippen. Er hatte so undeutlich gesprochen – war überhaupt etwas zu hören gewesen?
Mit aufgerissenem Mund beobachtete er, wie sich die Gestalt aufrichtete und langsam auf ihn zukam.
Ich wusste es nicht.
Ich wusste es doch!
Ich wollte es nicht!
Kraftlos griff seine Hand nach den Rädern des Rollstuhls. Es gab so viel zu erklären. Zu rechtfertigen. Richtigzustellen.
Aber dafür ist es jetzt zu spät, hörte er eine Stimme in sich flüstern.
Ruben war alt geworden, weit über achtzig. Er hatte Glück gehabt. Ein schönes Leben, alles in allem. Ein Leben, das sich nun jedoch, das fühlte er, als hätte ihn der Tod schon berührt, seinem Ende näherte.
»Es tut mir leid.« Seine Lippen zitterten. »Hörst du mich?«
Die Gestalt stand jetzt dicht vor ihm, und das Mondlicht tauchte ihr Gesicht in einen fahlen Glanz.
Ruben hörte sich selbst atmen – in kurzen, viel zu kurzen Zügen. Die Angst schien sich in flüssiges, eiskaltes Metall verwandelt zu haben, das seinen Körper auszufüllen begann. Verkrampft und unfähig, sich noch zu bewegen, lagen seine Hände auf den Rädern des Rollstuhls. Er konnte regelrecht mitverfolgen, wie der Tod in ihm die Oberhand gewann.
»Kannst du mir verzeihen?« Er nuschelte nur – wie sollte sie ihn denn verstehen?
Die Frau, die vor ihm stand, strich ihm eine schweißnasse Strähne aus der eiskalten Stirn.
»Was hier vor sich geht, ist deine Schuld, Ruben, weißt du das?« Prüfend sah sie ihm in die Augen.
Aber der Blick des alten Mannes war bereits gebrochen. Und an die Stelle des lebendigen Blitzens, das in seinen Augen immer gehaust hatte, war der stumpfe Glanz toter Fischaugen getreten.
Teil I
2
89 Stunden vorher
»Theo!«
Die aufgerissenen Augen des Jungen starrten ihn an.
»Bitte! Nicht! Du darfst nicht loslassen!«
Die Stimme des Kleinen war völlig verzerrt. Sein Gesicht eine Maske aus Panik und Verzweiflung. Er flehte um sein Leben.
»Ich halte dich, Kosta!«
Theo fühlte, wie die kleine Hand des Jungen seinem Griff entglitt. Er lag flach auf den eiskalten Stangen der Klettersteigbrücke. Unter ihm nichts als Hunderte Meter eines gähnenden Abgrunds. Tief unten, glitzernd, die schroffen Felsen der Schlucht. Direkt vor ihm: die Augen des Kleinen. Sein Mund. Seine Gesichtshaut glänzend von Tränen und Schweiß. Und Theo spürte, wie die Hand des Jungen aus dem Fäustling Millimeter für Millimeter hinausrutschte.
»Streck mir die andere Hand hoch, Kosta. Versuch es!«
Tränen liefen dem Jungen übers Gesicht. »Ich kann nicht, Theo. Ich kann nicht mehr.«
Nichts als Theos Griff um Kostas Hand hielt den Kleinen noch am Leben. Todesangst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Als könnte der Junge die wenigen Augenblicke, die sein kurzes Leben noch für ihn bereithielt, bereits abzählen.
Mit einem Ruck – sollte Theo den Kleinen mit einem Ruck zu sich auf die Klettersteigbrücke heraufziehen? Aber dabei glitschte die schweißnasse Hand des Jungen doch bloß aus seinem Handschuh!
»Kosta, die andere Hand, sonst kann ich dich nicht hochziehen!«
Der Kopf des Jungen war nach unten geneigt, er starrte in den Abgrund. Theo fühlte, wie er zitterte, wie die grauenvolle Tiefe an dem kleinen Leib des Jungen zog. Fühlte, wie Kostas Hand noch ein Stückchen weiter aus dem Fäustling glitt – und ganz rausrutschte. Kosta riss den Kopf in den Nacken – sein Mund ging auf – er flog …
»Theo!«
Was …
»Theo!«
Nach Luft ringend wie ein Ertrinkender kam Theo hoch.
»Was? Kosta! Um Gottes willen!« Er sprang aus dem Bett. Sein ganzer Körper bebte. Wirkte wie randvoll gefüllt mit Eissplittern der Angst. Kosta! Nicht!
Er wirbelte herum. Das Zimmer. Vor dem Fenster dämmerte der Morgen.
Der Klettersteig. Der Junge.
Außer sich stieß Theo seine Fäuste in die Augenhöhlen. Ein Albtraum! Kosta hing nicht an seiner Hand, er hatte es nur geträumt.
»Theo, bist du wach?« Eine weibliche Stimme drang durch die Tür seines Zimmers.
»Was? Ja! Ja, ich bin wach.«
Nur ein Albtraum! Er spürte eine Welle des Glücks durch sich hindurchpulsieren. Er war sich so sicher gewesen, den Kleinen nicht länger halten zu können. Doch es war nur ein Traum gewesen.
»Was ist denn?« Mit einem Schritt war er an der Tür und zog sie auf.
Eine schlanke Frau mit kurzen braunen Haaren stand davor. Dorine, Kostas Mutter.
»Ein Anruf für dich. Aus Berlin.«
Aus Berlin?
»Wo ist Kosta?«, entfuhr es ihm. »Geht es ihm gut?«
»Er ist unten, muss gleich in die Schule.« Dorine lächelte. »Wieso? Wegen gestern?«
Wegen gestern? Er fühlte einen Stich im Herzen. Mit einem Mal war alles wieder da. Deshalb hatte er von Kosta geträumt. Ein Albtraum, ja. Aber wirklich entkommen war er ihm durch sein Aufwachen nicht.
Dorine hatte es ihm gestern gesagt. Dass ein Mann ihren Sohn auf dem Nachhauseweg angesprochen hatte. Ob er Theo kenne, hatte der Mann den Jungen gefragt. Ob er Theo Glass kenne. Was Kosta natürlich bejaht hatte. Schließlich wohnte Theo schon seit ein paar Wochen in der kleinen Pension in den Bergen, am Rand von Interlaken. Der kleine Kosta – Sohn von Dorine, der die Pension gehörte – und Theo hatten sich ein bisschen angefreundet.
»Warte mal.« Nervös machte er einen Schritt zum Fenster, zog den Vorhang auf und starrte auf die Straße hinunter. Die schwarze Limousine sah aus wie ein Raubtier. Riesig. Glänzend. Aufgemotzt. Die Scheiben getönt. Sie parkte in zweiter Reihe, schräg gegenüber vom Eingang zur Pension. Durch die Windschutzscheibe hindurch konnte Theo die zwei Männer darin sehen. Das übliche Outfit. Basecap, Sonnenbrille, Bart. Kurz rasierte Haare, massige Statur. Wie alle Männer der Clans, überall. Mit den reichen Touristen waren auch sie hier in den Bergen angekommen. Er hätte sich niemals auf diese Weise Geld borgen dürfen! Jetzt waren sie an ihm dran und würden nicht lockerlassen. Sogar den kleinen Kosta hatten sie schon im Visier.
Er drehte sich zu Dorine um.
»Willst du den Anruf nicht annehmen?« Ihre hübschen Augen sahen ihn an.
Aus Berlin? Und wenn das nur ein Trick war? Die Gedanken in seinem Kopf überschlugen sich. Oder sah er schon überall Gespenster?
Er hatte einfach seit Wochen entsetzliches Pech gehabt. Nur deshalb hatte er sich ja das Geld borgen müssen. Er hatte fest damit gerechnet, ein paar Spiele zu gewinnen. Aber verloren. Es war wie verhext. Eine solche Pechsträhne hatte er, soweit er sich erinnern konnte, überhaupt noch nie gehabt. Dabei verdiente er schon seit Jahren sein Geld als professioneller Pokerspieler.
»Nowotny, hat er gesagt, heißt er. Ein Notar aus Berlin.« Dorine schaute ihn fragend an. »Also was ist jetzt, gehst du ran oder nicht?«
Ein Handy hatte er schon seit Tagen nicht mehr. Selbst das Geld, um die Karte aufzuladen, musste er ja erst mal verdienen.
»Ein Notar?«
Sie nickte.
»Und was will er?«
»Hat er nicht gesagt. Nun komm schon. Dann kannst du Kosta noch Tschüss sagen, bevor er zur Schule geht. Der Hörer liegt unten auf dem Tresen.«
Kosta. Theo spürte, wie er unwillkürlich lächeln musste. Kosta war wohlauf und ging gleich zur Schule. Gott sei Dank!
3
»Der Hörer liegt auf dem Tresen.« Kosta sah von seiner Müslischüssel auf, als Theo die Treppe runterkam.
»Ich weiß.« Er warf dem Kleinen einen Blick zu.
Sie hatten ihn gewarnt. Sie hatten ihm gesagt, dass sie das Geld zurückwollten. Achtzehntausend Schweizer Franken. Er hätte es ja auch längst zurückgezahlt, wenn er nicht dieses verfluchte Pech gehabt hätte. Gestern Abend zum Beispiel. Texas Hold’em. Eine wichtige Partie. Hohe Einsätze. Es war bereits nach zwei Uhr morgens gewesen. Zwei Könige hatte er auf der Hand gehabt. King Kong – was sollte da schon schiefgehen? Ein dritter König lag sogar auf dem Tisch, als die vierte Karte kam. Drei Könige? War es etwa falsch, mit so einem Set hoch zu wetten? Mit Sicherheit nicht! Bloß wenn man Pech hatte, ging so etwas schief!
»Theo?«
Er blieb neben Kostas Platz stehen. »Was ist?«
»Bringst du mir heute Nachmittag bei, wie man pokert? Mama hat gesagt, ich darf dich fragen.«
Die dunklen Augen des Kleinen leuchteten.
»Auf keinen Fall, Kosta. Pass lieber in der Schule auf, dann brauchst du die Karten nicht.«
Theo drehte den Kopf. Durch das Fenster der Pension konnte er die schwarze Limousine auf der anderen Straßenseite parken sehen. Achtzehntausend. Er hatte davon gehört, dass sie einem auflauerten, wenn man nicht bezahlte, und sich mit einer Zange an einem zu schaffen machten. Dass sie einem mit der Zange den Daumen abknipsten.
Kennst du Theo Glass, Kosta?
Er blickte zurück zu dem Jungen, der sich wieder über seine Müslischale gebeugt hatte. Und wenn sie mit der Zange dem Kleinen zu Leibe rückten? Theo riss sich zusammen. Trat an den Tresen. Und hob den Hörer an sein Ohr.
»Glass.«
»Ah, freut mich, dass ich Sie erreiche«, hörte er eine angenehm zivilisierte Stimme am anderen Ende der Leitung. »Mein Name ist Konrad Nowotny. Ich … habe leider keine sehr erfreuliche Nachricht für Sie, Herr Glass.«
Das war ja klar.
»Wer sind Sie?«
»Ach so … Ich dachte, Sie hätten vielleicht von einem Ihrer Geschwister bereits davon gehört. Ich bin Partner der Kanzlei Nowotny und Fink in Berlin. Wir vertreten die Angelegenheiten Ihrer Mutter, Hedda Laurent.«
Ihrer Mutter? Wie lange war er nicht in Berlin gewesen?
»Glass – das ist der Name, den Sie benutzen? Richtig?«
»Ja, richtig. Hören Sie, Herr Nowotny, ich will nicht unhöflich sein, aber … könnten Sie mir vielleicht sagen, was der Grund Ihres Anrufs ist? Sie erwischen mich gerade zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt.«
»Ihre Mutter liegt im Sterben, Herr Glass.«
Es kam ihm so vor, als würde er langsam in Wasser versinken.
»Sie hat mich gebeten, Sie ausfindig zu machen«, redete Nowotny weiter. »Es war nicht ganz einfach, deshalb habe ich Sie erst jetzt erreicht. Ihre Mutter bat mich, Ihnen auszurichten, dass sie Sie sehr gern noch einmal sehen würde.«
Fast dreißig Jahre.
Fast dreißig Jahre war er nicht in Berlin gewesen.
Fast dreißig Jahre hatte er seine Eltern nicht gesehen.
»Wir haben veranlasst, dass Ihnen ein ausreichender Betrag für den Flug in der Western Union Filiale von Interlaken hinterlegt wird. Meinen Sie, dass Sie es einrichten könnten?«
Was … was einrichten können?
»Herr Glass?«
Achtzehntausend … Kosta …
»Ja«, hörte sich Theo hervorstoßen, »sicher.«
»Gut. Wunderbar. Bitte entschuldigen Sie, wenn das vielleicht etwas schroff klingt, aber … ich glaube, dass Sie nicht viel Zeit verlieren sollten, wenn Sie Ihre Mutter noch sehen möchten, bevor sie …« Die Stimme am anderen Ende der Leitung verlor sich.
Im Sterben? Hatte der Mann gesagt, dass sie im Sterben lag?
»Was … ich meine, ist sie krank?«
»Wissen Sie das nicht? Vielleicht ist es am besten, Sie rufen einen Ihrer Geschwister an, Herr Glass. Ihrer Mutter geht es wirklich nicht gut. Ihre Geschwister können Ihnen sicherlich am besten alles erklären.«
4
Der Fernsehturm stach wie eine Nadel in den wolkenlosen Himmel über Berlin. Die 737 vom Flughafen Zürichflog einen sanften Bogen und steuerte Tegel an.
Seit dem Anruf von dem Notar waren nur ein paar Stunden vergangen. Stunden, die Theo gut genutzt hatte.
Als er aus der Pension auf die Straße getreten war, war die Limousine von der gegenüberliegenden Straßenseite verschwunden gewesen. Umso besser. Er würde den Mann, der ihm das Geld geborgt hatte, in Zürich direkt aufsuchen.
Als Erstes hatte er sich auf den Weg zur Western Union Filiale gemacht und das Geld abgehoben, das dort für ihn hinterlegt war. Genug, um die ausstehende Miete für das Zimmer zu zahlen.
Zurück in der Pension hatte er seinen Koffer gepackt. Dorine hatte sanft gelächelt, als er sich von ihr verabschiedet hatte. Fast drei Monate lang hatte er in ihrer Pension gewohnt, und sie hatten sich gut verstanden. Mehr nicht. Es hätte vielleicht mehr daraus werden können, aber nicht, solange er in dieser Pechsträhne feststeckte.
Mit dem Geld und dem Koffer hatte er die nächstbeste Autovermietung aufgesucht und einen Wagen geliehen, den er in Zürich abgeben konnte. Dort angekommen, hatte er sich mit Ralph getroffen, dem Mann, der ihm vor einem knappen Vierteljahr die Achtzehntausend geborgt hatte. Geborgt, warum? Weil Theo breitschultrig war, gut gekleidet, funkelnde Augen hatte und ein ausdrucksstarkes Gesicht wie ein offenes Buch? Vielleicht. Vor allem aber, weil Theo Glass ein Name war, den man in der Pokerszene kannte.
Das war nicht immer so gewesen. In den späten Nullerjahren hatte er jedoch eine Glückssträhne gehabt, bei der er regelrecht reich geworden war. World Series of Poker in Las Vegas, exklusive Pokerrunden in Monte Carlo. Er hatte mit den besten der Besten gespielt und einiges gewonnen. Turniere, private Hinterzimmerpartien, er hatte sogar als Lehrer des Spiels Geld gemacht.
Selbst den anfänglichen Boom von Online-Poker hatte er auf der Gewinnerseite verbracht. Und doch war vielleicht gerade das der Keim seines Niedergangs gewesen. Online. Inzwischen hasste er es.
Es hörte nicht auf. Im Netz waren die Casinos vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet. Zu jeder Zeit konntest du dich einloggen und loslegen. Der Gewinn rund um die Uhr in Reichweite. Aber es war ein Spiel ohne Gegenüber. Einsame Nächte hatte er vor dem Bildschirm verbracht, den Blick auf die Zahlenkolonnen mit den Gewinnchancen geheftet. Als wäre in diesen verlorenen Nächten ein Gift in ihn geträufelt. Er hatte begonnen, das Spiel zu fürchten. Und seine aufgehäuften Reserven schmolzen dahin.
Das war es, was er aus seinem Leben gemacht hatte? Er hatte gespielt und verloren. Und dieser Gedanke schien es gewesen zu sein, der sein Glück endgültig beendet hatte.
»Ich werde die Achtzehntausend in Berlin besorgen«, hatte er zu Ralph und dessen Leuten in Zürich gesagt. Und gewusst, dass sie sich darauf einlassen würden.
Er hatte ihnen seinen Pass gezeigt. Der Name, der dort eingetragen war, lautete nicht Theo Glass. Das war der Name, unter dem er seine Pokersiege errungen hatte, aber nicht der Name, auf den er getauft worden war. Im Pass stand sein richtiger Name: Theodor Laurent. Er hatte Ralph gesagt, dass er nachfragen sollte: Laurent, Berlin. Und gewartet, während Ralph seine Telefonate in einer Sprache führte, die Theo nicht verstand. Ralph hatte erfahren, was er wissen musste. Die Firma, die die Häuser von Theos Mutter verwaltete, war eingetragen und auch im Internet rasch auffindbar. Unter dem Namen, den Hedda Glass bei ihrer Heirat angenommen hatte: Laurent.
Theo hatte es Ralph angesehen. Dass sie sich bereits ernsthafte Gedanken darüber gemacht hatten, ob er wohl jemals in der Lage sein würde, seine Schulden zurückzuzahlen. Dass diese neue Wendung der Ereignisse ganz in ihrem Sinn war. Immobilien in Berlin? Das roch nach Geld. Wenn das Theos Familie war, würde er die Achtzehntausend bestimmt in Berlin besorgen können. Zwei Wochen hatten sie vereinbart. Nach Ablauf der vierzehn Tage würde Theo zwanzigtausend zurückzahlen. Und wenn nicht?
Sie hatten ihn in der Hand. Kosta.
Hätte er zur Polizei gehen sollen? Nach all den illegalen Pokerrunden, die er in seinem Leben gespielt hatte? Und wer beschützte dann den Kleinen? Theo hatte sich mit diesen Leuten eingelassen, es gab nur einen Weg, wie er da wieder rauskam. Er musste seine Schulden bezahlen.
Langsam drehte sich die Nase des Flugzeugs. Er fühlte, wie die Sonne durch das kleine Bordfenster fiel und sein Gesicht beschien. Der Landeanflug hatte begonnen, in wenigen Minuten würde er in Berlin auf der Straße stehen.
Berlin. Die Stadt, in der er aufgewachsen war. Die Stadt, in der er als Kind mit seinen Geschwistern gespielt hatte. Die Stadt, der er vor fast dreißig Jahren den Rücken gekehrt hatte.
Er hatte niemandem gesagt, wann er eintreffen würde. Natürlich hatte Nowotny recht gehabt, er hätte zumindest einen von seinen Geschwistern anrufen müssen.
Seine Mutter lag was?
Er wagte es nicht einmal zu denken.
Wie aus einem Nebel tauchten ihr Gesicht und ihre kleine Gestalt vor seinem geistigen Auge auf.
Mama.
Nicht viel älter als er jetzt war sie gewesen, als er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Hedda Laurent. Seine Mutter. Sie hatten nicht telefoniert, einander nicht besucht. Natürlich wusste er, dass sie unglücklich war über das Leben, das er sich entschlossen hatte zu führen. Poker? Sie war eine stolze Frau. Eine intelligente Frau mit einem eisernen Willen. Niemals hätte sie verstehen können, wieso er sein Leben … wegwarf.
Genau. Er wusste, dass sie so dachte. Er hatte es weggeworfen. Das Leben, das sie ihm geschenkt hatte.
Theo stützte den Ellbogen auf die Armlehne und legte seine Hand vor die Augen, um sie vor den stechenden Sonnenstrahlen zu schützen.
5
Im novemberzerzausten Berlin herrschten eisige Temperaturen. Er warf einen Blick auf die Uhr. Kurz vor eins. Am besten, er nahm ein Taxi.
Ein schwerer beigefarbener Mercedes hielt am Taxistand vor ihm. Theo zog die hintere Tür auf.
»Greenwichpromenade bitte.« Dort würde er ein Boot mieten müssen, das Geld dafür hatte er gerade noch.
Vom Flughafen Tegel dauerte die Fahrt nur ein paar Minuten.
Der Kiosk, an dem man ein Boot leihen konnte, stand noch dort, wo er sich auch vor Jahren schon befunden hatte. Der Betreiber aber hatte gewechselt. Die Frau, die Theo ein kleines Ruderboot mit Außenmotor vermietete, hatte er noch nie gesehen.
Normalerweise nahm man eins der Boote des Hauses, wenn man von Sandwerder, der Insel im Tegeler See, auf der Theo groß geworden war, zum Festland wollte oder umgekehrt. Aber er hätte zu Hause anrufen müssen und jemanden bitten, ihn an der Promenade abzuholen. Und das wollte er nicht. Wenn stimmte, was der Notar gesagt hatte, würden seine Geschwister gerade ganz andere Dinge im Kopf haben, als sich um ihn zu kümmern.
Spiegelgrau lag das Wasser vor ihm, als der knubbelige Bug des kleinen Boots es durchpflügte. Schwere Wolken waren aufgezogen und hatten die Sonne verdeckt. Es schien noch einmal kälter geworden zu sein, und Theo hoffte nur, noch rechtzeitig vor dem Regen zur Insel zu gelangen.
Sandwerder.
Eine der wenigen Inseln im Tegeler See. Nur ein paar Hundert Meter lang, nicht mal achtzig Meter breit. Auf ihr aber erhob sich ein herrlicher Gründerzeitbau. Eine Villa, deren höchsten Giebel Theo bereits über den entlaubten Bäumen, die drumherum standen, hervorblitzen sehen konnte. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Simon Glass, Heddas Vater, das Gebäude erworben. Eine verspielte Villa voller Erker und Türmchen, mit einer wunderbaren Terrasse, die nach Süden hinauslag, und Wintergärten in allen vier Stockwerken. Ein Gebäude, das Theo immer geliebt hatte und das für ihn als Kind wie ein riesiger Spielplatz gewesen war. In den Siebziger- und Achtzigerjahren hatten er, seine Eltern und seine Geschwister die Villa allein bewohnt.
Er zog das Steuer seines Boots ein wenig nach links, um Kurs auf den Landesteg zu nehmen. Mächtig und dunkel ragte die Fassade des Hauses zwischen den Bäumen jetzt auf. Ihm fiel auf, dass sich eine schlanke Gestalt von der Eingangstür aus auf den Landesteg zubewegte. Einen Moment lang fragte er sich, wer das sein könnte, da hob die Gestalt einen langen Arm und schwenkte ihn über den Kopf.
Jannick. Sein älterer Bruder.
6
»Es ist nicht nur irgendeine Krankheit, Theo … Mama … erst war es Parkinson, dann ist sie gefallen, und das ist nie mehr richtig verheilt. Letzte Woche kam eine Krebsdiagnose dazu. Das war der Grund, weshalb sie Nowotny gesagt hat, er soll dich anrufen.«
Sie saßen auf der Holzbank, die ihr Vater einst am Ende des Stegs aufgestellt hatte. Jannicks Gesicht war gerötet, die Augen schienen in ihren Höhlen zu brennen. Er war alt geworden. Grau, bärtig, aber immer noch riesig. Wenn Theo ihm in die Augen sah, erkannte er dort den Bruder, mit dem er seine Kindheit verbracht hatte.
»Wir haben so ein Krankenbett besorgt und mussten ein ganzes Zimmer umräumen, um es da reinzukriegen«, hörte Theo ihn sagen. »Nowotny hat gemeint, dass du kommst, also haben wir dein altes Zimmer für dich hergerichtet. Onkel Ruben ist aus Paris angereist und schläft im Gästezimmer oben, Sophia und Patty werden heute Nachmittag beziehungsweise heute Abend eintreffen und bringen ihre Familien mit.«
»Und Papa?«
Jannick stützte die Hände auf seine Knie und blickte geradeaus. »Hält sich gut. Ich bin ja schon seit ein paar Tagen hier und habe ein bisschen geholfen, aber Papa hat sich die letzten Jahre um Mama gekümmert und das schon ganz gut im Griff.« Er wandte den Blick zu Theo. »Er freut sich, dass du kommst. Endlich mal.«
Ja.
Theo schwieg. Er hatte geahnt, dass es seltsam sein würde, plötzlich zurückzukehren in diese Welt, aber jetzt, wo es tatsächlich dabei war zu geschehen, fragte er sich, wie er es überhaupt durchstehen sollte.
»Hättest du nicht mal anrufen können?« Sein Bruder sah ihn von der Seite an. »Weißt du eigentlich, wie viel Kummer du Mama und Papa gemacht hast?«
Der Wind fuhr wie mit Stacheln durch Theo hindurch.
Er stand auf. »Ich muss erst mal rein, sonst erfriere ich hier«, presste er hervor. »Meinst du, dass es einen Pullover oder so gibt, den ich mir borgen kann?«
Jannick erhob sich ebenfalls. Und breitete die Arme aus. »Entschuldige … ich … wollte dich nicht so überfallen. Herzlich willkommen zu Hause, kleiner Bruder.«
Sie umarmten einander.
»Am besten, du schaust bei Mama rein, und dann stell ich dir Betty und die Kinder vor.«
Theo ließ Jannick los und trat einen Schritt zurück. Natürlich! Über einen Bekannten hatte er vor Jahren gehört, dass Jannick geheiratet und mit seiner Frau Kinder in die Welt gesetzt hatte. »Eine richtige Bilderbuchfamilie«, hatte der Mann gesagt.
Theo nickte und grinste. »Gute Idee.«
7
»Das ist das Ende, mein Junge.«
Der Kopf seiner Mutter lag tief eingesunken im Kissen, ihre wie immer wachen und doch vom Alter ein wenig getrübten Augen waren auf ihn gerichtet. Ihre linke Hand, die sie sich verletzt hatte, lag wie die gebrochene Kralle eines Vögelchens auf der Decke. Die rechte hatte sie zu ihm ausgestreckt und Theo griff danach. Die Hand seiner Mutter war kühl und wirkte unendlich zerbrechlich. Er beugte sich zu ihr hinab und küsste sie vorsichtig auf die Wange. Ihr Blick ließ nicht von ihm ab, als wollte sie seine Züge noch einmal genau studieren. Als wollte sie an seinem Gesicht ablesen, wie es ihm in all den Jahren ergangen war. Was das Leben aus dem Jungen gemacht hatte, den sie geboren hatte.
»Setz dich, Theo. Willst du dir den Stuhl dort nehmen?«
Er nickte. »Wie geht’s dir, Mama?«
»Nicht gut. Nachher will der Arzt noch mal kommen, aber so geht das schon seit Monaten.«
All die Jahre über hatte er ein Foto seiner Mutter mit auf seinen Reisen gehabt. Ein Foto von ihr aus einer Zeit, als er noch nicht zur Schule ging und sie abends an seinem Bett gesessen hatte, um ihm eine ihrer Geschichten zu erzählen. Von einem Marienkäfer, der auf seinen Reisen durch die Welt die schönsten Abenteuer erlebte. Geliebt hatte er diese Geschichten. Aber er konnte sich an keine einzige mehr erinnern.
»Hast du deine Geschwister schon gesehen?«
»Nur Jannick.«
Sie nickte. Dachte ein wenig nach, während ihr Blick langsam von ihm weg zur Zimmerwand tastete, die dem Bett gegenüberlag. »Ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, Theo. Am liebsten würde ich wenigstens sagen können: Ich hab es versucht – aber selbst da bin ich mir nicht sicher.«
Er saß auf seinem Stuhl und hörte ihr zu. Und kam sich beinahe so vor, als stünde er ein wenig neben sich.
»Das Leben war schön«, sagte sie, »aber richtig glücklich war ich nie.« Sie sah zu ihm. »Obwohl ich weiß, dass es undankbar ist, das zu sagen.«
»Warum warst du nicht glücklich, Mama?«
Sie sah ihn an, als wollte sie nicht zulassen, dass sie seine Frage verstand.
»Ich habe Nowotny gebeten, etwas vorzubereiten«, sagte sie, statt ihm zu antworten, »er wird es euch dann erklären.« Ihre beiden Hände, die kaputte und die gesunde, verschränkten sich. »Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, aber jetzt bin ich zu schwach, um es noch zu ändern.« Sie blickte ihm forschend in die Augen, als versuchte sie, eine Antwort darin zu finden.
»Es tut mir leid, dass ich so lange nicht zu Besuch gekommen bin, Mama.«
Sie nickte. »Ja.« Stolz. Verletzt. »Jetzt bist du ja da. Ich wollte unbedingt darauf warten, dass du ankommst, deshalb habe ich dem Arzt gesagt, er soll mit dem Morphium warten. ›Bis mein Theo auch kommt‹, habe ich ihm gesagt.«
Und jetzt bin ich da.
»Aber ich ertrage die Schmerzen nicht mehr«, fuhr sie fort, »weißt du.«
»So schlimm?«
Sie winkte ab. »Hilfst du mir mal hoch?« Sie stützte einen Arm hinten ab und ließ sich von ihm aufhelfen. Griff nach dem Wasserglas, das auf dem Nachttisch stand, und trank einen Schluck. Aus seiner Mutter war eine Greisin geworden. Aber es gab etwas an ihr, das ungebrochen war und von dem er das Gefühl hatte, sie würde es vielleicht über den Tod hinaus mit sich nehmen.
»Außerdem«, sie stellte das Glas wieder ab und sank zurück ins Kissen, »sollen die Temperaturen ja jetzt richtig fallen.«
»Außerdem? Was meinst du?«
»Ich meine, dass ich Doktor Erikson gesagt habe, er soll mich heute Abend besuchen kommen. Hab ich das noch nicht erwähnt?«
»Mama, ich … Wir haben so lange nicht gesprochen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.«
»Es ist gut, Theo. Mach dir keine Sorgen. Du bist ein guter Junge.«
»Erinnerst du dich, wie ich einmal als Schüler betrunken nach Hause gekommen bin? Ich war auf einer Party gewesen, in der Schule, ich glaub, es war die Abifeier vom Jahrgang über uns? Und ich habe die Manteltaschen voller Flaschen gehabt! Papa und du – ihr habt mich an der Tür abgefangen, ihr habt euren Augen nicht getraut. Papa …«
»… hat die Schnapspullen ins Klo geleert. Ja, ich weiß.«
»Ich dachte, jetzt ist es aus, jetzt seid ihr wirklich fertig mit mir. Aber dann, am nächsten Tag, als ich von der Schule nach Hause kam, lag nur ein Buch auf dem Tisch in meinem Zimmer. Dostojewskis Spieler. ›Jeder schlägt mal über die Stränge‹ – sinngemäß, glaube ich, das war, was du vorne reingeschrieben hast.«
Er sah, wie sie lächelte.
»Erinnerst du dich, im Sommer, wenn wir alle sechs mit dem großen Kombi losgefahren sind? Sommerferien in Onkel Rubens Landhaus? Das … war so schön. Wir sind in einem Stück durchgefahren bis zu den Alpen, und dann ist Papa abgefahren, und wir sind ewig die kleinen Sträßchen langgekurvt, auf der Suche nach einem guten Plätzchen fürs Picknick! Du hattest immer hart gekochte Eier und ein bisschen Salz in Alufolie dabei, Mama.« Er spürte, wie ihm die Tränen übers Gesicht liefen. »Es war so schön, Mama, als Kind bei euch zu sein. Es tut mir so leid, dass ich das nicht weitergegeben habe. Ihr habt so gut für mich gesorgt, und ich hab das alles nur vergeudet.«
Ihre Hände lagen verschränkt auf der Decke, und sie hörte ihm zu.
»Erinnerst du dich an die Kindergeburtstage, als ich noch kleiner war? Du hast ganze Backbleche mit Pizzabrot für alle Kinder gemacht, und Jannick hat geholfen, Spiele vorzubereiten, und alle waren richtig gut gelaunt. Ich hatte alle meine Freunde um mich – da warst du jünger als ich jetzt, Mama. Wie kann das denn sein, dass das wirklich passiert ist, und wir uns jetzt nur noch daran erinnern, als ob es eigentlich nie stattgefunden hat?«
»Ich denke schon, dass es stattgefunden hat, Theo. Ich habe das gern gemacht mit den Kindergeburtstagen. Und Jannick war eine große Hilfe, das stimmt.«
»Aber als ich größer war, nach der Grundschule, war das vorbei. Keine Kindergeburtstage mehr – warum eigentlich nicht?«
Er sah, wie sie sich abwandte. Ohne zu antworten.
»Du hast immer mal wieder gesagt, dass du aus dem Haus ausziehen willst. Warum? Das Haus gehörte euch doch. Und es gehört euch ja jetzt noch, oder?«
»Sicher. Das Haus hat mein Vater gekauft, nach dem Krieg, das gehört uns, das weißt du doch.«
»Und warum wolltest du dann ausziehen?«
»Es war zu teuer, Theo. Das große Haus – nur für uns? Es schien wie eine Verschwendung. Weiter nichts.«
»Ja?«
»Aber sicher.« Sie griff nach seiner Hand, plötzlich drängend. »Hör zu Theo, manchmal muss man einfach Vertrauen haben. Man kann lange hin- und hergrübeln, zweifeln, zögern, aber irgendwann muss man sich sagen, dass man entschieden hat und es gut ist. Du wirst sehen … wenn du zu viel zweifelst, machst du dich nur ganz wirr im Kopf.«
»Aber …« Doch er brach ab, denn er glaubte, in ihrem Blick zu sehen, dass sie für einen Moment unsicher war, ob er sie jemals verstehen würde. »Ist gut, Mama.«
Sie atmete aus und ließ seine Hand los. Eine Last schien von ihr abzufallen. »Du wirst sehen, manchmal bekommt man auch was dazu, Theo.«
Aber er wurde das Gefühl nicht los, dass sie das, was sie eigentlich hatte sagen wollen, nicht ausgesprochen hatte.
8
1982
»Willst du die Geschichte jetzt hören, oder nicht?« Jannick hatte seinen stechenden Blick auf die kleine Schwester gerichtet.
»Komm schon, Janni, du weißt doch, dass sie nur schlecht davon träumt«, mischte sich Sophia ein.
Die vier Kinder lungerten auf den Sofas im Wohnzimmer des großen Hauses herum. Abendessen hatten sie schon gehabt, aber morgen war Sonntag, und keiner hatte Lust, ins Bett zu gehen.
»Mama hat es doch ausdrücklich gesagt, bevor sie gegangen sind«, beharrte Sophia und klang dabei, als wollte sie die Rolle der Mutter übernehmen, jetzt wo die Eltern außer Haus waren. »Keine Spukgeschichten, keine Gruselfilme und nur eine Portion Eis für jeden.«
»Hat sie sie denn wirklich gesehen?«, wisperte die kleine Patty so leise, dass man sie kaum verstand.
»Was?« Jannick und Sophia, die beiden Ältesten, beugten sich zu ihr vor.
»Ob sie sie wirklich gesehen hat«, wiederholte die Vierjährige mit den großen braunen Augen.
»Siehst du!« Jannick richtete sich auf und starrte Sophia an. »Ich bin es gar nicht, der immer wieder davon anfängt, Patty will, dass ich es ihr erzähle!«
»Weil du damit begonnen hast«, war Theo zu hören, der den Kopf in ein Buch gesteckt hatte, die Beine lang auf dem weinroten Sofa ausgestreckt.
»Patty, du weißt doch, was passiert, wenn Jannick solche Sachen erzählt.« Sophia hatte sich zu der kleinen Schwester gehockt und streichelte den flauschigen Stoffhasen, den Patty in ihren Händchen hielt. »Der Hase und du, ihr bekommt beide Angst!«
Patty nickte, die Lippen fest aufeinandergepresst. »Aber ich will ja nur wissen«, wisperte sie nach einer Weile, »ob sie sie wirklich gesehen hat.«
Sophia drehte sich zu Jannick um. »Und?«
»Ob sie sie wirklich gesehen hat? Aber ja!« Jannick zog seine langen Teenagerbeine zu sich auf die Sitzfläche und fuhr im Schneidersitz fort: »›Die Frau mit dem Pfauenkranz‹ hat sie sie genannt.«
»Pfauenkranz?« Theo schielte über sein Buch hinweg zum Bruder.
»Ja, Pfauenkranz … wie so ein Rad vom Pfau.« Jannick nahm beide Hände zur Hilfe, um mit einer Bewegung über seinem Kopf anzudeuten, was er meinte. »Der Kranz ragte hinter ihrem Kopf in die Höhe wie ein mächtiger Kragen. Wie die Federn eines Pfaus, wenn er ein Rad schlägt. Räderkranz – so hat sie es auch genannt.«
»Wer – diese …«
»Die Frau, deren Tochter unserm Großvater das Haus verkauft hat, genau.«
Theo ließ das Buch sinken. »Die Frau hat gesagt, sie hat eine Frau mit einem Pfauenkranz gesehen?«
»Als Kind!« Jannick legte beide Handflächen aneinander. »Als kleines Mädchen, da war sie nicht viel älter als Patty jetzt.« Er warf der Kleinen einen Blick zu. Pattys Augen schienen bei dem Gedanken, ein anderes Mädchen ihren Alters könnte so etwas gesagt haben, noch einmal größer geworden zu sein. »Da hat sie davon angefangen. ›Mama! Papa!‹ Sie ist zu ihren Eltern gelaufen, ›die Frau mit dem Pfauenkranz – ich hab sie wieder gesehen, ganz bestimmt.‹ Mitten in der Nacht, versteht ihr? Die Eltern wollten schlafen, aber sie konnten ja sehen, dass ihr kleines Mädchen völlig aufgelöst war. ›Und wo hast du sie gesehen?‹ ›Am Fußende von meinem Bett‹, rief sie, ›ich hab geschlafen, und irgendwas hat mich aufgeweckt, und als ich die Augen aufschlage, steht sie da!‹ Das Mädchen schlug die Hände vor sein Gesicht« – Jannick zeigte genau, wie sie es gemacht hatte – »und fing bitterlich an zu weinen. ›Ich hab solche Angst.‹«
Die Geschwister hatten sich inzwischen alle aufgesetzt und lauschten seinen Worten.
»Also stand der Vater auf und brachte seine kleine Tochter zurück in ihr Bett. ›Du brauchst keine Angst zu haben …‹«
»Wo war das? Hier, in diesem Haus?«, unterbrach ihn Pattys helle Kinderstimme.
»Aber ja, gleich oben im ersten Stock, wo unsere Zimmer liegen.«
Pattys Händchen hatte sich auf ihre Lippen gelegt, vollkommen selbstvergessen sah sie zu ihrem Bruder.
»Wo, in welchem Zimmer genau?«, fuhr Theo ungeduldig dazwischen.
Jannick sah zu Sophia. »Naja …«
»Hör bloß auf. Sag jetzt nicht, in welchem Zimmer das war«, ging seine Schwester ihn an.
»Wieso?« Patty sprang auf. »War es in meinem?«
»Natürlich war’s in deinem!«, rief Theo ihr zu. »Warum meinst du, würde Sophia sonst wollen, dass Janni dir das nicht sagt?«
»Wirklich?« Die Kleine lief zu ihrem großen Bruder und griff mit beiden Händen nach seinem Arm. »Stimmt das, Janni, in meinem?«
Er sah sie ernst an und schien einen Moment überlegen zu müssen. »Äh … ich weiß nicht genau. Das … muss nicht unbedingt sein. Da oben gibt es ja eine ganze Menge Zimmer.«
Patty atmete so tief aus, dass alle es hören konnten.
»Also jedenfalls«, setzte Jannick noch mal an und schaute zu Theo, um dem Blick der Kleinen direkt vor ihm ein wenig auszuweichen, »brachte der Vater das Mädchen in ihr Bett, und dort ist sie dann friedlich eingeschlafen. Aber …«, er zog die Mundwinkel wie in einer Grimasse des Bedauerns zur Seite, »kaum war der Vater zurück in seinem Bett, hörte er die nackten Füßchen seiner Tochter schon wieder über die Dielen patschen. Die Tür zum Schlafzimmer ging auf, und sie kam ans Bett der Eltern getapst. ›Papa, Mama, die Frau mit dem Pfauenkranz – an meinem Bett – sie steht wieder da – genau jetzt!‹«
9
76 Stunden vor Totensonntag
»Wie viel?«
»Naja, rechne es doch zusammen …«
»Genau das ist es ja, was ich nicht tun möchte, Oskar.«
Patty schaute ihren Mann misstrauisch an. Verstand er das nicht? Wollte er es nicht verstehen? Mama lag nebenan im Sterben – Theo war gerade bei ihr – und ihr Mann wollte worüber reden? Über die Erbschaft? Ob es etwas zu erben gäbe? Es war ihr so peinlich, sie hätte ihn am liebsten angeschrien. Aber das ging natürlich nicht. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Weil im Haus einer Sterbenden nicht geschrien werden sollte. Weil sie auf keinen Fall wollte, dass die anderen merkten, dass zwischen ihr und Oskar irgendetwas nicht stimmte. Weil ihre Tochter Natascha sie hören würde. Weil … sie Oskar noch nie angeschrien hatte.
»Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass wir das bekommen sollen«, hörte sie Oskar neben sich murmeln, »ich meine doch bloß, dass du es mal zusammenrechnen sollst. Spaßeshalber? Wie viele Mietshäuser hat dein Großvater Hedda damals vererbt? Ungefähr fünfzehn waren das, oder? Das hast du zumindest immer gesagt. Und zwar in den besten Lagen Berlins. Charlottenburg, Schöneberg, Kreuzberg – das hat er ja ganz billig bekommen vor x Jahren, und jetzt sind die Häuser ein Vermögen wert.«
Ja.
»Deshalb … ich habe mich in München mal ein bisschen erkundigt, bevor wir losgefahren sind. Nicht offiziell, nur bei einem Freund, okay? Was die fünfzehn Häuser heute ungefähr wert sein müssten.«
Sie hörte ihm zu, obwohl sie ihm am liebsten ins Gesicht gesprungen wäre. Alles in ihr schrie danach, ihm ins Wort zu fallen, bevor er damit anfing, mit Zahlen um sich zu werfen. Aber so war ihr Verhältnis nie gewesen. Oskar war fast sechs Jahre älter als Patty und schon immer sehr selbstbewusst aufgetreten. Perfekt gekleidet, casual und doch teuer. Geschliffene Manieren, und nicht dumm. Eine gewisse Bauernschläue, so hatte Patty es nach zig Jahren Ehe für sich entschieden, konnte man ihm einfach nicht absprechen. Nur dass er diese Schläue eben vor allem für ein Ziel einsetzte: um sich selbst ein angenehmes Leben zu verschaffen.
»Er ist nicht gerade von des Gedankens Blässe geküsst«, so hatte es ihre Schwester Sophia ausgedrückt, als Patty ihr den Mann vorgestellt hatte, den sie heiraten wollte. »Aber das ist ja vielleicht gar nicht schlecht für dich, Patty‚ mit dem hast du einen, der handelt, statt groß zu reden. Nur Vorsicht. So wie der auftritt, kommt er bei Frauen gut an. Und das könnte zu einem Problem werden.« Damals war Patty stinksauer gewesen, aber mittlerweile fand sie Sophias Einschätzung ganz treffend.
»Fünfundsiebzig Millionen, wenn du mich fragst.«
»Was?« Sie starrte ihn an. Das perfekt frisierte dichte, wallende Haar. Der Bartschatten. Die geschmackvolle Brille. »Fünfundsiebzig Millionen Euro. Plus die Wertpapiere. Eure Mutter hat wirklich ganz schön was zu vererben.«
Fünfundsiebzig Millionen Euro.
»Blödsinn!«, entfuhr es Patricia. »Und selbst wenn … das bekommt sowieso alles Papa erst mal.«
»Du meinst, sie zahlen die Erbschaftssteuer zweimal? Einmal, wenn es an deinen Vater geht und in ein paar Jahren sozusagen noch mal, wenn ihr Kinder erbt? Das glaube ich nicht. Außerdem … hast du nicht mehrfach gesagt, zwischen deinen Eltern stünde es nicht immer zum Besten?«
Patricia hielt ihre noch immer kalten Hände zum Kaminfeuer, das in dem Salon, in dem sie standen, fröhlich knisterte. Sicher, von inniger Liebe gezeichnet war ihr der Umgang zwischen ihren Eltern nie vorgekommen. Und doch … bald sechzig Jahre waren die beiden inzwischen verheiratet.
»Wie kommst du darauf, dass alles Mama gehört?«
Jetzt hatte er mit diesen Erbschaftssachen angefangen – bei den Zahlen, mit denen Oskar da jonglierte, konnte sie so schnell gar nicht an etwas anderes denken. Obwohl sie in München eigentlich ganz gut von dem lebten, was Oskar mit seiner PR-Firma verdiente. Und sie selbst zog ja auch den einen oder anderen Marketingauftrag an Land.
»Das sind doch deine Eltern, Pat, ich meine ja nur. Du hast mir erzählt, dass Hedda schon darauf geachtet habe, von deinem Vater unabhängig zu sein. Und da sie die Häuser von ihrem Vater geerbt hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch vor allem ihr gehören.«
Fünfzehn Mietshäuser. Das stimmte so in etwa.
»Also, auch wenn du die Wertpapiere erst mal weglässt und nur die Mietshäuser nimmst«, hörte sie Oskar sagen, »… mein Freund in München … ich hab ihm ein bisschen erzählt, was für Häuser das sind. Er hat gesagt, über den Daumen gepeilt kann man etwa fünf Mio pro Haus veranschlagen. Bei fünfzehn Stück komme ich auf fünfundsiebzig …«
»Mama?«
Patty fuhr herum. Mit rosigen Wangen und offenen Haaren kam völlig außer Atem Natascha auf sie zu – das Zentrum ihrer Ehe mit Oskar, ihr einziges Kind. Was auch immer Oskar für ein Windhund sein mochte – sein Stolz auf die inzwischen zwanzigjährige Tochter war Patty stets echt vorgekommen.
»Onkel Theo ist gerade aus Omas Zimmer gekommen!«
»Und?«
»›Und?‹ Das fragst du? Ist dir nicht klar, dass ich ihn noch nie zuvor gesehen habe? Da kommt ein Mann aus Omas Zimmer und sagt, er ist mein Onkel Theo, aber ich kenn sein Gesicht nur von Fotos!«
10
»Nein, ich genieße es wirklich«, sagte die blonde Frau gerade, »und den Kindern gefällt es auch sehr.«
Patty versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Und doch bohrte sich jeder Satz, den die Blondine zu ihr sagte, wie eine glühende Lanze in ihre Brust.
Die Blondine war Betty, Jannicks Frau. Sie war mit ihren Kindern gegen Mittag zum Shoppen nach Berlin reingefahren und gerade zurückgekehrt.
Das Haus in Luxemburg. Die drei ach so wohlgeratenen Kinder. Jannicks Job in der Bank. Natüüürlich als leitender Angestellter und mit einem Jahresgehalt von … Patty wollte es gar nicht wissen.
»Unsere Jüngste ist vom Klavier ja nicht mehr wegzubekommen«, flötete Betty, »und ich sage mir: Soll sie doch. Was ist daran schlimm, wenn eine Achtjährige ihre Leidenschaft für die Musik entdeckt?«
Patty versuchte zu lächeln. »Ja, meine Tochter …«