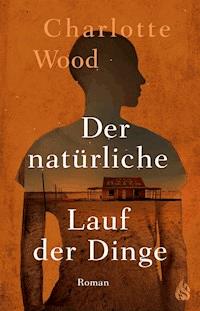
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Verla und Yolanda finden sich inmitten in der australischen Halbwüste wieder, gemeinsam mit acht jungen und attraktiven Frauen. Gefangen und beaufsichtigt in einer Baracke. Eine Flucht scheint aussichtlos, das Gelände ist von einem hohen Zaun umgeben. Ihnen werden die Köpfe kahlrasiert und sie müssen kratzige Leinenkittel tragen. Schon bald wird klar, dass sie alle etwas verbindet, doch was? Für welches 'Verbrechen' hält man sie an diesem trostlosen Ort gefangen? Und wer ist dafür verantwortlich? Nach und nach begreifen die zehn Frauen, warum sie verschleppt wurden. Dass sie Teil eines perfiden Plans sind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Charlotte Wood
Der natürliche Lauf der Dinge
Roman
Erster TeilSommer
Hier gab es also Kookaburras. Das war das Erste, was Yolanda am dunklen Morgen in den Sinn kam (das und: Wo sind meine Kippen?). Zwei Vögel brachen in ein ungehaltenes, schrilles Gackern aus, ein Ruf vor Sonnenaufgang, laut und verrückt.
Sie stand vom Bett auf und spürte grobe Bretter unter den Füßen, auf ihrer Haut den befremdlichen rauen Stoff eines Nachthemds. Wer hatte ihr das angezogen?
Sie ging über die trockenen Holzdielen, blieb stehen und reckte den Hals zu einem kleinen Fenster, um durch den engen Spalt zu blicken. Die zwei Straßenlaternen, die sie im Traum gesehen hatte, stellten sich als zwei riesige Sterne in einem tiefblauen Himmel heraus. Mit ihrem schrecklichen Kreischen durchdrangen die Kookaburras die Dunkelheit.
Später waren da noch andere Vögel; manchmal fragte sie nach ihnen, doch auf Fragen reagierten die Leute misstrauisch und sie gaben ihr keine Antwort. Dann dachte sie sich eigene Namen für die Vögel aus. Wasserfallvögel, deren Schreie herabstürzten. Oder Quietscher, die kleinen blitzschnellen Grauen. Wer hätte gedacht, dass es mitten in diesem beschissenen totalen Nichts so viele Vögel gab?
Hier nun, an diesem ersten Morgen, bevor alles begann, blickte sie in den Himmel, sah die blaue Nacht heller werden, lauschte den Kookaburras und dachte: O ja, ihr habt recht. Man hatte sie in eine Anstalt eingewiesen.
Sie tastete sich an den Wänden entlang zu einer Tür. Es gab keine Klinke. Mit den Fingerspitzen fuhr sie an den Kanten entlang – alles dicht. Sie ging wieder ins Bett und zog Laken und Decke hoch bis zum Hals. Vielleicht hatten sie recht. Vielleicht war sie verrückt, und alles wäre gut.
Sie wusste, dass sie nicht verrückt war, aber das dachten ja alle Irren von sich.
Als Darren und sie klein waren, hatten sie einmal massenweise Moos unter dem Wasserhahn auf der Rückseite des Wohnblocks gesammelt, in der feuchtkalten Ecke des Hofs, wo es selbst an den heißesten Tagen immer kühl war. Sie brachen Moosklumpen ab, die Erde schwer in ihren Händen; es erfüllte sie mit Zufriedenheit, eine Ecke anzuheben und darauf zu achten, dass das Stück nicht zerbrach. Sie wurden immer besser darin, das Moos nicht zu zerreißen und zu zerbröseln. Sie legten es in einen gesprungenen, orangefarbenen Plastikeimer und trugen es zum Straßenrand, um es zu verkaufen. »Moos zu verkaufen!«, riefen sie den vorbeibrausenden Autos zu, kicherten, gestikulierten und kasperten dabei herum. Und höflicher: »Wollen Sie nicht ein Stückchen Moos kaufen?«, wenn ein Mann oder eine Frau vorbeikam. Keiner kaufte Moos, auch dann nicht, als sie es schön am Straßenrand ausbreiteten, und Darren schickte Yolanda zweimal Wasser holen, das sie über das Moos gossen, damit es sich weiterhin geschmeidig anfühlte. Dann wurde es ihnen zu heiß; Darren ließ sie an der Straße sitzen, während er zwei Becher Wasser besorgte, doch noch immer kaufte niemand Moos. Also gingen sie hinauf und sahen fern, das Moos trocknete aus, wurde grau und staubig und welkte.
Daran musste sie jetzt in diesem Nachthemd denken, an das welke Moos, und sie liebte Darren, obwohl sie wusste, dass er es war, der sie hatte hierherbringen lassen, wo auch immer das war. Vielleicht hatte er sie in den rissigen orangeroten Eimer gesteckt und sie selbst hergetragen.
Sie brauchte jetzt wirklich eine Fluppe.
Während sie im Bett wartete, in dem Welken-Moos-Nachthemd und in der tiefen Stille – die Schreie der Kookaburras hatten so abrupt wieder aufgehört, wie sie angefangen hatten –, machte sie eine Bestandsaufnahme:
Yolanda Kovacs. Neunzehn Jahre, acht Monate. Gute Figur (sie war nur ehrlich; warum hätte sie damit angeben sollen, wo sie sich doch solche Probleme damit eingehandelt hatte?). Sie zog das raschelnde Nachthemd näher zu sich und fand heraus, dass es weniger kratzte, wenn es eng anlag.
Eine Mutter, ein Bruder – am Leben. Ein Vater, unbekannt – tot oder lebendig. Ein Freund, Robbie, der ihr nicht mehr glaubte. (Beim Gedanken an den armen Robbie verspürte sie einen Kloß im Hals. Sie schluckte ihn herunter.) Eine Nacht, ein dunkles Zimmer, dieser Dreckskerl und seine Kumpel, ein fataler Fehler. Und dann ein riesiges, heilloses Scheißchaos.
Yolanda Kovacs, verrückt. Dieses Wort machte ihr Angst, sie drehte den Kopf und weinte in das harte Kissen.
Sie hörte auf zu weinen und ging weiter ihre Liste durch. Fehlende Gegenstände: Handtasche, klar. Zigaretten, eine fast volle Schachtel, dunkelrotes Feuerzeug, Handy, Schminksachen, blaues Shirt, BH, Slip, enge Jeans. Schuhe. Drei Silberringe aus Bali, eine Kette mit Rentier-Anhänger von Darren (sie fasste sich ein weiteres Mal an den Hals, die Kette war immer noch weg).
Yolanda blickte zum Fenster. Oh, Sterne, bleibt bei mir! Doch bald schon wurde der Himmel hell und die beiden Sterne waren komplett verschwunden.
Sie atmete ein und aus, lechzte nach Nikotin, rollte sich im Bett zusammen und beobachtete die Tür.
In einem Fleckchen Sonnenlicht sitzt Verla auf einem Klappstuhl aus Holz und wartet. Als die Tür aufgeht, hält sie die Luft an. Ein weiteres Mädchen kommt ins Zimmer. Sie sehen sich kurz an, dann blicken sie zu Boden, an die Wand.
Das Mädchen bewegt sich steif in ihrem bizarren Aufzug, sie macht nur ein paar Schritte in den Raum hinein. Die Tür hat sich hinter ihr geschlossen. Der einzige freie Stuhl steht neben Verla, also steht sie auf und geht zum Fenster. Sie erträgt es nicht, so eng neben einer Fremden zu sitzen. Sie steht am Fenster und blickt durch die von Fliegendreck verschmutzte Scheibe ins Nichts. Ins Zimmer fällt helles Sonnenlicht, das jedoch nur von der weißen Holzverschalung eines anderen, nur wenige Meter entfernten Gebäudes reflektiert wird. Sie drückt das Gesicht an die Glasscheibe, kann aber entlang des ganzen Gebäudes nirgendwo Fenster sehen.
Hinter sich im Raum spürt sie das andere Mädchen, das ihre sonderbaren Kleider anstarrt. Der lange, steife grüne Leinenkittel, darunter die grobe Kattunbluse, die harten braunen Lederstiefel und lange Wollkniestrümpfe. Die altmodische Unterwäsche. Es ist Sommer. Verla schwitzt in ihrer Kleidung. Sie kann spüren, wie dem anderen Mädchen allmählich dämmert, dass Verla ein Spiegel ist, dass auch sie selbst diese albernen Kleider trägt und genauso seltsam aussieht wie Verla.
Verla versucht herauszufinden, was man ihr gegeben hat, und geht die Namen der Beruhigungsmittel ihres Vaters durch. Midazolam, Largactil? Sie will leben. Sie wühlt in ihrem Gedächtnis, ihrem Verstand, bekommt aber nichts zu fassen außer der Tatsache, dass ihre eigenen Kleidungsstücke – und vermutlich auch die des anderen Mädchens – weg sind. Sie dreht dem Mädchen langsam den Kopf zu. Große Augen mit schweren Lidern, buschige Augenbrauen, langes schwarzes Haar bis zur Taille – das ist alles, was Verla sieht, bevor sie sich wieder abwendet. Doch sie weiß, dass das Mädchen dort stumm mit herabhängenden Händen steht und auf die Bodendielen starrt. Ebenfalls unter Drogen. Verla bemerkt es an ihrer Langsamkeit, ihrer Leere. Ist es eine Ausreißerin, eine Schülerin, eine Drogenabhängige? Nichts davon, soweit Verla weiß. Aber irgendwie, selbst nach diesem nur flüchtigen Blick, kommt ihr das Mädchen bekannt vor.
Eigentlich müsste die Angst jetzt in ihr pochen. Aber logisches Denken ist nicht möglich, alles ist vernebelt von dem, was sie ihr verabreicht haben. Ihre Gedanken finden keinen Halt, wie ein Bohrkopf auf einer ausgeschlagenen Schraube.
Verla folgt dem Blick des Mädchens. Die Dielenbretter glitzern in der Sonne wie Honig. Sie bekommt Lust, sie abzulecken. Ihr ist klar, dass Angst jetzt das Einzige ist, das sie eventuell vor dem bewahren kann, was ihr bevorsteht. Aber sie hat einen Kopf wie aus Watte, zu träge dafür. Die Droge hat das Adrenalin so vollständig aufgelöst, dass sie es nicht einmal überraschend findet, hier zu sein, mit einer Fremden in einem fremden Zimmer, und diese absonderlichen, altbackenen Klamotten zu tragen. Sie kann nichts dagegen tun, kann es weder verstehen noch hinterfragen. Eine Art dümmlicher Erleichterung.
Doch sie kann horchen. Verla müht sich, ihren Nebel zu durchbrechen. Irgendwo hinter der Tür hört man das Brummen eines Gerätes – ein Kühlschrank vielleicht oder eine Klimaanlage. Aber hier an diesem Ort ist es siedend heiß und primitiv. Sie hat keine Ahnung, wo sie sind.
Das Zimmer ist groß und hell. An einer milchig grünen Wand stehen die zwei Klappstühle aus Holz – das andere Mädchen hat sich nicht gesetzt –, und am anderen Ende des Raums hängt eine Schiefertafel mit einer eingerollten Kunststofffolie. Ohne sicher sein zu können, weiß Verla, dass sie, wenn sie an dem Ring in der Mitte der Rolle zöge, sich eine Karte von Australien vor ihr auftun würde, gelb und orangerot eingefärbt und mit blauem Wasser ringsherum. Die Karte wäre blank gewetzt und leicht zerknittert von all den Jahren des Auf- und Abrollens, und sie würde irgendwo die Wahrheit darüber enthalten, an welchen Ort sie gereist ist in all den Stunden. Wenn ihr Verstand erst wieder funktioniert, wird sie klar denken können. Sie wird es schon noch herausfinden, sie wird Verantwortung für sich übernehmen, wird Informationen einfordern und die höchste Instanz anrufen, sie wird nicht ruhen und irgendwie dahinterkommen, warum sie offenbar mitten hinein in die bescheuerten Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts entführt wurde.
Draußen kreischt ein einzelner Weißhaubenkakadu; immer näher und lauter kommt das Geräusch, bis es den Raum füllt wie Mord. Sie und das Mädchen sehen einander wieder an, dann blickt Verla hinaus zu dem Himmelsspalt. Der Vogel flattert durch die Schneise zwischen den Gebäuden und ist verschwunden.
Verla bemüht sich erneut, und dieses Mal zieht sie aus ihrer klebrigen, wabernden Erinnerung die verschwommenen Umrisse eines Fahrzeugs in der Nacht. Realität oder Traum? Ein Bus. Gelb glänzend in der Finsternis. Entschlossene, feste Hände heben sie hoch und schubsen sie hinein. Irgendwann in der Dunkelheit wacht sie auf, ungewohnte Velourspolster an der Wange. Scheinwerfer beleuchten eine lange, gerade, leere Straße. Ist sie aufgestanden, hat sie geschwankt? Schrie sie, wurde sie hinuntergedrückt? Sie reibt sich das Handgelenk bei der traumschweren Erinnerung an Handschellen und Geländer.
Unmöglich.
Der Traum geht weiter – wie sie aus dem Bus gezogen und festgehalten wird, zu sprechen versucht; raue Hände, die zupacken, der Geschmack von Staub in der trockenen, stillstehenden Nacht. Sie war weit weg von zu Hause.
Jetzt ist sie hier, in diesem Zimmer.
Wieder lauscht Verla angestrengt. Es scheint nun so, dass Lauschen ihre einzige Hoffnung ist. Sie hört in der Ferne eine Tür knarren, einen Vogel piepsen. Irgendwann wird es ein Geräusch geben, von einem Auto, einem Flugzeug, einem Zug, von irgendetwas, wodurch sie sich verorten können. Es wird Schritte geben, Gesprächsfetzen, die Anwesenheit von Menschen in anderen Zimmern. Sie blickt aus dem Fenster auf die Holzverschalung. Da ist nichts. Der Motor ruckelt – es ist ein Kühlschrank – und schaltet sich aus.
Jetzt hört man gar nichts mehr bis auf den langsamen, regelmäßigen Atem des Mädchens. Sie hat sich bewegt und sich auf einen der Stühle gesetzt. Mit gespreizten Beinen sitzt sie da, die Stirn in den Händen, die Ellbogen auf den Knien. Ihr schwarzes Haar ein Vorhang, der fast bis auf den Boden reicht.
Verla möchte sich auf die Dielenbretter legen und schlafen. Doch irgendein Urinstinkt kämpft sich an die Oberfläche des Bewusstseins und sie zwingt sich, stehen zu bleiben. Minuten vergehen oder auch Stunden.
Schließlich spricht das Mädchen, ihre Stimme ist kehlig und belegt. »Hast du eine Zigarette?«
Als Verla sich zu ihm umdreht, fällt ihr auf, wie frisch sie aussieht, wie jung. Und, erneut, wie vertraut. Als hätte sie das Mädchen vor langer Zeit einmal gekannt. Als hätte es ihr einmal gehört und sie es später ausrangiert, wie eine Puppe oder einen Hund. Und hier ist sie nun, zurückgekehrt, eine Schauspielerin auf der Bühne; auch Verla ist wieder da und beide tragen sie diese seltsamen Kleider, wie man sie von altertümlichen Handpuppen kennt. Vielleicht war alles nur Einbildung. Aber Verla weiß, dass dem nicht so ist. Die Puppe macht den Mund auf, um weiterzusprechen, und Verla sagt im selben Moment »Nein«, als das Puppen- oder Hunde-Mädchen fragt: »Weißt du, wo wir sind?«
Vor der Tür im Flur sind Stimmen zu hören, und in einem plötzlichen Anflug von Geistesschärfe wird Verla klar, dass sie das Mädchen hätte fragen sollen, woher sie gerade kommt, was draußen vor der Tür ist; ihr wird klar, dass sie ihre letzte Chance vertan hat zu erfahren, was nun auf sie zukommt. Aber es ist zu spät. Es sind Männerstimmen, laut, fröhlich, alltäglich. Kurz bevor die Tür sich öffnet, stürzt das Mädchen durch das Zimmer zu Verla, sodass sie nebeneinander mit dem Gesicht zur Tür und mit dem Rücken zum Fenster stehen. Als die Tür aufgeht, finden sich die Hände der beiden Mädchen und umschließen sich.
Ein Mann trampelt ins Zimmer. Geräusche von Leben und Bewegung hallen hinter ihm durch den Gang: eine andere Männerstimme, das Scheppern von Besteck oder Messern. Leise metallische Geräusche, Instrumente, die klappernd in einem Ausguss oder in einer Schüssel landen.
Verla bekommt weiche Knie, sie fällt fast. Der Griff des anderen Mädchens um ihre Hand wird fester, und Verla muss überrascht erkennen: Sie ist stärker als ich.
»He!«, sagt der Mann verhalten, als wäre es ihm peinlich, sie hier vorzufinden. Dicke braune Dreadlocks fallen ihm bis auf die Schultern und rahmen das ausdruckslose, goldene Gesicht eines jungen Hippies ein. In seinem Blaumann tritt er von einem Bein aufs andere, an den Füßen große schwarze Stiefel. Overall und Schuhe sehen neu aus. Er fühlt sich nicht wohl darin. Mit verschränkten Armen steht er da und beugt sich immer wieder zurück, um durch die Tür zu sehen, als warte er auf jemanden.
Er sieht sie an, mustert sie in ihrer steifen, seltsamen Montur. »Schätze mal, ihr fühlt euch beschissen.« Eine heisere, träge Kifferstimme. Er streckt sich, reckt die Arme mit aneinandergelegten Handflächen weit nach oben, dann beugt er sich vor, knickt in der Taille ab, der Kopf berührt die Knie, die Hände den Boden, so atmet er tief und regelmäßig. Sonnengruß, denkt Verla. Dann richtet er sich auf und seufzt gelangweilt.
»Das wird sich wohl bald legen«, nuschelt er in sich hinein und blickt erneut durch die Tür.
Die Mädchen bleiben, wo sie sind, die Hände umschlossen.
Jetzt kommt ein weiterer Blaumann herein. Geschäftig, entschieden.
»Okay«, sagt er. »Wer will zuerst?«
Yolanda lehnteam Fenstersims, hielt die Hand des anderen Mädchens, damit sie nicht umfiel, ihr Hals fühlte sich wund und geschwollen an, als hätte man ihr im Schlaf etwas in den Rachen gestopft. Das Sprechen schmerzte ein wenig, aber sie hörte sich sagen: »Ich gehe als Erste.«
Zu welchem Zweck, das wusste sie nicht. Sie betete nur, dass sie schleunigst die Dosis von diesem Scheiß hochsetzen würden, wenn nicht, dann würde sie spucken und kratzen, bis sie es täten. Der Mann ging auf sie zu, beugte sich vor und hakte eine kleine Leine in einen Metallring, der ihr bislang nicht aufgefallen war, an der Taille ihres Kittels ein, sodass sie die Hand der Kleinen loslassen musste. Zum ersten Mal sah sie das andere Mädchen dort am Fenster richtig an, das Licht umspielte ihre weichen rotbraunen Locken. Ihre blauen Augen weiteten sich vor Schreck, ihre sommersprossigen Wangen wurden sogar noch blasser als das Licht draußen. Yolanda wollte sagen: Mich holen sie, du blöde Kuh, du bleibst verschont.
Aber sie wusste, dass sie den einfacheren Weg ging: Sie würde herausfinden, was auf sie zukam, während das andere Mädchen eine weitere Minute oder Stunde oder noch ein ganzes Jahr wartend in diesem Zimmer ausharren müsste.
Als der Mann sie in den nächsten Raum brachte, das andere Ende ihrer Leine an dem schweren Drehstuhl befestigte und wieder ging, sah sie sich nach Kabeln und Steckern und weiß der Himmel was um. Ihr stand der Tod bevor, vielleicht Folterqualen, und sie begann, nach Drogen zu schreien.
Als sie wieder zu sich kam – sie gewöhnte sich langsam an das Wegdämmern und Wiederauftauchen –, nahm sie wahr, dass der Kiffer mit den Dreadlocks erst vor ihr, dann hinter ihr stand und in seiner Hand etwas stählern aufblitzte. Sie schloss die Augen in einem heftigen Anfall von Übelkeit, doch dann löste sich das Adrenalin schlagartig in Erleichterung auf und ihre Eingeweide drohten sich zu zersetzen, weil sie begriff, dass man ihr nicht die Kehle durchschneiden würde.
Man verpasste ihr einen Haarschnitt.
Erleichtert sank sie zusammen und ja, fast hätte sie sich vollgeschissen, tat es aber nicht, sie dämmerte lediglich wieder weg, bis es vorbei war. In diesen Augenblicken spürte sie nur, wie die fettigen, wolligen Spitzen der Dreads des Kiffers ihr über Hals und Schultern strichen, während er arbeitete. Spürte, wie er an ihrem Kopf zog und ihn wieder losließ, zog und wieder losließ. Sie gab sich der Berührung hin, während die Schere sich durch ihre Mähne arbeitete, und sie fühlte einen kühlen Luftzug auf der Haut, wo früher Haar gewesen war.
Wie eine andere Art Droge durchflutete die Erleichterung sie schwer, kalt und silbrig wie Blei. Das arme Mädchen da drüben, dachte sie. Doch sie verachtete sie auch dafür, dass sie sich die Angst, von der sie überwältigt wurde, so anmerken ließ. Such dir eine andere Scheißhand, an die du dich klammern kannst!, dachte Yolanda dort auf dem Stuhl und schloss wieder die Augen.
Sie hörte den Kiffer flüstern: »Diese Schere ist verdammt stumpf.« Und Yolanda hätte schwören können, dass da Schritte waren, huschende Frauenschritte hinter ihr auf dem Linoleum. Sie konnte eine Frau riechen, einen weiblichen Duft nach Kosmetik, und hörte leises Kichern, dann sank alles weg und nahm sie mit, bis das kalte Surren eines elektrischen Rasierapparates an ihrem Nacken anhob und sie wieder aufschreckte.
Falls da eine Frau gewesen sein sollte, war sie nun weg. Nur der Kiffer war da und widmete sich seiner Arbeit. Er rasierte ihr jetzt den Kopf, fuhr die Form ihres Schädels nach, zog weite Bahnen auf ihrer zarten Haut. Yolanda stöhnte laut auf, als sie ihren halb geschorenen Kopf spürte. Darauf verharrte der Rasierer kurz in der Luft, und der Kiffer sah sie gereizt an. Er runzelte die Stirn und sagte: »Halt’s Maul.« Und dann, als wollte er das Wort testen, als hätte er es nie zuvor gesagt und gerade eben erst gelernt, fügte er hinzu: »Du Schlampe.«
Sie blickte zu Boden. Haar war lediglich Haar. Doch es gab so viel davon, erst lange glänzende Strähnen, dann kleine, funkelnde schwarze Häufchen, die den Boden wie winzige dunkle Kreaturen bedeckten und nur darauf zu warten schienen, zum Leben erweckt zu werden.
Als er fertig war, wich der Mann einen Schritt zurück, drückte die Schultern durch und streckte die Arme wieder nach oben, wie er es in dem anderen Zimmer getan hatte. Der Rasierer glitzerte in seiner Hand – er schien gelangweilt und erschöpft. Nachdem er die Leine losgemacht hatte, gab er dem Stuhl einen Stoß, sodass der einen Satz nach vorn machte und Yolanda abwarf. Sie fiel vornüber, stolperte, fing sich und kam zum Stehen. Alles Sanfte an diesem Kiffer war verschwunden, als er sie jetzt mit seinen starken Händen vorwärtsschubste, sie durch eine Tür stieß und »Die Nächste!« brüllte. Wie ein Schaf, das durch einen Treibgang ins grelle Licht eines beschissenen, furchtbaren Schafpferchs getrieben wird, landete Yolanda rudernd in einem anderen Raum – voller kahler und verängstigter Mädchen.
Der zweite Mann, der bleiche, pockennarbige, ist wieder mit Verla im Zimmer. Er dreht sich zur Tür. Mit der Hand auf dem Knauf sieht er sie an. »Kommst du?«
Ihr Mund ist trocken, sie begreift gar nichts. Sogar das Mädchen, das man abgeholt hat, schien zu verstehen – warum sonst hätte sie mit dieser tonlosen, barschen Stimme gesagt, dass sie als Erste gehen wolle? Was wusste sie? Nachdem das Mädchen ihre Hand losgelassen hatte, waren Verlas Finger zum Fenstersims geflogen. Nun muss sie sich darauf konzentrieren, ihren Griff zu lösen.
Schließlich erwacht ein Instinkt. Sie fährt sich mit der Zunge über die Zähne, die pelzig sind wie ihr Gehirn. Sie hört ihre eigene belegte Stimme tief drin in ihren Ohren, als sie sagt: »Ich muss wissen, wo ich bin.«
Der Mann steht da, groß und schmal, die Hand noch immer am Knauf, überrascht. Fast mitfühlend sagt er: »Oh, Süße. Du musst wissen, was du bist.«
Und auch er zieht eine schmale kleine Leine aus der Tasche wie die, die man dem anderen Mädchen angelegt hat. Er geht zu ihr, beugt sich vor, um die Leine in den Metallring an ihrer Taille zu haken. Sie riecht ihn: sauer wie alte Milch.
»Komm schon«, drängt er sie, als sei sie ein kleiner Hund, und zieht ein wenig an der Leine. Sie taumelt vorwärts und folgt ihm nach draußen.
Während sie wacklig und stockend hinter dem Mann hertrabt, versucht sie, ihre Umgebung zu erfassen. Outback kommt ihr als Erstes in den Sinn. Dann: Müllhalde. Da stehen ein paar verblichene farblose Gebäude aus Hartfaserplatten, in den Paneelen hier und da zerklüftete schwarze Löcher. Dächer aus fleckigem grauen Blech, krumme, herabhängende Regenrinnen. Schmale schwarze Fensterschlitze, abblätternde Farbe an den Rahmen. Stapelweise Wellblech, morsches Holz und alte Ölfässer rechts und links. Drahtgewirr. Ein verrosteter Traktor, ein Haufen Eisenrohre und Stangen, durch die Lücken lugt welkes weißes Gras. Keine Bäume. Und – sie sieht sich schnell um – außer dem eingerosteten Traktor keine Fahrzeuge. Kein gelber Bus.
Sie gehen weiter, die schweren harten Lederstiefel sind zu groß und scheuern an ihren Knöcheln.
»Mach schon«, sagt er und zieht wieder an der Leine. Sie kommen an einem Wassertank vorbei, aufgebockt auf Ziegelsteinen, ein runder Deckel lehnt dagegen. Rostflecke bluten aus großen zerfurchten Rillen an der Seite des Tanks. Der Mann zerrt sie weiter. »Mann, bist du lahm!«, schimpft er, als wäre sie ein alterndes Tier, das er an der Leine führt. Sie ist durstig. Die niedrigen Gebäude – eins, zwei, drei kann sie sehen, plus das, aus dem sie gekommen sind – spenden keinen Schatten in diesem harten Sonnenlicht, und kein Baum weit und breit. Ein grasüberwachsener Feldweg verliert sich im weißen Dunst hinter den Gebäuden. Sonst sind da nur der niedrige weiße Himmel und die staubige Erde.
Es kann nicht der Outback sein, wo Verla noch nie gewesen ist. War denn überhaupt schon jemals jemand dort? Im Outback sollte die Erde doch rot sein. Die Erde unter ihren Stiefeln ist nicht rot. Man kann es kaum Erde nennen – einfach nur ausgetretener Boden, grauer Kies, Staub.
Sie geht fast ein in diesen blöden Amish-Klamotten. »Ich habe Durst«, sagt sie.
»Halt’s Maul«, sagt der Mann. Er hat es satt, sie herumzuführen wie einen Esel. Man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber nicht zwingen zu trinken. »Man kann eine Hure zur Kultur führen«, hieß es über sie in den Medien. Verla denkt an den leeren Wassertank, ein verrücktes Lachen steigt aus ihrem Bauch auf, vertrocknet aber, bevor es herauskommt.
Ihre Füße knirschen über einen Fleck stoppeligen welken Grases, vorbei an einem lang gestreckten Betonblock – Viehställe oder aufgelassene Toiletten. Dann kommen sie zu einem niedrigen Holzhaus. Drei morsche Stufen führen zu einer schmalen Veranda. Der Mann reißt eine alte Fliegengittertür auf, und sie knallt gegen die verwitterten Bretter.
»Aufnahmestelle«, sagt er. »Komm schon.«
Innen ist ein muffiges provisorisches Büro. Ein Schreibtisch, eine Pinnwand voller eingerollter Zettel, so alt, dass die Schrift darauf vollkommen verblasst ist. Er lässt die Leine los und schiebt Verla zu einem grünen Plastikgartenstuhl, dann lässt er sich schwer in einen abgewetzten Bürostuhl aus Kunststoff fallen. Er fängt an, Stapel handbeschriebener Seiten auf dem Schreibtisch durchzublättern. Verla wirft den Kopf zurück, atmet die stickige Luft ein und starrt an die Decke. Zart gewobene, kreisrunde Zitterspinnennetze hängen herab und wabern in der Luft. Plötzlich schnappt sich der Mann einen altmodischen Stempel und ein Stempelkissen und stempelt wie verrückt drauflos. Dieses Mal lacht Verla laut auf. Das kann alles nicht wahr sein.
Der Mann hört auf zu stempeln und sieht sie geduldig an, mit den Zähnen des Unterkiefers fährt er an seiner Oberlippe entlang. »Was ist so lustig, Durstige?«
»Aufnahmestelle! Habt ihr nicht mal Laptops? Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß?« Verlas Stimme ist schrill und hysterisch. Die Wirkung der Drogen hat nun fast nachgelassen, bis auf ihren schrecklich trockenen Mund.
Mit einem leisen, schnaubenden Lachen widmet sich der Mann einfach wieder den Papieren.
Sie lässt nicht locker. »Ich brauche ein Glas Wasser und dann muss ich telefonieren.«
Der Mann seufzt und hört mit dem Papiergeraschel auf. Als wäre er in einem Theaterstück, in dem er die Aufgabe hatte, mit Papier zu rascheln, und Verla hätte seine Vorstellung gestört. Ernst und ganz genau besieht er sich das Blatt in seiner Hand, dann legt er es lächelnd weg. Er beugt sich über den Tisch und spricht mit einer gruseligen Babystimme mit Verla. »Hattest du denn auf unserem kleinen Spaziergang keine Augen im Kopf, Durstige? Warum, glaubst du, habe ich dir gerade alles gezeigt?«
Verla schnürt es die Brust ein. »Ich muss mit meinen Eltern sprechen.« Sie sagt nicht: mit meinem Vater.
Jetzt ist er sauer. »Verdammte Scheiße, Prinzessin! Siehst du hier Telefone? Computer? Funkmasten da draußen?«
Zweifel überkommen sie. »Nein«, sagt sie, und was sie meint, ist: Ich weigere mich, das zu glauben. Schließlich wird sie wütend, springt auf und will schreien, denn das ist nun wirklich nicht mehr auszuhalten, dieses blöde, saublöde Spiel, dieses Theater, dieser Scheißdreck, doch der Mann kommt flink um den Schreibtisch herum und gleich darauf rammt er ihr seinen großen schwarzen Stiefel so hart in den Bauch, dass sie gegen die Wand fällt.
Während Verla sich weinend auf dem staubigen Boden krümmt, geht Boncer zum Schreibtisch und zu seinen raschelnden Papieren zurück.
»Wer bist du? Der Dorftrottel?«
Da standen sie am helllichten Tag auf dem Kies, eng aneinandergedrängt in ihren dicken kratzigen Kleidern. Zehn Mädchen, alle mit frisch geschorenen Köpfen. (Yolanda hörte noch das kalte Klappern der Scherenklingen an ihren Ohren, spürte die Haare, die ihr in den Schoß gefallen waren wie Motten.) Alle trugen die gleichen sonderbaren Zuchthauskittel, die haferfarbenen Kattunblusen, steinharte Lederstiefel und grobe gestrickte Strümpfe wie in einer Country-Show aus den Achtzigern. Oder noch früher.
Yolanda dachte an die beiden Sterne, die sie in der Nacht gesehen hatte. Riesige Scheinwerfer am Himmel. Einer, so groß wie ihre Fingerspitze, hatte sich bewegt! War das möglich? Mit ihrem vernebelten Gehirn hatte sie gedacht, ein Raumschiff käme zu ihrer Rettung.
Der dünne Mann fragte noch einmal, ob sie der Dorftrottel sei, stellte sich vor sie und blickte ihr direkt ins Gesicht. Er war nicht viel älter als das älteste Mädchen hier, vielleicht fünfundzwanzig. Die schuppige Haut seines langen flachen Gesichts war stellenweise von Aknenarben gezeichnet. Nun stand er so dicht vor Yolanda, dass sie an seinem Kinn, direkt unterhalb des rechten Mundwinkels, die Schwellung eines in der Entstehung begriffenen Pickels sehen konnte.
Sie wusste es besser, als ihm zu antworten.
Er nuschelte zum Boden hin, dass sie sich aufstellen sollten. Während er wartete, bis sie schlurfend eine Reihe gebildet hatten, verzog er den Mund, drückte vorsichtig mit dem Finger auf den wachsenden Pickel und zuckte zusammen.
Ein kräftiges Mädchen mit heller Haut, drallen Wangen und breiten Schwimmerinnenschultern sagte ärgerlich: »Was? Wir können dich nicht hören!« Dann schloss sie die Augen vor der Sonne, stemmte die Hände in die Hüften und brummte etwas in sich hinein. So sah sie den behänden, tänzerischen Sprung des Mannes nicht, der unglaublich anmutig und leicht über den Kies kam, sah nicht den lederbezogenen Stock in seiner Hand, der sie mit einem Wusch seitlich am Kinn traf. Alle kreischten gemeinsam mit ihr auf, als sie fiel und vor Schmerz schrie. Einige Arme streckten sich und versuchten, sie aufzufangen. Sie duckten sich. Ein paar der Mädchen fingen an zu weinen, während sie sich hastig wieder aufstellten.
Der Mann, Boncer, warf ihnen einen betrübten Blick zu, als trügen sie die Schuld an dem Knüppel in seiner Hand, dann seufzte er. Das Mädchen mit den dicken Backen wiegte sich auf den Fersen und stöhnte, ihre Arme umfingen den Kopf und das Kinn, das von dem gewaltigen Schlag sicherlich gebrochen war. Yolanda erwartete, dass Boncer zu dem Mädchen ging und Erste Hilfe leistete. Dass er besorgt aussah. Aber er stand nur da und befingerte seinen Pickel, bis die Mädchen zu beiden Seiten der Geprügelten sie sanft an den Ellbogen fassten und hochzogen.
»Jetzt wird marschiert«, sagte Boncer unwirsch. Er drehte seinen braunen Lederstock in den Händen, die harten, schlampig gesäumten Nähte wie eine stümperhaft geflickte Wunde. Wie eine Narbe, die noch schlimmere Narben machen konnte.
Panisch starrten sie ihn an.
Neben Yolanda holte jetzt ein Mädchen mit schweißglänzender Stirn und Blick auf den Stock mit den Armen aus und begann, auf der Stelle zu marschieren. Sie wusste, was zu tun war. Als würde sie einen Trupp Soldaten und nicht Mädchen anführen. Aus ihrem kleinen Körper kam eine dünne leise Stimme: »Links, links, links-rechts-links.« Sie befehligte ein … ein Bataillon und warf die Arme hoch in die Luft.
»Oh, ja!«, schrie Boncer und stellte sich neben sie. »So geht das, meine Damen. Folgt der Soldatenhure. Du als Nächste, Dorftrottel.« Er rannte die Reihe entlang und hakte die Leinen der Mädchen aneinander, dann eilte er an die Spitze. Auch er holte nun weit mit den Armen aus und trampelte im Takt, während er »links-rechts-links« brüllte und die zerfledderte Reihe geschlagener Mädchen in ihren altertümlichen Kleidern unter der glühenden weißen Sonne über die Weiden führte.
Das war purer Irrsinn, wusste Yolanda. Doch sie würde sich ihm zusammen mit ihren neuen Schwestern mit derselben stillen Ehrfurcht ausliefern, wie sie und Darren sich als Kinder während der jährlichen Ferien mit ihrer Mutter dem kühlen Dunkel einer Höhle am Ende des weißen Sandstrandes ausgeliefert hatten.
Links-rechts-links.
Yolanda und Darren, die mit ihren weichen nackten Füßen über die kalten rundgespülten Kiesel in die nasse Höhle getreten waren und teils vor Angst, teils vor Spannung geschaudert hatten.
*
Die Mädchen marschierten zwei Stunden lang.
Yolanda unterdrückte ihre Panik, indem sie an früher dachte. Sie zählte Häuser, Schulen, Freunde, zählte die Jahre zurück in ihre Kindheit, bis sie in der alten Wohnung in der Seymour Road angelangt war. Sah Mutters Schachteln mit Wachs in der stockigen Diele aufgereiht, die Haare anderer Leute in der Badewanne. Die durchgesessene grüne Samtcouch, auf der sich an einem Ende die fadenscheinigen rosa Handtücher mit den weißen Bleicheflecken stapelten. Im Zimmer ihrer Mutter, unter dem Bett, die schwere, haferschleimfarbene ausklappbare Massageliege, die Gail immer ins Wohnzimmer schleppte und aufstellte, wenn sie eine Kundin hatte.
Die Kinder erfuhren nie, woher sie wusste, wann eine Kundin kommen würde. Gail sagte meist beiläufig: »Um drei Uhr kommt Mrs Goldman«, oder: »Wendy Pung wird gleich hier sein.« Dann rutschten die Kinder von ihren Horsten aus gefalteten Handtüchern, gingen ins Bad, schalteten den Boiler an und saßen dann im Schneidersitz auf dem Boden vor dem Fernseher, während ihre Mutter eine dickbeinige Frau in die Wohnung bat. Ihre Kindheit bestand aus dem buttrigen Geruch von Wachs, aus scharfen leisen Reißgeräuschen und zischendem Atem, wenn ihre Mutter die Wachsbahnen abriss und die Frauen leise ächzten. Gails Hände waren weich und kühl, flüsternd tätschelte sie die weiße Haut der Frauen, wenn sie deren Unterwäsche in diese und jene Richtung zog. Yolandas Aufgabe war es, hinterher die Wachsklumpen in dem kleinen, verbeulten Blechtopf auf der Elektroplatte zu schmelzen, die Baumwollstreifen herauszufischen und wegzuwerfen und das heiße Wachs durch eine Strumpfhose in den großen Kanister zu sieben. (»Natürlich ist es sauber!«, schrie die Mutter, die Hände in den Hüften, wütend den Mann vom Gesundheitsamt an, bevor sie eine Geldstrafe bekam, weil sie ihr Geschäft nicht angemeldet hatte.) All die krausen schwarzen Haare und auch die hellen feinen verfingen sich im Gewebe des Nylonstrumpfs.
*
Ihre Stiefel rieben durch die feuchten Socken hindurch schmerzhaft an ihren Fersen. Die einzigen Geräusche waren das schwere angstvolle Keuchen der Mädchen beim Marschieren, der Tritt ihrer Stiefel auf dem steinigen Boden. Und das helle leise Klimpern der Verschlüsse der Leinen in den Metallringen.
*
Mitunter lagen die Kundinnen ihrer Mutter rücklings auf der Liege, Augen geschlossen, die Hände auf dem Bauch gefaltet, während Gail ihnen das Gesicht mit sämigen Lotionen einschmierte und feuchte Wattebäusche auf die Lider drückte. Manchmal plauderten die Frauen, während Gail arbeitete: über Immobilien, über Geschäfte, die dichtmachten, über ihre vagabundierenden Söhne, über Klinikaufenthalte ihrer Freunde. Ihre Stimmen ein angenehmes Säuseln zum Ton der Zeichentrickfilme im Fernsehen. Oder sie lagen in Unterwäsche auf ihren weichen, vorquellenden Bäuchen, während Yolandas Mutter sie massierte, das dicke weiße Fleisch an Rücken und Schenkeln walkte, sich durch ihre Körper vor- und zurückarbeitete. Oft lehnten Yolanda und Darren sich dann leise auf den Fersen zurück und sahen das Gesicht der Frau an, das in das gepolsterte ovale Loch in der Massageliege gedrückt wurde. Die Augen der Frau waren immer geschlossen, ihr Gesicht war platt und verzerrt durch den Druck von oben, der Mund breit, ihre Lippen lagen flach an den Zähnen. Die Frauen erinnerten an die Fotos von Astronauten, kurz bevor sie ins All reisten. Yolanda und Darren grinsten einander heimlich an, wenn die Frauen manchmal sabberten und leise grunzten, während ihre Mutter sie oben bearbeitete. Gelegentlich schlief eine ein und begann leise zu schnarchen, und dann lächelte auch Gail zusammen mit den Kindern.
Bevor sie gingen, warfen die Frauen fast immer einen Blick ins Zimmer und flüsterten Gail zu: »Mein Gott, Sie haben ja eine tolle Tochter.« Manchmal blieben die Leute auch auf der Straße stehen und sagten: »So eine Schönheit!« Machten Witze über Gemischtrassige. Und: »Wie exotisch!« Und: »Wenn sie erst älter ist.« Und über Schlösser und Schlüssel und Jungs.
Wenn die Frauen gegangen waren, wurde die Massageliege eingesprüht und abgewischt, zusammengeklappt und wieder unter Gails Bett geschoben. Handtücher wurden gewaschen, der Wäschetrockner im Bad fing an zu surren und füllte die Wohnung mit süßlich duftender, feuchtwarmer Luft.
*
Nachdem der Weg geendet hatte, wurde der Marsch beschwerlicher. Die Reihe bewegte sich langsamer, als die Mädchen in ihren Lederstiefeln, in denen sie keinen Tritt fassen konnten, unbeholfen einen Hügel hinaufstiegen. Der Pfad, der eigentlich kein richtiger Weg gewesen war, lediglich bleiches niedergetretenes Gras, war immer undeutlicher geworden und ungefähr nach der ersten halben Stunde ganz verschwunden. Hin und wieder blieb Boncer stehen, kniff die Augen gegen die Sonne zusammen, blickte nach Osten und nach Westen, dann drehte er sich um und warf den Mädchen einen mürrischen, verächtlichen Blick zu, bevor er weiterging. Wusste er denn überhaupt, wohin sie wollten?
*
Die Leute in der Nachbarwohnung waren Deutsche, auf ihrem Balkon ragte eine australische Flagge an einem richtigen Fahnenmast auf. Mit breitem Akzent beschwerten sie sich untereinander über den Gestank von Darrens Mäusen, die auf dem Balkon von Yolandas Mutter in einem Vogelkäfig lebten. Die Mäuse stanken wirklich – säuerlich, scharf, muffig. Alle paar Wochen kamen neue Mäuse zur Welt und der Boden des Käfigs wurde zu einem glitschigen Berg aus altrosa Daumen, unbehaart und bedrohlich durch ihre Rohheit und Bedürftigkeit. Wenn die Jungen zehn Tage alt waren – ihr Pelz war dann so weich, dass man sie an die geschlossenen Lider schmiegen wollte, doch sie wanden sich und stanken –, schaufelte er sie mit dem Kehrblech heraus, legte sie in einen Eimer und trug sie die Treppen hinunter. Auf der Rückseite des Wohnblocks, oben neben dem Liguster hinter der Waschküche, kippte er sie aus dem Eimer und sah zu, wie sie blind in alle Richtungen rannten. Die Muttermaus und die beiden großen dicken Schwarzen schienen kaum zu bemerken, dass die Jungen weg waren. Die Dicken schnupperten an den Käfigrändern. Yolanda nahm an, dass sie die Väter der Babys waren, die unaufhörlich kamen.
Yolanda fürchtete sich vor der Muttermaus und ihrer kalten Dauerproduktion. Sie wusste, dass dies etwas mit ihr zu tun hatte, nicht mit Darren. Dass die zappelnden Jungen etwas mit der Haarlosigkeit der Frauen auf Gails Liege zu tun hatten, mit all den Cremes und Lotionen, mit den Worten, die ihrer Mutter zugeflüstert wurden: »So eine Schönheit!« Doch darin schwang etwas Erwachsenes, Unangenehmes mit, eine gewisse Erwartung.
Und es hatte mit diesem Ort hier zu tun, wusste Yolanda, mit ihrer Anwesenheit in der Reihe verunsicherter, sich dahinschleppender Mädchen. Manche hinkten nun schwer, während sie weiterstolperten, aneinandergekettet wie Gefangene. Sie waren Gefangene.
Zwei Stunden Marsch, die Mädchen schluchzen leise, ihre Füße bluten die Socken voll. Verla, die Letzte in der Reihe, beobachtet, wie sie vor ihr den Hang hinaufhumpeln, sie bewegen ihre Arme nicht mehr im Takt – zumindest solange dieser Boncer sich nicht umdreht und sie finster ansieht –, sondern rudern mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten, während sie den blassen, unebenen Grashügel erklimmen.
Boncer schwitzt, sein blauer Overall hat dunkle Schweißflecken unter den Achseln, an seinem schmalen Rücken zeichnet sich ein feuchtes Kreuz ab. Doch die Mädchen in ihren Kattun- und Leinenkleidern, den Schnallen, den groben Wollstrümpfen, den harten Stiefeln mit Ledersohlen, die über das welke Gras rutschen, schwitzen noch mehr. Manche haben den Latz ihres Kittels aufgehakt, sodass er herunterhängt, aber das macht das Gehen noch beschwerlicher. Alle haben die kratzenden Kattunärmel aufgerollt und die Haut an ihren Unterarmen entblößt. Als Verla aufblickt, statt nach unten auf ihre Füße und den holprigen Boden, wo jeder Schritt ihre Knöchel gefährdet, sieht sie, dass die Nacken und die nackten, kahlen Köpfe aller Mädchen glühen.
Das Land, das sie zunächst für flach gehalten hat, ist in Wirklichkeit eine weite seichte Schale. Die Ränder bilden einen Kamm, und wenn Verla sich umschaut, sieht sie, dass er das ganze Lager umschließt. Nun klettern sie eine Seite der Schüssel hinauf, dorthin, wo sich spärliches Gebüsch und Gestrüpp vom Kamm ausbreitet; da die Sonne so hoch steht, kann man unmöglich sagen, ob das Gebiet im Osten, im Westen oder sonst wo liegt. Doch abgesehen von diesem hervorspringenden Bewuchs ist die Schüssel leer und ausgekratzt.
Als Boncer sich ächzend umdreht, ist sein Gesicht rot bis zu den Wurzeln seines fettigen schwarzen Haars, seine Oberlippe glänzt nass. Er sieht nicht gesund aus. Dann stapft er an der Marschspitze weiter, inzwischen offenbar zu müde, um den Stock zu erheben oder ihnen wie am Anfang zu befehlen, dass sie sich straffen oder mit den Armen weiter ausholen sollen.
Wo sind sie? Ab und zu dreht sich eine von ihnen schnell um und stellt dem Mädchen hinter ihr diese Frage: »Wohin gehen wir?«





























