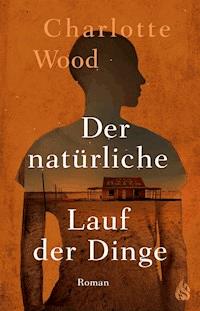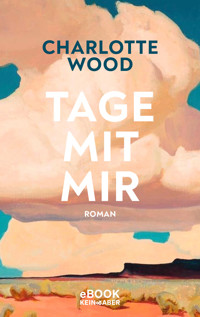
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sich fernab vom hektischen und geselligen Stadtleben einfach mal ins Kloster zurückziehen, sich diesem neuen, stark verlangsamten Rhythmus anpassen und ganz neu aufs eigene Leben schauen, das ist Thema dieses einfühlsamen Romans.
Wie lange der Aufenthalt im Kloster in den Monaro Plains dauern würde, war ihr nicht klar, aber er dauerte länger, als es die Städterin mittleren Alters aus Sydney erwartet hätte. Denn weder glaubt sie an Gott, noch hat sie jemals gebetet, aber müde von Arbeit und Stadtleben, hat sie sich eher zufällig für diese Form von Rückzug entschieden und ist vorerst einfach mal geblieben. Das ermöglicht ihr, auf überraschende Weise, zu sich selbst zu finden und sich mit Fragen zur Vergangenheit, Liebe, zu Krankheit und Tod, zum Älterwerden, zu Freundschaft und was es bedeuten könnte, »gut zu sein«,
auseinanderzusetzen. Es ist die ungewohnte Umgebung, die ungewohnte Situation, die grundsätzliche Fragen zulässt, fern von Religion, Esoterik, Dramatik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Charlotte Wood stammt aus New South Wales, Australien, und lebt in Sydney. Sie ist Journalistin und Autorin von mehreren Romanen und Sachbüchern und wurde unter anderem mit dem Stella Prize und dem Prime Minister’s Literary Award ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihr der Bestseller Ein Wochenende (2020).
ÜBER DAS BUCH
Eine Frau mittleren Alters aus Sydney verlässt ihr hektisches und geselliges Stadtleben, den Ehemann und Freundeskreis, um sich in ein Kloster in den kargen Monaro Plains – nahe dem Ort ihrer Kindheit – zurückzuziehen. Die Länge ihres Aufenthaltes plant sie nicht, und am Ende überrascht es sie selbst, wie diese ungewohnte Umgebung sie einnehmen wird. Nicht nur konfrontiert sie sich mit tiefgreifenden Fragen der eigenen Existenz, sondern es werden auch außergewöhnliche Ereignisse im Alltag der Klosterschwestern Teil ihres zurückgezogenen Lebens. Eine Mäuseplage, der Transfer von sterblichen Überresten einer Klosterschwester aus Thailand, eine Besucherin, die Erinnerungen an die Vergangenheit wachruft – alles löst Gefühle der Zugehörigkeit, aber auch wieder neue Fragen ans eigene Leben aus.
Für Jane Palfreyman
»Es schien, als wollte mich die Weltzum Nachdenken bringen.«
Nick Cave
»Ich habe beschlossen, jetzt mit meinem Leben Folgendes anzufangen: Ich werde die Arbeit umgeformter und sogar verzerrter Erinnerung leisten und das Leben führen, das ich heute führe.«
Elizabeth Hardwick
TEIL 1
ERSTER TAG
Gegen fünfzehn Uhr endlich angekommen. Das Ganze erinnert an ein Kurheim aus den Siebzigerjahren oder an eine Öko-Kommune, hat aber nichts Einladendes. Schilder an Zäunen oder an kurzen Pfosten entlang der Zufahrtswege: Kein Zutritt. Parken verboten. Ein Ort der Arbeit, nicht der Erholung.
Ich parke irgendwo an einem Zaun und bleibe im stillen Wagen sitzen.
~
Auf dem Weg hierher habe ich einen Zwischenstopp in der Stadt eingelegt und zum ersten Mal seit fünfunddreißig Jahren das Grab meiner Eltern besucht. Ich musste ziemlich lang suchen, bis ich es auf dem sogenannten Rasenfriedhof gefunden hatte, dem neueren Teil, den sie – warum eigentlich? – vom ursprünglichen Stadtfriedhof abgetrennt haben, wo schiefe weiße Grabsteine in krummen Reihen stehen. Dieser alte Teil wird von riesigen Kiefern überragt, auf deren hohen Ästen Raben und Kakadus kreischen. Der Rasenfriedhof dagegen ist eine öde ebene Fläche mit hässlichen niedrigen Grabsteinen in leicht geschwungenen Reihen, alle gleich groß. Ordentlicher, das schon (aber warum sollte ein Friedhof ordentlich sein?).
Kein Rasen, nur staubiges totes Gras.
Um meine Eltern zu finden, musste ich das kalte, unbehauste Gefühl in mir zurückrufen, das ich – physisch, meine ich – bei beiden Bestattungen gehabt hatte. An der Stelle, wo mein Vater und später meine Mutter in ihre nebeneinanderliegenden Erdschächte befördert wurden, war es mir so vorgekommen, als wäre um mich herum zu viel Raum. (Ich fand es damals lieblos, einen Menschen mit Seilen und Stricken statt mit den Armen in ein Loch in der Erde zu senken.) Doch nun half mir die Erinnerung an dieses Gefühl auf meinem Gang durch den Friedhof, die Stelle wiederzufinden. Ich stand vor den Gräbern meiner Eltern, zwei maschinell zugeschnittenen und polierten Steinen. Die Farbe und Ausführung dieser Steine und die Inschriften darauf hatten für mich nicht den geringsten Bezug zu den beiden. Und doch musste ich mich für sie entschieden, sie für gut befunden haben.
Irgendwer hatte hässliche Plastikblumen in das kleine Metallgitter neben den Steinen gesteckt. Vielleicht gibt es Freiwillige, die auf dem Friedhof herumgehen, um auf Gräbern, die niemand besucht, unechte Blumen abzulegen. Wem sonst wäre es wichtig, die Grabstelle meiner Eltern noch nach so langer Zeit hervorzuheben? Das Plastik war durchgehend grau verfärbt, dabei mussten diese Blumen einmal genauso kräftig gewesen sein wie die in den kleinen Metallvasen neben anderen Steinen – ausgefranste synthetische Blüten in Kastanienbraun, Weinrot und Weiß mit dunkelgrünen Stielen und da und dort einem künstlichen Knötchen oder Blättchen.
Ich stand auf dem Gras und betrachtete die hässlichen Blumen, dann die Namen meiner Eltern auf ihrem jeweiligen Stein. Und plötzlich wurde mir bewusst: Hier unter meinen Füßen liegen eure Knochen. Da ging ich in die Hocke – nur zwei Meter Erde zwischen ihren Körpern und meinem –, küsste meine Finger und drückte sie auf das knisternde Gras.
~
Auf dem Rückweg zum Auto kam mir noch eine Erinnerung: ein Anruf, viele Monate nach dem Tod meiner Mutter. Ein Mann teilte mir leise mit, dass ihr Grabstein nun fertig sei. Ich stand mit dem Telefon in der Hand vor der Waschküchentür und war äußerlich unverändert, aber in meinem Inneren donnerte alles nach unten. Als würde in mir eine Sandbank einstürzen.
~
Gegen Ende der Fahrt wurde der Himmel dunkel, und es begann zu nieseln. Die Straße wand sich eine steile Anhöhe hinauf, mündete in einen Tunnel aus dichtem Urwald – mein Auto hatte seine liebe Not mit dem nassen Asphalt – und führte auf der anderen Seite auf diese endlose, flache, unwirtliche Ebene, rau wie Wildleder.
Nacheinander fielen mir Ortsnamen ein, die ich glaubte vergessen zu haben: Chakola, Royalla, Bredbo, Bunyan, Jerangle, Bobundara, Kelton Plain, Rocky Plain, Dry Plain, wie die Perlen an einem Rosenkranz. Als würde ich die Knochen meines Körpers aufzählen.
~
Kurz vor dem Ziel zeigt sich die Sonne. Ich steige aus, lehne mich an die Wagentür, sehe mich um und versuchte zu entscheiden, wohin ich gehen soll. Schmale Zypressen, ein paar Eukalyptusbäume, sehr viel Stille. Drei, vier graugrün gestrichene Holzhütten mit grünen Spitzdächern aus Blech.
Ich gehe ein bisschen herum, entdecke eine Hütte mit der Aufschrift Büro und klopfe an. Eine Frau erscheint in der Tür und stellt sich als Schwester Simone vor. Sie spricht den Namen mit einem leichten Akzent aus (französisch?). Undefinierbares Alter, geschäftsmäßig, gleichzeitig wirkt sie sanft. Ziemlich mager. Sehr gelbe Zähne. Sie bittet um Entschuldigung, dass sie mich nicht draußen begrüßt hat; sie habe zu tun, eine Hauswirtschafterin werde mir in der Zwischenzeit alles zeigen. Erklärt mir mit breitem Grinsen – eher einer Grimasse –, dass sie mich gegoogelt hat und meine Arbeit »sehr beeindruckend« klingt. Ihr Ton hat etwas leicht Süffisantes. Ich erwidere lächelnd, dass das Internet sehr täuschen kann. Nach kurzem Schweigen entgegnet sie kühl, die Rettung der Geschöpfe Gottes sei mit Sicherheit eine wichtige Arbeit. Sie wirkt ein bisschen verärgert. Nicht an Meinungsverschiedenheiten gewöhnt. Wir grinsen einander noch einmal an, dann schließt sie die Tür des Büros.
~
Anita, die Hauswirtschafterin. Geschwätzig, breiter Arsch. Fröstelt ein bisschen in ihrer weinroten Fleeceweste über dem türkisen T-Shirt. Dunkelblaue Hose. Sie führt mich über das Gelände und durch die Gebäude, ich immer hinter ihr, während sie vor sich hin plappert. Nie im Leben könnte sie Nonne sein – allein das Aufstehen um fünf, die Vigil. Im Winter! Außerdem dürfen sie nicht Netflix schauen. »Also, für mich wär das nix.«
Hin und wieder öffnet sie die Arme, deutet auf etwas – den Laden, alte Obstbäume, die Gästeunterkünfte; zeigt auf die Weiden dahinter, auf ein kleines Wasserreservoir –, verschränkt sie dann wieder gegen die Kälte, und wir machen uns auf den Weg zu einer steinernen Kapelle. Um ein Haar sage ich: Schon gut, ich muss da nicht rein, möchte aber nicht unhöflich wirken. Wir drücken eine dicke Holztür auf. Anita plappert ununterbrochen weiter, jetzt aber flüsternd, obwohl drinnen niemand ist. Sie hat gerade erst gelernt, sagt sie, dass das keine Kapelle ist – Kapellen sind immer in Privatbesitz. Das hier ist eine geweihte Kirche. Hier beten sie die Horen, flüstert sie und spricht das Wort wie eine fremdsprachige Vokabel aus. Was es ja auch ist.
Sie deutet auf eine Ecke: »Und da sitzen Sie.«
Vier Holzbänke an der Seite, ein Stück entfernt von denen in der Mitte, die wahrscheinlich den Schwestern vorbehalten sind. Die Gästebänke sind kleiner, moderner und aus hellgelbem Kiefernholz. Auf jedem Platz liegt ein flaches, quadratisches braunes Kissen, und unten verläuft auf ganzer Länge ein mit braunem Leder bezogenes Kniepolster. Anita wartet, bis ich ihr bewiesen habe, dass ich weiß, wie man sitzt. Es ist erstaunlich bequem.
Einen Altar gibt es nicht. Nur ein schlichtes Lesepult aus Holz vor einem riesigen geschnitzten Holzkruzifix an der weiß getünchten Wand.
Als wir die Kirche verlassen, bleibt Anita stehen und zeigt mir ein großes eckiges Blumengesteck, das seitlich unter dem Kruzifix auf dem Boden liegt. Das hat eine von den Oblatinnen gemacht, sagt sie. Ich erwidere: »Hm.« Ja, sagt Anita und seufzt bewundernd. Diese Oblatin hat wirklich ihren ganz eigenen Stil.
Ich sage ihr nicht, dass ich keine Ahnung habe, was eine Oblatin ist.
~
Der nächste Halt auf unserem Rundgang ist eine zweitürige Kühl-Gefrier-Kombination auf einer Veranda. Anita reißt die Kühlschranktür auf und zeigt mir die mit Eiern, Milch und einigen Äpfeln gefüllten Fächer. Wirft die Tür zu und öffnet den Gefrierschrank, in dem einzeln eingeschweißte kleine Fleischpasteten und Päckchen mit jeweils vier Scheiben Vollkornbrot liegen. Die Sachen sind für Gäste, die sich zum Mittagessen nichts aus dem Speisesaal holen wollen, erklärt sie.
Die Schwestern bekomme ich ausschließlich in der Kirche zu sehen, sagt sie in warnendem Ton, als würde mich das enttäuschen. Die Nonnen wohnen in einem langen, niedrigen, durch eine Hecke abgezäunten Gebäude hinter der Kirche, auf einem abgeschotteten, für Gäste nicht zugänglichen Areal.
Schließlich geht es noch zu meiner Hütte, die Anita mit dem Namen eines Heiligen bezeichnet, den ich sofort vergesse. Die Nachbarhütten sind offenbar nicht belegt, aber wer weiß. Ich frage nicht, ob außer mir noch jemand da ist. Alles wirkt ziemlich leer.
Anita sperrt auf und duchquert das Zimmer, zieht den Vorhang zurück und zeigt mir die Fernbedienung für das Klimagerät, mit dem auch geheizt wird. (»Sie können sich nicht vorstellen, wie heiß es hier im Sommer ist, aber jetzt ist es auf ›Heizung‹ gestellt – sehen Sie da, die kleine Sonne?«) Sie nimmt eine laminierte Broschüre vom schmalen Schreibtisch – »Hier drin steht alles, was Sie wissen müssen« – und lässt sie wieder fallen. Macht eine unbestimmte Handbewegung zu den Behältern und Schränken der Miniküche hin, dann in die entgegengesetzte Richtung, wo das Bad ist, das ich aber nicht sehen kann, lächelt mich an und seufzt mit freudiger Bestimmtheit, so als könnten wir jetzt, nach Erledigung der Formalitäten, endlich ein richtiges Schwätzchen halten. Ich bedanke mich zügig und mache einen Schritt Richtung Tür. Sie kapiert, dass ich mich nicht unterhalten will, und geht.
~
Als ich endlich allein bin und die wenigen Sachen aus dem Auto geholt habe, lege ich mich auf den Boden in einen Fleck blasse Nachmittagssonne. Die Heizung funktioniert gut, das Zimmer wird schnell warm. Das Licht, das durch das Fenster in den Raum fällt, beleuchtet ein kleines hölzernes Kruzifix über dem Schreibtisch. Die Stille ist so dicht, dass ich mich reich fühle.
Mein Handy vibriert, ich schrecke zusammen. Alex ist in Heathrow gelandet, seine neuen Kollegen holen ihn ab. Ich antworte und lege mich wieder hin. Noch hat es keiner von uns laut gesagt, aber wir wissen beide, dass ich nicht nachkommen werde. Wir wissen beide, dass er darüber erleichtert sein wird.
Ich begreife, dass man, sobald Anita den Schlüssel überreicht hat und in ihren Lammfellstiefeln davongestapft ist, hierbleiben könnte, ohne während des ganzen Aufenthalts auch nur eine Menschenseele zu sehen oder zu hören. Es wird akzeptiert, steht in der laminierten Broschüre, wenn ein Gast für sich bleiben möchte. Niemand muss mit den anderen essen oder zum Gottesdienst gehen. Es wird darum gebeten, leise zu sein. Es würde bis zum Ende des Aufenthalts unentdeckt bleiben, wenn jemand sein Leben hier auf dem sauberen Teppichboden in einem warmen, stillen Zimmer beendet hätte. Ich kann mir in diesem Moment nichts vorstellen, was gütiger wäre, als einem fremden Menschen eine solche Ungestörtheit zuzugestehen.
Doch meine Flucht ist anders, weniger endgültig.
Irgendwo draußen vor meinem Fenster ertönt leises Hühnergegacker.
~
Um fünf Uhr nachmittags beschließe ich, mit den Nonnen an der Vesper teilzunehmen, um wach zu werden. Im sinkenden Licht, in der Stille gehe ich zu der kleinen Kirche. Meine Schritte auf dem Kiesweg sind das einzige Geräusch. Ich setze mich in die kalte Kirche und warte. Was weitere Gäste betrifft, habe ich mich geirrt: Zwei Frauen eilen zur Besucherbank ganz vorn und nehmen ihre Plätze ein. Sie scheinen sich gut auszukennen. Dann öffnet sich eine Tür auf der anderen Seite, und einzeln oder zu zweit treten die Nonnen ein. Lange braune Habite, weiße Krägen. Einige haben die Hände unter den Überwurf ihres Habits geschoben. Eine sehr alte Frau kommt im elektrischen Rollstuhl und fährt ruckelnd über die Schwelle. Eine andere benutzt ein Gehgestell. Insgesamt sind es acht, davon mindestens die Hälfte hoch betagt. Schwester Simone ist auch da, aber sie schaut nicht zu uns hin. Keine Nonne schaut zu uns hin.
Ihre Kirchenbänke sind an der Vorderseite mit Holz getäfelt, deshalb sieht man die Nonnen nur von der Hüfte aufwärts. Sie beginnen Gebete zu singen, die ich in den beiden fotokopierten Heftchen auf meinem Platz – im einen stehen die Noten, im anderen die Texte der Psalmen – nicht finden kann. Die Stimmen der Nonnen sind extrem hoch und dünn, manche klingen sehr schön. Es ist eine Art Sprechgesang, immer wieder die gleichen sieben oder acht Noten. Auf einer Bank hinter mir sitzt noch jemand. Ich höre eine ruhige, tiefe Männerstimme und hin und wieder ein leises Räuspern. Der Gesang hat etwas Hypnotisierendes. Doch dann habe ich endlich die richtige Seite im richtigen Heft gefunden und stelle fest, dass in den Texten ausschließlich dies und das als Sünde und diese und jene als Feinde Gottes angeprangert werden. Die Zartheit des Gesangs straft das stumpfe Instrument der Wörter Lügen.
Ich betrachte die Frauen und komme zu der Überzeugung, dass die Texte, die sie singen, unwichtig sind und es bei diesem Ritual allein um den Körper und das Unbewusste geht. Auf ein Zeichen hin, das ich nicht erkenne, verbeugen sie sich ab und zu so tief in ihren kleinen Holzbänken, dass sie kurz aus dem Blick verschwinden. Dann tauchen sie wieder auf. Ich fühle mich an Yoga erinnert: die gleiche rhythmische Ruhe, die gleiche bedächtige weibliche Unterordnung.
Nachdem die Nonnen und danach die Frauen vor mir (und der unsichtbare Mann) die Kirche hintereinander verlassen haben, bleibe ich kurz sitzen, bis die Kirche vollständig leer ist. Dann gehe auch ich. Im Halbdunkel kehre ich in meine Hütte zurück.
Es ist erschreckend ruhig dort.
Zum Abendessen knabbere ich zwei Schüsseln Erdnüsse und trinke drei Gläser Wein.
Mein Rücken tut wieder sehr weh. Die sechsstündige Fahrt hat es nicht besser gemacht und die harte Kirchenbank auch nicht, trotz des Kissens. Ich lege mich auf den Teppichboden und strecke die Arme aus. Als ich aufwache, blickt Jesus von seinem Kreuz auf mich herunter.
ZWEITER TAG
Schlecht geschlafen. Das grüne Leuchtschild über der Tür war zu hell, und das Ächzen und Knarzen der Holzhütte im Wind hat mich die ganze Nacht wachgehalten. Um halb sechs stehe ich auf, dusche, mache Kaffee. Bekomme ganz kurz ein Handysignal – mieser Empfang, aber genau deshalb fährt man hierher – und erhalte eine kurze, gut gelaunt klingende Mail von Alex und ein paar weitere von anderen. Einige lese ich, raffe mich aber nicht dazu auf, sie zu beantworten. Ich hätte eine Abwesenheitsnotiz einrichten sollen, doch nicht mal das erschien mir machbar. Setze mich mit meinem Kaffee an den kleinen Schreibtisch und sehe zu, wie der Himmel hinter den kirchturmartigen Zypressen heller wird. Lausche dem Wind, der sich nach und nach legt.
Um halb acht gehe ich aus reiner Neugier zu den Laudes. (Was sonst habe ich mir für meinen Aufenthalt hier vorgestellt? Schlafen, nehme ich an. Vielleicht Entscheidungen in Bezug auf Alex oder meine Arbeit treffen. Weinen. Mich verstecken.) Als ich die Hüttentür im ersten Morgenlicht schließe, scheinen die kalte, reine, von den Bergen herabsinkende Luft und der Geschmack dieser Luft aus der Kindheit zu kommen.
Jedesmal wenn die große Holztür geöffnet wird, strömen die Strahlen der steigenden Sonne in die Kirche. Die Nonnen kommen leise herein, zu zweit oder zu dritt. Die mit dem Rollator ist als Erste da. Ich glaube, sie spielt die Orgel, aber von meinem Platz auf einer hinteren Besucherbank aus kann ich nicht um die Ecke sehen. Eine andere Nonne zündet die Kerzen an – eine neben der Tür, durch die sie kommen und gehen, eine neben dem Lesepult und zwei unter dem großen Kruzifix.
Der Gesang ist bewegend, vor allem wenn er mehrstimmig wird. Eine Nonne singt einen Psalm vor, die anderen antworten mit einem wiederholten Refrain. Wie die Vesper dauern auch die Laudes eine halbe Stunde.
Um neun Uhr folgt die Eucharistie (auch Terz genannt?).
Während der Laudes ertappte ich mich bei dem Gedanken: Wann erledigen die eigentlich ihre Arbeit? Tagein, tagaus diese Unterbrechungen, wenn man das, was man gerade gemacht hat, stehen und liegen lassen und alle paar Stunden in die Kirche dackeln muss. Dann wurde mir bewusst: Das ist keine Unterbrechung der Arbeit, das ist die Arbeit. Das ist ihr Tagwerk.
~
Die Kerzen in der Kirche sind schlicht und weiß und riechen sehr angenehm. Nach Kräutern oder leicht zimtig. Und ganz schwach nach Weihrauch, aber nicht aufdringlich.
In der Kirche überkommt mich eine große Ruhe. Ich versuche das Geschehen kritisch zu bewerten, doch die seltsame Gelassenheit, die mich durchdringt, macht allen Gedanken ein Ende. Liegt das daran, dass man zwar fast vollkommen passiv, aber irgendwie doch dabei ist? Vielleicht aber auch einfach daran, dass man an einem so stillen Ort ist; an einem ganz dem Schweigen gewidmeten Ort. Heutzutage ist eine solche Stille radikal. Unzulässig.
~
Zur Mittagshore bin ich wieder in der Kirche. Diesmal dauert es nur ungefähr zwanzig Minuten. Die unterschiedlichen Psalmen werden auf die immer gleiche einfache Melodie gesungen. Mich überkommt wieder diese Müdigkeit, und ich halte mich nur mit Mühe wach. Der Gesang klingt mechanisch, mittelalterlich: unvermittelt und unausgewogen wegen der dünnen, scharfen Stimmen, aber doch melodiös. Sie singen alles sehr langsam. Es ist hypnotisierend. Die Texte ergeben kaum einen Sinn. Meistens geht es um Übeltäter, die den Erzähler der Psalmen zerstören wollen. Alle Tage überhäufen sie mich mit Unheil. Widersacher und Feinde, versessen auf Gemetzel und Vernichtung. Und das alles vorgebracht von ein paar Nonnen hier draußen auf der trockenen Monaro-Hochebene, mitten im Nirgendwo.
Am Ende der Mittagshore gehen zwei Nonnen von gegenüberliegenden Seiten her in die Mitte, verbeugen sich vor dem Kruzifix, drehen sich um, verbeugen sich voreinander und verlassen die Kirche. Die nächsten beiden gehen in die Mitte, verbeugen sich vor Jesus und voreinander. Und so weiter, bis keine mehr da ist.
~
Das Mittagessen nimmt man entweder »gemeinsam mit anderen Gästen am Tisch« ein – nein danke – oder holt es sich. Ich mache mich mit dem Korb und ein paar Behältern aus meiner Hütte auf den Weg zum Speisesaal. Als Anita erklärt hat, dass man den Korb mitnimmt und das Essen hineinlegt, klang das romantisch. Ich sah Weidengeflecht und karierte Tischdecken vor mir. Rotkäppchenbilder. Doch der Korb ist ein grellfarbiges Plastikding wie im Supermarkt an der Schnellkasse, und die Inneneinrichtung (falls das in einem Kloster so heißt) äußerst schlicht, irgendwie unschuldig, fast rührend. Wie das Haus einer alten Tante, nur hängen keine Schilder mit Sprüchen an der Wand (»Segne dieses Haus«), sondern Kruzifixe. Heute besteht das Mittagessen aus dicken Scheiben gekochtem Schinken, einem hellgelben Chutney, grünem Salat (daneben steht eine Flasche »Italian Dressing«) sowie Ofengemüse – Karotten, Kartoffeln und Pastinaken, alles ein bisschen hart. Außerdem in einer großen Schüssel pappig aussehendes Kartoffelpüree, das ich mir erspare. Die Nachspeise ist eine Art Apfelauflauf. Der Auflauf schmeckt gut, alles andere ist mittelmäßig. Jeden Tag würde man dieses Zeug ungern essen. Die anderen Gäste – zumindest die beiden Frauen; den Mann habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen – blicken nicht auf, wenn wir aneinander vorbeigehen. Soll mir recht sein.
Das Mittagessen ist die Hauptmahlzeit des Tages. Das Abendessen soll sich jeder im eigenen Zimmer aus den vielen Päckchen beziehungsweise Konservendosen zusammenstellen, die jeweils eine Portion enthalten. Ich hebe mir zwei Scheiben Schinken auf, die will ich abends mit gebackenen Bohnen essen. Die Küchenschränke in meinem Zimmer erinnern mich an Lagerräume in den Land-Motels meiner Kindheit. Alles ist in einzelnen Tütchen oder Portionsbehältern verpackt – Nescafé, Zucker, Vegemite, Margarine, Teebeutel. Mini-Konserven mit Heinz Spaghetti, gebackenen Bohnen oder Thunfisch. Winzige Schachteln mit stark industriell verarbeiteten Frühstücksflocken. Kekse, Shortbread und Jatz-Cracker jeweils im Zweierpack. Und in der Minibar klitzekleine Päckchen Scheibenkäse. Ich frage mich, ob das alles vielleicht von einem Unternehmen gespendet wird. Beim ersten Anblick dieses Verpackungswahnsinns kamen mir die Tränen, was ich selbst albern fand. Aber irgendwie haben mir die widerwärtigen kleinen Packungen zugesetzt; sie zerteilen alles in unnatürliche Bruchstücke, fürchterlich. Das Einsame daran: die Vergeudung. Und das Gefühl, dass alles verschmutzt wird: sogar hier die unbedingte Notwendigkeit, Abfall zu produzieren. Wie kann Gott, wenn es ihn gibt, diesen Müll billigen? Dabei habe ich ganz gegen den Geist dieses Orts meinen eigenen Müll mitgebracht: mehrere Tafeln Schokolade, gesalzene Erdnüsse, Blaubeeren in Plastikverpackung, Kaffee, Wein. Damit wäre er bestimmt genauso wenig einverstanden.
Ich fühle mich wie in meiner Kindheit: Die Stunden vergehen so langsam, ich muss so viel warten, starre in die Luft. Hier wird absolut nichts von mir gefordert oder erhofft.
~
Ich überlege mir, in den Klosterladen zu gehen und Kerzen zu kaufen. Falls es die schlichten gibt, die ich in der Kirche gesehen habe, würde ich gern eine mit nach Hause nehmen. Doch anstatt den dreiminütigen Spaziergang zu machen, lege ich mich auf den Boden und sinke in einen sirupartigen Schlaf.
Gegen vier gehe ich dann doch zum Laden, in dem es aber nichts Interessantes zu kaufen gibt. Nur grauenhafte Grußkarten, manche mit religiösen Darstellungen, größtenteils aber mit schlecht gemalten Blumenbildern. Die handgemachten Kerzen sind besonders hässlich, grelle Farben, klobige Goldschnörkel und astrologisch anmutende Motive. Ich kaufe dann doch etwas: eine einfache Kerze mit Sandelholzduft, eine Taschenlampe aus Plastik und ein Holzkreuz. Das Kreuz hat abgerundete Kanten und schmiegt sich angenehm in die Hand. Ein bisschen schäme ich mich. Ich weiß nicht, warum ich es kaufe, außer vielleicht aus Respekt vor diesen Menschen und als eine Art Talisman, den ich in der Hand halten und spüren möchte. Es ist für den Körper, nicht für den Geist.
~
Wieder die Vesper. Eine gesprochene Passage unterbricht den Gesang. »Fürbitten« lautet das Wort, das mir aus der Kindheit in Erinnerung kommt. »Wir beten für eine Ehe, die in die Brüche geht«, sagt eine Schwester. Ich schaue zu Boden. Ich denke an Alex, aber er ist frei. Er hat es nicht nötig, dass ich für ihn bete.
Und dann: »Wir beten für alle, die heute Nacht sterben werden.«
~
Nachdem meine Eltern gestorben waren – nicht gleichzeitig, aber so kurz hintereinander, dass die beiden Todesfälle in meinem primitiven Gehirn, in meinen Träumen und meinem Körper zu einer einzigen Katastrophe verschmolzen –, hatte ich jahrelang das Gefühl, ich würde Klebstoff einatmen, mich durch Klebstoff bewegen. So hätte ich es damals nicht beschreiben können. Hätte mich jemand gefragt, wie es mir gehe, hätte ich nichts antworten können. Die einzige ehrliche Antwort wäre gewesen: Ich weiß es nicht.
Einen Tag nachdem ich erfahren hatte, dass die Krankheit meiner Mutter unheilbar war, nahm ich einen Arzttermin in der Innenstadt wahr, wo ich damals wohnte. Als ich ins Sprechzimmer trat und die Ärztin mich strahlend nach meinem Befinden fragte, begann ich zu weinen, und weil mir das peinlich war, erklärte ich ihr, warum. Sie fragte nach meinem Vater, und als ich sagte, dass er tot sei, wollte sie wissen, welche professionelle Beratung meine Mutter und ich uns damals gesucht hätten. Ich war verwirrt. Meines Wissens gab es in unserer Stadt keine solche Beratung.
Daraufhin sagte sie, es sei klug und richtig, dass ich mir diesmal so schnell Hilfe gesucht habe. Aber ich bin doch nur da, um einen Pap-Test machen zu lassen, entgegnete ich unter Tränen. Sie hielt mir eine Kleenex-Box hin und sagte, den Test würden wir ein andermal durchführen. Sie fragte nach meinen Eltern und hörte mir eine Zeit lang zu. Kurz vor dem Ende des Gesprächs empfahl sie mir, eine spezialisierte Trauerbegleitung in Anspruch zu nehmen. Sie sei nur Allgemeinärztin und dafür nicht ausgebildet. Ein Spezialist könne besser helfen. Sie schrieb mir den Namen und die Adresse des Zentrums auf.
Kann ich nicht einfach mit Ihnen reden?, fragte ich.
Und so kam es dann. Ich war dreimal bei ihr.
Die Ärztin war dick und direkt und fordernd. Ihre Autorität und große pragmatische Freundlichkeit brachten mich, warum auch immer, zu der Vermutung, sie wäre lesbisch. Sie redete nicht auf mich ein und dramatisierte nichts, das war eine Erleichterung. Hätte mir jemand offen sein Mitgefühl entgegengebracht, hätte man mich gebeten, die emotionalen Aspekte dessen, was nun meine Trauer hieß, zu beleuchten, hätte ich mich geschämt.
Bei meinem zweiten Besuch erzählte ich (peinlicherweise wieder unter Tränen), dass mich meine Freunde jetzt, wo ich sie am dringendsten brauchte, im Stich ließen. Die Ärztin war nicht überrascht. Ihr Leben liegt jetzt bloß, sagte sie. Die Freunde können nichts dafür; deren Leben ist durch viele Dämmschichten abgepolstert, und sie verstehen nicht oder können nicht akzeptieren, dass es bei Ihnen anders ist. Wahrscheinlich macht es ihnen Angst. Aber sie wollen Sie nicht bewusst kränken.
Sie sagte nicht: Begreifen Sie, dass Sie allein sind, aber das hörte ich heraus und fand es merkwürdig tröstlich. Sie sagte noch einmal, ich solle das Zentrum für Trauerbegleitung anrufen.
Beim letzten Besuch hatte ich das Gefühl, dass sie mich und meine Probleme leid war. Sie saß hinter dem Schreibtisch und fragte mich leicht gereizt: Was ist gerade Ihr größter Wunsch?
Dass alles ganz anders wäre, sagte ich und hörte die Griesgrämigkeit in meiner Stimme.
Die Ärztin sah mich an und schwieg eine Weile. Dann entschied sie sich für die schlichte, brutale Wahrheit und sagte: Es ist aber nicht anders.
Ich bin ihr bis heute dankbar.
DRITTER TAG
Diesmal tief und lang geschlafen. Das Schild über der Tür habe ich abends mit meiner Jacke verhängt, sodass es viel dunkler geleuchtet hat, und weil kein Wind wehte, war es nachts leise.
Wieder bei den Laudes. Ich frage mich, ob Langeweile für die Nonnen eine Sünde ist. Gibt es das in allen Religionen, diese Art sich repetitiv zu bewegen? Es hat etwas Altertümliches, Abergläubisches. Im Kreis gehen, sich verbeugen und niederwerfen, knien und stehen. Welchen Sinn hat das? Soll es das Ego ausmerzen? Oder das menschliche Verlangen nach Neuem, nach dem Ausbrechen oder der Überraschung verneinen? Immer und immer wieder, ein verordnetes Wiederaufgreifen. Während ich ihnen bei ihrer Verrichtung zusehe, frage ich mich, ob sie sich auf die Nerven gehen. Ob es eine anmaßend findet, wenn sich eine andere besonders tief verbeugt, oder ob es sie wahnsinnig macht, wenn die Schwester neben ihr falsch singt. Ausgeschlossen, dass hinter dem Schweigen keine solchen Emotionen stecken. In den Psalmen, die sie heute gesungen haben, gab es nicht so viele böse Feinde, aber viele Anspielungen auf Nationales. Der Herr verschafft unseren Grenzen Frieden und füllt unsere Speicher usw. Viel Trara um all das Gute, das er unserem Land geschenkt hat … Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, was das mit diesen Frauen und ihrem Leben zu tun hat. Was bedeutet der alte hebräische Schwulst über Feinde, Grenzen und Verfolgung? Warum wird tagein, tagaus davon gesungen?
~
Um zehn – ich sitze in meinem Zimmer und lese – ertönt draußen ein Laubbläser! Ich laufe zum Fenster und sehe, wie eine der stämmigeren Nonnen das verhasste Ding aufheulen lässt und den Weg damit abgeht, wobei sie es langsam hin und her schwenkt und die Blätter sinnlos verteilt. Es dauert ungefähr zwei Minuten.
~
Allmählich mache ich mir Sorgen, dass diese Benommenheit vielleicht nie wieder verschwindet. Ich könnte natürlich abreisen, aber schon die Vorstellung, auch nur meine Sachen ins Auto zu packen, überfordert mich. Deshalb gehe ich mittags zu einer so genannten Lectio divina mit einer gewissen Schwester Bonaventure. Als ich eintrete, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die Laubbläsernonne ist, aber ich sage nichts. Eine Lectio divina, erklärt sie mit leiser, heiserer Stimme, ist eine »Göttliche Lesung«, die extrem langsame, kontemplative Lektüre von Bibelversen (die sie auf Zettel ausgedruckt verteilt). Bei den anderen Personen im Raum handelt es sich um die zwei Frauen – Diane und Cynthia aus Melbourne –, eine weitere Frau, Lavinia, die ich noch nie gesehen habe, sowie einen Mann namens Richard, der offenbar in der Nähe wohnt. Wahrscheinlich war es seine Stimme, die ich am ersten Tag in der Kirche gehört habe, und er kommt mir vage bekannt vor.
Wir sitzen auf Plastikstühlen im Kreis und lesen nacheinander jeweils einen Abschnitt vor. Nach jeder Lesung wird mehrere Minuten geschwiegen, und alle sollen über das Gehörte nachdenken. Dann soll jeder ein Wort sagen, das ihn beeindruckt oder beunruhigt hat oder ihm aufgefallen ist. Danach wird der nächste Abschnitt vorgelesen. Es folgt der gleiche Ablauf von Schweigen und Nennung bestimmter Wörter oder Sätze, doch diesmal hält das Schweigen länger an. Am Ende liest Schwester Bonaventure den ganzen Text noch einmal vor. Eine weitere Schweigepause, dann wird darüber gesprochen. Schwester Bonaventure sagt, sie habe plötzlich erkannt, dass es im heutigen Text um Gehorsam gehe – was praktisch sei, weil sie eine Novizin betreue, die sich gerade mit dem Aspekt des Gehorsams in ihrem Gelübde beschäftige. Einzelne Wörter werden in die Runde geworfen. Nur Richard ist beim Lesen ganz bei der Sache, denkt dabei schon über die mögliche Bedeutung nach, während die anderen den Text mechanisch herunterleiern und in dem Versuch, sich bei Schwester Bonaventure einzuschleimen, banale Beobachtungen von sich geben. Cynthia aus Melbourne verhält sich besonders unterwürfig (Schwester Bonaventure nennt sie »Wendy«; der geduldige Blick, den Cynthia und Diane daraufhin tauschen, lässt vermuten, dass das schon seit Tagen so geht). Sie findet jedes Wort im jeweiligen Abschnitt grandios. Bonaventure duldet sie offenbar nur. Meine Gedanken sind nicht interessant, höchstens als Argumente gegen den Inhalt der Bibel. Und weil das kaum Zweck der Übung ist, halte ich meinen Mund.
Trotzdem ist das Ganze seltsam schön. Schwester Bonaventure erklärt, es gehe darum, an einem bestimmten Wort hängen zu bleiben, und falls es einen weiterhin beunruhige oder verwirre, solle man es einfach »an Gott übergeben«. Das steht so sehr im Gegensatz zu allem, was ich glaube (Wissen ist Macht, alles muss hinterfragt werden, man soll Verantwortung übernehmen), dass es sich fast böse anfühlt. Die frappierende – verdächtige – Schlichtheit dessen, etwas einfach an einen anderen zu übergeben.
(Später kommt irgendwoher die Erinnerung an einen Künstler, den ich einmal im Fernsehen gesehen habe, wie er, den Blick auf die Leinwand gerichtet, malte. Er zitierte Kipling: »Wenn dein Dämon am Werk ist, versuche nicht, bewusst zu denken. Lass dich treiben, warte und gehorche.«)
Schwester Bonaventure sagt beiläufig, dass sie bei ihrem Eintritt ins Kloster Angst gehabt habe, sie könnte sich langweilen. Dann lacht sie, als wäre das ein absurder Gedanke, und sagt: »Nicht einen faden Moment hatte ich hier.« Ich spüre, dass sie es so meint.
~
Als ich danach die Tür meiner Hütte öffne, fällt es mir ein: Der Mann ist Richard Gittens aus der Highschool! Bei der Erinnerung an sein krauses rötliches Haar und seinen dünnen Körper, seine vergnügte, bescheidene Art, empfinde ich starke Zuneigung. Er ist inzwischen kräftiger, sein Haar stoppelkurz, grau und größtenteils verschwunden, aber die Selbstironie ist noch da.
~
Das Mittagessen besteht aus lauwarmer Ricotta-Lasagne und einem mit Käse überbackenen wässrigen Auflauf aus Blumenkohl, Karotten und Brokkoli sowie aus einem passablen Taboulé, meiner Vermutung nach aus Gerstengraupen zubereitet. Alles viel zu schwach gewürzt (wenigstens der Schinken von gestern war salzig). Nur gut, dass ich die Erdnüsse mitgenommen habe, die ich vor allem futtere, weil sie gesalzen sind. Auf das Dessert – eine Art Torte – verzichte ich, lege aber mehrere Konserven mit Pfirsichschnitten in meinen Korb, die ich zum Frühstück mit Joghurt essen werde, denn meine Beeren sind alle.
~
»Handeln ist das Mittel gegen Verzweiflung.« Joan Baez.
»Erstens nicht schaden.« Hippokrates.
Wieder einmal kommt mir der Gedanke, dass nicht nur ich – ich, wir, das Artenschutzzentrum – unser wichtigstes Ziel total verfehlt haben, sondern ich mit jeder meiner Bemühungen die Zerstörung noch vergrößert habe. Mit jeder E-Mail, jedem Meeting, jeder Presseerklärung, Konferenz, Protestaktion. Jede noch so geringfügige Tätigkeit nach dem Aufstehen frisst Ressourcen, produziert Müll, zerstört Lebensräume oder führt zu irgendwelchen anderen Beeinträchtigungen. In Zeitlosigkeit zu verharren, wie es diese Frauen tun, ist das genaue Gegenteil. Sie richten keinen Schaden an.
Andererseits: »Das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen.«
(Und was ist mit dem Verpackungswahnsinn?)
Ich gewöhne mich an die Glocke, die die Nonnen zu den Horen ruft. Sie gilt zwar nicht uns Laien, aber ihr leiser Klang dringt vom Gebäude der Schwestern hinter der Kirche zu mir, und ich ertappe mich dabei, dass ich auf ihn warte.
Bei meiner Rückkehr von der Vesper schaue ich nach oben und sehe den kalten weißen Mond hinter den schwarzen Bäumen aufsteigen.
VIERTER TAG
Ich wache um Viertel nach fünf auf und bleibe bis sechs im Bett, während es im Zimmer warm wird. Heute Morgen ist es viel kälter, und draußen nieselt es. Anders als in den letzten Tagen fühle ich mich erstaunlich leicht, als hätte ich einen großen Teil meiner Kraft wiedergewonnen. Als wäre ich aus einer zutiefst notwendigen Phase des Ruhiggestelltseins zurückgekommen.
Der Gottesdienst am Vormittag verläuft im Grunde wie immer. Nur dass plötzlich eine Nonne, eine, deren Aussehen mir gefällt – sie ist groß und schmal, hat eine lange, leicht gerötete Nase, und unter der Schleierkante spitzt stahlgraues Haar hervor –, die Kirche durchquert und sagt, ich solle mich bitte an die andere Seite des Kruzifixes stellen und warten. Während ich dort neben Cynthia aus Melbourne stehe, kommen die anderen dazu – Diane und Lavinia sowie zwei Männer und eine Frau, die ich bisher nicht gesehen habe –, und die Nonnen bilden einen großen geschlossenen Kreis. (Keine Spur von Richard Gittens. Falls er es überhaupt ist. Ob ein Zeichen des Wiedererkennens in seinem Gesicht zu sehen wäre, wenn ich ihm meinen Namen sagen würde?)
Plötzlich – zu spät, um zu meinem Sitz zurückzugehen – begreife ich, dass ich gleich die Kommunion empfangen werde. Mit den Worten »Der Leib Christi« legt mir die alte Nonne die Hostie in die Hand. Ich habe vergessen, was ich erwidern muss, doch dann taucht es aus ferner Kindheit auf: »Amen.« Die Hostie ist kreideweiß, ungefähr so groß wie eine 20-Cent-Münze und hat ein eingeprägtes Kreuz. Sie löst sich sofort auf, nachdem ich sie in den Mund gesteckt habe. Ohne jeden Geschmack, wie Papier. Sie kommt mir dünner oder zarter vor als die Hostien in meiner Kindheit, diese in meiner Erinnerung harten, leicht nach Weizen schmeckenden Scheiben, die lang am Gaumen klebten. Ich komme mir natürlich ziemlich albern vor. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zur Kommunion gegangen bin. Beim Begräbnis meiner Mutter? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es da noch gemacht hätte; das alles lag damals längst hinter mir.