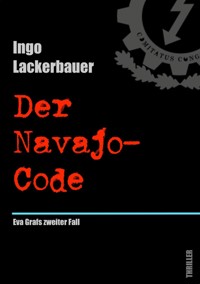
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wieso verschwinden immer wieder Mitarbeiter einer amerikanischen Behörde, die geheime Forschungsprojekte für die US-Streitkräfte durchführt? Was hat es mit der alten Rohrpostkartusche auf sich, die im Münchener U-Bahn-Netz gefunden wurde? Und besteht womöglich ein Zusammenhang mit dem brutal ermordeten Navajo-Indianer in den Isar-Auen? Eine harte Nuss für Museums-Chefin Dr. Eva Graf und den Sicherheitsbeauftragten Kolja Blomberg. Der Spürsinn der beiden ist gefragter denn je, gilt es doch, ein Rätsel zu lösen, dessen Anfänge viele Jahrzehnte zurückliegen und das von seiner Brisanz bis heute nichts verloren hat. Eine Jagd beginnt, in deren Verlauf sich die beiden Helden einem Gespinst aus Intrigen, Lügen und Täuschungen ausgesetzt sehen – und am Ende ist doch alles anders als gedacht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Navajo-Code
Eva Grafs zweiter Fall
Ingo Lackerbauer
IMPRESSUM
© 2016 Ingo Lackerbauer ([email protected])
Rechteinhaber Ingo Lackerbauer
Herausgeber: Ingo Lackerbauer
Autor: Ingo Lackerbauer
Umschlaggestaltung, Illustration: Alexandra Otte/ Ingo Lackerbauer
Korrektorat: Sarah Richert
ISBN-13:
ISBN-10:
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Text Copyright © 2016 Ingo Lackerbauer
Alle Rechte vorbehalten
Erstellt mit Vellum
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
1. Erkenntnis
2. Post aus der Vergangenheit
3. Fremde Lichter
4. Sklaven
5. Tatort
6. Geheimnisse
7. Einsamkeit
8. Machtspiele
9. Der Atzteken-Code
10. Insomnia
11. Scherben und Verrat
12. Anfänger
13. Wiedersehen
14. Die Bombe
15. Spekulationen und Konkretes
16. Nekropole
17. Lauschangriff
18. Wünsche
19. Zukunft
20. Misstrauen
21. Morgenerwachen
22. Geschichten
23. Atronix
24. Verrat
25. Testlauf
26. Verhör
27. Frühstück
28. Schatten
29. Leben
30. Irrweg
31. Finstere Nacht
32. Der Hauch des Teufels
33. Familienhistorie
34. Stuxnet
35. Aeternum
36. Überraschung
Über den Autor
Ingo Lackerbauer, Jahrgang 1968, schreibt seit mehr als 25 Jahren als freier Journalist und Texter Artikel und Reportagen für diverse Print-Publikationen. Journalistischer Schwerpunkt ist dabei der Bereich Wissenschaft und Technik. Regelmäßige Veröffentlichungen finden in Zeitungen und Zeitschriften wie etwa dem Kölner Stadtanzeiger, Süddeutsche Wissen, Zeit Wissen, GEO, G-Geschichte, P.M. Magazin, P.M. History, Wunderwelt Wissen, Welt der Wunder, usw. statt. Bereits erschienen sind seine sein Thriller »Das Tesla-Artefakt« sowie der Köln-Krimi »Froschkönige«.
Über das Buch
Wieso verschwinden immer wieder Mitarbeiter einer amerikanischen Behörde, die geheime Forschungsprojekte für die US-Streitkräfte durchführt? Was hat es mit der alten Rohrpostkartusche auf sich, die im Münchener U-Bahn-Netz gefunden wurde? Und besteht womöglich ein Zusammenhang mit dem brutal ermordeten Navajo-Indianer in den Isar-Auen? Eine harte Nuss für Museums-Chefin Dr. Eva Graf und den Sicherheitsbeauftragten Kolja Blomberg. Der Spürsinn der beiden ist gefragter denn je, gilt es doch, ein Rätsel zu lösen, dessen Anfänge viele Jahrzehnte zurückliegen und das von seiner Brisanz bis heute nichts verloren hat. Eine Jagd beginnt, in deren Verlauf sich die beiden Helden einem Gespinst aus Intrigen, Lügen und Täuschungen ausgesetzt sehen – und am Ende ist doch alles anders als gedacht …
1
Erkenntnis
Lakehurst, 22. April 1937 Das Luftschiff sah imposant aus. Von der silbrig glänzenden Außenhülle einmal abgesehen, glich der Riese tatsächlich einer überdimensionalen Zigarre. Und zwar einer aufgeblasenen kubanischen Montecristo von annähernd zweihundertfünzig Metern Länge und einem Durchmesser von rund vierzig Metern an der dicksten Stelle. Ein zugegebenermaßen oft zitierter, platter Vergleich, der den Nagel jedoch immer wieder auf den Kopf traf. Dr. Jonathan Madell stand mit offenem Mund vor dem Luftgefährt. So etwas wie das hatte er bisher noch nie aus der Nähe gesehen. Ihm kam das Gesamtgebilde reichlich surreal vor – ein gigantischer Walfisch, gefangen in einem enorm großen Aquarium, das die Leute hier Luftschiffhalle nannten. Das monotone silberne Farbeinerlei unterbrachen nur die unübersehbaren roten aufgemalten Hakenkreuzflaggen der unteren und oberen Seitenleitwerke am Heck. Nervös wischte sich der junge Mann die Handinnenflächen dezent an der Hose des eleganten anthrazitfarbenen Anzugs ab. Dabei blickte er mit gemischten Gefühlen vom Inneren des verglasten Terminals auf das imposante Flugschiff in der Halle. Ihm war nicht wohl zumute. Madell war Physiker, kein Globetrotter oder gar Draufgänger. Er hasste es, zu reisen, und mit einem Zeppelin erst recht. Zu oft hatte er in Zeitungen und den üblichen Boulevardblättern über Beinahekatastrophen von Luftschiffen gelesen. Er wusste ganz genau um die Gefahren dieses ganz speziellen Fortbewegungsmittels. Im Prinzip war ein Zeppelin nichts anderes als ein riesiger Brandsatz. Ein Funke an der »richtigen« Stelle, und das mondäne Gebilde verwandelte sich innerhalb von Sekunden in einen tödlichen Feuerball. Keine Chance zu überleben. Viel lieber hätte er mit einem Passagierschiff den Atlantik überquert. Madells neuer »Arbeitgeber« erwartete ihn jedoch binnen zwei Tagen in Deutschland. Selbst für ein Blaues-Band-Linienschiff war das nicht annähernd zu schaffen. Also musste der junge Physiker in den sauren Apfel beißen und den Luftweg nehmen. Zudem hatten seine »neuen Freunde« die Luftschiffpassage bereits bezahlt. Das Schreiben zu dem One-Way-Ticket war eindeutig formuliert: Friss oder stirb! Ein Gong riss ihn aus den Gedanken – das Boarding begann. Er umklammerte die abgewetzte braune Lederaktentasche eine Spur fester. Sie und die Dokumente, die er am Körper trug, bedeuteten einen Neuanfang – in wissenschaftlicher wie auch in persönlicher Hinsicht. Langsam wandte er sich vom Fenster ab und folgte den restlichen dreißig Passagieren Richtung Ausgang, der ins Innere der überdimensionalen Halle führte.
Madell trat als Letzter durch die große zweiflüglige Tür in das riesenhafte Konstrukt. Der Anblick der gesamten Szenerie raubte ihm den Atem. Zunächst nahm er lediglich eine gigantische grau-silbrige Wand wahr – die »Hindenburg«. Unter dem riesigen Luftschiff wuselten unzählige Menschen hin und her. Sie gingen Tätigkeiten nach, deren Sinn und Zweck er nur erahnen konnte. Jede Menge laut knatternder Kleinfahrzeuge zog undefinierbare Kreise und vermittelte den Eindruck immenser Beschäftigung. Diverse quäkende Lautsprecheransagen, die anscheinend nur das Bodenpersonal verstand, befeuerten zusätzlich die unwirkliche Kulisse. Madell dämmerte langsam, welch Aufwand betrieben werden musste, um so ein Ungetüm wie die Hindenburg in die Luft zu befördern. Er staunte wiederholt mit offenem Mund und bewegte sich schleppenden Schrittes weiter in die Halle hinein. Von ingenieurtechnischen oder organisatorischen Dingen wie einem Luftschiffstart hatte er keinerlei Ahnung. Er war schließlich theoretischer Physiker, gehörte zur naturwissenschaftlichen Elite, und kein Ingenieur oder gar Techniker. Die waren für ihn lediglich Domestiken der Wissenschaft, niedere Erfüllungsgehilfen – eine Einstellung, die ihn schon das ein oder andere Mal in Schwierigkeiten gebracht hatte. Ein lautes Hupen riss ihn erneut aus seinen Gedanken. Zornig gestikulierte ein Mitarbeiter des Bodenpersonals auf einem merkwürdigen Gefährt, das in direkter Linie auf ihn zuhielt. Das Fahrzeug zog kleine Wagen, beladen mit unzähligen Paketen, Postkisten und Gepäckstücken jedweder Art. Im letzten Augenblick sprang Madell beiseite, um nicht überfahren zu werden. Die Szenerie der Halle fing ihn sofort wieder ein. Er hatte keine Zeit, sich über die Unverschämtheiten und das ungebührende Verhalten der Arbeiter zu echauffieren. Zügigen Schrittes folgte er den restlichen Passagieren. Er hatte Angst, den Anschluss zu verlieren. Madell wollte nicht wie ein Idiot dastehen, der keinerlei Ahnung davon hatte, wie das Zeppelin-Boarding vonstattenging.
In weniger als einer Stunde würde der LZ 129 »Hindenburg« von Lakehurst aus in Richtung Deutschland starten, genauer gesagt nach Frankfurt. Madell atmete tief durch und hoffte, dass bis zum Start nichts mehr passieren würde. Er wollte so schnell wie möglich amerikanischen Boden hinter sich lassen, um ein neues Leben zu beginnen. Nervös zupfte er an seinem Hut, als er sich zu der kleinen Gruppe von Passagieren gesellte, die darauf wartete, endlich ins Innere des silbrigen Giganten zu gelangen. Er lauschte den nichtssagenden, trivialen Gesprächen der sogenannten Upperclass. Nur die war in der Lage, sich einen derart luxuriösen Flug zu leisten – und er! Doch sein Ticket zahlten andere. Madell blickte noch einmal nach oben über die Fahrgastgondel hinweg zu dem gewaltigen Körper des Luftschiffs, der das gesamte Gesichtsfeld einnahm. Da hatten die Deutschen wieder ganze Arbeit geleistet – es war das größte, schnellste und nobelste Fortbewegungsmittel, das man sich vorstellen konnte.
Am Fuße der Gangway, die ins Innere des Zeppelins führte, stand ein älterer, freundlich dreinschauender Mann in der Uniform des amerikanischen Zolls. Er kontrollierte konzentriert die Pässe und Tickets der Passagiere. Madell fing an zu schwitzen. Verdammt! Das dauerte alles viel zu lange. Nach einer gefühlten Ewigkeit war auch er endlich an der Reihe. Mit fahrigen Bewegungen, die er eigentlich tunlichst vermeiden wollte, hielt er dem Uniformträger seine Reiseunterlagen hin. Der schaute ihn lange an und senkte dann den Blick zu den Dokumenten, die er überreicht bekommen hatte. Schweiß rann Madells Rücken hinunter. Jetzt nur die Ruhe bewahren!
»Ich wünsche eine gute Reise«, sagte der Beamte schließlich nach unendlich langer Zeit und gab die Reisedokumente zurück. Madell atmete tief durch und ging die ersten Stufen der Treppe hinauf ins Innere des Luftschiffs. Mit jedem zittrigen Schritt nahm die Nervosität ab. Siegessicherheit keimte allmählich in ihm auf.
»Halt!«, rief der Zollbeamte mit scharfer Stimme.
Madell erstarrte. Der Magen verkrampfte schlagartig. Ihm wurde speiübel. Aus und vorbei – die Zukunft, seine Träume binnen weniger Augenblicke ausgelöscht. Langsam wandte er sich dem Beamten zu. Der blickte ihm direkt in die Augen. Mit aller Kraft versuchte der junge Physiker, dem Blick standzuhalten, was aber nur mit mäßigem Erfolg gelang. Schließlich wies der Zollbeamte mit dem Kopf leicht in Richtung Treppe.
»Mister, Sie haben Ihr Ticket verloren. Sie sollten besser darauf achtgeben.« Ein Blick nach unten auf die Stufen der Treppe löste in Madell eine ungeheure Erleichterung aus. Tatsächlich musste wohl der Fahrschein in ein neues Leben aus dem Sakko gefallen sein. Schnell stieg er die drei Stufen hinab, bückte sich und schnappte sich das Stück Papier mit einer einzigen Bewegung.
»Danke«, entgegnete er und ging dann rasch die Treppe hinauf.
»Herzlich willkommen an Bord der Hindenburg, Dr. Madell«, begrüßte ihn ein schneidiger Steward mit zackigem Ton und in fast perfektem Englisch. Madell war der Einzige, dem diese ganz persönliche Begrüßung zuteilwurde. Alle anderen Passagiere schauten misstrauisch und neugierig. Im ersten Moment war es Madell peinlich. Das Gefühl legte sich jedoch relativ rasch, und er genoss die Sonderbehandlung. Mit Sicherheit hatten seine neuen Geschäftspartner ihre Beziehungen spielen lassen.
»Ich führe Sie jetzt zu Ihrer Kabine. Darf ich?« Mit einem Griff wollte der Steward sich Madells Aktentasche schnappen, der sie dem Zugriff jedoch blitzartig entzog. Erstaunt blickte der junge Mann auf.
»Nein, die trage ich selbst!«, entgegnete Madell ungehalten.
»Kein Problem, der Herr, wenn Sie mir nun bitte folgen mögen?«
Madell nickte und trottete dem Steward hinterher. Der begann zu dozieren, während sie eine weitere Treppe nach oben stiegen.
»Wir befinden uns jetzt gerade im sogenannten Treppenhaus der Hindenburg. Das führt direkt ins Zentrum des Zeppelins, von wo aus Sie alle für Passagiere relevanten Bereiche des Luftschiffs erreichen.« Madell fand die Bezeichnung Treppenhaus reichlich übertrieben. Es handelte sich hierbei lediglich um zwei schmucklose Aluminiumtreppenaufgänge, die eine weitere Etage nach oben reichten. Nach wenigen Augenblicken erreichten sie das Ende des Treppenhauses. Der Steward ließ Madell den Vortritt. Der befand sich plötzlich vor einer Wand, von der linker und rechter Hand zwei weitere Korridore in Richtung der Längsachse des Zeppelins führten.
Und wieder begann der Steward zu erklären: »Auf zwei Gänge verteilt, finden Sie hier insgesamt vierunddreißig Schlafkabinen. Für Sie haben wir die Nummer Zwölf reserviert. Sie müssten also den linken Gang benutzen, um zu ihrer Kabine zu gelangen.« Er tat, wie ihm geheißen, riskierte aber einen Blick weiter, jenseits des Korridors. Klaus, so hieß der Steward, wie Madell mittlerweile dem Namensschild entnommen hatte, ließ sich nicht bremsen und erklärte weiter die Räumlichkeiten des Zeppelins.
»Links und rechts der beiden Flure gibt es jeweils die Promenaden, auch Galerien genannt. Vor der Galerie der linken Seite des Zeppelins ist der Essbereich – unser Restaurant.«
Madell war beeindruckt. Im Speisesaal herrschte schlichte Bauhaus-Eleganz vor. Jeweils vier anscheinend sehr bequeme Freischwinger-Stühle mit roter Polsterung waren vor quadratischen Tischen positioniert. Das Essen, das den wohlhabenden Passagieren serviert wurde, bestand aus erlesenen Gerichten und Weinen – so stand es zumindest in den meisten Zeitschriften. Die Küche der Hindenburg hatte einen legendär guten Ruf. Madell war schon sehr gespannt darauf, dies heute Abend ausgiebig zu testen. Sämtliche Möbel bestanden aus Duraluminium. So wollten die Konstrukteure des Giganten statische Elektrizität und Funkenflug vermeiden, welche die randvoll mit Wasserstoff gefüllten Auftriebstanks im ungünstigsten Fall binnen weniger Augenblicke zur Explosion gebracht hätten. Ein Horrorszenario! Madell wurde wieder unwohl, wenn er daran dachte, auf was für einer Bombe er hier saß. Andererseits war noch nie etwas Schlimmes passiert.
Was soll's, dachte er, es war aller Wahrscheinlichkeit nach seine letzte Reise mit einem Zeppelin. Den USA kehrte er ein für alle Mal den Rücken. Die Forschungen fanden von nun an in einem fremden Land statt. Nie hätte er gedacht, dass er das Angebot, das eines Tages per Post aus Deutschland gekommen war, auch nur ansatzweise in Erwägung ziehen würde. Doch die Zeiten hatten sich schnell, sehr schnell geändert. Die Universität zeigte nur noch mäßiges Interesse an den Forschungen des Physikers. Geldgeber sprangen sukzessive ab, und auch Freunde und Kollegen belächelten Madell nur noch mitleidig, wenn er grob seine Arbeit umriss. Ins Detail durfte er nicht gehen. Obwohl sich anscheinend immer weniger Menschen in den verantwortlichen Positionen für die Forschungen und Experimente interessierten, unterlag er trotzdem der Geheimhaltung. Ein Witz, über den er jedoch nicht lachen konnte.
Der Blick des jungen Mannes wanderte weiter zur Promenade. Sie befand sich auf beiden Seiten des Rumpfes der Hindenburg. Große Doppelfenster, die man teilweise sogar öffnen konnte, ermöglichten den Ausblick nach unten auf die bald gemächlich vorüberziehende Landschaft. Vor den Panoramafenstern hatten die Innenarchitekten hier und da Ledersessel und kleine Clubtische arrangiert, die zum Verweilen und Schauen einluden.
Klaus fuhr mit seiner Erklärung immer noch fort. »Im Deck eine Etage unter uns finden Sie den Rauchsalon des Schiffs.« Madell stutzte und schaute den Steward ungläubig an.
»Ein Rauchsalon?«
»Ganz recht. Sie brauchen aber nicht in Sorge zu sein. Der Salon verfügt über eine eigene Belüftung, die aus Sicherheitsgründen einen leichten Überdruck erzeugt, damit von außen keine brennbaren Gase eindringen können. Im Rauchsalon finden Sie außerdem das einzige Feuerzeug an Bord der Hindenburg.«
Madell schüttelte den Kopf. Unfassbar!
»Vor dem Raucherraum gibt es zudem eine kleine Bar, die bis kurz nach Mitternacht geöffnet hat.«
»Steht dort der Blüthner-Flügel?« Madell hatte schon sehr viel von diesem einzigartigen und berühmten Musikinstrument gelesen. Den Flügel hatten deutsche Instrumentenbauer speziell für den LZ 129 angefertigt. Er bestand größtenteils aus Aluminium, war mit gelbem Schweinsleder überzogen und wog lediglich 180 Kilogramm.
»Bedaure, Herr Doktor. Im Zuge des Umbaus der Hindenburg, um mehr Passagiere aufzunehmen, musste der Flügel leider entfernt werden.« Klaus hob entschuldigend die Schultern. Auf dem Weg zu Madells Kabine erklärte er noch, dass sich Duschen und Toiletten ebenfalls auf dem B-Deck befänden. Eine nicht unwichtige Information, wie Madell für sich feststellte. Irgendwann standen er und der Steward vor der Kabinentür.
»Den Schlüssel, Ihr Gepäck und eine kleine kulinarische Aufmerksamkeit der Reederei finden Sie in Ihrer Kabine. Haben Sie noch Fragen?« Klaus schaute Madell erwartungsvoll an, der verstand und drückte ihm eine Fünf-Dollar-Note in die Hand. Mit zackigem Hackenschlag sowie einem Kopfnicken quittierte der Steward das Trinkgeld und entfernte sich.
Madell öffnete die Kabinentür, trat ein und schaute sich um. Enttäuschung! So luxuriös und elegant die Gemeinschaftsräume gestaltet waren, so karg ausgestattet kamen die Passagierkabinen der Hindenburg daher. Der junge Amerikaner assoziierte das Interieur sofort mit dem einer Gefängniszelle oder – wenn man es gut meinte – mit dem eines Schlafwagenabteils. Ein Doppelstockbett, ein in die Wand versenkbares Waschbecken, ein Hocker sowie ein Rufknopf, um das Personal zu rufen – das war's. Jetzt wunderte es Madell auch nicht mehr, dass die Passagiere wohl ihre Zeit hauptsächlich in den Lounges, Promenaden und dem Speisesaal der Hindenburg verbrachten. Die Kabinen waren lediglich zum Schlafen gedacht. Das war eindeutig zu erkennen.
Dennoch, irgendwie erinnerte ihn diese Schlafzelle an die Hochzeitsreise mit Mildred. Mildred! Vor zwei Jahren hatten sie geheiratet und traumhafte Flitterwochen auf den Niederländischen Antillen verbracht, Schifffahrt dahin inklusive. Madell gab dafür fast das gesamte Ersparte aus – und das mit Freude! Die Kabine des in die Jahre gekommenen Linienschiffs war nur unwesentlich größer gewesen als die des Zeppelins. Aber das war damals nicht wichtig. Es gab nur sie beide und eine ganz große Liebe. Alles andere waren widrige und zu vernachlässigende Begleitumstände.
Madell atmete schwer ein, der Druck auf seine Brust verstärkte sich, wenn er an Mildred dachte. Sie war tot, weg, würde niemals wiederkommen oder ihn freudestrahlend zu Hause erwarten, wenn er aus dem Labor käme. Ein schrecklicher Autounfall hatte sie vor knapp einem Jahr plötzlich aus dem Leben gerissen. Und danach war nie wieder etwas, wie es einmal gewesen war. Das Leben hatte sich geändert; Madell hatte sich geändert.
Er musste sich dringend setzen oder legen, die Beine versagten den Dienst, und kalter Schweiß bildete kleine Tröpfchen auf seiner hohen Stirn. Schwindel. Der Kreislauf sackte ab. Ihm brummte der Schädel, er hatte auf einen Schlag schreckliche Kopfschmerzen. Madell schmiss Hut, Mantel und Jackett auf den Hocker und stellte die Aktentasche daneben. Dann legte er sich auf das untere Bett der Doppelstockbett-Konstruktion. Die um den Bauch gebundenen Dokumente in der Stofftasche störten. Er hatte aber keine Kraft mehr, sich derer zu entledigen. Nur kurze Zeit später fiel der junge Mann in einen traumlosen Erschöpfungsschlaf.
Irgendwann schreckte er auf. Ein Geräusch hatte ihn aus dem Schlaf gerissen. Es dauerte einige Augenblicke, bis er die Orientierung wiedergefunden hatte. Der Zeppelin, seine Kabine – schnell fingerte Madell nach den wichtigen Unterlagen, die er in einem selbst gebastelten Stoffbehältnis um den Bauch trug. Gott sei Dank, noch alles da. Da durchfuhr es ihn erneut. Wie lange hatte er geschlafen? Panisch schaute er auf die Armbanduhr – nur eine halbe Stunde. Erleichterung. Der Zeppelin musste unmittelbar vor dem Start stehen. Das Spektakel wollte er keinesfalls verpassen. Glücklicherweise waren die Kopfschmerzen auf dem Rückzug. Madell knurrte der Magen. Ein gutes Zeichen. Er musste dringend etwas essen, damit sein Kreislauf wieder in Schwung kam. Vorsichtig machte er sich vor dem Waschbecken in seiner Kabine parat, sodass er nicht mehr so aussah, als wäre er vor Kurzem aus dem Bett gestiegen. Nach zehn Minuten war Madell wieder vorzeigbar und der junge unauffällige Mann mit einem Geheimnis, das man ihm nicht zutrauen würde. Er musste unwillkürlich in den Spiegel grinsen.
Soweit man überblicken konnte, versammelten sich ausnahmslos alle Passagiere vor den schräg nach unten zulaufenden Panoramafenstern der beiden Promenaden der Hindenburg. Auf kleinen Beistelltischen stellten Kellner Häppchen und Getränke ab. Madell griff beherzt zu, schaute aber verstohlen, ob ihn nicht jemand beobachtete. Keine Gefahr, alle waren damit beschäftigt, das Schauspiel der Fahrt aus der Luftschiffhalle nicht zu verpassen. Nachdem der Magen erst einmal gefüllt war, gesellte sich der junge Amerikaner zu den anderen Passagieren der Promenade. Ihm wurde wieder unwohl. Am liebsten hätte er sich in seiner Kabine verkrochen. Madell hielt sich so krampfhaft am Aluminiumhandlauf fest, dass sich seine Knöchel weiß färbten. Die Bodenmannschaft öffnete die Säcke des Wasserballasts, und sofort begab sich der Zeppelin einige wenige Meter in die Höhe. Dies geschah so sanft, dass kaum eine Bewegung wahrnehmbar war. Plötzlich ein lauter, metallisch klingender Knall, gefolgt von einem Ruck, der durch die Gondel zu spüren war. Madell blickte panisch auf. Sein Blick fiel auf die Mitreisenden, die davon nicht im Geringsten beeindruckt schienen.
»Keine Panik, mein junger Freund.« Eine ältere Dame im geblümten Kleid und Fascinator – einem kleinen Hut – legte ihre Hand auf die von Madell.
»Man hat nur die Bugspitze des Zeppelins an einem fahrbaren Ankermast und das Heck auf einem Heckwagen befestigt. Als Nächstes lascht die Bodencrew die Hindenburg an den seitlichen Laufkatzen fest. Und dann kann’s endlich losgehen.«
Und so geschah es aus auch. Das Bodenpersonal befestigte die Hindenburg an den seitlichen Laufkatzen. Die Absicherung erfolgte durch Seitenwinden. Anschließend manövrierten jede Menge Arbeiter den Zeppelin langsam aus der Halle auf einen davorliegenden Platz. Und dann verankerte eine Traube von Menschen den transportablen Ankerplatz auf dem Startplatz und drehte das Luftschiff in den Wind. Als sich die Hindenburg in der korrekten Lage befand, entfernte man den Heckwagen. Plötzlich ein neues, nicht zu überhörendes Geräusch.
Wiederum stand ihm die ältere Dame erklärend zur Seite. »Man hat die Motoren gestartet. Gewöhnen Sie sich an das tiefe Brummen. Das wird Sie die nächsten Stunden begleiten.«
Aus Lautsprechern, die selbst im Inneren der Hindenburg zu hören waren, ertönte unvermittelt der Befehl: »Luftschiff hoch!« Mit einem metallisch klackenden Geräusch löste sich das Schiff vom Mast. Langsam erhob sich der Gigant wie von Geisterhand gen Himmel, und die angeworfenen Motoren brachten ihn langsam in Fahrt.
Madell war einerseits dankbar für die Information der älteren Dame, andererseits war ihm seine Panikattacke reichlich peinlich, outete sie ihn doch als Anfänger in Sachen Luftschifffahrt. Er nickte der Dame freundlich zu.
»Ist meine erste Fahrt mit einem Zeppelin«, sagte er zu der ihr und zog dabei seine Hand unter ihrer hinweg.
»Glauben Sie's mir, junger Mann, Sie werden es genießen.«
Die meisten Passagiere der Hindenburg verteilten sich, sobald sich der Zeppelin in der Luft befand, in den verschiedenen Salons, machten es sich in den Lounge-Sesseln bequem oder richteten irgendwelche Dinge in ihren Kabinen. Nach wenigen Augenblicken stand Madell fast allein an den Fenstern der Promenade. Wie konnte man sich nur so schnell von diesem phantastischen Anblick losreißen? Der junge Physiker starrte wie hypnotisiert auf die vorbeiziehende Landschaft. Im Gegensatz zu einem Flugzeug flog ein Zeppelin sehr viel niedriger und vor allem langsamer, sodass man immer noch Einzelheiten ausmachen konnte, selbst wenn das Luftschiff Reiseflughöhe erreicht hatte. Es war atemberaubend. Die Dämmerung verschlang jedoch zunehmend die Szenerie. In der Ferne tauchten immer mehr Lichter auf, je dunkler es wurde – New York und Philadelphia! Und in Flugrichtung der Hindenburg konnte man schon ein riesiges schwarzes Loch erkennen, das die Passagiere die kommenden zwei Tage begleiten würde. Der Atlantik! Eine tiefe Ruhe bemächtigte sich Madells, das beruhigende Gefühl, dass von nun an alles gut werden würde. Doch was genau sich hinter diesem »gut« verbarg, vermochte er noch nicht festzumachen. Der Bauch sagte aber, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Kopf und Geist würden bestimmt bald nachziehen. Er freute sich auf Deutschland sowie auf die neuen beziehungsweise alten Aufgaben und die Fortführung seines wichtigen Projektes. Madell schaute auf die Armbanduhr. Im selben Moment ertönte ein dezenter Gong. Das Abendessen war bereit zum Servieren.
Um kurz nach neun Uhr lag Madell bereits im Bett der Kabine. Das Menü war hervorragend und sehr köstlich gewesen. Was ihm jedoch ein wenig den Appetit verdorben hatte, war die penetrante Neugier der beiden Sitznachbarn. Er hatte das Gefühl gehabt, konstant ausgefragt zu werden. Und je einsilbiger Madell sich gab, desto intensiver wurde die Befragung. Schließlich dachte sich Madell eine Geschichte aus, weswegen er nach Nazi-Deutschland unterwegs war. Doch je länger das Essen dauerte, umso mehr verstrickte er sich in Widersprüche. Von alldem schienen die Tischgenossen jedoch nichts zu merken. Man konnte ihnen alles auftischen, sie schluckten es, ohne großartig nachzudenken. Madell hasste das. Irgendwann verließ er den Speisesaal und entschuldigte sich bei seinen Mitreisenden mit einem Verweis auf Unwohlsein.
Einmal in der Kabine angelangt, hatte er bereits das Gefühl, in einer vertrauten Umgebung anzukommen. So schlimm fand er die wenigen Quadratmeter mittlerweile gar nicht mehr. Hauptsache, es gab eine Rückzugsmöglichkeit, um sich auszuruhen und den unerträglich versnobten Passagieren hier an Bord aus dem Weg zu gehen. Madell streifte das Nachthemd über, setzte sich auf die Bettkante, atmete tief durch und legte sich schließlich hin. Vor allem die Ruhe, der sanfte Flug des Zeppelins und nur das ganz dezent im Hintergrund zu vernehmende tiefe Brummen der Motoren taten ihr Übriges, Madell in den Schlaf zu geleiten. Nach nur wenigen Augenblicken schlief er ein.
Madell schreckte hoch. Ein metallisches Kratzen hatte das Unterbewusstsein in Alarmbereitschaft versetzt. Es dauerte jedoch eine gefühlte Ewigkeit, bis ins Bewusstsein durchsickerte, dass er nicht träumte. Jemand war in der Kabine. Blind tastete Madell nach dem Lichtschalter für das Schlaflicht neben dem Bett. Das kleine Licht blendete ihn für einen Augenblick. Sobald sich die Augen an die neue Lichtsituation gewöhnt hatten, blickte er sich hektisch um, bis sein Blick an einem Schatten haften blieb. Neben dem Bett stand ein Mann, dessen Gesicht im Dunkeln lag. Die dezente Beleuchtung reichte nur aus, um ein Messer sichtbar zu machen, welches er fest in der Hand hielt. Panik! Madell wusste nicht, was er denken, fühlen oder tun sollte. Sämtliche Müdigkeit war auf einen Schlag verflogen. Er war wie gelähmt und zu keiner Handlung fähig.
»Geben Sie mir die Unterlagen!«, hauchte eine dunkle Stimme, die in ihrer Intensität keinerlei Diskussion zuließ. Madell versuchte es trotzdem.
»Was … was meinen Sie? Was machen Sie in meiner Kabine?«
Das zur Stimme gehörende Gesicht schoss aus der Dunkelheit hervor.
»Noch einmal: Wo sind die Unterlagen? Ich würde nur ungern ein Blutbad anrichten.« Der Eindringling spielte mit dem Messer nur wenige Zentimeter vor Madells Augen und Nase.
Der setzte sich schlagartig in seinem Bett auf und zog sich die Bettdecke über Beine und Oberkörper bis hoch zu den Schultern. Der fremde Mann schaute sich um und fand die braune Aktenmappe auf dem kleinen Aluminiumtisch der Kabine. Er nahm die Tasche an sich.
»Und nun die Dokumente, die Sie am Körper tragen! Los!«
Madell wurde gewahr, dass er keine Chance hatte. Er hatte versagt. Der Wissenschaftler griff unter die Bettdecke, beförderte eine Art übergroßen Brustbeutel zutage und hielt ihn dem Eindringling hin.
»Und was jetzt? Töten Sie mich?«, fragte Madell mit zittriger Stimme.
Wie aus dem Nichts erschien plötzlich eine weitere Person in Madells Kabine. Ein Hüne von einem Mann in Steward-Uniform. Der nahm mit einer fließenden Bewegung den Angreifer von hinten in den Schwitzkasten und brach ihm mit einer gekonnten Bewegung das Genick. Das knackende Geräusch konnte man bis zum Bett vernehmen – ein Geräusch, das Madell niemals vergessen würde. Der Körper sackte sofort in sich zusammen und fiel zu Boden.
»Was haben Sie getan? Wer sind Sie?«, kreischte Madell hysterisch. Der Mann in Steward-Uniform umgriff mit eisenharter Hand seine Kehle, sodass Madell keinerlei Geräusch mehr von sich geben konnte. Als er das Gefühl hatte, den Schwächling genug eingeschüchtert zu haben, lockerte er seinen Griff.
»Ich sorge dafür, dass Ihr Arsch heil an einem Stück und vor allem lebendig in Deutschland ankommt!«
Madell nickte. Er zitterte am ganzen Körper. »Und nun?«
Der Steward baute sich vor Madell auf und sagte mit leisem, aber sehr eindringlichem Timbre: »Nun vergessen Sie, was hier passiert ist, schließen schön hinter mir ab und achten auf Ihre Unterlagen. Verstanden?«
Madell nickte eingeschüchtert. »Was geschieht mit ihm?« Er zeigte mit einem Kopfnicken auf den Toten.
»Der Atlantik ist sehr groß und vor allem sehr tief.« Dabei grinste der vermeintliche Steward diabolisch. Dann packte er den Leichnam am Kragen, zerrte ihn fast mühelos aus der Kabine und verschwand in den Tiefen des Zeppelins. Madell sprang panisch vom Bett auf und versperrte die Kabine. So hatte er sich den Beginn seines neuen Lebens nicht vorgestellt.
2
Post aus der Vergangenheit
München, heute Das durch Mörtel zusammengehaltene Ziegelfragment krachte mit einem lauten Knall auf den Fliesenboden. Es war das erste Mal seit knapp achtzig Jahren, dass die Ruhe der luftdicht versiegelten Halle gestört wurde. Der Ziegelblock zerbrach in unterschiedlich große und kleine Teile. Eine riesige Staubwolke erfüllte im Nu den Raum. In der Decke klaffte ein rundes Loch mit einem Durchmesser von nahezu zwei Metern. Die Lichtkegel diverser Taschenlampen versuchten, Licht in das Dunkel der geöffneten Räumlichkeit zu bringen. Ohne Erfolg – der Staub schluckte erbarmungslos jedes Lichtteilchen. Oberhalb des Kuppeldurchbruchs erhob sich aus dem allgemeinen Stimmenwirrwarr eine weibliche Stimme.
»So, meine Damen und Herren, der Dreck muss raus, ehe wir uns auch nur einen Schritt hier hineinwagen. Wir brauchen weitgehend klare Sicht, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Also, Leute, auf geht's, lassen Sie uns Großreinemachen.«
Dr. Eva Graf, zu der der resolute Tonfall gehörte, war es gewohnt, Kommandos zu geben. Eva trieb die Ungeduld. Sie wollte nach all der Vorarbeit und Recherche der letzten Wochen nun endlich die Früchte ihrer Arbeit ernten. Da sie erwartet hatte, dass es eine sehr staubige Angelegenheit werden würde, hatte Eva sich bereits im Vorfeld um zwei leistungsstarke Sauggebläse gekümmert. Deren rot glänzende Schläuche stopften Evas Mitarbeiter kurzerhand durch das Loch der Kuppel in den darunterliegenden Raum.
»Sagen Sie Ihren Leuten oben, dass Sie die Sauger anschalten können«, rief Eva einem Service-Mann der Verleihfirma zu.
Die enorm leistungsfähigen Maschinen befanden sich ebenerdig auf Höhe des U-Bahn-Eingangs und kosteten jede Stunde ein Heidengeld. Eva stand mächtig unter Druck. Sie hatte nur wenig Zeit. Die hiesigen Verkehrsbetriebe räumten ihr freundlicherweise ein Zeitfenster von sechs Stunden ab Mitternacht ein. In dem Zeitraum blockierten sie den Streckenabschnitt, indem sie den U-Bahn-Verkehr umleiteten. Und das auch nur, weil es sich um einen vergleichsweise gering befahrenen äußeren Bereich handelte. Zudem war das Münchener Technik- und Naturkundemuseum eine Institution in der Stadt, der man in persona Dr. Graf nur sehr ungern etwas abschlug.
Eva schaute auf die Uhr – kurz vor fünf. Verdammt, das dauerte alles viel zu lange. In spätestens einer Stunde lief die Zeit ab. Dann erwarteten die Verkehrsbetriebe eine saubere Haltestelle ohne Sauger oder dergleichen Gerätschaften. Die morgendlichen Pendler sollten von dem ganzen Tohuwabohu nichts mehr merken, wenn sie zu den Bahngleisen strömten. In zähen Verhandlungen hatte Eva den Verkehrsmanagern den Zugang zum Objekt auch während des gesamten Tages und den folgenden Wochen aus dem Kreuz geleiert.
Mit einem dumpfen Grollen begannen die mächtigen Maschinen, den Staub aus der Kuppel nach oben ans aufziehende Morgenlicht zu transportieren. Erfreut und erleichtert stellte Eva fest, dass der schmutzig graue Vorhang nach wenigen Minuten tatsächlich merklich lichter wurde. Die Uhr tickte, und zwar wieder zu Evas Gunsten. Zufrieden klopfte sie den Dreck aus dem blauen Overall. Na also, ging doch! Zeit für einen Kaffee. In spätestens einer halben Stunde, so schätzte Eva, wäre das Gewölbe überwiegend staubfrei. Und erst dann konnten sie die eigentliche Aufgabe in Angriff nehmen.
Eva rüttelte einem in der Nähe stehenden Mann in Feuerwehruniform an der Schulter. Der wandte sich um und hielt sein Ohr in Richtung Evas Mund. Die Lautstärke des Luftstroms aus Staub, der in die Schläuche gesaugt wurde, war ohrenbetäubend.
»Wenn die Kuppel weitgehend staubfrei ist, machen Sie bitte eine Luftanalyse. Ich habe keine Lust auf unangenehme Überraschungen. Nicht dass mir meine Leute hier reihenweise zusammenklappen.« Der Feuerwehrmann nickte und hob den Daumen.
»Ach du heilige Scheiße«, entfuhr es Anja, während sie sich abseilte und gleichzeitig den Blick hektisch umherschweifen ließ. Sie wollte nicht das Geringste verpassen. Nach einer knappen Minute erreichte sie den Boden, und zwar direkt neben Dr. Eva Graf. Mit offenem Mund, staunendem Gesichtsausdruck und in eine leichte Staubwolke gehüllt blickte sie ins Gesicht der Chefin. Die strahlte die übliche routinierte Gelassenheit aus, um die Anja sie immer wieder beneidete. Als Eva sah, dass sich ihre Assistentin wie ein kleines Kind freute, musste sie lächeln. Anja mitzunehmen war die »gute Tat des Tages« – sie hatte es sich mehr als verdient. Sie, die man fast niemals von ihren geliebten Rechnern, Internet, Deep Web oder was auch immer loseisen konnte.
»Nicht schlecht, was?«
Und ob. Anja war überwältigt. Sie schaute nach oben. »Wow, ich bin schwer beeindruckt.«
Über ihr öffnete sich ein gewaltiger Kuppelbau mit einem Durchmesser von knapp dreißig Metern bei annähernd gleicher Höhe. Die Mauern, die die imposante Kuppel trugen, bestanden aus Ziegeln und ruhten auf einem tiefen Ring aus Gussmauerwerk als Fundament. In Anja wurden sofort Assoziationen an das weltbekannte Pantheon geweckt. In einer Geste, die etwas zu theatralisch ausfiel, indem sie beide Arme einen Halbkreis beschreiben ließ, begann Eva zu erzählen.
»Meine Liebe, was du hier siehst, ist eine perfekt erhaltene, wenn auch in höchstem Maße eingestaubte Rohrpostverteilerstation. So was bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Dieses Prachtstück ist nahezu unversehrt und sehr alt.«
»Rohrpost? In München? Wieso habe ich noch niemals etwas davon gehört, geschweige denn gesehen?«
»Tja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht liegt es an deinem Alter. Ich vermute aber mal, die Ursache für das Wissensdefizit ist in dem ausgeprägten Desinteresse für Stadtgeschichte begründet. Stimmt's?«
Anja verzog ihr Gesicht und äffte Eva freundschaftlich nach. Die musste lachen.
»Tut mir leid, ich bin manchmal ein schrecklicher Klugscheißer.«
»Manchmal?«
Eva stupste Anja in die Seite.
»Also, in Sachen Rohrpost hatte München eine europäische Vorreiterrolle. Bereits am 1. April 1877 wurde eine Anlage in Betrieb genommen, die die Telegrafen-Zentralstation im Telegrafengebäude am Bahnhofsplatz, die Börse und das Hauptpostamt in der Maximilianstraße miteinander verband. Immerhin, nach dem Ersten Weltkrieg gab es schon mehr als vierunddreißig Kilometer Rohrpostnetz. Es war jedoch erst Anfang der zwanziger Jahre, als das Netz der Allgemeinheit zugänglich gemacht und somit sehr viel populärer wurde.«
»Und wozu das Ganze?«, fragte Anja eher beiläufig, ohne eine Antwort zu erwarten.
»Tja, der Mensch ist ein sehr kommunikatives Wesen. Das Rohrpostnetz entstand aus der Notwendigkeit, die anschwellende Flut von Telegrammen zu bewältigen, die nicht mehr über die bestehenden Telegrafenleitungen geschickt werden konnten. Der Ausbau des Telefonnetzes nach dem Zweiten Weltkrieg machte jedoch der Rohrpost den Garaus, sodass das Rohrpostnetz in 1960ern stillgelegt wurde.«
»Okay, okay, Chef, du hast dein Wissen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Könnten wir uns nun endlich weiter umsehen?«
Eva musste schmunzeln. »Na klar, schau dich ruhig um. Aber nichts anfassen! Haben wir uns verstanden?«
Anja nickte genervt, ging ein paar Schritte und schaute sich fasziniert um.
Der Kuppelbau war schlicht eingerichtet. Nur wenige Schreibtische standen in der Mitte der Kuppel, die allesamt immer noch von einer zentimeterdicken Staubschicht bedeckt waren. Diverse Wandleuchten im Art-déco-Stil, in regelmäßigen Abständen um das Gewölbe herum angebracht, hätten jedem Antiquitätenhändler das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Hier und da sah Anja verschiedene Schalttafeln, deren Sinn und Zweck sich ihr allerdings verschlossen. Sie hatte das Gefühl, sich in einem Steampunk-Blockbuster à la »Metropolis«, »20.000 Meilen unter dem Meer« oder »Sky Captain and the World of Tomorrow« zu befinden. Als glühende Anhängerin dieses Metiers war sie davon natürlich sehr entzückt. Was jedoch ihr größtes Interesse weckte, war ein riesiges Gebilde vor einer gemauerten Ziegelwand, das sehr technisch und irgendwie wie nicht von dieser Welt aussah. Anja war sofort von den angestaubten Messingknöpfen, Schaltern, Hebeln und diversen runden Messinstrumenten angetan.
»Wow, und das?«
Eva schaute in die angezeigte Richtung.
»Das ist die Hauptsteuertafel mit Eingängen, Ausgängen und Steuerknöpfen der Trassen. Hier konnte man Rohrpostbehälter abfangen, erneut einsetzen und falls gewünscht auf eine andere Route schicken.«
»Wie funktionierte das alles eigentlich?«
»Mit Druckluft. Schau mal dahinten.« Eva deutete auf einen gemauerten Torbogen, den Zugang zu einem weiteren Raum.
Anja blickte sich um, sah Eva fragend an und zuckte mit den Schultern.
»Da sind wahrscheinlich die Elektromotoren untergebracht, welche die Luft in die Rohre der Rohrpostanlage drückten. Die Briefe, verstaut in ganz speziellen Kartuschen, wurden einfach mit sehr viel Pressluft durch das Rohrsystem gepustet. Der Trick dabei war, dass die Behälter vom Durchmesser her genau in das Rohr passten und trotzdem noch ein wenig Spielraum aufwiesen. Außerdem musste die Oberfläche außerordentlich glatt sein. Nur so war gewährleistet, dass die Mitteilungen auf die gewünschte Geschwindigkeit kamen und nirgendwo stecken blieben. Am Ziel angekommen, landete die Rohrpost in einem stabilen Fangkorb.«
Anja nickte anerkennend und schaute sich weiter um.
Eva ließ ihren Blick ebenfalls zufrieden schweifen. Es war das erste Mal seit ungefähr einem Jahr, dass sie als Chefin des Münchener Technik- und Naturkundemuseums im Außeneinsatz tätig war. Sie genoss es, endlich einmal vor den administrativen Aufgaben zu flüchten und echte Feldarbeit zu leisten. Ein wenig sehnte sie sich von Zeit zu Zeit nach der alten Stellung als Chef-Kuratorin zurück. Da musste sie lediglich neue Ausstellungen konzipieren, die noch mehr Besucher ins Museum lockten. Ein schwieriger, aber überschaubarer Aufgabenbereich, in den man sich herrlich vertiefen konnte. Aber das war wohl vorbei. Es gab jedoch nicht den geringsten Grund zum Jammern. Evas Nachfolger erledigte den Job ganz hervorragend. Kein Wunder, sie hatte ihn höchstpersönlich ausgesucht und ihn mit kleinen »Geschenken« und weiteren Annehmlichkeiten einem anderen namhaften Institut abgeluchst. Tja, und dann war da noch die Sache mit den »Kollektoren«. Zusätzlich zu dem offiziellen Posten als neue Chefin des Museums hatte man sie zum Oberhaupt einer Organisation auserkoren, die sich Kollektoren nannte – einer geheimen wissenschaftlich-technischen Gesellschaft. Eva war zu diesem obskuren Posten gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, als sie vor knapp über einem Jahr ihre Stelle in München antrat. Im Laufe mehrerer Wochen wurden sie und Kolja Blomberg, der damals noch beim LKA arbeitete, in eine sehr mysteriöse Geschichte hineingezogen. In deren Verlauf kam Eva mit dieser Vereinigung in Kontakt. Dabei handelte es sich um eine finanzstarke Verbindung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Menschheit vor den negativen Auswirkungen von Erfindungen und Entdeckungen jedweder Art zu schützen, für die sie noch nicht reif war. Eva kam das anfangs reichlich überheblich vor. Sie war der Ansicht, dass die Menschen das schon selbst regeln würden. Doch schließlich, nach langen Gesprächen und unzähligen Fallstudien der Kollektoren, änderte sich langsam Evas Meinung zu dieser Art von »Gott spielen«. Es brauchte ein Regulativ, wollte sich die Weltbevölkerung nicht selbst zerstören – sei es aus Gründen übertriebenen und verantwortungslosen Forscherdrangs oder reiner Profitgier.
Die Kollektoren hatten die Augen und Ohren überall da, wo geforscht, getüftelt und entwickelt wurde. Evas inoffizielle Mitarbeiter sammelten rund um die Uhr Informationen und gaben Alarm, wenn Gravierendes dabei war zu entstehen, was den Fortgang der Menschheit negativ beeinflussen könnte. Sie trugen Dinge zusammen, sabotierten technologische Fehlentwicklungen und sicherten in ihrem gigantischen Archiv Artefakte jedweder Art, um diese erst einmal wegzuschließen. Zudem forschte und entwickelte eine Heerschar eigener Wissenschaftler und Techniker an sichergestellten Artefakten. Kam dabei etwas Nützliches und Sinnvolles heraus, wurde es fertigentwickelt und vermarktet. Mit dieser Vorgehensweise finanzierten sich die Kollektoren. Über viele Jahrhunderte hinweg hatte die Gemeinschaft damit ein immenses Vermögen angehäuft.
Nach dem Fall um das Tesla-Artefakt wählten die Kollektoren Eva zur neuen Chef-Kollektorin aus. Gerechterweise musste man sagen, dass immer der amtierende Chef des Museums für Technik und Naturkunde in München beziehungsweise dessen Chef-Kurator diesen Posten innehatte. Die Ergebnisse einer Hintergrundüberprüfung von Evas Persönlichkeit und vor allem ihr Verhalten während der Lösung des Rätsels um das Tesla-Artefakt hatten sie quasi auf diesen Vorsitzposten katapultiert. Zudem hatten Al und Leonhardt für Eva votiert. Al war Koljas Adoptivvater, namhafter Pathologe Münchens und einflussreiches Mitglied der Kollektoren, genau wie sein Freund und Weggefährte Leonhardt. Der war offiziell Hausmeister des Museums und inoffiziell die graue Gestalt der Gesellschaft, die diverse Dinge regelte – auch die weniger appetitlichen.
Eva dachte an Kolja. Ihr wurde schwer ums Herz, und ein flaues Gefühl übermannte sie. Vor einem Jahr hatten sie sich kennengelernt und prompt verliebt. Es lief großartig – Schmetterlinge im Bauch, die Begeisterung für das Gegenüber und der notwendige Respekt für den jeweils anderen Part einer Beziehung inklusive. Und dennoch hatte es irgendwie nur bedingt gezündet. Zuerst glaubte Eva, dass sie noch Altlasten mit sich herumschleppte. Das war es allerdings nicht, wie sie irgendwann merkte. Zugegeben, Kolja war schüchtern und nicht gerade eine Ausgeburt an Gefühlsausbrüchen, wenn das Thema Beziehung auf den Tisch kam. Aber das war es auch nicht. Eva fand diesen Aspekt von Koljas Persönlichkeit eher faszinierend und süß. Es war die Zeit, die beiden fehlte, um die Liebelei zu manifestieren beziehungsweise zu etablieren. Kolja hatte seinen LKA-Job als Kommissar nach der Tesla-Affäre an den Nagel gehängt und die Berufung zum Chef der Kollektoren-Sicherheitstruppe nach langer Überlegung schließlich angenommen. Seitdem versuchte er, aus dem Haufen ambitionierter Wachschützer, Ex-Polizisten und Ex-Bundeswehr-Leuten eine schlagkräftige Truppe zu formen, und zwar mit sehr viel Engagement und Eifer. Oft, viel zu oft war er im Auftrag der Kollektoren rund um den Erdball unterwegs, um das ein oder andere Artefakt zu sichern, den vielen Kollektoren-Informanten unter die Arme zu greifen oder sie aus brenzligen Lagen zu befreien. Nicht selten riskierte er dabei sein Leben. Und Eva als Chefin der Kollektoren hatte dies zu verantworten. Sie war es, die Kolja in lebensgefährliche Situationen entsandte. Das machte Eva schwer zu schaffen, obwohl Kolja ihr immer wieder gebetsmühlenartig versicherte, dass er damit keinerlei Probleme hatte. Schließlich war es sein Job, und er hatte ihn freiwillig angenommen. Trotzdem …
Anja stupste Eva an und riss sie aus ihren Gedanken. Evas »gute Seele« wusste über die Kollektoren, Evas »Nebenjob« und das riesige Archiv Bescheid, das sich tief im Bayerischen Wald befand. Die quirlige junge Frau war nicht nur Evas rechte Hand, ein Recherche- und Organisationstalent à la bonne heure, sondern auch ein Mensch, dem Eva zu einhundert Prozent vertraute, und eine gute Freundin zudem.
Damit Anja auch mal ein wenig aus ihrem Museums-Kabuff herauskam, hatte Eva sie kurzerhand mit auf diese Entdeckungstour genommen, quasi als kleine Belohnung für die Arbeit der letzten Monate.
»Ich fass es nicht, dass das alles jahrzehntelang unter unseren Füßen schlummerte«, gab Anja immer noch völlig baff von sich.
»Tja, in der Tat unglaublich. Noch unglaublicher ist es, dass wir nur durch einen dummen Zufall auf dieses Stück Technikgeschichte gestoßen sind. U-Bahn-Arbeiter hatten bei Wartungsarbeiten festgestellt, dass es unterhalb der Gleise einen Hohlraum gab. Ein Mitarbeiter hatte in einem Nebenraum der U-Bahn-Trasse – einem Serviceraum – einen schweren Vorschlaghammer zu Boden fallen lassen. Daraufhin hat sich ein kleiner Teil des Bodens in die Tiefe verabschiedet.«
Mittlerweile hatten sich vier weitere Personen abgeseilt und zu Eva gesellt.
»So, dann wären wir ja erst einmal komplett.« Eva klatschte in die Hände, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Peter, du und dein Team seid verantwortlich für die Elektrifizierung. Baut die Leuchten auf und verbindet sie mit dem Generator. Der befindet sich außerhalb. Ach ja, und gebt acht, dass ihr genügend Stromkabel mit hinunterbringt.«
Peter nickte und gab per Funk diverse Befehle an seine Mitarbeiter durch. »Pascal, deine Leute bringen den Lufttauscher herunter und nehmen ihn in Betrieb, sobald die Energieversorgung gesichert ist. Wir müssen unbedingt den Staub hier herausbringen, ehe wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Und vergesst die Staubsauger nicht, damit wir nicht bei jedem Tritt wiederum so viel Staub aufwirbeln, dass wir nichts mehr sehen. Sorry, aber ihr seit diesmal die Putzkolonne.«
»Na ja, irgendwann musste es uns ja mal erwischen«, gab Pascal per Funk zurück.
Eva zeigte auf eine Frau mittleren Alters. »Martina, ihr übernehmt den Aufbau des 3-D-Scanners. Sobald die Beleuchtung ausreicht und der Staub weitgehend beseitigt ist, beginnt ihr, den Raum zu scannen.«
Eva blickte erneut in die Runde und schlug einem Mann auf die Schulter. »So, und wir zwei Hübschen kümmern uns um den regulären Ein- und Ausgang zu diesem Schätzchen hier. Aneas, sag deinen Männern Bescheid, dass sie diverse Bohrhämmer und andere Abbruchmaschinen mitbringen. Ich will mich nicht dauernd abseilen müssen, um in die Halle zu gelangen.«
»Und ich?«, fragte Anja.
»Oh ja, Anja. Also, du kletterst wieder hinauf zum Deckenloch und suchst dir ein paar Mitarbeiter. Die sollen das Loch sichern, damit nicht weitere Fragmente in den Bau stürzen. Die haben so einen schnell härtenden Kriechkleber, der binnen Minuten das Ziegelgemäuer aushärtet und stabilisiert. Damit sollen sie die Bruchstelle bearbeiten.«
»Yes, Ma'am, wird gemacht«, entgegnete Anja, während sie ihre Hand zum militärischen Gruß an die Schläfe führte. Nur wenige Augenblicke später befand sie sich schon wieder auf dem Weg nach oben zur Deckenöffnung.
Nach knapp zwei Stunden war die Halle nicht wiederzukennen. Der Staub war weitestgehend entfernt, und überall gab es Licht, das die alte Rohrpostzentrale in ihrer alten Schönheit erstrahlen ließ. Dutzende Menschen wuselten umher und gingen ihren Aufgaben nach. Der reguläre Eingang zur Rohrposthalle war jedoch noch immer nicht geöffnet. Das würde noch eine ganze Weile dauern. Dennoch, Eva schaute sich zufrieden um. Sie hatte einen wahren Schatz für das Museum geborgen, der in den kommenden Monaten sukzessive abgebaut und im Museum erst einmal eingemottet werden würde, bis es einen gebührenden Platz zur Präsentation gäbe.
»Dr. Graf, Sie glauben nicht, was wir gefunden haben«, rief einer von Evas Assistenten quer durch den Raum. Mit einer Rohrpostkartusche in der Hand kam er auf Eva zugestürmt. Kurz bevor er mit Eva zu kollidieren drohte, bremste er mit einem waghalsigen Manöver ab. Aufgeregt drückte er Eva die Kartusche in die Hand. Eva blickte ihren hageren Assistenten mit einer Mischung aus Verwunderung und Ratlosigkeit an. Sein Gesicht war übersät mit hektischen Aufregungsflecken – ein sicheres Zeichen, dass er mal wieder etwas von Bedeutung entdeckt hatte.
»Was ist los, Anton? Atmen Sie erst einmal tief durch, und dann erklären Sie mal, was Sie so in Aufregung versetzt.«
»Die Kartusche, schauen Sie selbst!«
Eva schaute sich die Kartusche genauer an. Sie war verschlossen und mit dem Etikett »Geheim« versehen. Eva runzelte die Stirn. Ihr Interesse war geweckt. Mit vorsichtigen Bewegungen öffnete sie die Kartusche und schaute hinein. Mit äußerster Umsicht beförderte sie ein Stück Papier heraus, entfaltete es und las interessiert die Nachricht.
3
Fremde Lichter
München, zwei Wochen später Das Rauschen der Isar erinnerte den alten Mann an die weit entfernte Heimat. Die hatte er seit so langer Zeit nicht mehr gesehen, gerochen und gespürt. Ein flaues Gefühl kam in ihm auf. Heimweh. Langsam schweifte der müde Blick weg vom Fluss hin zu den nächtlichen Lichtern der Stadt. Verständnislos beobachtete der Greis das hektische Treiben der Bewohner des vor ihm liegenden Molochs. Kaum merklich schüttelte er den Kopf. Er hasste den Lärm und Gestank der Großstadt, die Egozentrik der Menschen sowie deren stumpfsinnige Einstellung gegenüber jedwedem, was sie umgab. Die manifestierte sich augenscheinlich in dem überall herumliegenden Müll – die typischen Überreste einer Wohlstandsgesellschaft, die die Verbindung zur Natur schon vor sehr langer Zeit verloren hatte. Vor allem aber fand er die Lichtverschmutzung furchtbar. Auch hier am Isar-Ufer herrschte keine Dunkelheit. Millionen Lichtquellen nahmen die Sicht zu den so bedeutungsvollen und geliebten Sternen. Er brauchte sie wie die Luft zum Atmen. Der Glaube des Mannes räumte den Gestirnen einen besonderen Platz ein. Sie trugen den Himmel und hielten dessen Weltbild zusammen. Die hellen, funkelnden Lichter am nächtlichen Sternenzelt waren ein maßgeblicher Pfeiler dieser Religion. Wieder schweiften die Gedanken zu der vermissten Heimat ab. Da, wo seine spirituellen Wurzeln lagen, gab es nichts als unendliche Ferne, eine tiefe heilige Ruhe und einen schier grenzenlosen Himmelsdom. Asphaltierte Straßen, Müll, Autoverkehr, Hektik, Lärm, Gewalt und vieles, was der »hippe« Großstadtmensch unter Zivilisation verstand, suchte man in den Weiten des nordöstlichen Arizonas vergebens. Im Reservat gab es nur Stammesbrüder und -schwestern, Natur und zahlreiche göttliche Ratgeber. Und das war alles, was er Zeit seines langen Lebens gebraucht hatte. Ein einfaches, aber sehr erfülltes Dasein, auf das er mit Stolz und tiefer Befriedigung zurückblickte. Die Zumutungen und Verlockungen der Moderne hatte er in unzähligen Missionen kennengelernt, war ihnen jedoch nie verfallen. Immer blieb er sich und den verinnerlichten Idealen treu. Er war ein Diné, ein »Mensch« – eine bedeutungsvolle Vokabel aus der uralten Sprache der Navajos.
Mit routinierten Griffen breitete der Navajo eine kleine Decke aus, um sich auszuruhen und zu meditieren. Die Decke … Fast zärtlich streichelte er entlang der reichlich verzierten Kanten des vertrauten, abgegriffenen Stückes Stoffs, das ihn seit so vielen Jahrzehnten begleitete. Sämtliche Kriege – der Zweite Weltkrieg, Korea, Vietnam – überallhin hatte ihn die Erinnerung an seine geliebte Heimat in Form des handlichen Textilfragments eskortiert. Mit einem Schwung, den man dem alten Mann nicht so ohne Weiteres zugetraut hätte, beförderte sich der Navajo auf den Teppich. Sofort durchströmte ihn eine grenzenlose Zufriedenheit und Ruhe. Die Textilie verband ihn mit der Erde. Er schloss die Augen, atmete tief ein und wieder aus. So verharrte Ahiga minutenlang. Irgendwann öffnete er langsam die Augen und fing an, in der neben ihm liegenden Umhängetasche zu kramen. Nach wenigen Augenblicken fühlte er den Gegenstand, den er suchte – das Calumet, die Pfeife. Behutsam holte er sie aus der Tasche, blickte das viele Jahrzehnte alte Stück Holz liebevoll an und stopfte es schließlich mit Tabak. Alles sehr bedächtig und mit Vorsicht. In seiner Religion symbolisierte die heilige Pfeife eine Art Schutzschild, das vor Gegnern schützte und mit dem es möglich war, sich Feinden unbemerkt zu nähern. Selbst der aufsteigende Qualm des Calumets war geweiht und von besonderer Bedeutung. Er stellte die Verbindung zum großen Geist her. Ahiga inhalierte den Rauch so tief er nur konnte und blies ihn langsam wieder aus. Dies wiederholte er einige Male. Mit geschlossenen Augen griff er erneut in die Tasche, zog das heilige Bündel hervor und legte es vor sich auf den Teppich. Obwohl er es eigentlich nicht brauchte – denn Ahiga war ein erfolgreicher Navajo-Krieger, auch wenn er auf die einhundert zuging –, hatten seine Stammesführer ihm diesen Talisman, der ihn vor Unheil bewahren sollte, mit auf den Weg gegeben. So tröstlich die Vorstellung war, dass ihn die Götter bei der Mission begleiteten, umso skeptischer war Ahiga, dass sie etwas gegen den Feind ausrichten könnten, mit dem er es hier in München zu tun hatte. Nein, Ahiga schüttelte erneut unmerklich den Kopf und zog an der Pfeife. Zweifel an der Mission durften nicht aufkommen. Es war rechtens, was er vorhatte, und nichts und niemand auf dieser Welt würde ihn davon abbringen. Die Beweggründe waren ehrenhaft. Er hatte eine Mission, die er trotz des hohen Alters erfüllen musste. Wer auch sonst? Keiner war mehr übrig von der alten Army-Abteilung – er war der Letzte der »Windtalker«, wie sie sich immer genannt hatten. Alle waren mittlerweile tot und hatten ihre schlimmen Geheimnisse und Kriegserlebnisse mit ins Grab genommen. Ahiga war dazu nicht bereit. Er wollte, er musste die Menschen aufklären, was da für eine Gefahr auf sie zukam. Unbedingt! Zu viel hing davon ab. Und morgen war der Tag der Entscheidung. Es war der Tag, an dem er einen großen Fehler seiner Vergangenheit korrigieren würde. Zu lange hatte er geschwiegen. Es war höchste Zeit, das Schweigen zu brechen. Er war froh, dass man ihm die Chance gab, einen Irrtum seiner Vergangenheit zu berichtigen.
Das Geschoss traf Ahiga mit ungeheurer Wucht und völlig unvermittelt. Der Navajo hatte nicht das geringste Geräusch, geschweige denn einen Schuss wahrgenommen. Das Projektil riss ihn nieder. Schnell färbte sich die geliebte Decke tiefrot. Ein Stöhnen entwich den Lippen des alten Mannes. Mit unbändiger letzter Kraft griff Ahiga in die Jackentasche, entnahm ihr einen kleinen Gegenstand und verschluckte ihn. Wenige Sekunden später explodierte das Geschoss in seinem Brustkorb mit zerstörerischer Wucht. Ahiga starb mit dem Blick auf die ihm so fremde Stadt und der Gewissheit, dass er versagt hatte.
4
Sklaven
Irgendwo in Arlington County, Virginia Fuck! Auf was hatte er sich bloß eingelassen? Sich mit den Händen am Spiegel abstützend blickte Max in sein Spiegelbild. Schlecht schaute er aus, und das, obwohl er erst wenige Tage hier unten hauste und arbeitete. Das Antlitz wirkte eingefallen, Augenringe, Dreitagebart und eine blasse Gesichtsfarbe – Max schüttelte den Kopf, drehte den Hahn auf und schaufelte kaltes Wasser ins Gesicht. Irgendetwas lief verdammt schief. Bisher war die DARPA für ihn wie eine Bank gewesen – krisenfester Job beim Vater Staat, guter Verdienst, klasse Sozialleistungen und interessante Forschungsfelder. Doch seit zwei Wochen war alles anders. Stellte sich Max' Zusage zum externen Projekt gar als ein Fehler heraus? Er lächelte müde, hob den Kopf und schaute erneut resigniert das Spiegelbild an. Sicherlich nicht! Er musste annehmen, ansonsten hätte er die berufliche Zukunft bei der Agentur an den Nagel hängen können. Das Projektgespräch verlief eindeutig. Trotzdem fand Max die gesamte Situation und Vorgehensweise der Rekrutierung im Nachhinein seltsam ominös, selbst für DARPA-Verhältnisse. Bisher kam ihm die »Defense Advanced Research Projects Agency«, kurz DARPA, als ein stets fairer Arbeitgeber vor. Klar, Geheimhaltung wurde hier großgeschrieben, das war auch irgendwie normal, schließlich ging es um zukünftige Waffensysteme, Forschungsaufträge der Rüstungsindustrie und derlei Kram. Gleichwohl war man in der Vergangenheit immerfort auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Aber dies schien wohl Geschichte zu sein.
Die DARPA war die Hightech-Schmiede und Entwicklungsbehörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten. Die Mitarbeiter selbst sahen sich als wissenschaftlicher Thinktank des Pentagons – eine Spielwiese für große Kinder, die ihre Visionen und Träume in die Tat umsetzen konnten. Egal, ob Pläne für Generationenraumschiffe, Mondstationen, fliegende U-Boote, Nano-Waffen, Quantencomputer oder künstliche Lebensformen, alles war möglich und denkbar – Hauptsache, es war für das Militär irgendwie von Interesse. Max und seine Kollegen, allesamt hochbegabte Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Tüftler unterschiedlichster Wissensgebiete, standen unbegrenzte finanzielle und technische Ressourcen zur Verfügung. Und doch, vor einer Woche hatte Max das andere Gesicht der Organisation kennengelernt. Ein unfassbarer Gedanke schoss ihm durch den Kopf: War es wirklich die DARPA, die ihm das hier eingebrockt hatte, oder kochte da irgendjemand im Thinktank das berühmte eigene Süppchen?
Max schüttelte sich. Egal! Er fasste in die Hosentasche und umklammerte einen USB-Stick mit festem Griff. Heute war es so weit. Er hatte es satt und wollte nur noch raus, nichts wie raus aus dem unterirdischen Luxus-Verlies. Der Speicherstick platzte aus allen Nähten, randvoll gefüllt mit hochbrisantem Material und geheimen Projekt-Informationen. Er hatte die Daten im Laufe der letzten Tage immer wieder heimlich abgezweigt. Warum? Vielleicht eine Art Eingebung oder Ahnung? Max' Herzschlag pumpte heftig, Übelkeit überkam ihn. Würde ihm jemand glauben? Würde er überhaupt aus diesem Gefängnis fliehen können? Max hoffte inständig auf die Integrität des DARPA-Chefs. Und wenn dem nicht so war? – Ein Risiko, das er eingehen musste. Max hatte keine Wahl. Er kannte den General zwar nur flüchtig, hatte ihn jedoch stets als integren Menschen in den unterschiedlichsten Situationen erlebt. Für Max war es unvorstellbar, dass er für diese geheime Operation verantwortlich zeichnete. Er sah keinen anderen Weg, als ihn zu unterrichten, wollte er selbst nicht als Verräter für den Rest seines Lebens weggesperrt, erschossen oder als Whistleblower verfolgt werden. Max konnte sich nicht ohne Probleme aus dem Staub machen, er musste die Vorgesetzten informieren, die Befehlskette einhalten.
Während Max sich noch einmal eine Ladung Wasser ins Gesicht spritzte, dachte er daran, wie alles angefangen hatte. Das »Einstellungsgespräch« dauerte nur wenige Minuten. Schnell war ihm klar, dass der Situation etwas Merkwürdiges und sehr Spezielles anhaftete. Wieso wurde er für ein Projekt innerhalb der DARPA angeheuert? Sie hätten ihn doch einfach nur versetzen müssen. Sein Gegenüber war ein smarter Kerl, Typus aalglatter Anwalt, der ihn eindringlich anschaute, sich als John vorstellte und von einer streng dreinschauenden Frau begleitet wurde. Ohne Umschweife kam Schmierlappen zur Sache und legte die Karten scheinbar offen auf den Tisch.
»Mr. Archer, ich mache es kurz. Sie sind eine Koryphäe auf Ihrem Gebiet, der Teilchenphysik. Wir brauchen Sie für ein ganz spezielles Projektteam. Die Entlohnung ist fürstlich und die technische Ausstattung einzigartig – selbst für DARPA-Verhältnisse. Und ehe Sie fragen: Einzelheiten unterliegen der Geheimhaltung. Erst wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben, gibt's Details.«
Mit einer flüssigen Bewegung warf John einen dicken Schmöker auf den Tisch, der Richtung Max schlitterte. Der schaute irritiert drein über den Umfang der Geheimhaltungsvereinbarung.
»Was, wenn ich nicht möchte? Habe ich eine Wahl?«
»Aber natürlich, Max. Ich darf doch Max sagen?«
Max nickte.
»Schön, Max, ich will es Ihnen mal so erklären: Sie haben die Wahl, Ihre sieben Sachen zu packen und aus der DARPA zu verschwinden. Und glauben Sie mir, kein anderes staatliches Unternehmen im Rüstungsbereich wird Sie jemals wieder anstellen. Sie haben die Wahl!« Schmierlappen grinste.
»Wie lange soll mein Ausflug in die externe Abteilung dauern?«
»Wir schätzen, dass Sie in ungefähr sechs Monaten wie gehabt an Ihrem angestammten Schreibtisch bei der DARPA sitzen. Ach ja, denken Sie sich eine hübsche Geschichte für die werte Gattin, Freundin oder was auch immer aus. Es gilt die höchste Geheimhaltungsstufe.«
Max wusste ganz genau, was der Advokat meinte. »Wo muss ich unterschreiben?«, fragte er missmutig. Irgendwie wurde ihm schlagartig bewusst, dass er nach dem Ausflug in fremde Gefilde die Agency verlassen musste. Der Anwalt klatschte zufrieden in die Hände und verstaute den unterschriebenen Vertrag in seiner Aktentasche.
»Na wunderbar, das hätten wir. Halten Sie sich bitte dann morgen früh ab fünf Uhr bereit. Man wird Sie abholen. Nehmen Sie kein Gepäck mit, lediglich ein paar persönliche Gegenstände sind erlaubt.«
Max wurde immer mulmiger zumute. »Wieso abholen?«, fragte er mit unsicherer Stimme.
»Oh, habe ich vergessen, das zu erwähnen? Wo habe ich nur meine Gedanken! Sie werden nicht hier bei der DARPA arbeiten. Wir haben Ihnen und Ihren Kollegen ein erstklassiges externes Labor eingerichtet.«
»Und kann ich erfahren, wohin die Reise geht?«
Schmierlappen grinste überheblich.
»Ach Max, muss ich Sie nochmals auf die unterschriebene Geheimhaltungsklausel hinweisen? Der Standort ist geheim.«
Max schüttelte resigniert den Kopf. Nein, das musste er sicherlich nicht.
Pünktlich um fünf Uhr am nächsten Morgen hielt vor Max' Haus ein dunkelfarbener Escalade mit blickdichten Scheiben. Ein bulliger Sicherheitsbeamter im schwarzen Anzug stieg auf der Beifahrerseite aus und ging zur Hautür. Max wanderte schon seit Stunden nervös durch das Haus. Er war angespannt und neugierig gleichermaßen, was ihn erwarten würde. Noch ehe der Mann läuten konnte, riss Max die Tür auf.
Der Typ schaute einigermaßen erstaunt auf, als Max vor ihm stand. Allerdings fing er sich relativ schnell wieder.
»Mr. Archer, sind Sie bereit?«
Max nickte, schnappte sich den Rucksack und schloss ab. Der Mann mit dem obligatorischen Kabel im Ohr riss Max den Rucksack aus der Hand, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, die keinen Widerspruch zuließ.
»Ich darf?«, fragte er noch der Form halber, als er das Handgepäck schon routiniert durchwühlte.
»Aber klar doch.« Max musste schmunzeln. Der Sicherheitsbeamte war ein Prototyp seiner Spezies: kantiges Gesicht, Bürstenschnitt, muskulöse Figur und das alles verpackt in einen perfekt passenden schwarzen Anzug von der Stange. Man in Black. Max schüttelte den Kopf.
»Hab ich was verpasst, Mr. Archer? Was ist denn so lustig?«
»Nein, nein, nichts! Lassen Sie uns fahren.«
Max nahm im Fond des riesigen Geländewagens Platz. Ihm fiel als Erstes auf, dass die hinteren Scheiben des Escalade nicht nur von außen, sondern merkwürdigerweise auch von innen geschwärzt waren. Ein ungutes Gefühl beschlich Max. Die ganzen letzten Stunden hatte er sich eingeredet, dass er vielleicht eine Spur zu paranoid war. Die Ansicht geriet im Wageninneren zunehmend ins Wanken. Max machte es sich bequem, soweit dies möglich war in Anbetracht seines miserablen Bauchgefühls. Sobald der SUV anfuhr, wurde die automatische Verriegelung der hinteren Türen aktiviert. Max blickte irritiert drein.
»Das ist jetzt nicht euer Ernst! Was soll der Scheiß?«, fragte Max aufgeregt.
»Keine Panik, das ist nur die Automatik des Wagens«, kam die prompte Antwort von vorn. Das beruhigte Max aber nicht im Geringsten, ganz im Gegenteil.
»Machen Sie es sich bequem, wir werden eine Zeit lang fahren. In der Kühlbox finden Sie Getränke und etwas zu essen. Und fragen Sie nicht nach dem Fahrtziel. Ist geheim!«
Max nickte genervt. Er akzeptierte mit jedem zurückgelegten Kilometer, dass es kein Zurück gab. Das gleichmäßige Surren des Geländewagens ließ ihn zunehmend wegdämmern. Irgendwann fiel er in einen unruhigen, oberflächlichen Schlaf. Albträume mit surrealen Szenen plagten Max, was in Anbetracht der Lage nun wirklich nicht verwunderlich war. Nach ungefähr einer Stunde wachte er auf und schaute durch die Windschutzscheibe des Escalade. Es war immer noch dunkel. Von den Lichtern der Stadt war nichts mehr zu sehen.
»Wo sind wir?«, fragte Max.
»Mr. Archer, was hatte ich vorhin gesagt? Keine Fragen!«, entgegnete der Sicherheitsbeamte auf dem Fahrersitz stoisch. Er drehte sich zu Max um, der reichlich verdöst und müde dreinblickte. Deshalb sah er auch nicht, was der Man in Black in der Hand hielt. Mit einer ruckartigen Bewegung griff der Max' Wade und injizierte ihm mit einer Injektionspistole etwas in den Oberschenkel. Max wusste nicht, wie ihm geschah, und schaute nur panisch und verblüfft drein.





























