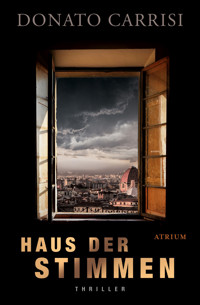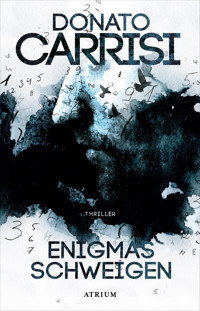8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein abgelegenes Dorf. Sieben verschwundene Kinder. Und ein Ermittler, dem nicht zu trauen ist: Dieser Thriller hat allein in Italien mehr als hunderttausend Leserinnen und Lesern den Atem geraubt. In einer eisigen Winternacht irrt der römische Sonderermittler Vogel mit blutbesudeltem Hemd durch die nebelverhangenen Wälder am Rand eines Dorfes. Vogel war vor einigen Wochen von Rom in die italienischen Alpen gereist, um den Verbleib eines vermissten Mädchens zu klären. Dreißig Jahre zuvor waren mehrere Kinder in den umliegenden Wäldern verschwunden, und es besteht der dringende Verdacht, dass der Mörder von damals – der im Dorf nur "Der Nebelmann" genannt wird – wieder aktiv geworden ist. Als Vogel aufgegriffen wird, gibt er an, einen Unfall gehabt zu haben, doch das Blut an seinem Hemd stammt nicht von ihm. Ein Psychiater wird gerufen, um ihn zu befragen. Vogel beginnt zu erzählen – und sein Bericht ist ungeheuerlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Donato Carrisi
Der Nebelmann
Thriller
Aus dem Italienischen von Karin Diemerling
Für Antonio.
Meinen Sohn, mein Alles.
23. Februar.Zweiundsechzig Tage nach dem Verschwinden.
Die Nacht, die alles für immer veränderte, begann mit dem Klingeln eines Telefons.
Der Anruf kam um null Uhr zwanzig. Es war ein Montagabend, draußen herrschten acht Grad minus und ein Eisnebel, der alles verschluckte. Flores lag im mollig warmen Bett neben seiner Frau und sah sich genüsslich einen alten Gangsterfilm im Fernsehen an. Sophia schlief schon seit einer Weile und ließ sich von dem Klingeln nicht stören. Sie bekam nicht einmal mit, dass ihr Mann aufstand und sich anzog.
Flores schlüpfte in eine wattierte Hose, einen Rollkragenpullover und eine dicke Winterjacke. Dann beeilte er sich, zu dem kleinen Krankenhaus von Avechot zu kommen, in dem er seit gut dreißig seiner zweiundsechzig Lebensjahre als Psychiater tätig war. In all der Zeit war er kaum je wegen eines Notfalls aus dem Bett geholt worden, schon gar nicht von der Polizei. Hier in dem kleinen Alpenort, in dem er geboren worden war und die meiste Zeit gelebt hatte, passierte nach Sonnenuntergang so gut wie nichts – als würden in diesen Breitengraden selbst die Kriminellen eine maßvolle Lebensweise bevorzugen und ebenso zeitig schlafen gehen wie alle anderen.
Folglich rätselte Flores, was seine Anwesenheit im Krankenhaus zu dieser ungewöhnlichen Stunde erforderlich machen konnte. Die Polizei hatte ihn am Telefon lediglich über die Festnahme eines Mannes infolge eines Verkehrsunfalls informiert. Weiter nichts.
Am Nachmittag hatte es aufgehört zu schneien, doch die Kälte hatte gegen Abend noch zugenommen. Als Flores das Haus verließ, wurde er von einer übernatürlichen Stille empfangen. Alles war starr, regungslos. Sogar die Zeit schien stehen geblieben zu sein. Den Psychiater überlief ein Schauder, der nichts mit der Außentemperatur zu tun hatte. Er ließ seinen alten Citroën an und wartete ein paar Sekunden, ehe er losfuhr, damit der Dieselmotor sich warm laufen konnte. Zudem brauchte er das Geräusch, um der Eintönigkeit dieses unheimlichen Friedens etwas entgegenzusetzen. Der Nebel war so dicht, dass er die gesamte Schöpfung ausgelöscht zu haben schien.
Die Straße war vereist, aber es war vor allem der Dunst, der ihn zwang, mit weniger als zwanzig Stundenkilometern zu fahren, beide Hände fest ums Lenkrad gelegt, das Gesicht dicht an der Windschutzscheibe, um die Straßenränder besser erkennen zu können. Zum Glück kannte er die Strecke in- und auswendig.
An einer Abzweigung nahm er die Straße Richtung Ortsmitte, und kurz darauf erspähte er etwas in der Milchsuppe. Vorsichtig fuhr er weiter und hatte dabei das Gefühl, dass alles stark verlangsamt war, wie in einem Traum. Aus der Tiefe des Weiß blinkte ihm etwas entgegen. Es schien auf ihn zuzukommen, doch in Wahrheit war er es, der darauf zufuhr. Im Nebel tauchte eine menschliche Gestalt auf. Sie machte merkwürdige, ausladende Armbewegungen. Beim Näherkommen sah Flores, dass es sich um einen Polizisten handelte, der dort stand, um vorbeifahrende Fahrzeuge zu warnen. Als er ihn passierte, grüßten sie sich flüchtig. Hinter dem Beamten stellte sich das Blinken als das Blaulicht eines Streifenwagens und die Warnblinkanlage einer dunklen Limousine heraus, die von der Straße abgekommen und im Graben gelandet war.
Kurz darauf erreichte Flores das Ortszentrum. Es war vollkommen verlassen. Die gelblichen Straßenlampen schimmerten wie Erscheinungen im Nebel. Er durchquerte die gesamte Ortschaft, dann war er am Ziel.
Im Krankenhaus herrschte ungewöhnliche Betriebsamkeit. Kaum war Flores zur Tür herein, kam ihm auch schon Rebecca Mayer entgegen, eine junge Staatsanwältin, die sich in letzter Zeit einen Namen gemacht hatte. Sie wirkte besorgt. Während der Psychiater seinen Parka ablegte, unterrichtete sie ihn über die Identität des neu eingetroffenen Patienten.
»Vogel«, sagte sie nur.
Als er den Namen hörte, verstand Flores die ganze Aufregung. Er pfiff leise durch die Zähne. »Und was soll ich tun?«, fragte er.
»Die Notärzte sagen, es geht ihm gut. Er macht nur einen verwirrten Eindruck, vielleicht aufgrund des Unfallschocks.«
»Aber Sie sind sich da nicht so sicher, stimmt’s?« Flores hatte es erfasst, denn die Mayer antwortete nicht. »Ist er katatonisch?«
»Nein, er reagiert, wenn man ihn anspricht. Aber er hat starke Stimmungsschwankungen.«
»Und er erinnert sich an nichts«, schloss Flores die Anamnese selbst ab.
»Er erinnert sich an den Unfall. Aber uns interessiert vor allem, was vorher war. Wir müssen unbedingt wissen, was heute Abend geschehen ist.«
»Sie glauben, dass er simuliert?«, folgerte der Psychiater.
»Ich fürchte, ja. Und da kommen Sie ins Spiel, Doktor Flores.«
»Was erwarten Sie von mir, Frau Staatsanwältin?«
»Wir haben nicht genug in der Hand, um ihn zu beschuldigen, und das weiß er. Deshalb muss ich wissen, ob er zurechnungsfähig ist.«
»Und falls er es ist, was dann?«
»Dann können wir Anklage gegen ihn erheben und eine offizielle Vernehmung durchführen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendein Rechtsanwalt im Gerichtssaal alles aufgrund einer blöden Spitzfindigkeit wieder zerpflückt.«
»Aber, Verzeihung … man hat mir gesagt, dass es bei dem Unfall keine anderen Verletzten oder Todesopfer gab. Was wollen Sie ihm denn zur Last legen?«
Die Mayer antwortete nicht gleich.
»Sie werden es verstehen, wenn Sie ihn vor sich haben.«
Man hatte ihn in sein Sprechzimmer gebracht. Als Flores die Tür aufmachte, fiel sein Blick direkt auf den Mann, der auf einem der beiden Besucherstühle vor dem mit Akten überhäuften Schreibtisch saß. Er trug einen dunklen Kaschmirmantel, und seine Schultern waren gekrümmt, er schien nicht einmal wahrzunehmen, dass jemand hereingekommen war.
Flores hängte seine Jacke an den Kleiderhaken und rieb sich die immer noch klammen Hände. »Guten Abend«, sagte er, während er zur Heizung ging und so tat, als wollte er sich vergewissern, dass sie an war. Ein Vorwand, um sich vor den Patienten zu stellen, seinen Zustand einzuschätzen und vor allem zu verstehen, was Staatsanwältin Mayer gemeint hatte.
Unter seinem Mantel war Vogel elegant gekleidet. Ein dunkelblauer Anzug, taubenblaue Seidenkrawatte mit dezentem Blumenmuster zum weißen Hemd, ein gelbes Einstecktuch in der Brusttasche des Jacketts. Nur dass er ziemlich zerknittert aussah, als trüge er diese Sachen schon seit Wochen.
Vogel hob kurz den Blick, ohne den Gruß zu erwidern, dann sah er wieder auf seine im Schoß liegenden Hände.
Der Psychiater wunderte sich über die verrückte Laune des Schicksals, die sie beide an diesem Abend zusammengeführt hatte. »Sind Sie schon lange hier?«, fragte er.
»Und Sie?«
Flores lachte, doch sein Gegenüber blieb ernst.
»Mehr oder weniger dreißig Jahre«, antwortete Flores also. Das Zimmer hatte sich im Laufe der Zeit mit allerlei Krimskrams und Möbelstücken angefüllt. Auf einen Außenstehenden musste es wie ein vollgestopfter Trödelladen wirken.
An einem Ende des Schreibtischs standen mehrere gerahmte Familienfotos. Vogel nahm eines zur Hand und betrachtete es. Es zeigte Flores umgeben von seiner zahlreichen Nachkommenschaft an einem Sommertag im Garten.
»Nette Familie«, bemerkte Vogel mit vagem Interesse.
»Drei Kinder und elf Enkel.« Flores hing sehr an diesem Bild.
Vogel stellte es wieder an seinen Platz und sah sich um. An den Wänden hingen neben der gerahmten Promotionsurkunde, diversen Auszeichnungen und selbst gemalten Bildern der Enkelkinder auch einige andere Trophäen, auf die der Psychiater besonders stolz war.
Er war Sportangler und stellte in seinem Sprechzimmer diverse Exemplare präparierter Fische zur Schau.
»Wann immer ich kann, lasse ich alles stehen und liegen und fahre an einen See oder einen Bergbach«, erklärte Flores. »So fühle ich mich wieder eins mit der Natur.«
In einer Ecke stand ein offener Schrank mit Angelruten und einem Köfferchen voller Haken, Köder, Schnüre und anderem Zubehör. Der Raum sah kaum noch nach dem Sprechzimmer eines Psychiaters aus. Er war zu seiner Höhle geworden, seinem Rückzugsort, und Flores dachte nur ungern daran, dass er in ein paar Monaten in Pension gehen würde und dann alles ausräumen, all seine Sachen mitnehmen musste.
Zu den vielen Geschichten, die diese Wände dann erzählen könnten, kam nun die eines unvorhergesehenen Besuchs an einem späten Winterabend hinzu.
»Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Sie hier sitzen«, gestand Flores ein wenig verlegen. »Meine Frau und ich haben Sie schon so oft im Fernsehen gesehen.«
Der andere nickte nur. Er schien tatsächlich in einem desorientierten Zustand zu sein – oder er war ein ausgezeichneter Schauspieler.
»Sind Sie sicher, dass Ihnen nichts fehlt?«
»Mir geht es gut«, antwortete Vogel matt.
Flores entfernte sich von dem Heizkörper und setzte sich an seinen Schreibtisch, in den Sessel, der sich mit den Jahren seiner Körperform angepasst hatte. »Sie hatten großes Glück, wissen Sie das? Ich bin gerade an der Unfallstelle vorbeigefahren. Sie sind auf der richtigen Seite von der Straße abgekommen. Da ist zwar ein ziemlich tiefer Graben, aber auf der anderen Seite ist ein Abgrund.«
»Der Nebel«, sagte der Gast.
»Natürlich«, bestätigte Flores. »Eisnebel, das erlebt man nicht oft. Ich habe zwanzig Minuten mit dem Auto hierher gebraucht, doppelt so lang wie gewöhnlich.« Er legte beide Ellbogen auf die Armlehnen des Sessels und ließ sich entspannt zurücksinken. »Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt: Ich bin Doktor Auguste Flores. Sagen Sie, wie soll ich Sie anreden? Als Sonderermittler Vogel oder einfach Herr Vogel?«
Der Mann schien flüchtig darüber nachzudenken. »Das überlasse ich Ihnen.«
»Nun, ich denke, dass ein Polizist seinen Dienstgrad beibehält, auch wenn er suspendiert ist. Also bleiben Sie für mich Sonderermittler Vogel.«
»Wenn Sie meinen …«
Flores gingen Dutzende von Fragen durch den Kopf, aber er wusste, wie wichtig es war, mit den richtigen zu beginnen. »Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, Sie noch in unserer Gegend anzutreffen. Ich dachte, Sie seien längst wieder unten in der Stadt, nach dem, was passiert ist. Warum sind Sie zurückgekommen?«
Der Sonderermittler strich langsam mit den Händen über seine Hose, als wollte er imaginären Staub abstreifen. »Ich weiß es nicht.«
Er fügte nichts weiter hinzu. Flores nickte. »Verstehe. Sind Sie allein gekommen?«
»Ja«, antwortete Vogel. Sein Gesichtsausdruck besagte, dass sich ihm der Sinn der Frage nicht erschloss. »Ich bin allein.«
»Hat Ihre Anwesenheit etwas mit dem vermissten Mädchen zu tun?«, wagte Flores sich vor. »Denn soweit ich mich erinnere, haben Sie keinerlei Befugnis mehr in dem Fall.«
Das schien den Mann aufzurütteln, ihn in seinem Stolz zu treffen. »Darf man mal erfahren, weshalb Sie mich hier festhalten?«, fragte er, plötzlich verärgert. »Was will die Mayer von mir? Warum darf ich nicht gehen?«
Flores ließ seine geradezu sprichwörtliche Geduld walten. »Herr Sonderermittler, Sie hatten heute Abend einen Unfall.«
»Das weiß ich selbst«, blaffte Vogel.
»Und Sie waren allein unterwegs, ist das richtig?«
»Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt.«
Flores zog eine Schreibtischschublade auf, nahm einen kleinen Klappspiegel heraus und stellte ihn vor sein Gegenüber. »Sie haben keine körperlichen Blessuren davongetragen. Sie sind unverletzt, ist das richtig?«
»Mir geht es gut, wie oft soll ich das noch sagen?«
Der Psychiater beugte sich zu ihm vor. »Dann erklären Sie mir doch bitte, von wem das Blut auf Ihrer Kleidung stammt.«
Vogel wusste auf einmal nichts mehr zu sagen. Seine Wut verpuffte, und sein Blick richtete sich unwillkürlich auf den Spiegel.
Erst da sah er sie. Kleine rote Flecken am Kragen seines weißen Hemdes. Ein paar größere im Brustbereich. Einige verschwammen mit der dunklen Farbe seines Anzugs und des Mantels, doch man konnte die Ränder erahnen. Er schien die Spritzer zum ersten Mal zu bemerken, und doch sah Flores, dass er um ihre Existenz bereits wusste. Denn er war weder besonders erstaunt noch leugnete er zu wissen, woher sie kamen.
In Vogels Augen trat ein neues Leuchten, und während draußen vorm Fenster der Nebel unverändert auf der Welt lastete, schien seine Verwirrung sich zu lichten.
Vogel sah Flores in die Augen, plötzlich ganz klar.
»Sie haben recht«, sagte er. »Ich denke, ich schulde Ihnen eine Erklärung.«
25. Dezember.Zwei Tage nach dem Verschwinden.
Tannenwälder zogen sich die Berghänge hinunter wie eine geordnete Armee, die sich anschickt, ein Tal zu erobern. Das Tal war lang und schmal, und mitten hindurch lief ein Fluss. Der Fluss, mal still, mal aufbrausend, war von einem leuchtenden Grün.
Dort, eingebettet in diese Landschaft, lag Avechot. Ein Alpenstädtchen, nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Häuser mit spitzen Giebeldächern, eine Kirche mit Glockenturm, Rathaus, Polizeiwache, ein kleines Krankenhaus. Ein Schulgebäude, ein paar Cafés und eine Eissporthalle.
Die Wälder, das Tal, der Fluss, der Ort. Und ein monströses Bergwerk, wie ein futuristischer Hieb gegen die Vergangenheit und die Natur solcher Orte.
Nicht weit vom Ortskern eine Raststätte an der Schnellstraße.
Durch das Fenster blickte man auf die Straße und eine Zapfsäule. Oben an der Scheibe prangte eine Leuchtschrift, die den Vorbeifahrenden ein »Frohes Fest« wünschte, doch von innen, spiegelverkehrt gesehen, war sie nur eine Reihe unverständlicher Hieroglyphen.
In dem Restaurant standen etwa dreißig himmelblaue Resopaltische, die meisten in Nischen entlang der Wände. Alle waren sie gedeckt, doch nur einer war besetzt – der ganz in der Mitte.
Sonderermittler Vogel verzehrte allein ein Frühstück aus Eiern mit Speck. Er trug einen bleigrauen Anzug mit einer moosgrünen Weste und einer dunkelblauen Krawatte und hatte seinen Kaschmirmantel noch nicht einmal zum Essen ausgezogen. Den Blick auf ein schwarzes Notizbuch gerichtet und den Rücken gerade, machte er sich Aufzeichnungen mit einem feinen silbernen Füllfederhalter, den er hin und wieder auf dem Tisch ablegte, um eine Gabel voll Essen zu sich zu nehmen. Diese Bewegungen wechselte er so regelmäßig ab, als hielte er sich streng an einen inneren Rhythmus.
Der alte Wirt, in einer fettbespritzten Schürze über einem rot-schwarz karierten Holzfällerhemd, dessen Ärmel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt waren, kam hinter dem Tresen hervor und näherte sich mit einer Kanne voll frischem Kaffee. »Denken Sie, ich wollte heute eigentlich gar nicht aufmachen. Hab mir gesagt: Wer soll denn schon am Weihnachtsmorgen herkommen? Bis vor ein paar Jahren wimmelte es hier ja noch von Touristen, Familien mit Kindern … Aber seit sie diesen fluoreszierenden Mist gefunden haben, ist alles anders geworden.« Er sagte es, als trauerte er einer fernen, glücklichen Zeit nach, die nie wiederkommen würde.
Vogel dachte, dass nichts von Dauer ist. Früher war das Leben in Avechot heiter und ruhig verlaufen, die Leute lebten vom Tourismus und vom Kunsthandwerk. Eines Tages jedoch hatte irgendein Spezialist von außerhalb prognostiziert, dass sich unter den Bergen der Gegend ein beträchtliches Vorkommen von Flussspat verbarg.
Ein multinationaler Konzern war gekommen und hatte die Schürfrechte erworben, indem er den Eigentümern der über dem Lager befindlichen Grundstücke üppige Summen anbot. Viele Dorfbewohner waren dadurch über Nacht reich geworden. Andere dagegen, die nicht das Glück gehabt hatten, eines der fraglichen Grundstücke zu besitzen, waren von heute auf morgen verarmt, weil die Touristen plötzlich wegblieben.
»Vielleicht sollte ich mich dazu durchringen, den Laden zu verkaufen, und mich zur Ruhe setzen«, fuhr der Alte fort. Verdrossen den Kopf schüttelnd, schenkte er Vogel Kaffee nach, ohne darum gebeten worden zu sein. »Als ich Sie reinkommen gesehen habe, dachte ich zuerst, Sie wären einer von diesen Vertretern, die mir andauernd ihren Plunder andrehen wollen. Aber dann ist mir ein Licht aufgegangen … Sie sind wegen dem Mädchen hier, stimmt’s?« Mit einer knappen Kopfbewegung deutete er auf das Flugblatt, das an der Wand neben dem Eingang hing.
Darauf das Foto eines lächelnden Teenagers mit roten Haaren und Sommersprossen. Ein Name, Anna Lou. Und eine Frage: »Hast du mich gesehen?« Gefolgt von einer Telefonnummer und ein paar Zeilen Text.
Vogel merkte, dass der Alte auf sein Notizbuch schielte, und klappte es zu. Dann legte er die Gabel auf dem Teller ab. »Kennen Sie sie?«
»Ich kenne die Familie. Sind anständige Leute.« Der Wirt zog einen Stuhl heraus und setzte sich zu ihm. »Was denken Sie, was mit ihr passiert ist?«
Vogel verschränkte die Hände unterm Kinn. Wie oft hatte er diese Frage schon gehört. Es war immer dasselbe. Die Fragenden wirkten aufrichtig besorgt, gaben sich die größte Mühe, so zu wirken, doch letztendlich war es nichts als Neugier. Morbide, eigennützige, erbarmungslose Neugier.
»Vierundzwanzig Stunden«, sagte er. Der Wirt verstand nicht, und Vogel kam seiner Bitte um Aufklärung zuvor. »Vierundzwanzig Stunden halten es von zu Hause ausgerissene Jugendliche im Allgemeinen aus, ihr Handy nicht einzuschalten. Dann müssen sie unbedingt einen Freund oder eine Freundin anrufen oder im Internet nachsehen, ob schon über sie gesprochen wird, und so werden sie lokalisiert. Der größte Teil kehrt nach achtundvierzig Stunden zurück. Falls es nicht zu einer fatalen Begegnung gekommen oder ein Unfall passiert ist, stehen die Chancen für einen glücklichen Ausgang bis zu zwei Tage nach dem Verschwinden gut.«
Der Wirt guckte verwirrt drein. »Und danach, was passiert dann?«
»Dann ruft man für gewöhnlich mich.« Der Sonderermittler stand auf, steckte die Hand in die Manteltasche und warf einen Zwanziger für das Frühstück auf den Tisch. Dann ging er zum Ausgang, drehte sich jedoch noch einmal zu dem Wirt um. »Hören Sie auf meinen Rat, verkaufen Sie nicht. In Kürze wird es hier wieder von Gästen wimmeln.«
Es war ein kalter Tag, aber die Wintersonne strahlte vom klaren Himmel und brachte alles zum Leuchten. Auf der Schnellstraße donnerte hin und wieder ein LKW vorbei, dessen Luftzug Vogels Mantelschöße flattern ließ. Der Sonderermittler stand reglos neben der Zapfsäule vor dem Lokal, die Hände in die Taschen gesteckt, und sah nach oben.
Hinter ihm tauchte ein junger Mann von Anfang dreißig auf. Auch er trug Anzug und Krawatte und einen Mantel, allerdings nicht aus Kaschmir. Er hatte blonde, zur Seite gescheitelte Haare und himmelblaue Augen. Das Gesicht eines braven Jungen.
»Guten Tag«, sagte er, doch sein Gruß blieb ohne Antwort. »Ich bin Kommissar Borghi. Man hat mich beauftragt, Sie abzuholen.«
Vogel schenkte ihm keine Beachtung, sondern starrte weiter in den Himmel.
»Die Besprechung beginnt in einer halben Stunde. Alle werden da sein, wie Sie es verlangt haben.« Borghi beugte sich ein Stück vor und begriff, dass der Sonderermittler etwas auf dem Schutzdach der kleinen Tankstelle betrachtete.
Eine Überwachungskamera, die auf die Schnellstraße gerichtet war.
Endlich drehte sich Vogel zu ihm um. »Diese Straße ist die einzige Zufahrt zum Tal, richtig?«
Borghi brauchte nicht darüber nachzudenken. »Ja. Es führt kein anderer Weg hinein oder hinaus. Sie verläuft geradewegs hindurch.«
»Gut«, sagte Vogel. »Dann bringen Sie mich jetzt ans andere Ende des Ortes.«
Mit schnellen Schritten ging er auf die dunkle Limousine ohne Polizeikennzeichen zu, mit der er abgeholt wurde. Borghi zögerte kurz, bevor er ihm folgte.
Wenige Minuten später standen sie auf der Brücke, die den Fluss überspannte und in das angrenzende Tal führte. Der junge Polizist wartete neben dem am Straßenrand geparkten Wagen, während Vogel ein paar Meter weiter die Pantomime von eben wiederholte und eine Videokamera zur Verkehrsüberwachung fixierte, die an einem Mast seitlich der Fahrbahn angebracht war. Der Verkehr brauste an ihm vorbei, und es wurde empört gehupt, doch er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr unbeirrt mit seiner Betrachtung fort.
Als der Sonderermittler endlich genug hatte, kehrte er zum Auto zurück. »Statten wir den Eltern des Mädchens einen Besuch ab«, sagte er und stieg ein, ohne Borghis Antwort abzuwarten. Der sah kurz auf seine Armbanduhr, bevor er sich ergeben wieder ans Steuer setzte.
»Anna Lou hat uns nie Probleme gemacht«, erklärte Maria Kastner entschieden. Die Mutter des verschwundenen Mädchens war eine kleine, zierliche Frau, die eine bemerkenswerte Kraft ausstrahlte. Sie saß neben ihrem massigen, aber harmlos wirkenden Ehemann auf dem Sofa im Wohnzimmer ihres zweigeschossigen Hauses. Die beiden waren noch in Schlafanzug und Morgenmantel und hielten sich an den Händen.
In der Luft hing ein süßlicher Geruch nach gekochtem Essen und Raumspray, den Vogel kaum ertrug. Er saß in einem Sessel, Borghi auf einem etwas abseits stehenden Stuhl. Zwischen ihnen und dem Ehepaar befand sich ein Couchtisch mit Espressotässchen darauf. Der Kaffee war dabei, kalt zu werden, da offenbar niemand die Absicht hatte, ihn zu trinken.
In einer Ecke stand ein geschmückter Weihnachtsbaum, unter dem ein Zwillingspärchen von etwa sieben Jahren mit den am Morgen ausgepackten Geschenken spielte. Ein Päckchen mit einer hübschen roten Schleife darum war noch unberührt.
Die Frau fing Vogels Blick auf. »Wir fanden, dass die Kleinen trotz allem die Geburt Jesu feiern sollten, auch um sie von der Situation abzulenken.«
Die »Situation« bestand darin, dass ihre sechzehnjährige Tochter, die Älteste und das einzige Mädchen, seit fast zwei Tagen verschwunden war. Sie hatte nachmittags um siebzehn Uhr das Haus verlassen, um zu einem Treffen in der Kirche zu gehen, die nur ein paar Hundert Meter entfernt lag.
Doch sie war nie dort angekommen.
Anna Lou hatte nur einen kurzen Weg in einem Wohnviertel mit lauter gleich aussehenden Häusern – Einfamilienhäuser mit Garten – zurückgelegt, in dem sich alle von jeher kannten.
Trotzdem hatte niemand etwas gesehen oder gehört.
Die Eltern hatten gegen neunzehn Uhr Alarm geschlagen, nachdem die Mutter festgestellt hatte, dass ihre Tochter nicht nach Hause gekommen war, und mehrmals vergeblich versucht hatte, sie auf dem Handy zu erreichen. Zwei lange Stunden, in denen ihr alles Mögliche zugestoßen sein konnte. Man hatte den ganzen Abend nach ihr gesucht, bis die Vernunft dazu riet, die Suche zu unterbrechen und erst am nächsten Morgen fortzusetzen, zumal die örtliche Polizei nicht die Mittel für eine groß angelegte Suchaktion hatte.
Bislang gab es noch keine Vermutungen über mögliche Gründe für das Verschwinden des Mädchens.
Vogel betrachtete schweigend die Eltern mit ihren dunklen Augenringen, eingegraben von einer Schlaflosigkeit, die gerade erst begonnen hatte, sie zu zeichnen, und sie in den kommenden Wochen schnell altern lassen würde.
»Unsere Tochter ist immer sehr verantwortungsbewusst gewesen, schon von klein auf«, fuhr die Frau fort. »Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll … aber wir haben uns nie Sorgen um sie machen müssen. Sie hat sich praktisch selbst aufgezogen. Sie hilft im Haushalt, kümmert sich um ihre kleinen Brüder. Die Lehrer in der Schule sind mit ihr zufrieden. Und vor Kurzem hat sie als Katechistin in unserer Gemeinde angefangen.«
Das Wohnzimmer war bescheiden eingerichtet. Beim Hereinkommen waren Vogel sogleich die vielen Devotionalien aufgefallen, die von einer tiefen Frömmigkeit zeugten. An den Wänden hingen Bilder mit religiösen Symbolen oder Szenen aus der Bibel. Jesus war am häufigsten vertreten, auch in Form von kleinen Plastik- oder Gipsstatuen, und die Jungfrau Maria war ebenfalls sehr präsent. Außerdem gab es eine breite Riege an Heiligen. Über dem Fernseher hing ein Holzkreuz.
Daneben waren im ganzen Zimmer gerahmte Familienfotos verteilt. Anna Lou war ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Und immer lächelte sie. Bei ihrer Erstkommunion, in den Bergen mit ihren Brüdern, mit den Schlittschuhen über der Schulter in der Eissporthalle, stolz eine Medaille vorzeigend.
Vogel wusste, dass dieses Zimmer, diese Wände, dieses Haus, nie wieder dieselben sein würden. Alles war randvoll mit Erinnerungen, die schon bald anfangen würden wehzutun.
»Wir bauen den Weihnachtsbaum nicht ab, bis unsere Tochter wieder zu Hause ist«, verkündete Maria Kastner beinahe stolz. »Wir lassen die Kerzen brennen, damit man ihn durchs Fenster leuchten sieht.«
Vogel dachte, wie einfältig das war. Ein Weihnachtsbaum als Leuchtturm und Wegweiser für jemanden, der womöglich nie zurückkehren würde. Auch wenn Anna Lous Eltern sich dessen noch nicht bewusst waren: Der festliche Schein würde allen dort draußen signalisieren, dass sich zwischen diesen Wänden ein Drama abspielte. Er würde zu einer bedrückenden, ja aufdringlichen Präsenz werden. Die Nachbarn würden den Baum und seine Bedeutung nicht übersehen können und sich mit der Zeit davon belästigt fühlen. Wer an dem Haus vorbeikam, würde die Straßenseite wechseln, um seinen Anblick zu vermeiden. Dieses Symbol würde alle verjagen und die Einsamkeit der Kastners noch vergrößern. Der Preis dafür, dass man mit dem eigenen Leben weitermachen kann, ist die Gleichgültigkeit, sagte Vogel sich.
»Ihre Kollegen haben gesagt, ein Akt der Rebellion, eine Kurzschlusshandlung wäre etwas ganz Normales bei einer Sechzehnjährigen«, sagte Maria Kastner und schüttelte den Kopf. »Nicht bei meiner Tochter.«
Vogel nickte. Nicht aus Höflichkeit, um einer Mutter beizupflichten, die sich vor allem selbst freisprechen wollte, indem sie auf den guten Charakter ihres Kindes schwor. Nein, er glaubte wirklich, dass sie recht hatte, und bezog diese Gewissheit aus Anna Lous Gesicht, das ihn aus jeder Zimmerecke anlächelte. Ihr schlichter, beinahe kindlicher Ausdruck sagte ihm, dass ihr etwas zugestoßen sein musste.
»Wir haben eine enge Bindung zueinander, sie ist mir sehr ähnlich. Das hier hat sie für mich gemacht, sie hat es mir vor einer Woche geschenkt …« Die Frau zeigte ihm ein schmales Armband aus kleinen bunten Perlen. »Das ist in letzter Zeit ihr Hobby, sie macht diese Armbändchen und verschenkt sie an alle, die sie gernhat.«
Vogel stellte fest, dass sie diese für die Ermittlungen eher unbedeutenden Nebensächlichkeiten erzählte, ohne dass ihre Stimme oder ihr Blick große Gefühlsregungen verrieten. Doch das war keine Kaltherzigkeit. Er verstand, was in ihr vorging. Die Frau war davon überzeugt, dass sie und ihr Mann einer Prüfung unterzogen wurden, einer Art Test, mit dem sie die Festigkeit und Unerschütterlichkeit ihres Glaubens unter Beweis stellen sollten. Deshalb akzeptierte sie, was passiert war, und lehnte sich nicht gegen die Ungerechtigkeit des Schicksals auf, in der Hoffnung, dass irgendwer dort oben, vielleicht Gott persönlich, bald Abhilfe schaffen würde.
»Anna Lou hat sich mir stets anvertraut, aber eine Mutter muss immer damit rechnen, nicht alles über ihre Kinder zu wissen. Gestern, als ich ihr Zimmer in Ordnung brachte, habe ich das hier gefunden …« Sie ließ die Hand ihres Mannes kurz los, um Vogel ein farbig gebundenes Tagebuch zu geben, das sie neben sich liegen gehabt hatte.
Der Sonderermittler beugte sich über den Couchtisch und nahm es. Auf dem Einband waren zwei niedliche zerzauste Kätzchen abgebildet. Zerstreut begann er, durch die Seiten zu blättern.
»Sie werden nichts darin finden, das etwas Schlimmes ahnen lässt«, bemerkte die Frau.
Vogel schloss das Tagebuch und holte seinen Füller und das schwarze Notizbuch aus der Innentasche seines Mantels. »Ich nehme an, Sie wissen, mit wem Ihre Tochter vorwiegend Umgang hatte …«
»Selbstverständlich«, antwortete Maria Kastner mit einer Spur von Empörung.
»Hat Anna Lou in letzter Zeit jemand Neues kennengelernt? Einen Freund oder eine Freundin?«
»Nein.«
»Sind Sie sich da ganz sicher?«
»Ja«, erwiderte die Frau. »Das hätte sie mir erzählt.«
Eben hatte sie noch eingeräumt, dass eine Mutter nicht alles über ihre Kinder wissen kann, und jetzt gab sie sich vollkommen gewiss. Das war typisch für die Eltern in Vermisstenfällen. Sie wollten die Polizei unterstützen, waren sich aber zugleich bewusst, dass sie zum Teil mitverantwortlich waren, sich zumindest der Unaufmerksamkeit gegenüber ihren Kindern schuldig gemacht hatten. Sobald man Zweifel anmeldete, reagierten sie mit Abwehr, selbst wenn das hieß, das Offensichtliche zu leugnen. Maria Kastner war bereits dabei, Kompromisse mit sich selbst zu schließen. Aber er musste noch mehr erfahren. »Ist Ihnen kürzlich irgendein anormales Verhalten an Ihrer Tochter aufgefallen?«
»Was meinen Sie mit ›anormal?‹«
»Sie wissen doch, wie Jugendliche sind. Aus kleinen Anzeichen kann man oft einiges schließen. Hat sie gut geschlafen? Regelmäßig gegessen? War sie in letzter Zeit schlecht gelaunt? Verschlossen, abweisend, oder hat sie sonst irgendwelche Verhaltensweisen gezeigt, die Sie vorher nicht an ihr kannten?«
»Sie war dieselbe Anna Lou wie immer. Ich kenne meine Tochter, Herr Kommissar Vogel, ich merke, wenn etwas nicht stimmt.«
Das junge Mädchen besaß ein Handy, allerdings ein altes Modell, kein Smartphone. »Hat Ihre Tochter im Internet gesurft?«
Die Eltern sahen sich an. »Unsere Bruderschaft rät davon ab, die Nutzung bestimmter Technologien zu fördern. Das Internet ist voller Gefahren, Kommissar Vogel. Inhalte, die auf Abwege führen und die Erziehung eines guten Christenmenschen verderben können«, sagte Maria Kastner. »Trotzdem haben wir unserer Tochter nie etwas verboten, sie hat sich selbst dagegen entschieden.«
Na klar doch, dachte Vogel. In einem allerdings hatte die Frau recht: Die Gefahr ging häufig vom Netz aus. Sensible Heranwachsende wie Anna Lou waren leicht zu beeinflussen, und im Internet trieben sich perfide Rattenfänger herum, die es verstanden, verletzliche Gemüter zu manipulieren und sich in ihr Leben einzuschleichen. Indem sie nach und nach alle Widerstände durchbrachen und bestehende Vertrauensbeziehungen untergruben, gelang es ihnen, sich an die Stelle der engsten Verwandten und Freunde zu setzen und die Minderjährigen quasi fernzusteuern. In dieser Hinsicht stellte Anna Lou Kastner das perfekte Opfer dar. Vielleicht hatte das Mädchen nur scheinbar dem Willen der Eltern entsprochen und sich woanders ins Internet eingeloggt, in der Schule oder der Bibliothek. Das würde man überprüfen müssen. Im Moment aber gab es noch andere Dinge, denen er nachgehen musste. »Sie gehören zu den Glücklichen im Ort, die eine Konzession an die Bergbaugesellschaft verkaufen konnten, ist das richtig?«
Er hatte die Frage an Bruno Kastner gerichtet, doch wieder antwortete seine Frau. »Mein Vater hat uns ein Grundstück hinterlassen, oben am Nordhang. Wer hätte gedacht, dass es einmal so viel wert sein könnte … Wir haben einen Teil des Geldes der Kirchengemeinde gespendet und die Hypothek für dieses Haus abbezahlt. Der Rest ist für unsere Kinder angelegt.«
Es musste sich um ein hübsches Sümmchen handeln, überlegte Vogel. Wahrscheinlich genug, um noch vielen zukünftigen Kastner-Generationen ein mehr als anständiges Auskommen zu sichern. Sie hätten sich den einen oder anderen Luxus gönnen oder ein größeres, schöneres Haus kaufen können, doch sie hatten sich dafür entschieden, ihren bescheidenen Lebensstil beizubehalten. Er persönlich verstand nicht, wie man so einfach auf das Wohlleben, den dieser unerwartete warme Regen ermöglichte, verzichten konnte, sah aber von einer Nachfrage diesbezüglich ab und sagte, den Kopf immer noch über sein Notizbuch gebeugt: »Da bislang keine Geldforderung eingegangen ist, schließe ich eine erpresserische Entführung vorerst aus. Aber haben Sie vielleicht in der Vergangenheit irgendwelche Drohungen erhalten? Gibt es jemanden, der Grund zu Neid, Groll oder Ärger auf Sie hätte?«
Die Kastners schienen verwundert über diese Fragen.
»Nein, niemanden«, sagte die Frau. »Wir verkehren privat nur mit den Mitgliedern unserer Gemeinschaft.«
Vogel dachte über die unterschwellige Bedeutung dieser Aussage nach – die Kastners waren anscheinend davon überzeugt, dass es in ihrer Bruderschaft keinen Raum für Konflikte gab. Doch er hatte mit dieser Antwort gerechnet, denn bevor er ihr Haus betreten hatte, hatte er sich bereits in ihrem Leben umgesehen und sich über alles informiert, was es über sie zu wissen gab.
Die öffentliche Meinung machte gewöhnlich beim äußeren Anschein halt. Wenn etwas Ungewöhnliches passierte wie das Verschwinden eines wohlerzogenen Mädchens aus gesundem familiären Umfeld, neigten die Leute zu der Annahme, dass das Böse von außen gekommen war. Erfahrene Polizisten wie er dagegen richteten ihre Ermittlungen nicht zuerst auf das äußere Umfeld, denn in einer Vielzahl der Fälle verbarg sich die Erklärung – ebenso banaler- wie schrecklicherweise – zwischen den trauten häuslichen Wänden. Er hatte es schon mit Vätern zu tun gehabt, die ihre Kinder sexuell missbrauchten, und mit Müttern, die ihre Töchter wie gefährliche Rivalinnen behandelten, statt sie zu beschützen. Um des lieben Friedens willen und um ihre Ehe oder die Familienehre zu retten, kamen manche dann zu dem Schluss, dass die beste Lösung darin bestand, sich ihr eigenes Fleisch und Blut vom Hals zu schaffen. Einmal war ihm der Fall einer Frau begegnet, die beschlossen hatte, ihren Mann zu schützen und sich die öffentliche Schande zu ersparen, indem sie ihre missbrauchte Tochter eigenhändig umbrachte und verschwinden ließ. Kurzum, das Spektrum der Grausamkeiten war groß und vielfältig.
Die Kastners aber schienen in Ordnung zu sein.
Er war ein Fuhrunternehmer, der auch nach dem unerwarteten Geldsegen nicht damit aufgehört hatte, sich den Buckel krumm zu schuften, sie eine bescheidene Hausfrau, die sich voll und ganz der Familie widmete. Darüber hinaus lebten die beiden ihren Glauben mit Inbrunst und Überzeugung.
Dennoch, man wusste schließlich nie.
Vogel tat, als sei er zufrieden. »Ich denke, das wäre alles fürs Erste.« Damit stand er auf, prompt gefolgt von Borghi, der die ganze Zeit geschwiegen hatte. »Danke für den Kaffee und … das hier«, sagte er, Anna Lous Tagebuch hochhaltend. »Es wird uns sicher eine große Hilfe sein.«
Die Kastners brachten die Polizeibeamten zur Tür. Vogel warf noch einen Blick auf die beiden Kinder, die gleichmütig unterm Weihnachtsbaum weiterspielten. Wer weiß, wie die Erinnerung an das alles sich ihnen einprägen und später in ihrem Erwachsenengedächtnis verhaftet sein würde. Vielleicht waren sie gerade noch klein genug, um dem Trauma zu entrinnen. Doch das Päckchen mit der roten Schleife, das auf Anna Lou wartete, sagte dem Sonderermittler, dass sie immer irgendetwas an die Tragödie, die ihre Familie getroffen hatte, gemahnen würde. Schließlich gibt es nichts Schlimmeres als ein Geschenk, das die Person, für die es gedacht ist, nicht erreicht. Die Freude, die es enthält, verdirbt allmählich und verseucht alles ringsherum.
Er wandte sich unvermittelt an Borghi. »Würden Sie bitte im Auto auf mich warten?«
»Ja, gewiss«, sagte der junge Polizist beflissen.
Mit den Kastners allein geblieben, schlug Vogel einen neuen Ton an, freundlicher, fürsorglicher, als läge ihm »die Situation« wirklich am Herzen. »Ich möchte ganz offen zu Ihnen sprechen«, sagte er. »Die Medien haben inzwischen Wind von dem Vorfall bekommen und werden bald in Scharen hier auflaufen. Sie müssen wissen, die Journalisten sind manchmal gewitzter darin, Informationen aufzuspüren, als die Polizei, und nicht immer ist das, was dann in die Zeitung oder ins Fernsehen kommt, für die Ermittlungen relevant. Manchmal kann es die Ermittlungen sogar behindern. Falls Sie mir also noch irgendetwas zu sagen haben, egal, was es ist … Jetzt wäre der richtige Moment.«
Es folgte ein Schweigen, das Vogel länger als nötig andauern ließ. Sein Rat enthielt im Grunde eine Warnung: Ich weiß, dass ihr Geheimnisse habt, alle haben welche. Und eure Geheimnisse sind bei mir besser aufgehoben als beim Fernsehen.
»Schön«, sagte er schließlich, um sie von ihrer Verlegenheit zu erlösen. »Ich habe gesehen, dass Sie Flugblätter mit dem Foto Ihrer Tochter verteilt haben – eine gute Idee, aber das reicht nicht. Zum Beispiel wäre es hilfreich, sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit zu wenden. Fühlen Sie sich dazu in der Lage?«
Die Eheleute sahen sich an, berieten sich mit Blicken. Dann streifte Anna Lous Mutter das Perlenarmband von ihrer Tochter ab, nahm Vogels linke Hand und legte es ihm um wie bei einer feierlichen Investitur. »Wir werden alles tun, um Sie zu unterstützen, Herr Kommissar Vogel. Aber bitte bringen Sie sie uns nach Hause.«
Während er im Dienstwagen wartete, telefonierte Borghi. »Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, das war nun mal seine Anordnung«, erklärte er einem der Kollegen, die nun schon seit über einer Stunde auf den Beginn der angesetzten Besprechung warteten. »Ja, ich habe auch Familie. Beruhige sie und sag ihnen, dass niemand das Weihnachtsessen zu Hause verpassen wird.« In Wahrheit befürchtete er, sich mit dem Versprechen zu weit aus dem Fenster zu lehnen, denn er hatte keine Ahnung, was Vogel noch alles einfallen würde. Er selbst wusste nur das Allernötigste über den Fall und hatte sich daher an diesem Vormittag darauf beschränkt, den Chauffeur zu spielen.
Am Abend zuvor hatte ihm sein Dienstabschnittsleiter aufgetragen, morgens nach Avechot zu fahren und den Sonderermittler Vogel im Fall einer vermissten Minderjährigen zu unterstützen. Er hatte ihm eine kümmerliche Fallakte übergeben und mit einer etwas merkwürdigen Anweisung geendet: Er solle mit dunklem Anzug und Krawatte pünktlich um halb neun bei der Raststätte am Ortsausgang des Alpenorts erscheinen.
Borghi hatte natürlich schon viel über Vogel und dessen Exzentrik gehört. Im Fernsehen war oft von ihm und seinen Fällen die Rede, und er war ein regelmäßiger Gast in Talkshows, die sich mit Verbrechen und anderen Sensationen befassten. Zeitungen und Nachrichtensendungen rissen sich um Interviews mit ihm. Der Sonderermittler schien sich wohlzufühlen vor den Kameras, wie ein erfahrener Schauspieler, der bei seinem Auftritt jederzeit improvisieren kann und sich seines Erfolgs gewiss ist.
Dann waren da noch die Geschichten, die innerhalb der Kriminalpolizei kursierten und ihn als einen eigensinnigen, kontrollsüchtigen, nur an seiner Medienwirkung interessierten Typen darstellten. Dermaßen egozentrisch, dass er alle um sich herum in den Hintergrund drängte.
In letzter Zeit war es allerdings nicht so gut für Vogel gelaufen. Ein Fall insbesondere hatte ihm viel Kritik eingetragen, und der eine oder andere Kollege empfand Schadenfreude deswegen. Borghi dagegen glaubte, dass man von einem Spürhund wie ihm trotzdem jede Menge lernen konnte. Er selbst war im Grunde noch ein blutiger Anfänger, und die Erfahrung dieser Zusammenarbeit konnte ihm gewiss nicht schaden.
Nur dass der Sonderermittler sich stets mit aufsehenerregenden Verbrechen beschäftigte, besonders brutalen oder grausamen Delikten mit hohem emotionalem Wirkungsgrad. Und er sich seine Fälle immer sehr sorgfältig aussuchte, wie es hieß.
Also fragte sich Borghi, was Vogel am Verschwinden eines Teenagers so besonders fand.
Denn auch wenn er persönlich Verständnis für die Ängste der Eltern hatte und es durchaus für möglich hielt, dass dem Mädchen etwas zugestoßen war, sah er keinen massenmedienwirksamen Fall darin. Die aber waren es, für die Vogel sich normalerweise interessierte.
»Wir sind bald da«, versicherte er seinem Kollegen, nur um das Gespräch abzuschließen. Im selben Moment fiel ihm ein schwarzer Lieferwagen auf, der am Ende der Straße parkte.
Zwei Männer saßen darin und starrten auf das Haus der Kastners, ohne ein Wort miteinander zu wechseln.
Borghi wollte schon aus dem Auto steigen, um sie zu überprüfen, als er den Sonderermittler aus dem Haus kommen sah. Vogel ging auf ihn zu, hielt jedoch plötzlich mitten auf der Straße inne und tat etwas völlig Verrücktes.
Er begann zu applaudieren.
Zuerst leise, dann immer lauter. Dabei sah er sich um. Das Geräusch erzeugte einen Widerhall, und an den Fenstern der umliegenden Häuser tauchten Gesichter auf. Eine alte Frau, ein Ehepaar samt Kindern, ein dicker Mann und eine Hausfrau mit Lockenwicklern auf dem Kopf. Nach und nach kamen weitere Köpfe hinzu, die das Geschehen verständnislos verfolgten.
Endlich hörte Vogel mit dem Klatschen auf.
Er blickte sich noch ein letztes Mal um, nun seinerseits beobachtet, und stieg in den Wagen, als wäre nichts gewesen. Borghi hätte ihn gern nach dem Grund seines seltsamen Verhaltens gefragt, doch Vogel kam ihm wieder zuvor. »Was ist Ihnen bei diesen Leuten aufgefallen, Borghi?«
Der junge Polizist zögerte nicht. »Das Ehepaar hat sich die ganze Zeit an den Händen gehalten, sie wirkten sehr einträchtig. Aber es hat immer nur sie gesprochen.«
Der Sonderermittler nickte und sah geradeaus auf die Straße. »Dieser Mann brennt darauf, uns etwas zu sagen.«
Borghi gab keinen Kommentar dazu ab. Er fuhr los und hatte den Applaus und den schwarzen Lieferwagen bald vergessen.
Die Polizeiwache war zu klein und zu eng für das, was Vogel vorschwebte, weshalb er um eine geeignetere Lokalität gebeten hatte. So kam es, dass aus der Schulturnhalle eine Einsatzzentrale für die Suche nach Anna Lou Kastner wurde.
Die Turnmatten und -geräte waren an die eine Längswand gerückt worden. Der große Korb mit den Volleybällen stand unbeachtet in einer Ecke. Jemand hatte Pulte aus den Klassenzimmern herbeigeschafft, die als Schreibtische dienen sollten, ein anderer einige Gartenklappstühle besorgt. Sie hatten zwei Laptops und einen PC angeschleppt, aber es gab nur ein einziges Festnetztelefon. Unter einem der Basketballkörbe war eine schwarze Schiefertafel aufgestellt worden, darauf stand mit Kreide geschrieben: »Ermittlungsergebnisse«. Darunter hatte man die bis dahin gesammelten Fahndungshilfen angebracht: ein Foto von Anna Lou, das gleiche wie auf den von den Eltern ausgedruckten Flugblättern, sowie eine Karte des Tals.
Der Saal hallte vom Gemurmel einer spärlichen Gruppe örtlicher Polizeibeamter in Zivil wider, die sich um eine Kaffeemaschine und ein Tablett mit Gebäck versammelt hatten. Sie redeten aufgeregt durcheinander und sahen ständig auf die Uhr.
Bei einem plötzlichen dumpfen Knall, hervorgerufen von den Flügeln einer Feuertür, die beide zugleich aufgestoßen wurden, fuhren sie wie ein Mann herum. Vogel marschierte gefolgt von Borghi in die Halle, und die Unterhaltung verstummte. Die Tür fiel hinter den beiden zu, und dann war nur noch das leise Quietschen der Ledersohlen auf dem Bodenbelag zu hören.
Ohne Begrüßung und ohne jemanden eines Blickes zu würdigen, ging Vogel zu der Tafel unter dem Korb. Er starrte einen Augenblick auf die »Ermittlungsergebnisse«, als würde er sie aufmerksam studieren. Dann wischte er die Überschrift mit einer schnellen Handbewegung weg und riss das Foto und die Karte herunter.
Mit einem Stück Kreide schrieb er ein Datum auf die Tafel: 23. Dezember.
»Es sind fast zwei Tage seit dem Verschwinden des Mädchens vergangen«, begann er. »In Vermisstenfällen läuft die Zeit meist gegen uns. Wir müssen sie so gut wie möglich nutzen, und deshalb ist es nötig, einen ersten Schritt zu tun.« Er machte eine Pause. »Ich möchte Kontrollposten an der Schnellstraße, an den beiden Zufahrten zum Tal. Sie sollen vorerst niemanden anhalten, aber wir wollen ein Signal aussenden.«
Die Beamten hörten schweigend zu. Borghi hatte sich etwas abseits an die Wand gelehnt und beobachtete die Versammlung.
»Die Überwachungskamera über der Zapfsäule bei dem Schnellrestaurant. Wurden die Aufnahmen schon überprüft?«, fragte Vogel.
Nach kurzem Zögern hob einer der Polizisten, ein Mann mit vorstehendem Bauch, Karohemd und hellblauer Krawatte, seine Kaffeetasse in die Höhe und räusperte sich. »Ja. Wir haben uns die Aufnahmen von den Stunden um den Zeitpunkt des Verschwindens herum geben lassen. Nichts Auffälliges.«
»Sehr gut«, sagte Vogel zufrieden. »Sie werden bitte die männlichen Fahrer der durchkommenden Fahrzeuge ausfindig machen und deren Gründe für das Aufsuchen beziehungsweise Verlassen des Tals überprüfen. Konzentrieren Sie sich auf diejenigen mit gewalttätiger Vergangenheit oder Vorstrafen.«
Von seinem Beobachtungsposten aus entging Borghi der Missmut der Männer nicht.
Ein zweiter Beamter meldete sich zu Wort, der älter war und daher wohl glaubte, sich Kritik erlauben zu können. »Wir sind nur wenige Leute hier, wie Sie sehen, wir haben kein Personal für Sondereinsätze.« Dies wurde von den anderen mit zustimmendem Geraune quittiert.
Vogel ließ sich nicht davon irritieren. Er warf einen Blick auf die Schulpulte, den geradezu lächerlichen Mangel an Ausstattung. Er konnte es diesen Männern kaum zum Vorwurf machen, dass sie skeptisch und wenig motiviert waren, aber er konnte auch keine Ausflüchte gelten lassen. »Ich weiß, dass Sie jetzt alle zu Hause sein und mit Ihren Familien Weihnachten feiern wollen«, fuhr er fort. »Sie sehen mich und Kommissar Borghi als zwei Fremde an, die hierherkommen und Ihnen sagen, was Sie zu tun haben. Aber bedenken Sie eins: Wenn diese Geschichte zu Ende ist, kehren Borghi und ich dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Sie dagegen …« Er sah sie rasch der Reihe nach an. »Sie werden den Eltern dieses Mädchens weiter im Dorf begegnen, auf der Straße, überall.«
Es folgte ein kurzes Schweigen. Dann meldete sich der ältere Polizist wieder zu Wort, etwas weniger feindselig diesmal. »Verzeihen Sie mir die Frage, aber warum sollen wir nach einem Mann suchen, wenn ein junges Mädchen verschwunden ist? Sollten wir uns nicht lieber auf Spuren von ihr konzentrieren?«
»Ganz einfach: weil sie jemand entführt hat.«
Ein Raunen ging durch den Raum. Vogel musterte die Anwesenden forschend. Jeder Polizist von gesundem Menschenverstand hätte seine Behauptung als ermittlerischen Leichtsinn abgetan. Es gab keinen einzigen Beleg für seine Hypothese, nicht einmal den schwächsten Anhaltspunkt. Es war eine leere Behauptung. Doch es genügte ihm, in ihren Köpfen den Gedanken aufkeimen zu lassen, dass es möglich war. Ein Samenkorn Möglichkeit reichte aus, um in kürzester Zeit Gewissheit wachsen zu lassen. Und wenn es ihm gelang, diese Männer hier auf seine Seite zu bringen, konnte er alle überzeugen. Das Spiel entschied sich hier, in dieser improvisierten Einsatzzentrale. Nicht unter Profis, gestählt durch jahrelange Erfahrung, sondern unter ein paar schlecht ausgerüsteten Dorfwachtmeistern. In diesen wenigen Minuten wurde über das Schicksal des Falls und vielleicht eines sechzehnjährigen Mädchens entschieden. Deshalb packte Vogel sämtliche im Laufe der Zeit erworbenen Tricks aus, um den Männern seine Sichtweise unterzujubeln.
»Es hat keinen Zweck, um den heißen Brei herumzureden«, fuhr er fort. »Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, sonst verlieren wir, wie gesagt, nur Zeit. Zeit, die für Anna Lou sehr wertvoll sein kann.« Er zog sein Notizbuch aus der Manteltasche, schlug es mit einer knappen Drehung des Handgelenks auf und konsultierte seine Aufzeichnungen. »Es ist gegen fünf Uhr nachmittags am 23. Dezember. Anna Lou Kastner verlässt das Haus, um zu einem Treffen in der Kirche zu gehen, die nur rund dreihundert Meter entfernt liegt.« Vogel drehte sich um und zeichnete zwei weit auseinanderliegende Punkte auf die Tafel. »Wir wissen, dass sie nicht dort ankommt. Und dass sie nicht der Typ ist, der von zu Hause fortläuft. Das sagen uns diejenigen, die sie kennen, aber auch ihr gesamter Lebensstil – kein Internet zu Hause, kein Profil auf den sozialen Netzwerken und nur fünf Telefonnummern in ihrem Handy-Verzeichnis.« Er zählte sie an den Fingern ab: »Mutter, Vater, eigener Hausanschluss, Großeltern und Pfarrgemeinde.« Dann wandte er sich wieder zur Tafel um und verband die beiden Punkte mit einer Linie. »Die Antwort verbirgt sich irgendwo auf diesen dreihundert Metern. In der näheren Umgebung wohnen weitere elf Familien, sechsundvierzig Personen insgesamt, von denen zweiunddreißig zur fraglichen Zeit zu Hause waren – aber niemand hat etwas gesehen oder gehört. Die Überwachungskameras der privaten Sicherheitsanlagen sind alle auf die hauseigenen Grundstücke gerichtet, nicht auf die Straße, deshalb nützen sie uns nichts. Wie heißt es doch so schön? ›Keiner schaut über den eigenen Gartenzaun.‹« Er steckte das Notizbuch wieder ein. »Der Entführer hat die Gewohnheiten des Viertels genau studiert und wusste, wie man sich dort unbeobachtet fortbewegt. Die Tatsache, dass wir seine Existenz nur vermuten können, lässt darauf schließen, dass er sich gründlich auf die Tat vorbereitet hat. Und uns um einige Nasenlängen voraus ist.«
Vogel legte die Kreide ab und wischte sich den Staub von den Händen. Erneut taxierte er seine Zuhörer, um festzustellen, ob er mit seiner Darstellung zu ihnen durchgedrungen war. Ja, es sah so aus. Er hatte ihnen einen Verdacht eingepflanzt, aber nicht nur das. Vor allem hatte er ihnen genug Motivation geliefert, um sich voll einzusetzen. Von nun an würde er sie leicht lenken können, und keiner würde seine Anweisungen mehr infrage stellen.
»Gut. Und denken Sie daran: Die Frage ist nicht mehr, wo Anna Lou sich aufhält. Die eigentliche Frage ist jetzt, bei wem«, schloss er. »Dann legen wir mal los.«
Ohne etwas gegessen zu haben, verkroch Borghi sich in sein kleines Hotelzimmer, das er zusammen mit dem Vogels am Nachmittag reserviert hatte. Er hatte damit gerechnet, dass am Weihnachtstag nichts mehr zu bekommen wäre, doch obwohl das »Hotel Alpenblume« zu den wenigen noch geöffneten Herbergen im Tal gehörte, war es so gut wie leer. Die meisten anderen Hotels hatten nach dem Beginn des Fluoritabbaus dichtgemacht. Borghi hatte sich gefragt, warum sie nicht in Gästehäuser für die Arbeiter und Angestellten des Bergbaukonzerns umgewandelt worden waren, bis der Portier ihm erklärt hatte, dass die Arbeiter fast alle aus dem Ort stammten, während die Manager des Unternehmens mit ihren Helikoptern kamen und gingen und nie lange blieben. Die Hälfte der männlichen Erwerbsbevölkerung Avechots war in der großen Mine beschäftigt, die das Tal beherrschte.
Als Erstes streifte Borghi seine Anzugschuhe ab und zog die Krawatte aus. Er hatte den ganzen Tag elend gefroren in diesen dünnen Sachen. Normalerweise trug er nur einen Anzug, wenn er vor Gericht aussagen musste. Er wartete, dass seine Körpertemperatur sich der des Zimmers anglich, und zog dann auch sein Jackett und das Hemd aus. Er würde es waschen und in der Dusche aufhängen müssen, in der Hoffnung, dass es bis zum nächsten Morgen trocknete, da seine Frau vergessen hatte, ihm eines zum Wechseln einzupacken. Caroline war in letzter Zeit sehr zerstreut. Sie hatten im vergangenen Jahr geheiratet, und sie war im sechsten Monat schwanger. Keine leichte Sache, einer jungen Ehefrau, die ein Kind erwartete, zu erklären, weshalb man Weihnachten nicht mit ihr verbringen konnte.
Borghi rief sie an, während er das Hemd im Waschbecken einweichte. Das Gespräch verlief ziemlich knapp.
»Was ist denn da eigentlich los in Avechot?«, fragte Caroline ungehalten.
»Wir wissen es noch nicht genau.«
»Dann können sie dir ja genauso gut freigeben über die Feiertage.«
Es lag auf der Hand, dass Caroline Streit suchte. Sie war ungenießbar in dieser Stimmung. »Ich habe dir doch erklärt, was für eine Chance dieser Fall für mein berufliches Fortkommen ist.« Er versuchte, einen versöhnlichen Ton anzuschlagen, wurde aber von dem nebenan laufenden Fernseher abgelenkt. »Entschuldige, ich muss Schluss machen, es klopft an der Tür«, log er und legte auf, ehe Caroline ihn weiter volljammern konnte. Rasch ging er hinüber, um den Sonderbeitrag in den Nachrichten zu sehen.
Am Weihnachtsabend, nachdem die Leute genug gefeiert hatten und den langen Tag allmählich ausklingen ließen, traten Anna Lous Eltern im Fernsehen auf.
Sie saßen nebeneinander hinter einem großen rechteckigen Tisch, der auf ein kleines Podest gestellt worden war. Beide trugen Winteranoraks, die ihnen zu groß geworden zu sein schienen, als hätten die vergangenen bangen Stunden sie von innen her aufgezehrt. Tatsächlich wirkten sie sehr bedrückt und hielten wieder Händchen.