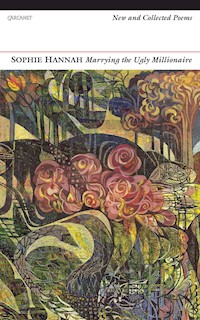10,99 €
Mehr erfahren.
Die 70-jährige Lady Athelinda Playford, Witwe und Herrin von Lillieoak, lädt zu einem großen Dinner in ihr irisches Gutshaus ein. Die Zusammensetzung der Gäste ist so illuster wie kurios. Neben ihren Kindern mit Anhang und ihrem Sekretär sind auch zwei Anwälte, ein Gerichtsmediziner sowie Hercule Poirot und sein Kollege von Scotland Yard, Edward Catchpool, geladen. Als die Runde komplett ist, legt die alte Dame die Karten auf den Tisch: Sie wird ihr Testament ändern, ihre Kinder enterben und alles ihrem todkranken Sekretär vermachen. Unter den Familienmitgliedern bricht ein Sturm der Entrüstung los. Als man den Sekretär am nächsten Morgen ermordet auffindet, scheint der Fall für alle klar. Nicht aber für Poirot.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Sophie Hannah
Der offene Sarg
Ein neuer Fall für Hercule Poirot
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Atlantik
Für Mathew und James Prichard
und Familie, von Herzen
Erster Teil
1Ein neues Testament
Michael Gathercole starrte die geschlossene Tür an und versuchte sich einzureden, der Augenblick zu klopfen sei gekommen, während unten in der Halle die betagte Standuhr stotternd die Stunde bekannt gab.
Gathercoles Instruktionen hatten gelautet, um vier zu erscheinen, und es war vier. In den vergangenen sechs Jahren hatte er oft hier gestanden – an exakt derselben Stelle des breiten Korridors im Obergeschoss von Lillieoak. Nur ein einziges Mal hatte er sich dabei unwohler gefühlt als jetzt. Zu jener Gelegenheit war er einer von zwei Wartenden gewesen, nicht allein wie an diesem Nachmittag. Er erinnerte sich noch an jedes Wort seiner Unterhaltung mit dem anderen Mann, obwohl er es vorgezogen hätte, nichts mehr davon zu wissen. Unter Aufbietung all seiner Selbstdisziplin, auf die er sich stets verlassen konnte, verbannte er sie aus seinem Bewusstsein.
Er war vorgewarnt worden, dass die Besprechung des heutigen Nachmittags schwierig werden würde. Die Warnung war Teil der Vorladung gewesen, was typisch für seine Gastgeberin war. »Was ich Ihnen zu sagen beabsichtige, wird Ihnen einen Schock versetzen …«
Gathercole zweifelte nicht daran. Die Vorwarnung nützte ihm jedoch nichts, da sie nichts darüber verriet, welche Art von Vorbereitung angezeigt sein könnte.
Sein Unbehagen verstärkte sich, als er seine Taschenuhr konsultierte und bemerkte, dass er durch sein Zögern sowie durch das Herausnehmen der Uhr aus seiner Westentasche und das Wiedereinstecken und abermalige Herausholen mittlerweile spät dran war. Es war bereits eine Minute nach vier. Er klopfte.
Nur eine Minute zu spät. Sie würde es bemerken – gab es überhaupt etwas, was sie nicht bemerkte? –, aber mit ein bisschen Glück würde sie sich eines Kommentars enthalten.
»Kommen Sie nur herein, Michael!« Lady Athelinda Playford klang überschwänglich wie immer. Sie war siebzig Jahre alt, und ihre Stimme klang so laut und klar wie eine blank polierte Glocke. Gathercole hatte sie noch nie in gemäßigter Gemütslage erlebt. Für sie bestand immer ein Grund zur Begeisterung – oft genug Dinge, die einem konventionellen Menschen eher ein Anlass zur Besorgnis gewesen wären. Lady Playford besaß die Gabe, dem Belanglosen ebenso viel Vergnügen zu entlocken wie dem Kontroversen.
Gathercole bewunderte ihre Geschichten – um glückliche Kinder, die Kriminalfälle lösten, welche die örtliche Polizei vor ein Rätsel stellten –, seit er sie einst als einsamer Zehnjähriger in einem Londoner Waisenhaus entdeckt hatte. Vor sechs Jahren war er ihrer Schöpferin zum ersten Mal begegnet und hatte sie als ebenso entwaffnend und unvorhersehbar wie ihre Bücher kennengelernt. Er hatte nie erwartet, es in dem Beruf seiner Wahl sonderlich weit zu bringen, aber dank Athelinda Playford – voilà: mit 36 Jahren noch relativ jung und dennoch bereits Partner in der erfolgreichen Anwaltskanzlei Gathercole und Rolfe. Dass ein gewinnbringendes Unternehmen seinen Namen trug, war Gathercole selbst nach mehreren Jahren noch immer unbegreiflich.
Seine Loyalität zu Lady Playford übertraf zwar jede andere gefühlsmäßige Bindung, die er in seinem bisherigen Leben eingegangen war, doch die persönliche Bekanntschaft mit seiner Lieblingsautorin hatte ihn genötigt, sich einzugestehen, dass er es doch vorzog, wenn Schocks und verblüffende Wendungen sich in der beruhigend entlegenen Welt der Fiktion ereigneten und nicht in der Wirklichkeit. Unnötig zu sagen, dass Lady Playford diese Vorliebe nicht teilte.
Er öffnete zaghaft die Tür.
»Haben Sie etwa vor … Ah! Da sind Sie ja! Stehen Sie nicht da rum. Hinsetzen, hinsetzen! Wir kommen zu gar nichts, wenn wir nicht endlich anfangen.«
Gathercole setzte sich.
»Hallo, Michael.« Sie lächelte ihn an, und er hatte das gleiche seltsame Gefühl wie immer – als ob ihre Augen ihn aufgelesen, herumgedreht und wieder abgesetzt hätten. »Und jetzt müssen Sie ›Hallo, Athie‹ sagen. Na los, sagen Sie es! Nach all den Jahren müsste es doch wirklich ein Kinderspiel sein. Nicht ›Guten Tag, Eure Ladyschaft‹. Nicht ›Habe die Ehre, Lady Playford‹. Ein schlichtes, freundliches ›Hallo, Athie‹. Fühlen Sie sich überfordert? Ha!« Sie klatschte in die Hände. »Sie sehen ganz wie ein gehetztes Füchslein aus! Sie fragen sich, warum ich Sie für eine Woche hierher eingeladen habe, nicht wahr? Oder warum ich Mr Rolfe ebenfalls eingeladen habe.«
Würden die Vorkehrungen, die Gathercole getroffen hatte, ausreichen, um seine eigene und Orville Rolfes Abwesenheit zu überbrücken? Es war noch niemals vorgekommen, dass sie beide an fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Kanzlei fernblieben, aber Lady Playford war die illustreste Klientin der Firma; kein Wunsch ihrerseits durfte ausgeschlagen werden.
»Ich könnte wetten, Michael, Sie fragen sich gerade, ob auch weitere Gäste erwartet werden. Zu alldem kommen wir gleich, aber ich warte noch immer auf Ihr ›Hallo‹.«
Er hatte keine Wahl. Die Begrüßung, die sie ihm jedes Mal abverlangte, würde ihm niemals glatt von der Zunge gehen. Er war ein Mann, der gern Regeln befolgte, und wenn es keine Regel gab, die es einem Menschen mit seiner Herkunft verbot, eine verwitwete Viscountess, die Gemahlin des verblichenen fünften Viscount Playford of Clonakilty, mit »Athie« anzusprechen, so war Gathercole felsenfest davon überzeugt, dass es eine geben sollte.
Es war daher bedauerlich – wie er sich oft selbst sagte –, dass Lady Playford, für die er alles getan hätte, keine Gelegenheit ausließ, Regeln mit Hohn und Spott zu übergießen, und all jene, die ihnen gehorchten, als »sture Stockfische« titulierte.
»Hallo, Athie.«
»Na also!« Sie breitete die Arme aus wie eine Frau, die einen Mann dazu einlädt, sich in selbige zu werfen, doch Gathercole wusste, dass es nicht so gemeint war. »Prüfung bestanden. Sie können sich entspannen. Nicht zu sehr! Wir haben wichtige Dinge zu erledigen – nachdem wir uns über das aktuelle Bündel unterhalten haben.«
Es war Lady Playfords Angewohnheit, das Buch, das sie jeweils gerade in Arbeit hatte, als »das Bündel« zu bezeichnen. Ihr jüngstes Produkt lag auf der Ecke ihres Schreibtisches, und sie warf einen grollenden Blick in seine Richtung. Gathercole fand, dass es nicht so sehr wie ein Roman aussah als wie die Papier-Nachbildung eines Wirbelwinds: zerknitterte Blätter mit sich rollenden Rändern, achtlos zu einem ungefügen Stapel gehäuft. Das Ganze hatte nichts auch nur annähernd Rechteckiges an sich.
Lady Playford stemmte sich aus ihrem Sessel am Fenster. Wie Gathercole aufgefallen war, sah sie nie nach draußen. Wenn es einen Menschen zu begutachten gab, verschwendete Lady Playford keine Zeit an die Natur. Ihr Arbeitszimmer hatte einen herrlichen Ausblick: auf den Rosengarten und, dahinter, einen großen, vollkommen quadratischen Rasen, in dessen Mitte die Engelsplastik stand, die ihr Ehemann Guy, der verblichene Viscount Playford, anlässlich ihres dreißigsten Hochzeitstags als Geschenk für sie in Auftrag gegeben hatte.
Bei seinen Besuchen betrachtete Gathercole stets die Statue und den Rasen und die Rosensträucher, desgleichen die Standuhr in der Halle und die bronzene Tischlampe in der Bibliothek, mit ihrem Schneckenhausschirm aus bleigefasstem Glas; er tat es ganz bewusst. Er begrüßte die Beständigkeit, die sie zu verkünden schienen. Die Dinge – womit Gathercole ganz konkret unbelebte Objekte meinte und nicht etwa eine allgemeinere Sachlage – änderten sich selten in Lillieoak. Lady Playfords gleichbleibend gründliche Musterung jeder Person, die ihr über den Weg lief, ging damit einher, dass sie allem, was nicht der Rede mächtig war, nur geringe Beachtung schenkte.
Im großen Bücherregal an der einen Wand ihres Arbeitszimmers – wo sie und Gathercole sich gerade aufhielten – standen zwei Bücher falsch herum: Shrimp Seddon und die Perlenkette und Shrimp Seddon und der Weihnachtsstrumpf. Sie standen bereits seit Gathercoles erstem Besuch auf dem Kopf. Sie nach sechs Jahren richtig herumgedreht zu sehen wäre befremdlich gewesen. Keines anderen Autors Werke durften auf diesen Brettern stehen: ausschließlich Athelinda Playfords Bücher. Ihre Rücken brachten etwas dringend benötigte Farbe in den dunklen, holzgetäfelten Raum – Streifen von Rot, Blau, Grün, Violett, Orange; Farben, die Kinder ansprechen sollten –, wenngleich auch sie von Lady Playfords leuchtender Wolke von Silberhaar überstrahlt wurden.
»Athie« stellte sich direkt vor Gathercole hin. »Ich möchte mit Ihnen über mein Testament sprechen, Michael, und Sie um einen Gefallen bitten. Aber zunächst: Was glauben Sie, wie viel ein Kind – ein gewöhnliches Kind – über chirurgische Eingriffe zur Umformung einer Nase wissen könnte?«
»Einer … einer Nase?« Gathercole wäre es lieber gewesen, als Erstes vom Testament und als Zweites ihren Wunsch zu erfahren. Beides klang wichtig und hing möglicherweise miteinander zusammen. Lady Playfords letztwillige Verfügung stand schon seit geraumer Zeit fest. Alles war so, wie es sich gehörte. Konnte es sein, dass sie irgendetwas ändern wollte?
»Treiben Sie mich nicht zur Verzweiflung, Michael. Es ist eine absolut simple Frage. Nach einem schweren Automobilunfall oder um eine angeborene Missbildung zu korrigieren. Eine Operation zur Veränderung der Form der Nase. Würde ein Kind wissen, dass es so etwas gibt? Würde es wissen, wie man es nennt?«
»Ich fürchte, ich weiß es nicht.«
»Wissen Sie, wie man so etwas nennt?«
»›Operation‹ würde ich dazu sagen, gleich, ob an der Nase oder an irgendeinem anderen Körperteil.«
»Es wäre möglich, dass Sie den Namen kennen, ohne zu wissen, dass Sie ihn kennen. Das kommt bisweilen vor.« Lady Playford runzelte die Stirn. »Hm. Ich möchte Ihnen eine andere Frage stellen: Sie kommen in die Geschäftsstelle einer Firma, in der zehn Männer und zwei Frauen beschäftigt sind. Sie hören zufällig, wie einige der Männer sich über eine der Frauen unterhalten. Sie titulieren sie dabei als ›Rhino‹.«
»Nicht gerade galant von ihnen.«
»Ihre Manieren brauchen Sie nicht zu interessieren. Kurz darauf kommen die zwei Damen von der Mittagspause zurück. Die eine ist zartgliedrig, schmal und von sanftem Naturell, aber sie hat ein ziemlich ungewöhnliches Gesicht. Niemand wüsste zu sagen, was damit nicht stimmt, aber irgendwie sieht es nicht ganz normal aus. Die andere ist ein Koloss von einer Frau – wenigstens das Doppelte meines Formats.« Lady Playford war von durchschnittlicher Körpergröße und rundlich, mit abschüssigen Schultern, die ihr eine irgendwie trichterförmige Erscheinung verliehen. »Darüber hinaus hat sie eine grimmige Miene. Was meinen Sie, welche dieser zwei Frauen würden Sie nach meiner Beschreibung für Rhino halten?«
»Die große, grimmige«, erwiderte Gathercole prompt.
»Ausgezeichnet! Sie irren sich. In meiner Geschichte stellt sich heraus, dass Rhino das schmale Mädchen mit den seltsamen Gesichtszügen ist – weil ihre Nase nach einem Unfall chirurgisch wiederhergestellt wurde, durch einen Eingriff, der als Rhinoplastik bezeichnet wird!«
»Ah. Das wusste ich nicht«, sagte Gathercole.
»Aber ich fürchte, dass Kinder das Wort nicht kennen werden, und für die schreibe ich ja. Wenn schon Sie noch nie etwas von Rhinoplastik gehört haben …« Lady Playford seufzte. »Ich bin mir unschlüssig. Im ersten Moment war ich ganz begeistert von meiner Idee, aber dann kamen mir Zweifel. Ist es vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll, wenn der Knackpunkt der Geschichte ein medizinischer Fachausdruck ist? Kein Mensch denkt über chirurgische Eingriffe nach, wenn er nicht unbedingt muss – wenn er nicht gerade selbst kurz davor steht, ins Krankenhaus zu gehen. Kinder denken über solche Dinge nicht nach, oder?«
»Die Idee gefällt mir«, sagte Gathercole. »Sie könnten ja betonen, dass die schlanke junge Dame nicht lediglich ein merkwürdiges Gesicht, sondern eine merkwürdige Nase hat, um Ihre Leser auf die richtige Spur zu bringen. Sie könnten schon gegen Anfang der Geschichte sagen, dass sie, dank einem speziellen chirurgischen Eingriff, eine neue Nase hat, und Sie könnten es so einrichten, dass Shrimp irgendwie den Fachterminus für eine solche Operation herausfindet, und dem Leser ihre Überraschung vorführen, als sie ihn herausfindet.«
Shrimp Seddon war Lady Playfords zehnjährige Protagonistin, die Anführerin einer Bande von Kinderdetektiven.
»Der Leser sieht zunächst also nur die Überraschung, die Entdeckung selbst aber nicht … Ja! Und vielleicht könnte Shrimp zu Podge sagen: ›Du kommst nie darauf, wie das heißt‹, und dann unterbrochen werden, und ich kann ein Kapitel über irgendetwas anderes einschieben – vielleicht, wie die Polizei dummerweise den Falschen verhaftet, aber einen noch Falscheren als sonst, vielleicht sogar Shrimps Vater oder Mutter –, sodass der Leser, wenn er möchte, in der Zwischenzeit einen Arzt fragen oder ein Konversationslexikon konsultieren kann. Aber ich lasse nicht zu viel Zeit verstreichen, bevor Shrimp die Auflösung bringt. Ja. Michael, ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen konnte! Das wäre also erledigt. Und jetzt zu meinem Testament …«
Sie kehrte zu ihrem Sessel am Fenster zurück und machte es sich darin bequem. »Ich möchte, dass Sie mir ein neues aufsetzen.«
Gathercole war überrascht. Gemäß Lady Playfords bisheriger letztwilliger Verfügung sollte ihr beachtliches Vermögen nach ihrem Tod zu gleichen Teilen an ihre zwei noch lebenden Kinder fallen: ihre Tochter Claudia und ihren Sohn Harry, den sechsten Viscount Playford of Clonakilty. Es hatte noch ein drittes Kind gegeben, Nicholas, doch es war jung gestorben.
»Ich möchte alles meinem Sekretär vermachen, Joseph Scotcher«, verkündete die glockenklare Stimme.
Gathercole beugte sich in seinem Sessel vor. Der Versuch, die unliebsamen Worte zu verdrängen, wäre sinnlos gewesen. Sie waren gefallen, und er konnte nicht so tun, als hätte er sie nie gehört.
Auf welchen gefährlichen Unfug war Lady Playford bloß verfallen? Das konnte doch unmöglich ihr Ernst sein! Das war ein Witz; es konnte nicht anders sein. Ja, Gathercole durchschaute ihren Plan: erst den lustigen Teil abhaken – Rhino, Rhinoplastik, alles sehr clever und amüsant – und dann die große Hanswurstiade als absoluten Ernst servieren.
»Ich bin bei klarem Verstand und scherze auch nicht, Michael. Ich möchte, dass Sie tun, was ich verlange. Bis spätestens zum Dinner, bitte. Warum setzen Sie sich nicht gleich daran?«
»Lady Playford …«
»Athie«, korrigierte sie ihn.
»Wenn das jetzt eine weitere ›Rhino-Geschichte‹ ist, die Sie an mir ausprobieren möchten …«
»Nein, Michael, ehrlich. Ich habe Sie noch nie belogen. Ich lüge auch jetzt nicht. Sie müssen ein neues Testament für mich aufsetzen. Joseph Scotcher soll alles erben.«
»Aber was ist mit Ihren Kindern?«
»Claudia ist im Begriff, in Gestalt Randall Kimptons ein noch größeres Vermögen als das meinige zu heiraten. Damit hat sie absolut ausgesorgt. Und Harry ist ein gescheiter Kopf und hat eine verlässliche, wenn auch nervende Frau. Der arme Joseph hat das, was ich besitze, nötiger als Claudia oder Harry.«
»Ich muss Sie dennoch ersuchen, Ihr Vorhaben sehr gründlich zu überdenken, bevor …«
»Michael, machen Sie sich bitte nicht lächerlich«, unterbrach ihn Lady Playford. »Glauben Sie etwa, die Idee wäre mir erst in dem Moment gekommen, als Sie vor wenigen Minuten anklopften? Oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass ich sie seit Wochen und Monaten mit mir herumtrage? Die gründliche Überlegung, die Sie mir so dringend anraten, hat bereits stattgefunden, da kann ich Sie beruhigen. Also: Werden Sie mein neues Testament beglaubigen, oder muss ich Mr Rolfe kommen lassen?«
Deswegen also hatte Lady Playford Orville Rolfe gleichfalls nach Lillieoak eingeladen: für den Fall, dass er, Gathercole, sich weigern sollte, ihrem Wunsch zu entsprechen.
»Es gibt noch eine weitere Änderung, die ich an meinem Testament vornehmen möchte: der Gefallen, um den ich Sie, wie Sie sich erinnern, bitten wollte. Dazu können Sie, wenn Sie möchten, nein sagen, aber ich hoffe sehr, dass Sie nicht ablehnen weren. Bislang sind Claudia und Harry als Verwalter meines literarischen Nachlasses eingesetzt. Dieses Arrangement gefällt mir nicht mehr. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie, Michael, diese Aufgabe zu übernehmen bereit wären.«
»Ihren … Ihren literarischen Nachlass zu verwalten?« Er konnte es kaum glauben. Fast eine Minute lang bekam er kein weiteres Wort heraus. Ach, aber es war nicht richtig! Was würden Lady Playfords Kinder dazu sagen? Er konnte unmöglich annehmen.
»Wissen Harry und Claudia von Ihren Absichten?«, fragte er schließlich.
»Nein. Sie werden sie heute beim Dinner erfahren. Ebenso wie Joseph. Momentan sind die einzigen Personen, die davon wissen, Sie und ich.«
»Ist es in der Familie zu einem Konflikt gekommen, von dem ich nichts weiß?«
»Ganz und gar nicht!« Lady Playford lächelte. »Harry, Claudia und ich sind ein Herz und eine Seele und werden es auch bleiben – zumindest bis zum heutigen Abendessen.«
»Ich … aber … Sie kennen Joseph Scotcher seit lediglich sechs Jahren. Sie haben ihn an demselben Tag kennengelernt wie mich.«
»Es ist nicht nötig, mir Dinge zu sagen, die ich schon weiß, Michael.«
»Während Ihre Kinder … Hinzu kommt, dass Joseph Scotcher meines Wissens …«
»Sprechen Sie sich aus, mein Guter.«
»Ist Scotcher nicht ernsthaft krank?« Im stillen fügte Gathercole hinzu: Glauben Sie denn etwa nicht mehr, dass er vor Ihnen sterben wird?
Athelinda Playford war nicht mehr die Jüngste, aber sie war die Vitalität in Person. Es fiel schwer, sich vorzustellen, dass jemand, der das Leben so sehr genoss, es irgendwann verlieren sollte.
»Joseph ist in der Tat sehr krank«, sagte sie. »Er wird von Tag zu Tag schwächer. Daher mein ungewöhnlicher Entschluss. Ich habe es noch nie ausgesprochen, aber Ihnen ist doch sicherlich bewusst, dass ich Joseph vergöttere? Ich liebe ihn wie einen Sohn – als wäre er mein eigen Fleisch und Blut.«
Gathercole verspürte eine plötzliche Enge in der Brust. Ja, es war ihm bewusst. Aber zwischen etwas wissen und es bestätigt bekommen bestand ein gewaltiger Unterschied. Er gab Anlass zu Gedanken, die seiner nicht würdig waren und die er mühsam aus seinem Kopf zu verbannen versuchte.
»Wie ich von Joseph weiß, geben ihm seine Ärzte nur noch Wochen.«
»Aber … dann muss ich gestehen, dass ich vor einem absoluten Rätsel stehe«, sagte Gathercole. »Sie wünschen, ein neues Testament zugunsten eines Mannes zu errichten, von dem Sie wissen, dass er das Eintreten des Erbfalls nicht mehr erleben wird.«
»Nichts auf dieser Welt kann man mit Sicherheit wissen, Michael.«
»Und sollte Scotcher, wie Sie erwarten, binnen weniger Wochen seiner Krankheit erliegen – was dann?«
»Nun, in dem Fall kehren wir zur ursprünglichen Regelung zurück – Harry und Claudia bekommen jeder die Hälfte.«
»Ich muss Ihnen eine Frage stellen«, sagte Gathercole, in dem sich eine schmerzliche Bangigkeit immer stärker bemerkbar machte. »Vergeben Sie mir die Taktlosigkeit. Haben Sie vielleicht Grund zu der Annahme, dass auch Sie in Kürze verscheiden werden?«
»Ich?« Lady Playford lachte. »Ich bin so stark wie ein Ochse. Ich rechne damit, noch Jahre zu halten.«
»Dann wird Scotcher bei Ihrem Ableben nichts erben, da er selbst bereits lange tot sein wird, und das neue Testament, das ich für Sie aufsetzen soll, wird keine andere Wirkung zeitigen, als zwischen Ihnen und Ihren Kindern Zwietracht zu säen.«
»Im Gegenteil: Mein neues Testament könnte bewirken, dass etwas Wunderbares geschieht.« Sie sagte dies mit hörbarem Genuss.
Gathercole seufzte. »Ich muss leider gestehen, dass ich weiterhin vor einem Rätsel stehe.«
»Natürlich«, sagte Athelinda Playford. »Das hatte ich auch nicht anders erwartet.«
2Ein überraschendes Wiedersehen
Verschleiern und enthüllen: Wie fern und dennoch nah sind sich diese zwei Begriffe! Sie klingen wie Gegensätze, und doch lässt sich, wie alle guten Erzähler wissen, durch geringste Verschleierungsversuche viel enthüllen, und neue Enthüllungen verbergen oft ebenso viel, wie sie offenkundig machen.
So weit mein unbeholfener Versuch, mich als den Erzähler dieser Geschichte einzuführen. Alles, was Sie bislang – über Michael Gathercoles Treffen mit Lady Athelinda Playford – erfahren haben, wurde Ihnen von mir enthüllt, und doch habe ich meine Erzählung begonnen, ohne eine Menschenseele auf meine Anwesenheit aufmerksam zu machen.
Mein Name ist Edward Catchpool, und ich bin Ermittler beim Londoner Scotland Yard. Die unerhörten Begebenheiten, die ich zu schildern kaum begonnen habe, fanden jedoch nicht in London statt, sondern in Clonakilty, County Cork, im Irischen Freistaat. Es war der 14. Oktober 1929, als Michael Gathercole und Lady Playford sich in Myladys Arbeitszimmer in Lillieoak trafen, und an demselben Tag – und lediglich eine Stunde, nachdem diese Besprechung ihren Anfang genommen hatte – traf ich nach der langen Anreise aus England in Lillieoak ein.
Sechs Wochen zuvor hatte ich einen Brief erhalten, in dem Lady Athelinda Playford mich zu meiner Verblüffung zu einem einwöchigen Aufenthalt auf ihr Landgut einlud. Die vielfältigen Freuden der Jagd (zu Pferd und zu Fuß) und des Angelns – wovon ich bis dato noch nichts praktiziert hatte noch auszuprobieren gedachte (was meine Gastgeberin allerdings nicht zu wissen brauchte) – wurden mir verlockend in Aussicht gestellt, doch was sich in der Einladung nicht fand, war das kleinste Wort der Erklärung, warum meine Anwesenheit eigentlich erwünscht war.
Ich legte den Brief auf den Esstisch in meiner Pension und überlegte, was ich tun sollte. Ich dachte über Athelinda Playford nach – Verfasserin von Detektiv-Geschichten, die wohl berühmteste Kinderbuchautorin, die mir einfiel –, und dann dachte ich über mich selbst nach: Junggeselle, Polizist, keine Frau und somit auch keine Kinder, denen ich Geschichten vorlesen könnte …
Nein, entschied ich, Lady Playfords Welt und die meinige hatten keinerlei Veranlassung, sich je zu überschneiden – und doch hatte sie mir diesen Brief geschrieben, was bedeutete, dass ich irgendwie darauf reagieren musste.
Hatte ich Lust zu fahren? Keine besondere, nein – und das wiederum bedeutete, dass ich es höchstwahrscheinlich tun würde. Menschen, so meine Beobachtung, halten sich gern an Muster, und ich bilde diesbezüglich keine Ausnahme. Da ein Großteil dessen, was ich Tag für Tag tue, nichts ist, was ich je freiwillig auf mich nehmen würde, neige ich dazu, wenn sich etwas ergibt, was ich lieber nicht täte, den Schluss zu ziehen, dass ich es mit Sicherheit tun werde.
Ein paar Tage darauf schrieb ich Lady Playford und nahm ihre Einladung mit gebührendem Enthusiasmus an. Ich hatte den Verdacht, dass sie mich aushorchen wollte, um dadurch gewonnene einschlägige Informationen in eines oder mehrere ihrer künftigen Bücher einfließen zu lassen. Vielleicht hatte sie ja endlich beschlossen, ein bisschen mehr darüber herauszufinden, wie die Polizei tatsächlich arbeitete. Als Kind hatte ich ein, zwei ihrer Bücher gelesen und zu meiner großen Überraschung erfahren, dass selbst ranghohe Polizeibeamte ausgemachte Trottel waren, die es nicht fertigbrachten, auch nur den simpelsten Fall zu lösen, sofern ihnen nicht eine Gruppe von eingebildeten, großmäuligen Zehnjährigen unter die Arme griff. Tatsächlich war meine diesbezügliche Verwunderung der Beginn meines Interesses an Polizeiarbeit gewesen – eines Interesses, das unmittelbar zu meiner Berufswahl führte. Seltsamerweise war mir bis dahin noch nie der Gedanke gekommen, dass ich dafür Athelinda Playford zu danken hatte.
Während der Fahrt nach Lillieoak hatte ich zur Auffrischung meines Gedächtnisses einen weiteren Roman von ihr gelesen und festgestellt, dass mein jugendliches Urteil zutreffend gewesen war: Die Geschichte gipfelte darin, dass Sergeant Hohlkopf und Inspector Vollidiot von der frühreifen Shrimp Seddon heruntergeputzt wurden, weil sie sich in einer absolut offensichtlichen Kette von Indizien verheddert hatten, die sogar Shrimps fetter Zottelhund Anita korrekt zu deuten imstande gewesen war.
Als ich um fünf Uhr nachmittags eintraf, ging die Sonne bereits unter, aber es war noch so hell, dass ich die ziemlich spektakuläre Umgebung zur Kenntnis nehmen konnte. Während ich vor Lady Playfords feudalem palladianischem Herrenhaus am Ufer des Flusses Argideen in Clonakilty stand – hinter mir ein geometrischer Garten, zu meiner Linken Felder und zu meiner Rechten, wie mir schien, der Rand eines Waldes –, nahm ich etwas wie endlosen Raum wahr – die ununterbrochenen Blau- und Grüntöne der Natur. Ich hatte schon vor meiner Abreise gewusst, dass das Landgut Lillieoak eine Fläche von achthundert Morgen besaß, aber erst jetzt begriff ich, was das bedeutete: keinerlei Berührungspunkte zwischen der eigenen Welt und der Welt von wem auch immer, sofern man es nicht wünschte; nichts und niemand, das beziehungsweise der einen bedrängte oder um einen herumstand, wie das in der Großstadt zu sein pflegt. Es war wirklich kein Wunder, dass Lady Playford nicht die leiseste Ahnung hatte, wie sich echte Polizisten gemeinhin verhielten.
Während ich die frischeste Luft einatmete, die je durch meine Lungen geströmt war, regte sich in mir die Hoffnung, den Grund meiner Einladung richtig erraten zu haben. Bot sich mir die Gelegenheit, dachte ich, würde ich nur zu gern die Überzeugung äußern, dass Lady Playfords Bücher durch etwas mehr Realismus entscheidend gewinnen würden. Vielleicht konnten ja Shrimp Seddon und ihre Clique in ihrem nächsten Abenteuer mit etwas kompetenteren Beamten zusammenarbeiten …
Die Eingangstür von Lillieoak öffnete sich. Ein Butler spähte zu mir heraus. Er war von mittlerer Größe und Statur, mit schütterem grauem Haar und jeder Menge Runzeln und Falten um die Augen, aber nirgendwo sonst: als hätte man in das Gesicht eines viel jüngeren Mannes Greisenaugen eingesetzt.
Noch seltsamer war die Miene des Butlers. Sie deutete an, er habe mir etwas eminent Wichtiges mitzuteilen, was mich vor einer Peinlichkeit bewahren würde, könne aber aus Gründen der Diskretion leider nichts verraten.
Ich wartete darauf, dass er sich vorstellte oder mich ins Haus bat. Er tat keines von beidem. Schließlich sagte ich: »Mein Name ist Edward Catchpool. Ich bin gerade aus England eingetroffen. Ich glaube, Lady Playford erwartet mich.«
Meine Koffer standen zu meinen Füßen. Er sah sie an, warf dann einen Blick über die Schulter; zweimal wiederholte er diese Prozedur. Dazu gab es keinerlei sprachliche Begleitung.
Schließlich sagte er: »Ich werde Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer bringen lassen, Sir.«
»Danke.« Ich runzelte die Stirn. Das Ganze war wirklich äußerst sonderbar – sonderbarer, fürchte ich, als ich hier zu vermitteln vermag. So normal die Aussage des Butlers in sich auch war, erweckte der Sprecher doch den Eindruck, als wäre unendlich mehr ungesagt geblieben – etwas wie: »Mehr kann ich unter den gegebenen Umständen bedauerlicherweise nicht preisgeben.«
»War sonst noch etwas?«, fragte ich.
Das Gesicht straffte sich. »Ein weiterer … Gast Lady Playfords erwartet Sie im Salon, Sir.«
»Ein weiterer Gast?« Ich hatte angenommen, der einzige zu sein.
Meine Frage schien ihn zu empören. Der Stein des Anstoßes wollte sich mir nicht erschließen, und ich erwog bereits, meiner Ungeduld freien Lauf zu lassen, als ich im Haus eine Tür sich öffnen hörte, gefolgt von einer Stimme, die ich kannte. »Catchpool! Mon cher ami!«
»Poirot?«, rief ich. Zum Butler sagte ich: »Ist das Hercule Poirot?« Müde, darauf zu warten, dass man mich aus der Kälte hereinbat, stieß ich die Tür auf und betrat das Haus. Ich sah einen kunstvoll gefliesten Fußboden von der Art, wie man sie in einem Palast finden könnte, eine imposante Holztreppe, weit mehr Türen und Korridore, als ein Neuankömmling zu verarbeiten imstande sein konnte, eine Standuhr und an einer Wand einen präparierten Hirschkopf. Die arme Kreatur sah so aus, als ob sie lächelte, und ich lächelte zurück. Obwohl tot und von seinem Körper getrennt, war der Hirschkopf gastfreundlicher als der Butler.
»Catchpool!«, ließ sich die Stimme aufs Neue vernehmen.
»Sagen Sie, hält sich Hercule Poirot in diesem Haus auf?«, fragte ich mit größerem Nachdruck.
Diesmal antwortete der Butler mit einem widerwilligen Nicken, und Augenblicke später kam der Belgier mit – für seine Verhältnisse – eiligem Schritt in Sicht. Beim Anblick des eiförmigen Kopfes und der blitzblanken Schuhe, beides mir so vertraute Attribute, und natürlich des unverwechselbaren Schnurrbarts konnte ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Catchpool! Welch eine Freude, Sie gleichfalls hier anzutreffen!«
»Das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Waren Sie es zufällig, der mich im Salon erwartete?«
»Ja, ja. Das war ich.«
»Das hatte ich mir gedacht. Gut, dann können Sie mich ja dorthin führen. Was in aller Welt ist eigentlich los? Ist irgendetwas passiert?«
»Passiert? Nein. Was sollte denn passiert sein?«
»Na ja …« Ich drehte mich um. Poirot und ich waren allein, und meine Koffer waren verschwunden. »Angesichts des reservierten Verhaltens des Butlers hatte ich mich gefragt …«
»Ah, ja, Hatton. Achten Sie nicht auf ihn, Catchpool. Sein ›reserviertes Verhalten‹, wie Sie das nennen, ist ohne Ursache. Es ist einfach sein Charakter.«
»Sind Sie sicher? Das ist schon ein ziemlich kurioser Charakter.«
»Oui. Lady Playford hat es mir heute Nachmittag, kurz nach meiner Ankunft, erläutert. Ich stellte ihr die gleichen Fragen, die Sie mir jetzt stellen, in der Annahme, es müsste etwas geschehen sein, was der Butler nicht glaubte preisgeben zu dürfen. Sie sagte, Hatton sei so geworden, weil er schon so lange seinen Dienst tut. Er hat viele Dinge gesehen, welche zu erwähnen für ihn nicht klug gewesen wäre, und so, erklärte mir Lady Playford, zieht er es jetzt vor, so wenig wie möglich zu sagen. Sie findet es ebenfalls enervierend. ›Selbst auf die banalste Frage – um wie viel Uhr wird das Dinner serviert? Wann werden die Kohlen geliefert? – reagiert er so, als versuchte ich ihm ein streng gehütetes, explosives Familiengeheimnis abzuringen!‹ So hat sie sich bei mir beklagt. ›Was er jemals an Urteilsvermögen besaß, ist dahin, und jetzt ist er außerstande, zwischen eklatanter Indiskretion und völligem Schweigen den richtigen Mittelweg zu finden‹, hat sie gesagt.«
»Warum stellt sie dann nicht einen neuen Butler ein?«
»Auch das ist eine Frage, die ich ihr stellte. Wir denken in gleichen Bahnen, Sie und ich.«
»Und, hat sie Ihnen darauf eine Antwort gegeben?«
»Sie findet es faszinierend, die Entwicklung von Hattons Persönlichkeit mitzuverfolgen, und ist gespannt, wie weit er es mit der Verfeinerung seiner Manieren noch treiben wird.«
Ich zog ein entnervtes Gesicht, während ich mich fragte, wann endlich jemand erscheinen und mir eine Tasse Tee anbieten würde. In diesem Moment erbebte das Haus, kam zum Stillstand, erbebte dann wieder. Ich wollte schon »Was in aller Welt …?« ausrufen, als ich, am oberen Ende der Treppe, den voluminösesten Mann erblickte, den ich jemals gesehen hatte. Er war auf dem Weg nach unten. Er hatte strohfarbenes Haar und Hängebacken, und sein Kopf sah so winzig wie ein Kieselsteinchen aus, das auf einem erdballgroßen Körper balancierte.
Bei jedem Schritt ertönten laute Knarrgeräusche unter seinen Füßen, und ich befürchtete schon, er könnte mit einem davon glatt in den Holzstufen einbrechen. »Hören Sie dieses entsetzliche Geräusch?«, fragte er uns herrisch, ohne sich vorzustellen. »Stufen dürften nicht ächzen, wenn man auf sie tritt. Sind sie nicht genau dazu da – dass man auf sie tritt?«
»Das sind sie«, pflichtete Poirot ihm bei.
»Nun?«, fügte der Mann unnötigerweise hinzu. Er hatte seine Antwort ja schon bekommen. »Ich sag Ihnen was, Treppen wie früher bekommt man heutzutage einfach nicht mehr. Das Handwerk verkommt.«
Poirot lächelte höflich, nahm mich dann beim Arm und lotste mich weiter nach links, um mir zuzuflüstern: »Sein Appetit ist schuld daran, dass die Stufen ächzen. Aber immerhin ist er Anwalt – wenn ich diese Treppe wäre, würde ich juristischen Rat einholen.« Erst als er lächelte, begriff ich, dass das ein Witz sein sollte.
Ich folgte ihm in den Salon, einen großen Raum mit einem gewaltigen steinernen Kamin, der zu nah an der Tür angebracht war. Da kein Feuer brannte, war es hier noch kälter, als es draußen in der Halle gewesen war. Der Raum war viel länger als breit, und die zahlreichen Sessel waren in einer schludrigen Reihe an der einen und einer gleichermaßen disziplinlosen Gruppe an der anderen Schmalseite positioniert. Die Anordnung der Möbel unterstrich die rechteckige Form des Zimmers und sorgte für einen recht zwiespältigen Gesamteindruck. Am jenseitigen Ende gab es Fenstertüren. Die Vorhänge waren noch nicht für die Nacht zugezogen worden, obwohl es draußen dunkel war – und, wie ich feststellte, für die Tageszeit dunkler, als es in London gewesen wäre.
Poirot ging die Tür des Salons schließen. Endlich konnte ich mir meinen alten Freund genauer ansehen. Er kam mir rundlicher vor als bei unserer letzten Begegnung, und sein Schnauzbart wirkte größer und auffälliger, jedenfalls auf diese Entfernung. Als er aber auf mich zukam, entschied ich, dass er ganz genau wie immer aussah und dass ich ihn lediglich in meiner Vorstellung auf eine verkraftbarere Größe zurückgestutzt hatte.
»Welch ein großes Vergnügen, Sie zu sehen, mon ami! Ich traute meinen Ohren nicht, als ich hier eintraf und Lady Playford mir eröffnete, dass Sie zu den Gästen dieser Woche gehörten.«
Seine Freude war offenkundig, und ich verspürte ein gewisses Schuldgefühl, da meine diesbezüglichen Empfindungen weniger eindeutig waren. Doch seine gute Laune munterte mich auf, und ich stellte mit Erleichterung fest, dass er nicht im Mindesten von mir enttäuscht zu sein schien. In Poirots Gegenwart bekommt man allzu leicht ein Gefühl eigenen Ungenügens.
»Sie wussten also, ehe Sie heute hier eintrafen, nicht, dass ich kommen würde?«
»Non. Ich muss Sie gleich fragen, Catchpool: Warum sind Sie hier?«
»Aus dem gleichen Grund wie Sie, möchte ich annehmen. Athelinda Playford hat mich brieflich eingeladen. Es kommt nicht alle Tage vor, dass man dazu eingeladen wird, eine Woche im Haus einer berühmten Schriftstellerin zu verbringen! Als Kind habe ich ein paar ihrer Bücher gelesen, und …«
»Nein, nein. Sie haben mich missverstanden. Ich entschied mich aus dem gleichen Grund zu kommen – wenngleich ich kein einziges ihrer Bücher gelesen habe. Bitte verraten Sie es ihr nicht. Was ich mit meiner Frage meinte, war: Warum will Lady Playford uns hier haben, Sie und mich? Ich hatte zunächst vermutet, dass sie vielleicht deswegen Hercule Poirot einlud, weil er, wie sie, der Berühmteste und Gefeiertste auf seinem Gebiet ist. Jetzt weiß ich, dass das nicht zutreffen kann, da Sie ebenfalls hier sind. Hm … Lady Playford muss über diese Geschichte in London gelesen haben, im Bloxham Hotel.«
Da ich keinen Wunsch verspürte, die fragliche Geschichte aufzuwärmen, sagte ich: »Bevor ich Sie hier antraf, hatte ich mir vorgestellt, sie hätte mich eingeladen, um mich über die polizeiliche Arbeit zu befragen, damit die entsprechenden Details in ihren Büchern stimmen. Es würde ihnen mit Sicherheit nicht schaden, etwas realisti…«
»Oui, oui, bien sûr. Sagen Sie, Catchpool, haben Sie den Einladungsbrief bei sich?«
»Hm?«
»Den Lady Playford Ihnen schickte.«
»Ach so, ja. Den habe ich hier.« Ich fischte ihn aus meiner Brusttasche und reichte ihn ihm.
Er überflog ihn und gab ihn mir dann mit den Worten zurück: »Er ist identisch mit dem, der mir geschickt wurde. Er verrät nichts. Vielleicht haben Sie ja recht. Möglich, dass Sie unseren fachlichen Rat einholen will.«
»Aber … Sie haben sie schon gesprochen, sagten Sie. Haben Sie sie denn nicht gefragt?«
»Mon ami, wie rüpelhaft muss ein Gast sein, der seiner Gastgeberin gleich bei Betreten des Hauses die Frage an den Kopf wirft: ›Was wollen Sie von mir?‹ Das wäre ungezogen.«
»Und von sich aus hat sie keinerlei Informationen geliefert? Andeutungen?«
»Dazu wäre kaum Zeit gewesen. Schon wenige Minuten nach meiner Ankunft musste sie sich in ihr Arbeitszimmer zurückziehen, um sich für eine Besprechung mit ihrem Anwalt vorzubereiten.«
»Dem von vorhin auf der Treppe? Dem, äh, ziemlich ausgedehnten Gentleman?«
»Mr Orville Rolfe? Nein, nein. Er ist zwar auch Anwalt, aber der, mit dem Lady Playford um vier ein Treffen hatte, war ein anderer Mann. Ihn habe ich ebenfalls gesehen. Sein Name ist Michael Gathercole. Einer der längsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Es schien ihm äußerst unangenehm zu sein, sich durch die Gegend tragen zu müssen.«
»Was meinen Sie damit?«
»Nur, dass er den Eindruck erweckte, als wünschte er, er könnte seine Haut abstreifen.«
»Ah. Ich verstehe.« Ich verstand keineswegs, aber ich befürchtete, eine Bitte um nähere Erklärung hätte nur den gegenteiligen Effekt gezeitigt.
Poirot schüttelte den Kopf. »Kommen Sie, legen Sie Ihren Mantel ab und setzen Sie sich«, sagte er. »Es ist ein Rätsel. Besonders, wenn man bedenkt, wer sonst noch alles hier ist.«
»Ich frage mich, ob man nicht jemand bitten könnte, Tee zu bringen«, sagte ich und sah mich um. »Mittlerweile hätte der Butler doch längst ein Hausmädchen hergeschickt haben müssen, wenn Lady Playford beschäftigt ist.«
»Ich habe darauf bestanden, dass wir nicht unterbrochen werden. Ich habe gleich nach meiner Ankunft eine Erfrischung zu mir genommen, und wie ich erfuhr, werden in diesem Zimmer bald Drinks serviert werden. Uns bleibt nicht viel Zeit, Catchpool.«
»Zeit? Wofür?«
»Wenn Sie sich setzten, würden Sie schon erfahren, wofür.« Poirot deutete ein kleines Lächeln an. Er hatte noch nie vernünftiger geklungen.
Nicht ohne eine gewisse Beklommenheit nahm ich Platz.
3Ein spezielles Interesse am Tod
»Ich muss Ihnen erzählen, wer sonst noch hier ist«, sagte Poirot. »Sie und ich sind nicht die einzigen Gäste, mon ami. Lady Playford eingeschlossen, sind wir zu elft in Lillieoak. Rechnet man die Bediensteten dazu, sind es drei mehr: Hatton, der Butler, ein Hausmädchen namens Phyllis und die Köchin, Brigid. Die Frage lautet: Sollten wir die Dienstboten dazurechnen?«
»Als was dazurechnen? Oder wozu? Wovon reden Sie, Poirot? Sind Sie hier, um eine Studie über die Bevölkerungsdichte des County Cork durchzuführen – wie viele Einwohner pro Haus, so was in der Richtung?«
»Ihr Sinn für Humor hat mir gefehlt, Catchpool, aber wir müssen ernst bleiben. Wie ich schon sagte, haben wir nicht viel Zeit. In Kürze – binnen einer halben Stunde – wird uns jemand stören, um die Drinks zu richten. Jetzt hören Sie zu. In Lillieoak halten sich, abgesehen von uns und den Bediensteten, unsere Gastgeberin, Lady Playford, und die zwei Rechtsanwälte auf, von denen wir bereits sprachen – Gathercole und Rolfe. Weiterhin sind hier Lady Playfords Sekretär, Joseph Scotcher, eine Krankenpflegerin namens Sophie Bourlet …«
»Eine Krankenpflegerin? Ist Lady Playford also bei schlechter Gesundheit?«
»Nein. Lassen Sie mich ausreden. Ebenfalls hier sind Lady Playfords zwei Kinder, die Ehefrau des einen und der junge Gentleman, mit dem die andere befreundet ist. Tatsächlich glaube ich, dass Mr Randall Kimpton und Miss Claudia Playford miteinander verlobt sind. Sie wohnt in Lillieoak. Er ist aus England zu Besuch gekommen. Ein gebürtiger Amerikaner, aber auch ein ›Oxforder‹, wie Lady Playford, glaube ich, sagte.«
»Und das alles haben Sie von ihr erfahren?«
»Sobald Sie ihre Bekanntschaft gemacht haben, werden Sie feststellen, dass sie die Fähigkeit besitzt, in einem kurzen Zeitraum viel mitzuteilen, und alles mit großer Anschaulichkeit und Geschwindigkeit.«
»Ich verstehe. Das klingt besorgniserregend. Immerhin ist es tröstlich zu wissen, dass wenigstens ein Bewohner dieses Hauses der Sprache mächtig ist – wenn man an den Butler denkt, meine ich. Sind Sie jetzt mit Ihrer Personen-Inventur fertig?«
»Ja, aber ich habe die letzten zwei noch nicht benannt. Mademoiselle Claudias Bruder, Lady Playfords Sohn, heißt Harry, sechster Viscount Playford of Clonakilty. Ihm bin ich ebenfalls bereits begegnet. Er wohnt hier mit seiner Gattin Dorothy, die von jedermann Dorro genannt wird.«
»Schön. Und warum ist es so wichtig, dass wir diese Leute auflisten, bevor wir uns alle zu einem Umtrunk versammeln? Offen gesagt, würde ich gern auf mein Zimmer gehen und mir das Gesicht waschen, bevor der gesellige Teil des Abends beginnt, also …«
»Ihr Gesicht ist sauber genug«, erklärte Poirot kategorisch. »Drehen Sie sich um und sehen Sie, was über der Tür hängt.«
Ich gehorchte und erblickte wütende Augen, eine große schwarze Nase und ein offenes Maul, das von spitzen Zähnen starrte. »Grundgütiger, was zum Teufel ist das?«
»Der ausgestopfte Kopf eines Leoparden, das Werk Harrys, Viscount Playfords. Er ist ein Adept der Taxidermie.« Poirot runzelte die Stirn und fügte hinzu: »Und zwar ein leidenschaftlicher, der wildfremde Leute davon zu überzeugen versucht, kein anderes Hobby vermöge es, einem eine solche Befriedigung zu verschaffen.«
»Dann dürfte der Hirschkopf in der Halle ebenfalls von ihm sein«, schloss ich.
»Ich erklärte ihm, dass ich weder das Handwerkszeug noch das Wissen besäße, die das Ausstopfen von Tieren erfordert. Er sagte, ich würde dazu lediglich etwas Draht, ein Federmesser, Nadel und Faden, Hanf und Arsen benötigen. Ich erachtete es für klug, ihm nicht zu verraten, dass es für mich darüber hinaus erforderlich wäre, nicht schon die bloße Vorstellung dégoûtante zu finden.«
Ich lächelte. »Ein Steckenpferd, das Arsen mit sich bringt, dürfte einem Detektiv, der schon etliche mit diesem Gift durchgeführte Morde aufgeklärt hat, auch kaum sonderlich zusagen.«
»Ebendarüber möchte ich mit Ihnen sprechen, mon ami. Über den Tod. Viscount Harry hat ein Hobby, das sich um den Tod dreht. Tiere, nicht Menschen – aber immerhin tot.«
»Zweifellos. Ich verstehe allerdings nicht, wieso das von Belang sein sollte.«
»Sie erinnern sich an den Namen Joseph Scotcher – ich erwähnte ihn gerade.«
»Lady Playfords Sekretär, ja?«
»Er liegt im Sterben. Bright’sche Nierenkrankheit. Deswegen wohnt die Krankenpflegerin, Sophie Bourlet, hier – um den Invaliden zu pflegen.«
»Ich verstehe. Dann wohnen also der Sekretär und die Krankenpflegerin beide in Lillieoak?«
Poirot nickte. »Damit hätten wir drei Personen, die auf die eine oder andere Weise aufs engste mit dem Tod befasst sind. Und dann sind Sie hier, Catchpool. Und ich. Wir beide kommen im Rahmen unserer Arbeit häufig mit gewaltsamen Todesfällen in Berührung. Mr Randall Kimpton, der Claudia Playford zu ehelichen beabsichtigt – welchen Beruf übt er Ihrer Meinung nach aus?«
»Hat auch er mit dem Tod zu tun? Ist er vielleicht Leichenbestatter? Grabsteinmetz?«
»Er arbeitet als Pathologe für die Polizei von Oxfordshire. Auch seine Arbeit hängt also aufs engste mit dem Tod zusammen. Eh bien, möchten Sie mich nach Mr Gathercole und Mr Rolfe fragen?«
»Nicht nötig. Anwälte haben tagtäglich mit der Regelung des Nachlasses von Verstorbenen zu tun.«
»Und ganz besonders trifft dies auf die Firma von Gathercole und Rolfe zu, die für ihre Spezialisierung weithin bekannt ist: die Nachlässe und letztwilligen Verfügungen der Begüterten. Catchpool, jetzt begreifen Sie doch wohl?«
»Und was ist mit Claudia Playford und Dorro, der Frau des Viscount? Worin besteht deren Beziehung zum Tod? Schlachtet die eine vielleicht Nutzvieh, während die andere Leichen einbalsamiert?«
»Sie machen darüber Scherze«, sagte Poirot ernst. »Sie halten es nicht für bemerkenswert, dass so viele Menschen mit einem speziellen – sei es beruflichen, sei es persönlichen – Interesse am Tod gleichzeitig hier in Lillieoak versammelt sind? Ich jedenfalls wüsste gern, was Lady Playford im Schilde führt. Ich kann nicht glauben, dass das alles ein Zufall ist.«
»Na ja, sie könnte sich irgendein Gesellschaftsspiel für nach dem Essen ausgedacht haben. Als Kriminalschriftstellerin hat sie wahrscheinlich den Ehrgeiz, uns in Atem zu halten. Aber Sie haben meine Frage nach Dorro und Claudia noch nicht beantwortet.«
»Mir fällt nichts für unser Thema Relevantes ein, was auf die beiden zuträfe«, räumte Poirot nach kurzem Schweigen ein.
»Dann nenne ich das Zufall! So, wenn ich mir vor dem Dinner noch Gesicht und Hände waschen will …«
»Warum meiden Sie mich, mon ami?«
Ich blieb eine Handbreit vor der Tür stehen. Es war idiotisch von mir gewesen anzunehmen, nur weil er das Thema nicht sofort angesprochen hatte, würde er es überhaupt nicht mehr anschneiden.
»Ich hatte gedacht, Sie und ich wären les bons amis.«
»Das sind wir auch. Ich hatte nur entsetzlich viel um die Ohren, Poirot.«
»Ah, um die Ohren! Und ich soll Ihnen glauben, dass weiter nichts dahintersteckt.«
Ich wandte mich halb zur Tür. »Ich mache mich jetzt auf die Suche nach diesem stummen Diener und drohe ihm mit Meuterei und Landfriedensbruch, wenn er mich nicht augenblicklich zu meinem Zimmer führt«, knurrte ich.
»Diese Engländer! Wie heftig auch die Emotion, wie wild die Wut auch sei, noch stärker ist der Wunsch, sie unter den Teppich zu kehren, so zu tun, als wären sie gar nicht da!«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und eine Frau von – schätzungsweise – dreißig bis fünfunddreißig, die ein paillettenbesetztes grünes Kleid und eine weiße Stola trug, trat ins Zimmer. Tatsächlich trat sie nicht so sehr, sie glitt herein, was mich sofort an eine sich anschleichende Katze denken ließ. Sie hatte eine hochnäsige Art an sich, als ob es unter ihrer Würde wäre, ein Zimmer auf die allgemein übliche Weise zu betreten. Sie schien durch jede Bewegung ihres Körpers gezielt zum Ausdruck bringen zu wollen, dass sie weit über jedem stand, der sich zufällig gerade in der Nähe befand – in diesem Fall Poirot und mir.
Sie war außerdem fast übernatürlich schön: kunstvoll arrangiertes Haar von einem satten Braun, das Gesicht ein vollkommenes Oval, boshafte braune Katzenaugen mit dichten Wimpern, anmutig geschwungene Brauen und Wangenknochen, so scharf wie zwei Klingen. Sie bot einen überwältigenden Anblick, und sie war sich ganz offensichtlich ihrer Reize bewusst. Außerdem strahlte sie eine Bösartigkeit aus, die sich sofort bemerkbar machte, noch ehe sie auch nur ein Wort gesprochen hatte.
»Oh«, sagte sie, eine Hand auf der Hüfte. »Ich verstehe. Gäste, aber nichts zu trinken. Wär’s doch nur umgekehrt! Ich habe mich wohl verfrüht.«
Poirot stand auf und stellte erst sich, dann mich vor. Ich schüttelte die elegante, eiskalte Hand der Frau.
Sie antwortete darauf weder mit einem »Angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen« noch sonst etwas in der Art. »Ich bin Claudia Playford«, stellte sie fest. »Tochter der berühmten Schriftstellerin, Schwester des Viscount Playford. Ältere Schwester, wie es der Zufall will. Der Titel fiel meinem jüngeren Bruder statt mir zu, schlicht weil er ein Mann ist. Wo bleibt da die Logik? Ich gäbe einen weit besseren Viscount ab als mein Bruder. Was sage ich – ein gebuttertes Rosinenbrötchen gäbe einen besseren Viscount als Harry ab. Nun? Finden Sie das etwa fair?«
»Ich habe noch nie darüber nachgedacht«, erwiderte ich wahrheitsgemäß.
Sie wandte sich an Poirot. »Was ist mit Ihnen?«
»Wenn Sie jetzt, in diesem Augenblick, den Titel verliehen bekämen, würden Sie dann sagen: ›Jetzt, wo ich habe, was ich wollte, bin ich vollkommen glücklich und zufrieden‹?«
Claudia hob hochmütig das Kinn. »Ich würde nichts dergleichen sagen, um nicht wie ein albernes Kind aus einem Märchen zu klingen. Abgesehen davon, wer sagt, ich sei unglücklich? Ich bin sehr glücklich, und ich habe auch nicht von Zufriedenheit gesprochen, sondern davon, was fair ist. Erzählt man sich nicht, Sie hätten einen brillanten Verstand, Monsieur Poirot? Aber vielleicht haben Sie ihn ja in London gelassen.«
»Nein, Mademoiselle, er ist mit mir gereist. Und wenn Sie einer der wenigen Menschen auf der Welt sind, die aufrichtig ›ich bin sehr glücklich‹ sagen können, dann kann ich Ihnen versichern: Das Leben hat Sie fairer behandelt als die meisten.«
Sie zog die Brauen zusammen. »Ich sprach von mir und meinem Bruder und niemandem sonst. Wenn Sie Sinn für Fairplay hätten, würden Sie Ihre Beurteilung der Situation auf uns beide beschränken. Stattdessen bringen Sie klammheimlich eine namenlose Menge von Tausenden ins Spiel, um Ihre Argumentation zu stützen – weil Sie wissen, dass Sie nur durch Sophisterei gewinnen können!«
Erneut ging die Tür auf, und ein dunkelhaariger Mann in Abendkleidung trat ein. Claudia presste die Hände ineinander und seufzte verzückt, als hätte sie die ganze Zeit befürchtet, er würde nicht kommen, aber da war er, um sie vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren. »Liebling!«
Der Kontrast zwischen ihrem jetzigen Gebaren und ihrer Rüdheit mir und Poirot gegenüber hätte größer nicht sein können.
Der Neuankömmling war gut aussehend und gepflegt, mit einem natürlichen, einnehmenden Lächeln und fast schwarzem Haar, das ihm auf einer Seite in die Stirn fiel. »Da bist du ja, Liebste!«, sagte er, als Claudia in seine Arme eilte. »Ich habe dich überall gesucht.« Er hatte die makellosesten Zähne, die ich je gesehen hatte. Es fiel schwer zu glauben, dass sie ihm auf natürlichem Wege gewachsen sein sollten. »Und hier haben wir, wie es aussieht, ein paar unserer Gäste – wie wunderbar! Willkommen, alle miteinander.«
»Es steht dir nicht zu, wen auch immer willkommen zu heißen, Liebling«, erklärte ihm Claudia mit gespielter Strenge. »Vergiss nicht, du bist selbst hier zu Gast.«
»Dann sagen wir, ich habe es in deinem Namen getan.«
»Unmöglich. Ich hätte etwas ganz anderes gesagt.«
»Das haben Sie bereits sehr eloquent getan, Mademoiselle«, erinnerte sie Poirot.
»Bist du göttlich biestig zu ihnen gewesen, Liebste? Schenken Sie ihr keine Beachtung, Gentlemen.« Er streckte die Hand aus. »Kimpton. Dr. Randall Kimpton. Freut mich, Sie kennenzulernen.« Er hatte eine bemerkenswerte Eigenart beim Sprechen – so bemerkenswert, dass sie mir sofort auffiel, und Poirot mit Sicherheit auch. Kimptons Augen schienen parallel zur Bewegung seiner Lippen aufzuleuchten und abzublenden. Diese großäugigen Leuchtfeuer lagen jeweils nur Sekunden auseinander und schienen eine besonders begeisterte Emphase zum Ausdruck bringen zu wollen. Dadurch setzte sich in einem das Gefühl fest, jedes dritte oder vierte Wort, das er aussprach, bereite ihm ein erlesenes Vergnügen.
Ich hätte schwören können, dass Poirot mir gesagt hatte, Claudias Bursche sei Amerikaner. Er hatte nicht die Spur eines Akzents – jedenfalls nicht, soweit ich hören konnte. Gerade als ich das dachte, sagte Poirot: »Es ist ein großes Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen, Dr. Kimpton. Aber … sagte mir Lady Playford nicht, Sie seien aus Boston, in Amerika?«
»Das bin ich in der Tat. Ich vermute, Sie wollen damit sagen, dass ich nicht wie ein Amerikaner klinge. Nun, das will ich hoffen! In demselben Augenblick, in dem ich die Universität Oxford betrat, ergriff ich die Gelegenheit, mich sämtlicher unersprießlicher kultureller Bindungen an mein Geburtsland zu entledigen. Sie verstehen, in Oxford ginge es nicht an, irgendwie anders als englisch zu klingen.«
»Randall hat ein Talent dafür, sich unerwünschter Bindungen zu entledigen, ist es nicht so, Liebling?«, sagte Claudia ziemlich spitz.
»Was? Oh!« Kimpton machte ein betretenes Gesicht. Sein Verhalten hatte sich von Grund auf geändert. Desgleichen übrigens auch das ihre. Sie starrte ihn so an wie eine Lehrerin, die von einem unartigen Schüler eine Stellungnahme erwartet. Endlich sagte er leise: »Liebste, brich mir nicht das Herz, indem du mich an meinen tadelnswertesten Fehler erinnerst. Gentlemen, ein Mal war ich, vorübergehend, dumm genug – nachdem ich die größten Anstrengungen unternommen hatte, um diese außergewöhnliche Frau dazu zu bewegen, mir ihr Jawort zu geben –, war ich also dumm genug, an meinen eigenen Neigungen zu zweifeln und …«
»Niemand ist an deinen Selbstbeschuldigungen und Selbstvorwürfen interessiert, Randall«, fiel ihm Claudia ins Wort. »Ausgenommen ich – ich werde nie müde, sie mir anzuhören. Und ich warne dich, ich werde davon eine ganze Menge mehr, und zwar vor Zeugen, hören müssen, ehe ich mich dazu bereit erkläre, einen Hochzeitstermin festzusetzen.«
»Liebste, ich werde nichts anderes mehr tun, als mich selbst mit Tadel, Vorwürfen und Verwünschungen zu überschütten – bis an mein Lebensende!«, sagte Kimpton ernsthaft, mit flammend aufgerissenen Augen. Die beiden schienen völlig vergessen zu haben, dass Poirot und ich auch noch da waren.
»Gut. In dem Fall sehe ich keine unmittelbare Veranlassung, mich deiner zu entledigen.« Plötzlich lächelte Claudia, als hätte sie ihn die ganze Zeit nur aufgezogen.
Prompt schien sich Kimpton erneut vor Selbstsicherheit zu blähen. Er nahm ihre Hand und küsste sie. »Ein Hochzeitstermin wird festgesetzt werden, meine Liebste – und zwar bald!«
»Ach wirklich?« Claudia lachte vergnügt. »Wir werden ja sehen. Jedenfalls bewundere ich deine Entschlossenheit. Es gibt keinen anderen Mann auf dieser Welt, der imstande wäre, mich zweimal zu gewinnen. Oder wahrscheinlich auch nur ein Mal.«
»Kein anderer Mann wäre so besessen oder treu ergeben wie ich, meine göttliche Liebste.«
»Das nehme ich dir ohne weiteres ab«, sagte Claudia. »Ich hätte nicht geglaubt, dass ich je dazu gebracht werden könnte, mir diesen Ring noch einmal anzustecken, und doch, siehe da, ich trage ihn wieder.« Sie hielt kurz inne, um den großen Brillanten am Ringfinger ihrer linken Hand prüfend zu betrachten.
Dann meinte ich, sie seufzen zu hören, aber das Geräusch wurde von dem der Tür übertönt, die sich ein drittes Mal öffnete. Ein junges Hausmädchen stand auf der Schwelle. Ihr helles Haar war zu einem Dutt gebunden, den sie, während sie sprach, nervös betastete. »Ich soll das Zimmer für die Drinks richten«, murmelte sie.
Claudia Playford neigte sich zu Poirot und mir herüber und flüsterte laut und deutlich: »Vergessen Sie nicht zu schnüffeln, bevor Sie trinken. Phyllis ist verschusselter, als die Polizei erlaubt. Es ist mir schleierhaft, warum wir sie noch immer beschäftigen. Sie könnte Portwein nicht von Badewasser unterscheiden.«
4Ein unerwarteter Bewunderer
Es ist ein Phänomen, das ich sowohl im Berufs- als auch im gesellschaftlichen Leben immer wieder zu beobachten Gelegenheit gehabt habe: Wenn man einer größeren Anzahl von Menschen zum ersten Mal begegnet, erkennt man irgendwie – gleichsam durch übersinnliche Intuition – auf Anhieb, mit welchen von ihnen man sich gern unterhalten und um welche man eher einen Bogen machen wird.
Und so wusste ich, als ich mich zum Dinner umgezogen hatte und in den Salon zurückkehrte, der sich jetzt zunehmend mit mir unbekannten Leuten füllte, auf den ersten Blick, dass ich unbedingt versuchen musste, mich neben den Anwalt zu stellen, den Poirot mir beschrieben hatte, Michael Gathercole. Er war noch größer als ein durchschnittlicher hochgewachsener Mann und hielt sich leicht gebeugt, wie um seine Größe zu verringern.
Poirot hatte völlig recht: Gathercole sah wirklich so aus, als ob sein Körper ihm Unbehagen bereitete. Seine Arme schlenkerten rastlos an seinen Seiten, und bei jeder, selbst der geringsten Bewegung erweckte er den Eindruck, als versuchte er, ziemlich ungeschickt und ungeduldig, etwas abzuschütteln – etwas Unliebsames, das an ihm hängen geblieben war, aber niemand außer ihm wahrnehmen konnte.
Er war nicht im landläufigen Sinne des Wortes gut aussehend. Sein Gesicht ließ mich an einen treuen Hund denken, der von seinem Herrchen zu oft getreten worden war und nicht daran zweifelte, dass es wieder passieren würde. Trotzdem war er seinem Aussehen nach der bei weitem Intelligenteste unter meinen neuen Bekannten.
Die übrigen Neuankömmlinge im Salon entsprachen gleichfalls, mehr oder weniger, Poirots Charakterisierung. Lady Playford war, als sie hereinkam, gerade dabei, niemand Bestimmtem eine komplizierte Anekdote zu erzählen. Sie war genau die imposante Erscheinung, die ich erwartet hatte, mit einer lauten, melodischen Stimme und silbergrauem Haar, das zu einer Art schiefem Turm gewunden war. Nach ihr kam der erdballgroße Anwalt, Orville Rolfe; ihm folgte Viscount Harry Playford, ein blonder junger Mann mit einem flachen, quadratischen Gesicht und einem liebenswürdigen, wenn auch leicht abwesenden Lächeln – als hätte er sich einst über irgendetwas königlich amüsiert und versuche seitdem, sich der Ursache seiner Heiterkeit zu entsinnen. Seine Frau Dorro war eine hochgewachsene Frau mit Gesichtszügen, die an einen Raubvogel denken ließen, und einem langen Hals mit einer tiefen Höhlung an der Basis. Man hätte eine Teetasse in dieser Vertiefung abstellen können, und sie hätte dort absolut zureichenden Halt gefunden.
Die letzten zwei, die zum Umtrunk erschienen, waren Joseph Scotcher, Lady Playfords Sekretär, und eine dunkelhaarige, dunkeläugige Frau. Ich nahm an, sie sei die Krankenpflegerin, Sophie Bourlet, denn sie hatte Scotcher in einem Rollstuhl ins Zimmer geschoben. Sie hatte ein gütiges Lächeln, das zugleich effizient wirkte – als hätte sie entschieden, dass exakt ein solches Lächeln der Situation angemessen sein würde –, und eine bescheidene Art. Von allen Anwesenden war sie diejenige, an die man sich, mit einem praktischen Problem konfrontiert, wohl gewandt hätte. Sie trug, wie ich bemerkte, ein Bündel Papiere unter dem Arm, und sobald sie die Gelegenheit dazu fand, legte sie es auf einem kleinen Schreibtisch ab, der vor einem der Fenster stand. Dann begab sie sich zu Lady Playford und sagte etwas zu ihr. Lady Playford warf einen Blick auf die Papiere und nickte.
Ich fragte mich, ob Sophie aufgrund von Scotchers nachlassenden Kräften möglicherweise einen Teil seiner Pflichten in Lillieoak übernommen hatte. Gekleidet war sie jedenfalls eher wie eine Sekretärin als wie eine Krankenpflegerin. Alle übrigen Frauen trugen Abendkleider, aber Sophie sah so aus, als hätte sie sich zu einer wichtigen geschäftlichen Besprechung fein gemacht.
Von seiner physischen Erscheinung her war Scotcher ebenso hell, wie seine Pflegerin dunkel war. Sein Haar besaß die Farbe von gesponnenem Gold, und seine Haut war blass. Er hatte zarte, fast mädchenhafte Züge und sah besorgniserregend dünn aus: ein sich verflüchtigender Engel. Ich fragte mich, ob er kräftiger gewesen war, bevor sein Gesundheitszustand sich zu verschlechtern begann.
Es gelang mir relativ schnell, mich vor Gathercole zu postieren, und es folgten die üblichen Vorstellungsfloskeln. Er war tatsächlich zutraulicher, als er aus der Ferne gewirkt hatte. Er erzählte mir, er habe Athelinda Playfords Shrimp-Seddon-Bücher im Waisenhaus entdeckt, in dem er den größten Teil seiner Kindheit verbracht hatte, und sei jetzt ihr Anwalt. Er sprach von ihr mit Bewunderung und einer gewissen Ehrfurcht.
»Es ist unverkennbar, dass Sie sie extrem gern haben«, bemerkte ich an einem Punkt, und er entgegnete: »Das gilt für jeden, der ihr Werk kennt. Sie ist, davon bin ich überzeugt, ein Genie!«
Ich dachte an das zutiefst unglaubwürdige Gespann Sergeant Hohlkopf und Inspector Vollidiot und entschied, dass es unklug wäre, die schöpferischen Bemühungen meiner Gastgeberin zu kritisieren, solange sie nur ein paar Fuß von mir entfernt stand.
»Viele der Herrenhäuser, die englischen Familien gehörten, wurden während der noch nicht lange zurückliegenden … dummen Geschichte hier niedergebrannt.«
Ich nickte. Das war nichts, was ein Engländer am Anfang einer Ferienwoche in Clonakilty unbedingt erörtern zu müssen glaubte.
»Keiner kam auch nur in die Nähe von Lillieoak«, sagte Gathercole. »Lady Playfords Bücher sind so beliebt, dass selbst die gesetzlosen Horden es nicht über sich bringen konnten, ihr Heim anzugreifen – oder aber sie wurden von jenen edleren Charakteren zurückgehalten, für die der Name Athelinda Playford etwas bedeutet.«
Das klang für mich nicht sehr wahrscheinlich. Welche gesetzlose Horde würde schließlich wegen Shrimp Seddon und ihren fiktiven Kameraden davon Abstand nehmen, wie geplant zu sengen und zu brandschatzen? War die junge Shrimp wirklich so einflussreich? Konnte ihr fetter Zottelhund Anita ein Lächeln in das Gesicht eines wütenden Rebellen zaubern und ihn dazu bringen, seine Sache zu vergessen? Ich hatte da meine Zweifel.
»Ich sehe, Sie sind nicht überzeugt«, sagte Gathercole. »Sie berücksichtigen nicht, dass die Menschen sich als Kinder in Lady Playfords Bücher verlieben. Sich eine solche Liebe in späteren Jahren wieder auszureden ist schwer, gleichgültig, mit welchen politischen Argumenten.«
Er sprach als Waisenkind, rief ich mir ins Gedächtnis zurück; Shrimp Seddon und ihre Bande waren wahrscheinlich die einzige »Familie«, die er je gehabt hatte.
Ein Waisenkind …
Mir ging auf, dass dies eine weitere Verbindung zwischen einem Gast in Lillieoak und dem Tod darstellte. Michael Gathercoles Eltern waren gestorben. Wusste Poirot davon? Obwohl Gathercole natürlich auch unabhängig davon in einer engen Beziehung zum Tod stand – durch das Spezialgebiet seiner Firma, die Nachlässe der Begüterten. Hinzu kam – ich war wirklich ein Narr! –, dass jeder Mensch auf der Welt wenigstens einen toten Angehörigen hatte. Poirots Idee von einer Zusammenkunft im Zeichen des Todes, entschied ich, war lachhaft.