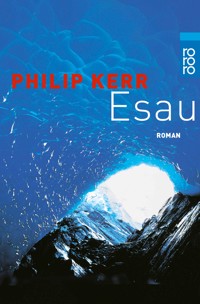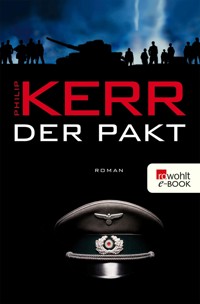
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Europa, 1943: Was wäre gewesen, wenn …? Nach Stalingrad ist eines klar: Deutschland kann den Krieg nicht gewinnen. Die «Großen Drei», Churchill, Stalin und Roosevelt, treffen sich in Teheran, um über die Aufteilung Europas zu beraten. Misstrauen und Argwohn bestimmen die Atmosphäre, die Stadt wird zur Kulisse eines gefährlichen Spiels der Geheimdienste. Dann kündigt sich ein vierter Teilnehmer an. Einer, mit dem niemand gerechnet hätte. Eine atemberaubende Vision eines möglichen Kriegsendes, das den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert hätte … «Kerr ist im Thrillergenre der Spezialist für historische Spekulation.» (Die Zeit) «Ein glänzender, erfindungsreicher Thriller-Autor.» (Salman Rushdie)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Philip Kerr
Der Pakt
Roman
Über dieses Buch
Europa, 1943: Was wäre gewesen, wenn …?
Nach Stalingrad ist eines klar: Deutschland kann den Krieg nicht gewinnen. Die «Großen Drei», Churchill, Stalin und Roosevelt, treffen sich in Teheran, um über die Aufteilung Europas zu beraten. Misstrauen und Argwohn bestimmen die Atmosphäre, die Stadt wird zur Kulisse eines gefährlichen Spiels der Geheimdienste. Dann kündigt sich ein vierter Teilnehmer an. Einer, mit dem niemand gerechnet hätte.
Eine atemberaubende Vision eines möglichen Kriegsendes, das den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert hätte …
«Kerr ist im Thrillergenre der Spezialist für historische Spekulation.» (Die Zeit)
«Ein glänzender, erfindungsreicher Thriller-Autor.» (Salman Rushdie)
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2013
Covergestaltung any.way, Hamburg,
nach einem Entwurf von PEPPERZAK BRAND
Coverabbildung Illustration: PEPPERZAK BRAND
Umschlagfoto: Bernd Ebsen
ISBN 978-3-644-21271-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In Memoriam
A.H.R. Brodie (1931–2004)
Ein empirischer Mensch sein heißt,
sich von der Erfahrung leiten zu lassen,
nicht von Sophisten, Scharlatanen,
Priestern oder Demagogen.
Willard Mayer, Der empirische Mensch
Montag, 1. Oktober 1943
Washington
Alles um mich herum atmete Geschichte, von der französischen Second-Empire-Uhr, die auf dem edlen Kaminsims vor sich hin tickte, bis zu der leuchtend roten Tapete, der der Red Room seinen Namen verdankte. Ich hatte es gleich gespürt, als ich das Weiße Haus betreten hatte und in dieses Vorzimmer geführt worden war, um hier auf die Sekretärin des Präsidenten zu warten. Die Vorstellung, dass Abraham Lincoln womöglich auf ebendiesem Savonnerie-Teppich gestanden hatte, wo ich jetzt stand und zu einem riesigen Kronleuchter emporschaute, oder dass Teddy Roosevelt auf einem dieser rot-golden bezogenen Stühle gesessen haben könnte, ließ mich ebenso wenig los wie der Blick der schönen Frau, deren Porträt über dem weißen Marmorkamin hing. Ich rätselte, warum sie mich so an meine Diana erinnerte, und kam zu dem Schluss, dass es etwas mit dem Lächeln auf ihrem alabasterfarbenen Gesicht zu tun haben musste. Sie schien zu sagen: «Du hättest deine Schuhe putzen sollen, Willard. Oder besser noch, du hättest andere anziehen sollen. Die da sehen aus, als wärst du von Monticello hierher gelaufen.»
Mich auf dem barocken Sofa niederzulassen, wagte ich nicht, aus Angst, mich auf Dolly Madisons Geist zu setzen, also wählte ich einen Esszimmerstuhl neben der Tür. Im Weißen Haus zu sein, war ganz und gar nicht das, was ich an diesem Abend vorgehabt hatte. Ich hatte Diana in Loews Kino in der Third Street, Höhe F Street, ausführen wollen, zu Gary Cooper und Ingrid Bergman in Wem die Stunde schlägt. Krieg oder auch nur ein Film über Krieg schien unendlich fern hier, inmitten der kunstvoll verarbeiteten, polierten Edelhölzer dieses eleganten roten Mausoleums.
Nach einer weiteren Minute öffnete sich eine der schmucken Türen, und herein trat eine große, gepflegte Frau reiferen Alters, die mich ansah, als hätte ich einen der Stühle beschmutzt. Sie forderte mich mit tonloser Stimme auf, ihr zu folgen.
Sie war mehr Schuldirektorin als Frau und trug einen Bleistiftrock, dessen Futter zischelte, als würde er sofort die Hand beißen, die sich seinem Reißverschluss zu nähern wagte.
Vom Red Room gingen wir nach links, über den roten Teppich der Cross Hall, und betraten dann einen Fahrstuhl, wo uns ein schwarzer Diener mit weißen Handschuhen in den ersten Stock hinauffuhr. Dort führte mich die Frau mit dem zischelnden Rock durch die West Sitting Hall und die Center Hall bis zur Tür zum Präsidentenbüro, wo sie anklopfte und dann, ohne auf Antwort zu warten, eintrat.
Wir gelangten in einen ovalen Raum, der auf den Südrasen hinausging. Im Gegensatz zu der Eleganz, aus der ich gerade kam, war das Arbeitszimmer des Präsidenten auffallend informell, und ich fand, dass es mit seinen Türmen von Büchern, den mit Bindfaden verschnürten Stapeln vergilbten Papiers und dem vollen Schreibtisch dem schäbigen, kleinen Dozentenzimmer ähnelte, das ich einst in Princeton gehabt hatte.
«Mr. President, das ist Professor Mayer», sagte sie. Dann ging sie und schloss die Tür hinter sich.
Der Präsident saß, ein Rührglas in der Hand, im Rollstuhl vor einem kleinen Tischchen, auf dem mehrere Spirituosenflaschen standen. Er lauschte der Symphony Hour auf Radio WINX.
«Ich mixe gerade Martinis», sagte er. «Ich hoffe, Sie trinken mit. Die Leute sagen immer, meine Martinis seien zu kalt, aber so mag ich sie nun mal. Ich kann lauwarmen Alkohol nicht ausstehen. Das scheint mir doch dem ganzen Sinn und Zweck des Trinkens zu widersprechen.»
«Ein Martini wäre mir sehr recht, Mr. President.»
«Gut, gut. Kommen Sie rein und setzen Sie sich.» Franklin D. Roosevelt deutete mit dem Kinn auf das Sofa jenseits des Tischchens. Er stellte das Radio ab und goss uns Martinis ein. «Hier.» Er hielt ein Glas hoch und ich ging um den Tisch herum, um es entgegenzunehmen. «Nehmen Sie das Rührglas auch mit, für den Fall, dass wir Nachschub brauchen.»
«Ja, Sir.» Ich nahm das Rührglas und ging wieder zum Sofa.
Roosevelt schwenkte den Rollstuhl vom Bartisch weg und rollte zu mir herüber. Es war ein improvisierter Rollstuhl, keines der Modelle, wie man sie in einem Krankenhaus oder Altersheim findet, sondern eher wie ein Küchenstuhl mit abgesägten Beinen, so als ob es dem Konstrukteur darum gegangen wäre, den wahren Zweck des Möbels vor dem amerikanischen Wahlvolk zu verbergen, weil dieses sich womöglich gesträubt hätte, einen Krüppel zu wählen.
«Sie wirken, wenn ich das sagen darf, recht jung für einen Professor.»
«Ich bin fünfunddreißig. Außerdem war ich nur außerordentlicher Professor, als ich von Princeton wegging. Das ist etwa so, wie wenn man sagt, man sei Vize-Präsident eines Unternehmens.»
«Fünfunddreißig, ja, das ist wohl nicht mehr so jung. Nicht heutzutage. Bei der Armee würden Sie als alter Mann gelten. Dort sind die meisten noch halbe Kinder. Manchmal bricht es mir schier das Herz, wenn ich sehe, wie jung unsere Soldaten sind.» Er erhob das Glas zu einem stummen Toast.
Ich erwiderte die Geste und kostete dann meinen Martini. Für meinen Geschmack war viel zu viel Gin drin. Das Zeug war nur dann nicht zu kalt, wenn man gern Flüssigwasserstoff trank. Aber schließlich mixte einem ja nicht jeden Tag der Präsident der Vereinigten Staaten einen Cocktail, also trank ich das Zeug mit allen gebührenden Zeichen des Genusses.
Beim Trinken registrierte ich die Details an Roosevelt, die nur aus nächster Nähe erkennbar waren: den Kneifer, den ich immer für eine Brille gehalten hatte, die vergleichsweise kleinen Ohren – aber vielleicht war ja auch einfach sein Kopf zu groß geraten –, den fehlenden Zahn im Unterkiefer, die Tatsache, dass die Metallschienen an seinen Beinen schwarz angemalt waren, damit sie auf der Hose möglichst wenig auffielen, die schwarzen Schuhe mit den verräterisch makellosen Ledersohlen, die Fliege, die abgetragene Hausjacke mit den Lederflicken auf den Ellbogen und die Gasmaske, die seitlich am Rollstuhl baumelte. Ich bemerkte einen schwarzen Scotch-Terrier, der vor dem Kamin lag und eher wie ein kleiner flauschiger Teppich aussah. Der Präsident beobachtete, wie ich langsam meinen Flüssigwasserstoff trank, und ein leises Lächeln spielte um seine Lippen.
«Sie sind also Philosoph», sagte er. «Ich kann nicht behaupten, dass ich viel von Philosophie verstünde.»
«Die traditionellen Dispute der Philosophen sind zum größten Teil ebenso unsinnig wie unfruchtbar.» Es klang hochtrabend, aber das bringt dieses Gebiet nun mal mit sich.
«Das klingt, als hätten Philosophen eine Menge mit Politikern gemein.»
«Nur dass Philosophen niemandem verantwortlich sind. Außer der Logik. Wenn Philosophen Wähler für sich gewinnen müssten, wären wir bald alle arbeitslos, Sir. Wir sind vor allem für uns selbst interessant, viel mehr als für andere Menschen.»
«Aber nicht in diesem konkreten Fall», bemerkte der Präsident. «Sonst wären Sie jetzt nicht hier.»
«Es gibt da nicht viel zu erzählen, Sir.»
«Aber Sie sind doch ein berühmter amerikanischer Philosoph?»
«Ein amerikanischer Philosoph, das ist etwa so, als ob man sagt, man spiele für Kanada Baseball.»
«Und Ihre Familie? Ist Ihre Mutter nicht eine geborene von Dorff? Von den Cleveland-von Dorffs?»
«Doch, Sir. Mein Vater, Hans Mayer, ist ein deutscher Jude, der in den Vereinigten Staaten aufwuchs und zur Schule ging und nach dem College dann in den diplomatischen Dienst trat. Er lernte meine Mutter 1905 kennen und heiratete sie im selben Jahr. Ein, zwei Jahre später erbte sie dann ein auf Gummireifen gegründetes Familienvermögen, was erklärt, warum ich so weich durchs Leben geglitten bin. Ich war in Groton. Dann in Harvard, wo ich Philosophie studierte, sehr zur Enttäuschung meines Vaters, der der Überzeugung ist, alle Philosophen seien verrückte deutsche Syphilitiker, die glauben, dass Gott tot ist. Tatsächlich neigt meine ganze Familie zu der Ansicht, dass ich mein Leben vergeudet habe.
Nach dem College blieb ich noch eine Zeit lang in Harvard. Machte meinen Doktor und bekam das Sheldon-Reisestipendium. Also ging ich über Cambridge nach Wien und veröffentlichte ein ziemlich langweiliges Buch. Ich blieb noch eine Weile in Wien und nahm dann eine Dozentenstelle in Berlin an. Über München kehrte ich schließlich nach Harvard zurück und veröffentlichte ein weiteres ziemlich langweiliges Buch.»
«Ich habe Ihr Werk gelesen, Professor. Eines Ihrer Werke jedenfalls. Der empirische Mensch. Ich will nicht so tun, als hätte ich alles verstanden, aber mir scheint doch, Sie haben sehr großes Vertrauen in die Wissenschaft.»
«Ich weiß nicht, ob ich es Vertrauen nennen würde, aber ich bin der Überzeugung, wenn ein Philosoph etwas zur menschlichen Erkenntnis beitragen will, muss er auf wissenschaftlichem Weg zu dieser Erkenntnis gelangen. Mein Buch vertritt den Standpunkt, dass wir nicht so vieles als gegeben annehmen sollten, was lediglich auf Spekulation beruht.»
Roosevelt schwenkte zum Schreibtisch und ergriff ein Buch, das neben einem bronzenen Schiffssteuerrad lag. Es war eines meiner Bücher. «Wenn Sie mittels dieser Methode zu der Behauptung gelangen, Moral sei letztlich nur eine überkommene Idee, habe ich Schwierigkeiten damit.» Er schlug das Buch auf, fand die Sätze, die er unterstrichen hatte, und las vor:
«Ästhetik und Moral sind insofern deckungsgleich, als keinem von beidem eine objektive Gültigkeit zugesprochen werden kann, und die Behauptung, die Wahrheit zu sagen sei nachweislich gut, ist nicht sinnvoller als die Behauptung, ein Gemälde von Rembrandt sei nachweislich ein gutes Gemälde. Keine der beiden Aussagen ist in irgendeiner Weise sachhaltig.»
Roosevelt schüttelte den Kopf. «Ganz abgesehen von den Gefahren, die eine solche Position gerade in einer Zeit birgt, da die Nazis wild entschlossen sind, alle bisherigen Moralbegriffe zu zertrümmern, scheint mir doch, dass Sie da etwas übersehen. Ein ethisches Urteil ist sehr häufig nur die sachhaltige Klassifizierung einer Handlung, die die Menschen nachweislich in einer bestimmten Weise erregt. Mit anderen Worten, Gegenstand moralischer Missbilligung sind für gewöhnlich Handlungen oder Handlungsklassen, die sehr wohl einer empirischen Untersuchung zugänglich sind.»
Ich lächelte den Präsidenten an, weil ich es sympathisch fand, dass er sich die Mühe gemacht hatte, Teile meines Buchs zu lesen und sich mit mir auseinander zu setzen. Ich wollte ihm gerade antworten, als er das Buch hinwarf und sagte:
«Aber ich habe Sie nicht hergebeten, um über Philosophie zu diskutieren.»
«Nein, Sir.»
«Sagen Sie, wie sind Sie zu Donovans Truppe gekommen?»
«Schon bald nach meiner Rückkehr aus Europa bot man mir eine Stelle in Princeton an, wo ich dann Extraordinarius wurde. Nach Pearl Harbor bewarb ich mich für den Dienst bei der Marine-Reserve, aber noch ehe meine Bewerbung bearbeitet werden konnte, traf ich mich mit einem Freund meines Vaters, einem Juristen namens Allan Dulles, zum Mittagessen. Er überredete mich, dem Central Office of Information beizutreten. Als unser Teil des COI zum Office of Strategic Service wurde, kam ich nach Washington. Jetzt bin ich Analyst für deutsche Nachrichtendiensttätigkeit.»
Roosevelt drehte sich im Rollstuhl um, als plötzlich Regen gegen das Fenster prasselte. Das Hemd spannte um die kräftigen Schultern und den breiten Nacken, aber seine Beine waren im Gegensatz dazu so schwach und mager, als hätte sein Schöpfer sie versehentlich an den falschen Körper gesetzt. Die Kombination von Rollstuhl, Kneifer und der fast zwanzig Zentimeter langen Zigarettenspitze, die zwischen seinen Zähnen klemmte, gab ihm etwas von einem Hollywood-Regisseur.
«Ich wusste gar nicht, dass es so heftig regnet», sagte er, nahm die Zigarette aus der Spitze und ersetzte sie durch eine neue aus dem Camel-Päckchen auf dem Schreibtisch. Auch mir bot er eine an. Ich nahm sie dankend, fand das silberne Dunhill-Feuerzeug in meiner Westentasche und gab uns Feuer.
Der Präsident bedankte sich auf Deutsch und setzte dann das Gespräch in dieser Sprache fort. Er sprach von der jüngsten amerikanischen Gefallenenzahl – 115000 Mann – und von den erbitterten Kämpfen, die sich gerade im süditalienischen Salerno abspielten. Sein Deutsch war gar nicht so schlecht. Dann wechselte er abrupt das Thema und schaltete wieder auf Englisch um.
«Ich habe einen Job für Sie, Professor Mayer. Einen heiklen Job. Zu heikel, um ihn dem Außenministerium anzuvertrauen. Das hier muss unter uns bleiben, strikt unter uns. Das Problem mit diesen Kerlen im Außenministerium ist, dass sie ihren verflixten Mund nicht halten können. Ja, schlimmer noch, dass das ganze Ministerium von Rivalitäten zerfressen ist. Ich nehme an, Sie wissen, was ich meine.»
Es war in Washington wohl bekannt, dass Roosevelt seinen Außenminister nie wirklich respektiert hatte. Cordell Hull galt allgemein nicht gerade als begnadeter Außenpolitiker, und mit seinen zweiundsiebzig Jahren ermüdete er leicht. Nach Pearl Harbor hatte sich FDR, was die eigentliche außenpolitische Arbeit anging, lange auf Vize-Außenminister Sumner Welles verlassen. Doch dann, vor einer Woche erst, hatte Welles plötzlich sein Rücktrittsgesuch eingereicht. In besser informierten Regierungs- und Geheimdienstkreisen wurde gemunkelt, Welles sei dazu gezwungen gewesen, nachdem er sich im Präsidentenzug auf der Fahrt nach Virginia eines «Aktes schwerwiegender moralischer Verderbtheit mit einem Negerschaffner» schuldig gemacht habe.
«Ich sage Ihnen ganz offen, dass sich diese verdammten Snobs im Außenministerium auf einiges gefasst machen können. Die eine Hälfte ist pro-britisch und die andere antisemitisch. Wenn man sie alle durch den Wolf drehen würde, käme immer noch nicht genug für einen anständigen Amerikaner heraus.» Roosevelt trank von seinem Martini und seufzte. «Was wissen Sie über einen Ort namens Katyn?»
«Vor ein paar Monaten meldete der Reichssender Berlin die Entdeckung eines Massengrabs im Wald bei Katyn, in der Nähe von Smolensk. Die Deutschen behaupten, es enthalte die sterblichen Überreste von rund fünftausend polnischen Offizieren, die sich 1940, nach dem Nichtangriffspakt zwischen den Deutschen und den Sowjets, der Roten Armee ergeben hätten, nur um dann auf Befehl Stalins ermordet zu werden. Goebbels hat jede Menge politisches Kapital daraus geschlagen. Katyn ist das, was die deutsche Propagandamaschinerie seit dem Sommer in die Welt bläst.»
«Schon aus diesem Grund habe ich anfangs dazu tendiert, das Ganze für reine Nazi-Propaganda zu halten», sagte Roosevelt. «Aber es gibt polnisch-amerikanische Radiosender in Detroit und Buffalo, die eisern daran festhalten, dass sich diese Gräueltaten tatsächlich ereignet haben. Es wurde sogar behauptet, meine Administration habe die Tatsachen vertuscht, um unser Bündnis mit den Russen nicht zu gefährden. Seit die Geschichte im Umlauf ist, habe ich bereits einen Bericht unseres Verbindungsoffiziers bei der polnischen Exilarmee, einen von unserem Marineattaché in Istanbul und einen von Premierminister Churchill persönlich erhalten. Ja, ich habe sogar ein Dossier der deutschen Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Kriegsverbrechen bekommen. Im August schrieb mir Churchill und fragte mich, wie ich darüber dächte, und daraufhin habe ich alle einschlägigen Unterlagen dem Außenministerium übergeben, mit der Anweisung, sie sich anzusehen.»
Roosevelt schüttelte müde den Kopf.
«Sie können sich denken, was passiert ist. Gar nichts! Hull schiebt natürlich alles auf Welles und behauptet, der habe wochenlang auf diesen Akten gesessen.
Tatsache ist, dass ich Welles die Akten gegeben und ihn gebeten habe, jemanden aus der Deutschlandabteilung des Ministeriums einen Bericht verfassen zu lassen. Dann hat Welles seinen Herzinfarkt bekommen, seinen Schreibtisch aufgeräumt und mir seinen Rücktritt angeboten. Was ich abgelehnt habe.
Unterdessen hat Hull dem Mann aus der Deutschland-Abteilung, Thornton Cole, Anweisung gegeben, die Akten Bill Bullitt zu geben und zu schauen, was unser Ex-Moskau-Botschafter damit anzufangen weiß. Bullitt hält sich für einen Russlandexperten.
Ob Bullitt je einen Blick in die Akten geworfen hat, weiß ich nicht. Er hat es schon eine ganze Weile auf Welles’ Stuhl abgesehen, und ich vermute, er war ganz damit ausgelastet, seine Karriere voranzutreiben. Als ich bei Hull wegen der Katyn-Akten nachgefragt habe, haben er und Mr. Bullshit gemerkt, dass sie die Sache versiebt haben, und offenbar beschlossen, die Akten still und heimlich in Welles’ Büro zurückzubringen und alles auf ihn zu schieben. Natürlich hat Hull dafür gesorgt, dass Cole seine Geschichte stützte.» Roosevelt zuckte die Achseln. «Das ist Welles’ Theorie, wie es abgelaufen sein muss, und ich glaube, er hat Recht.»
Genau da fiel mir wieder ein, dass ich Welles einst im Washingtoner Metropolitan Club mit Cole bekannt gemacht hatte.
«Als Hull die Akten zurückbrachte und mir mitteilte, wir seien leider nicht in der Lage, irgendeine Meinung zu der Katyn-Sache zu haben», fuhr Roosevelt fort, «habe ich geflucht wie ein Seemann. Und das Ende der Geschichte ist: Es ist nichts passiert.» Der Präsident zeigte auf einen Stapel verstaubter Akten auf einem Bücherbord. «Wären Sie so nett, sie mir herunterzuholen? Dort oben.»
Ich nahm die Akten herunter, deponierte sie auf dem Sofa neben dem Präsidenten und inspizierte dann meine Hände. Vom Dreck an meinen Fingern her zu schließen, ließ sich der Job nicht besonders gut an.
«Es ist kein großes Geheimnis, dass ich mich noch vor Weihnachten mit Churchill und Stalin treffen werde. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo. Stalin weigert sich, nach London zu kommen, also können wir so gut wie überall anders landen. Doch wo immer dieses Treffen stattfinden wird, ich möchte eine klare Vorstellung von dieser Katyn-Sache haben, weil sie sich mit Sicherheit auf die Zukunft Polens auswirken wird. Die Russen haben bereits die diplomatischen Beziehungen zur polnischen Exilregierung in London abgebrochen. Die Briten fühlen sich den Polen natürlich besonders verbunden. Schließlich sind sie für Polen in den Krieg gezogen. Sie sehen also, es ist eine delikate Situation.»
Der Präsident zündete sich eine weitere Zigarette an und legte dann eine Hand auf den Aktenstapel.
«Und das bringt mich zu Ihnen, Professor Mayer. Ich möchte, dass Sie eine eigene Untersuchung in dieser Katyn-Angelegenheit durchführen. Fangen Sie mit einer objektiven Evaluierung des Inhalts dieser Akten an, aber fühlen Sie sich nicht allein an die Akten gebunden. Reden Sie mit jedem, von dem Sie glauben, dass er Ihnen von Nutzen sein könnte. Bilden Sie sich eine eigene Meinung und schreiben Sie dann einen Bericht ausschließlich für mich. Nicht zu lang. Nur ein Resümee ihrer Ergebnisse und ein paar Strategievorschläge. Mit Donovan habe ich das bereits geregelt, diese Sache hat also Vorrang vor all Ihren sonstigen Aufgaben.»
Er zog sein Taschentuch heraus und wischte sich den Staub von der Hand.
«Wie lange habe ich Zeit, Mr. President?»
«Zwei, drei Wochen. Ich weiß, das ist nicht viel für eine so schwerwiegende Angelegenheit, aber daran lässt sich, wie Sie sicher verstehen werden, nichts ändern. Nicht jetzt.»
«Wenn Sie sagen, ich soll mit jedem reden, der mir von Nutzen sein könnte, schließt das auch Leute in London ein? Mitglieder der polnischen Exilregierung? Leute im auswärtigen Amt? Und wie lästig darf ich werden?»
«Reden Sie, mit wem Sie möchten», sagte Roosevelt. «Falls Sie nach London zu reisen beschließen, wird es hilfreich sein, wenn Sie sich als mein Sonderbeauftragter vorstellen. Das wird Ihnen jede Tür öffnen. Meine Sekretärin, Grace Tully, wird den nötigen Papierkram für Sie erledigen. Aber bemühen Sie sich, keinerlei Meinung zu äußern. Und vermeiden Sie es, irgendetwas zu sagen, was die Leute auf die Idee bringen könnte, Sie sprächen in meinem Namen. Dies ist wie gesagt eine äußerst heikle Angelegenheit, aber was auch passieren mag, ich möchte vermeiden, dass aus dieser Sache irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen mir und Stalin erwachsen. Habe ich mich klar ausgedrückt?»
Klar genug. Ich würde ein kastrierter Köter sein, mit nichts als dem Namen meines Herrchens auf dem Halsband, um den Leuten deutlich zu machen, dass ich das Recht hatte, auf seine Blumen zu pinkeln. Aber ich setzte ein Lächeln auf und legte ein paar Stars und Stripes in meine Worte, als ich sagte: «Ja, Sir, absolut klar.»
Als ich nach Hause kam, erwartete mich Diana mit einem Sack voller aufgeregter Fragen.
«Und?», sagte sie. «Was war?»
«Er macht grässliche Martinis», sagte ich. «Das war.»
«Du hast Martinis mit ihm getrunken?»
«Wir beide ganz allein. Als ob er Nick wäre und ich Nora Charles. Aus Dashiell Hammetts Dünnem Mann.»
«Und? Erzähl doch.»
«Zu viel Gin drin. Und viel zu kalt. Wie eine Landhausparty in England.»
«Ich meine, worüber habt ihr geredet?»
«Unter anderem über Philosophie.»
«Philosophie?» Diana verzog das Gesicht und setzte sich hin. Jetzt schien sie schon nicht mehr ganz so aufgeregt. «Ist magenverträglicher als Schlaftabletten, nehme ich an.»
Diana Vandervelden war reich, extrovertiert, glamourös und von einem derart trockenen Humor, dass sie mich immer an eine der herberen Hollywood-Diven wie Bette Davis oder Katherine Hepburn erinnerte. Von einer geradezu unheimlichen Intelligenz, langweilte sie sich leicht und hatte deshalb einen Studienplatz am Bryn Mawr aufgegeben, um Damengolf zu spielen und 1936 beinahe die amerikanischen Damen-Amateurmeisterschaften zu gewinnen. Im Jahr darauf hatte sie das Turnier-Golfen aufgegeben, um einen Senator zu heiraten. «Mit meinem Mann, das war Liebe auf den ersten Blick», sagte sie gern. «Aber nur, weil ich zu geizig war, mir eine Brille zu kaufen.» Diana war selbst kein sonderlich politischer Mensch. Sie verkehrte lieber mit Schriftstellern und Malern als mit Senatoren, und trotz ihrer unbestreitbaren gesellschaftlichen Talente – sie war eine hervorragende Köchin, und um eine Einladung zu ihren Dinnerpartys riss sich ganz Washington –, war sie die Ehe mit ihrem Juristengatten bald leid. «Ich musste dauernd nur für seine Republikaner-Freunde kochen», beschwerte sie sich später bei mir. «Perlen vor die Säue. Und zwar die ganze verdammte Austernfarm.» Als Diana 1940 ihren Mann verließ, gründete sie eine eigene Innendekorationsfirma. Darüber lernten wir uns kennen. Kurz nachdem ich nach Washington übersiedelt war, schlug mir ein gemeinsamer Bekannter vor, sie mit der Gestaltung meines Hauses in Kalorama Heights zu betrauen. «Das Heim eines Philosophen, hm? Mal überlegen. Wie könnte das aussehen? Wie wär’s mit jeder Menge Spiegel, alle in Nabelhöhe?» Unsere Freunde gingen davon aus, dass wir heiraten würden, aber Diana hielt nichts von der Ehe. Und ich auch nicht.
Unsere Beziehung war von Anfang an hochgradig sexuell, was uns beiden sehr recht war. Wir mochten uns sehr, sprachen aber beide nie groß von Liebe. «Wir lieben uns», hatte ich Diana letzte Weihnachten erklärt, «so wie sich Leute lieben, die sich selbst noch ein ganz kleines bisschen mehr lieben.»
Und ich schätzte an Diana, dass sie Philosophie hasste. Das Letzte, was ich brauchte, war jemand, der die ganze Zeit über mein Fachgebiet reden wollte. Ich mochte Frauen. Vor allem, wenn sie so intelligent und geistreich waren wie Diana. Ich mochte es nur nicht, wenn sie über Logik reden wollten. Philosophie kann im Salon eine höchst anregende Gefährtin sein, aber im Schlafzimmer ist sie schrecklich öde.
«Worüber hat Roosevelt noch geredet?»
«Kriegsangelegenheiten. Ich soll ihm einen Bericht über etwas schreiben.»
«Wie überaus heroisch», sagte sie und zündete sich eine Zigarette an. «Was kriegst du dafür? Einen Orden am Schreibmaschinenband?»
Ich musste grinsen, weil mich ihre demonstrative Verachtung amüsierte. Ihre Brüder waren 1939 freiwillig zur kanadischen Luftwaffe gegangen und, wie sie mir immer wieder erzählte, beide ausgezeichnet worden.
«Man könnte meinen, du hältst Geheimdienstarbeit nicht für wichtig, Liebling.» Ich ging zum Schnapstablett hinüber und goss mir einen Scotch ein. «Auch einen?»
«Nein, danke. Weißt du, ich glaube, ich bin dahinter gekommen, warum das hierzulande intelligence heißt. Weil intelligente Leute wie du es dadurch immer schaffen, aus der Schusslinie zu bleiben.»
«Jemand muss doch ein Auge darauf haben, was die Deutschen im Schilde führen.» Ich nahm einen Schluck von dem Scotch, der nach dem Genuss von Roosevelts Einbalsamierungsflüssigkeit ungemein gut schmeckte und mein Inneres angenehm wärmte. «Aber wenn es dir Lust bereitet, mich als Feigling hinzustellen, dann bitte, nur zu. Ich kann es verkraften.»
«Vielleicht ist es das, was mich am meisten stört.»
«Mich stört es nicht, dass es dich stört.»
«So also funktioniert das. Mit der Philosophie.» Diana beugte sich in ihrem Sessel vor und drückte ihre Zigarette aus. «Worum geht es überhaupt in diesem Bericht? In dem, den du für den Präsidenten der Vereinigten Staaten schreiben sollst?»
«Das kann ich dir nicht sagen.»
«Sei doch nicht gleich so kratzbürstig.»
«Ich bin nicht kratzbürstig. Ich bin diskret. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich kratzbürstig wäre, könntest du mir wahrscheinlich das Fell streicheln, mit meinen Ohren spielen und die Sache aus mir herauskraulen. Diskretion bedeutet, dass ich eher meine Giftkapsel nehmen würde, als das zuzulassen.»
Jetzt bekam ihr Gesicht etwas Verkniffenes. «Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen», sagte sie.
«Danke, meine Liebe. Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde für ein, zwei Wochen nach London gehen müssen.»
Ihr Gesicht entspannte sich ein wenig, sie lächelte.
«London? Hast du’s noch nicht gehört, Willy-Schatz? Die Deutschen bombardieren diese Stadt. Das könnte gefährlich sein.» Ihr Ton war leicht spöttisch.
«Doch, ich habe schon davon gehört», sagte ich. «Deshalb will ich ja hin. Damit ich mir morgens beim Rasieren ins Gesicht sehen kann. Nach fünfzehn Monaten an einem Schreibtisch in der Dreiundzwanzigsten Straße wird mir allmählich klar, dass ich vielleicht doch zur Marine hätte gehen sollen.»
«Du liebe Güte. So viel Heroismus. Ich glaube, ich nehme jetzt doch den Drink.»
Ich goss ihr einen Scotch ein, pur, wie sie ihn am liebsten mochte. So jungfräulich wie ihre Art, auf einem Stuhl zu sitzen, mit keusch zusammengepressten Knien. Als ich ihr den Whisky reichte, nahm sie ihn mir aus den Fingern, fasste dann meine Hand und drückte sie an ihre marmorkühle Wange. «Du weißt doch, dass ich immer Sachen sage, die ich nicht so meine, oder?»
«Natürlich. Das ist doch einer der Gründe, warum ich dich so mag.»
«Manche Leute kämpfen mit Stieren, reiten auf die Jagd oder schießen Vögel. Ich rede nun mal gern. Das ist eines der beiden Dinge, die ich wirklich gut kann.»
«Liebling, du bist Weltmeisterin im Reden.»
Sie kippte ihren Scotch und knabberte an ihrem Daumennagel, als wollte sie mir signalisieren, dass es Teile von mir gab, an denen sie ihre Zähne viel lieber ausprobieren würde. Dann stand sie auf und küsste mich. Ihre Lider flackerten dabei, weil sie immer wieder darunter hervorlinste, ob ich schon bereit war für die Lustpartie, die sie für uns plante.
«Was hältst du davon, dass wir nach oben gehen und ich dir zeige, worin ich noch Weltmeisterin bin?»
Ich küsste sie wieder und legte meine ganze Person in den Kuss, wie ein Schmierenschauspieler, der das Lichtdouble für John Barrymore macht.
«Geh schon mal vor», sagte ich, als wir nach einer Weile auftauchten, um Luft zu holen. «Ich komme gleich. Muss nur erst noch was lesen. Ein paar Papiere, die mir der Präsident gegeben hat.»
Ihr Körper versteifte sich in meinen Armen. Sie schien eine sarkastische Bemerkung machen zu wollen, sich dann aber zu bremsen.
«Bilde dir bloß nicht ein, dass du diese Ausrede mehr als einmal benutzen kannst», sagte sie. «Ich bin durchaus Patriotin. Aber ich bin auch eine Frau.»
Ich nickte und küsste sie abermals. «Das ist die Eigenschaft, die ich an dir am meisten mag.»
Diana schob mich sanft von sich und grinste. «Gut. Aber mach nicht zu lange. Und wenn ich schon schlafe, versuch mal dein Superhirn dafür zu benutzen, eine Methode zu finden, wie du mich wieder wach kriegst.»
«Ich werde mir was einfallen lassen, Prinzessin Aurora.»
Ich beobachtete, wie sie die Treppe hinaufging. Es lohnte sich. Ihre Beine waren ein Kunstwerk. Ich folgte ihnen bis zum Rand der Strümpfe und noch ein ganzes Stück darüber hinaus. Aus rein philosophischen Gründen natürlich. Alle Philosophen, sagte Nietzsche, verstünden sich schlecht auf Weiber. Aber er hatte ja auch nie Diana eine Treppe hochgehen sehen. Ich kannte keinen Weg zur Erkenntnis der letzten Wirklichkeit, der es auch nur annähernd mit dem Studium jenes hauchzarten Phänomens aufnehmen konnte, das Dianas Unterwäsche war.
Um dieses spezielle Wissen möglichst schnell aus meinem Kopf zu verbannen, machte ich mir eine Kanne Kaffee, fand ein unangebrochenes Päckchen Zigaretten auf dem Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer und ließ mich nieder, um die Akten, die mir Roosevelt gegeben hatte, durchzusehen.
Der Bericht der deutschen Wehrmacht-Untersuchungsstelle war der detaillierteste. Doch der britische Bericht, verfasst von Sir Owen O’Malley, Botschafter bei der polnischen Exilregierung, und erstellt mit Hilfe der polnischen Exilarmee, war der, der mich am längsten aufhielt. Er war lebendig geschrieben und schilderte anschaulich, wie Offiziere und Leute vom sowjetischen NKWD viereinhalbtausend Männer ermordeten – per Genickschuss, nachdem sie ihnen zum Teil die Hände gefesselt oder statt eines Knebels Sägemehl in den Mund gestopft hatten –, ehe sie sie in einem Massengrab verscharrten.
Als ich kurz nach Mitternacht mit der Lektüre des Berichts fertig war, musste ich mich O’Malleys Behauptung anschließen, dass ohne den leisesten Zweifel die Sowjets die Schuldigen waren. O’Malleys Warnung an Winston Churchill, dass der Massenmord von Katyn «einen anhaltenden Nachhall auf der moralischen Ebene» haben würde, schien noch untertrieben. Doch nach meinem Gespräch mit Roosevelt konnte ich mir ausrechnen, dass jeder Schluss, zu dem ich durch meine eigenen Untersuchungen käme, hinter dem Umstand zurücktreten musste, dass der Präsident herzlichere Beziehungen zu dem Mörder und Polenhasser Josef Stalin wünschte.
Jeder Bericht, den ich über das Massaker erstellen würde, konnte nicht mehr sein als ein Mittel für Roosevelt, sich abzusichern. Ich hätte den Auftrag vielleicht sogar als langweilige Bürde betrachtet, wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass ich es geschafft hatte, mir in seinem Rahmen eine kleine London-Reise zu organisieren. London war eine tolle Stadt, und nach monatelanger Untätigkeit in einem der vier Backsteingebäude des «Campus» – wie der lokale Spitzname des OSS und seines vorwiegend akademischen Personals lautete – gierte ich nach etwas Aufregenderem. Eine Woche London war wohl genau das, was mit der Arzt verschrieben hätte, zumal jetzt auch noch Diana darauf herumzuhacken begann, dass ich mich immer aus der Schusslinie hielt.
Ich stand auf und ging ans Fenster. Während ich auf die Straße hinaussah, versuchte ich mir all die ermordeten polnischen Offiziere in einem Massengrab bei Smolensk vorzustellen. Ich trank meinen Whisky aus. Im Mondschein hatte der Rasen vor meinem Haus die Farbe von Blut und der unruhige, silberne Himmel etwas Gespenstisches, ganz so als ob der Tod selbst sein riesiges Auge auf mich geworfen hätte. Nicht dass es eine große Rolle spielte, wer einen tötete. Die Deutschen oder die Russen, die Briten oder die Amerikaner, die eigenen Leute oder der Feind. Wenn man tot war, war man tot, und nichts, auch kein Präsidentenauftrag, konnte daran etwas ändern. Aber ich gehörte zu den Glückspilzen, und oben rief mich der Akt des Lebens schlechthin.
Ich knipste das Licht aus und ging zu Diana.
Mittwoch, 3. Oktober 1943
Berlin
Der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop erhob sich, ging um den riesigen Schreibtisch mit der Marmorplatte herum und quer durch den Raum zu den beiden Männern, die auf einer grün-weiß gestreiften Biedermeier-Salongarnitur saßen. Auf dem Tisch vor ihnen lag ein Stapel Fotos, allesamt zeitschriftengroß und allesamt Faksimiles eines Dokuments, das heimlich aus dem Safe des britischen Botschafters in Ankara, Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, entwendet worden war. Ribbentrop setzte sich, ignorierte so gut wie möglich den Regenwasser-Stalaktiten an dem Maria-Theresia-Kronleuchter, von dem es laut in einen Blecheimer tropfte, und studierte mit der Miene müder Verachtung zuerst die Fotos und dann den etwas zwielichtig wirkenden Mann, der sie nach Berlin gebracht hatte.
«Klingt alles zu schön, um wahr zu sein», sagte er.
«Das wäre natürlich möglich, Herr Reichsminister.»
«Leute werden nicht plötzlich ohne triftigen Grund zu Spionen, Herr Moyzisch», sagte Ribbentrop. «Und schon gar nicht die Kammerdiener englischer Gentlemen.»
«Bazna wollte Geld.»
«Und das hat er ja offenbar auch bekommen. Wie viel, sagten Sie, hat ihm Schellenberg gegeben?»
«Zwanzigtausend Pfund bis jetzt.»
Ribbentrop warf die Fotos wieder auf den Tisch, wobei eines zu Boden fiel. Rudolf Linkus, Ribbentrops engster Mitarbeiter im Außenministerium, hob es auf.
«Und wer hat ihm beigebracht, so meisterhaft mit der Kamera umzugehen?», fragte Ribbentrop. «Die Briten? Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, dass es sich hierbei um gezielte Falschinformation handeln könnte?»
Ludwig Moyzisch hielt dem kalten Blick des Außenministers stand. Er wünschte sich nach Ankara zurück und fragte sich, warum nach all den Leuten, die diese von seinem Agenten Bazna (Deckname Cicero) beschafften Dokumente geprüft hatten, Ribbentrop als Einziger deren Echtheit bezweifelte. Selbst Kaltenbrunner, Chef des Sicherheitsdiensts und Schellenbergs Vorgesetzter, war von der Authentizität dieser Informationen überzeugt gewesen. Um eine Lanze für Ciceros Material zu brechen, sagte Moyzisch, Kaltenbrunner persönlich halte die Dokumente inzwischen für höchstwahrscheinlich echt.
«Kaltenbrunner ist doch krank, oder?» Wie wenig Ribbentrop vom Chef des SD hielt, war im Außenministerium wohl bekannt. «Phlebitis, wie ich hörte. Zweifellos ist sein Verstand, soweit er einen solchen besitzt, durch seine Krankheit erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem kennt niemand – und schon gar nicht so ein versoffener, sadistischer Trottel – die Briten besser als ich. In meiner Zeit als deutscher Botschafter am Hof von St. James habe ich etliche recht gut kennen gelernt, und ich sage Ihnen, das ist ein Trick, den sich die englischen Spymasters ausgedacht haben. Gezielte Falschinformation, um unsere Nachrichtendienste von ihrer eigentlichen Arbeit abzuhalten.» Er kniff eines seiner wässrig blauen Augen halb zu, fixierte seinen Untergebenen.
Ludwig Moyzisch nickte – wie er hoffte, gebührend unterwürfig. Als Mann des SD in Ankara war er Brigadeführer Schellenberg unterstellt, aber seine Situation wurde dadurch kompliziert, dass er als deutscher Handelsattaché in der Türkei gleichzeitig Ribbentrop unterstand. Deshalb musste er jetzt Ciceros Arbeit gegenüber dem SDund dem Reichsaußenminister verteidigen. Das hätte jeden nervös gemacht, da Ribbentrop nicht minder rachsüchtig war als Ernst Kaltenbrunner. Ribbentrop mochte zwar schwach und affektiert wirken, aber Moyzisch wusste, es wäre ein Fehler, ihn zu unterschätzen. Die Zeiten diplomatischer Triumphe lagen zwar hinter ihm, aber Ribbentrop war immer noch SS-Standartenführer und ein Freund von Himmler.
«Jawohl, Herr Minister», sagte Moyzisch. «Ihre Zweifel sind sicher begründet, Herr Minister.»
«Dann sind wir ja jetzt wohl fertig.» Ribbentrop erhob sich abrupt.
Moyzisch sprang ebenfalls auf, stieß aber in seiner Hast, der Gegenwart des Reichsministers zu entkommen, den Stuhl um. «Entschuldigen Sie, Herr Reichsminister», sagte er und hob ihn wieder auf.
«Bemühen Sie sich nicht.» Ribbentrop wies mit einer Handbewegung auf die tropfende Zimmerdecke. «Wie Sie sehen, haben wir den letzten Besuch der britischen Luftwaffe noch nicht verwunden. Das oberste Stockwerk des Ministeriums fehlt, wie auch etliche Fensterscheiben auf dieser Etage. Und natürlich gibt es auch keine Heizung, aber wir bleiben dennoch lieber in Berlin, als uns in Rastenburg oder Berchtesgaden zu verkriechen.»
Ribbentrop begleitete Linkus und Moyzisch zur Tür seines Büros. Zu Moyzischs Erstaunen wirkte der Reichminister jetzt ganz höflich, fast als wollte er etwas von ihm. Ja, er hatte jetzt sogar ein leises Lächeln aufgesetzt.
«Darf ich fragen, was Sie Brigadeführer Schellenberg über diese Unterredung berichten werden?» Eine Hand in der Tasche seines Savile-Row-Anzugs, klimperte er nervös mit einem Schlüsselbund.
«Ich werde ihm berichten, was der Herr Reichsminister mir selbst erklärt haben», sagte Moyzisch. «Dass es sich um gezielte Falschinformation handelt. Um einen primitiven Trick des britischen Geheimdienstes.»
«Sehr richtig», sagte Ribbentrop, als stimmte er einer Meinung zu, die Moyzisch von sich aus geäußert hatte. «Sagen Sie Schellenberg, er verschwendet sein Geld. Auf diese Information hin zu handeln, wäre reine Idiotie. Meinen Sie nicht?»
«Ganz zweifellos, Herr Reichminister.»
«Kommen Sie gut in die Türkei zurück, Herr Moyzisch.» Und zu Linkus sagte er: «Bringen Sie Herrn Moyzisch hinaus, und lassen Sie dann Fritz am Haupteingang vorfahren. Wir müssen in fünf Minuten zum Bahnhof.»
Ribbentrop schloss die Tür und ging wieder zu dem Biedermeiertisch, wo er die Cicero-Fotos an sich nahm und sorgsam in seiner Sattelledermappe verstaute. Er war überzeugt, dass Moyzisch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Recht hatte, was die Echtheit der Dokumente anbelangte. Aber er hatte nicht die Absicht, das Schellenberg gegenüber in irgendeiner Form zu äußern, nur damit der SS-Brigadeführer diese wichtige, neue Information zum Anlass für irgendein idiotisches Husarenstück nahm. Das Letzte, was er wollte, war eine neue «Sondermission» des SD, so wie letzten Monat, als Otto Skorzeny und ein Trupp von 108 SS-Leuten mit dem Fallschirm auf einem Abruzzengipfel gelandet waren und Mussolini aus den Fängen der verräterischen Badoglio-Fraktion befreit hatten, die Italien den Alliierten übergeben wollte. Mussolini zu befreien, war eine Sache, hinterher zu entscheiden, was mit ihm passieren sollte, eine ganz andere. Dieses Problem zu lösen, war ihm zugefallen. Den Duce in der Republik von Salò am Gardasee unterzubringen, war eines der sinnloseren diplomatischen Unterfangen seiner Karriere gewesen. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er Mussolini dem alliierten Kriegsgericht überlassen.
Diese Cicero-Unterlagen aber waren etwas völlig anderes. Sie waren für ihn die Chance, seine Karriere wieder voranzubringen, zu beweisen, dass er tatsächlich «ein zweiter Bismarck» war, wie Hitler einst nach den erfolgreichen Verhandlungen über den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion gesagt hatte. Der Krieg war der Feind der Diplomatie, aber jetzt, da klar war, dass Deutschland den Krieg nicht mehr gewinnen konnte, war die Zeit der Diplomatie – seiner Diplomatie – wieder angebrochen, und Ribbentrop hatte nicht vor, den SD mit seinen idiotischen Heldenstückchen Deutschlands Chancen auf einen Verhandlungsfrieden zunichte machen zu lassen.
Er würde mit Himmler reden. Nur Himmler war weitblickend und visionär genug, um zu begreifen, welch ungeheure Möglichkeiten dieses zum goldrichtigen Zeitpunkt gelieferte Cicero-Material eröffnete.
Ribbentrop schloss seine Aktenmappe und eilte nach draußen.
Unter der hohen Laterne neben dem Hauptportal fand Ribbentrop die beiden Referenten, die ihn auf der Zugfahrt begleiten sollten: Rudolf Linkus und Paul Schmidt. Linkus nahm ihm die Aktenmappe ab und legte sie in den Kofferraum des riesigen, schwarzen Mercedes, der darauf wartete, sie alle drei zum Anhalter Bahnhof zu bringen. Ribbentrop schnupperte in die feuchtkalte Nachtluft, die vom Korditgeruch der Flak-Batterien am Pariser und am Leipziger Platz erfüllt war, und stieg dann in den Fond des Wagens.
Sie fuhren die Wilhelmstraße hinunter, vorbei am Gestapo-Hauptquartier, dann auf die Königgrätzer Straße und schließlich rechter Hand in den Bahnhof, wo es von Rentnern, Frauen und Kindern wimmelte, die, wie es ihnen der Goebbels-Erlass erlaubte, den Bombenangriffen der Alliierten zu entfliehen suchten.
Der Mercedes hielt an einem Bahnsteig, ein ganzes Stück abseits dieser weniger distinguierten Reisenden, neben einem windschnittig geformten, dunkelgrünen Zug, der bereits unter Dampf stand. Auf dem Bahnsteig waren in Fünf-Meter-Abständen SS-Leute postiert, um die zwölf Waggons und die beiden mit 200-Millimeter-Vierfachflak bestückten Geschützwagen zu bewachen. Dies war der Sonderzug Heinrich des Reichsführers-SS Heinrich Himmler und nach dem Führerzug der wichtigste Zug Deutschlands.
Ribbentrop stieg in einen der beiden Waggons, die für den Reichsaußenminister und dessen Stab reserviert waren. Schon jetzt ergaben das Schreibmaschinengeklapper und das Klirren des Geschirrs aus dem Speisewagen zwischen Ribbentrops Salonwagen und dem des Reichsführers-SS eine Geräuschkulisse, die es mit der eines jeden Ministeriumsbüros aufnehmen konnte. Um Punkt zwanzig Uhr fuhr der Heinrich ab, nach Osten, dorthin, wo einst Polen gewesen war.
Um halb neun ging Ribbentrop in sein Schlafabteil, um sich fürs Abendessen umzuziehen. Seine SS-Uniform lag bereits auf dem Bett parat: schwarzer Waffenrock, Mütze, Koppel, schwarze Reithosen und blitzblanke schwarze Reitstiefel. Ribbentrop, der seit 1936 im Rang eines SS-Standartenführers ehrenhalber stand, trug gern Uniform, und sein Freund Himmler schien es zu schätzen, wenn er es tat. Zu diesem speziellen Anlass jedoch war die Uniform ein Muss, und als der Minister aus seinem Schlafabteil trat, hatten alle anwesenden Herren aus dem Außenministerium ebenfalls ihre rabenschwarzen Uniformen angelegt. Ribbentrop lächelte, weil es ihm gefiel, dass seine Männer so schneidig aussahen und eine Effizienz an den Tag legten, wie sie nur die Nähe des Reichsführers-SS hervorzurufen vermochte. Instinktiv salutierte er. Seine Leute salutierten zurück. Paul Schmidt, der SS-Obersturmbannführer war, legte seinem Chef ein mit dem Briefkopf des Ministeriums versehenes Blatt Papier vor, auf dem in Schreibmaschinenschrift sämtliche Punkte aufgelistet waren, die Ribbentrop beim gemeinsamen Abendessen mit Himmler besprechen wollte. Dazu gehörten der Vorschlag, sämtliche britischen Flieger, die bei Bombenangriffen gefangen genommen wurden, der örtlichen Bevölkerung zur Selbstjustiz zu überlassen, und die Sache mit den Dokumenten-Fotos, die SD-Agent Cicero geliefert hatte. Zum Erstaunen des Reichsministers war unter den anstehenden Themen jedoch auch die Deportation von Juden aus Norwegen, Italien und Ungarn aufgeführt. Ribbentrop las diesen letzten Punkt noch einmal, warf dann die Liste auf den Tisch und fragte mit zornrotem Gesicht: «Wer hat das getippt?»
«Fräulein Mundt», sagte Schmidt. «Stimmt etwas nicht, Herr Reichsminister?»
Ribbentrop machte auf dem Absatz kehrt und marschierte in den nächsten Wagen, wo mehrere Stenotypistinnen beim Anblick des Ministers unverzüglich zu tippen aufhörten und respektvoll aufstanden. Er ging zu Fräulein Mundt, durchsuchte ihren Ausgangskorb, entnahm ihm wortlos den Durchschlag von Schmidts Liste und ging dann wieder in seinen Salonwagen zurück. Dort legte er den Durchschlag auf den Tisch und wandte sich, die Hände in die Taschen seines Uniformrocks gestemmt, ungehalten an Schmidt.
«Nur weil Sie verdammt noch mal zu faul sind, sich an das zu halten, was ich sage, gefährden Sie unser aller Leben», schnauzte er. «Indem Sie konkrete Einzelheiten dieser Moellhausen-Sache zu Papier bringen – noch dazu in einem offiziellen Dokument –, wiederholen Sie ebenjenen Weisungsverstoß, für den er aufs Strengste zu tadeln ist.»
Eitel von Moellhausen war Konsul in Rom und hatte in der Vorwoche ein Kabel nach Berlin geschickt, in dem er das Außenministerium darauf hinwies, dass der SD beabsichtige, 8800 italienische Juden «zur Liquidierung» in das österreichische Konzentrationslager Mauthausen zu deportieren. Das hatte einige Irritation hervorgerufen, denn Ribbentrop hatte strikte Weisung erteilt, dass Wörter wie «Liquidierung» nie und nimmer in schriftlichen Unterlagen des Außenministeriums auftauchen durften, für den Fall, dass diese Dokumente den Alliierten in die Hände fielen.
«Angenommen, dieser Zug würde von britischen Kommandotrupps gekapert», brüllte er. «Dann würde uns Ihre idiotische Liste ebenso sicher ans Messer liefern wie Moellhausens Kabel. Ich sagte es bereits, aber offenbar muss ich es noch einmal sagen. ‹Evakuierung›, ‹Umsiedlung›, ‹Wohnsitzverlegung›, das sind die Wörter, die in allen Dokumenten des Außenministeriums bezüglich der Lösung der europäischen Judenfrage zu benutzen sind. Dem Nächsten, der das vergisst, wird es ergehen wie Luther.» Ribbentrop ergriff das inkriminierende Schreiben samt Durchschlag und warf es Schmidt hin. «Vernichten Sie das. Und lassen Sie Fräulein Mundt diese Liste unverzüglich noch einmal tippen.»
«Wird sofort erledigt, Herr Reichsminister.»
Ribbentrop goss sich ein Glas Fachinger ein und wartete ungeduldig, dass Schmidt mit dem neu getippten Papier zurückkam. Da klopfte es an der anderen Tür des Waggons. Ein Ministeriumsbeamter öffnete sie und ließ einen kleinen, unscheinbaren SS-Obersturmbannführer herein, der seinem obersten Vorgesetzten nicht unähnlich war, denn es handelte sich um Dr. Rudolf Brandt, Himmlers persönlichen Referenten und einen der fleißigsten Männer im Umfeld des Reichsführers-SS. Brandt knallte die Hacken zusammen und verbeugte sich steif vor Ribbentrop, der ihn gewinnend anlächelte.
«Schönen Gruß vom Reichsführer, Herr Standartenführer», sagte Brandt. «Er lässt fragen, ob Sie Zeit haben, in seinen Wagen zu kommen.»
Schmidt kam mit der neuen Aufstellung zurück. Ribbentrop nahm sie wortlos entgegen und folgte dann Brandt durch die Ziehharmonika zwischen den beiden Wagen.
Himmlers Salonwagen hatte eine Täfelung aus poliertem Holz. Auf einem Tischchen am Fenster stand eine Messinglampe. Die Sessel waren mit grünem Leder bezogen, passend zum dicken Plüschboden. Es gab auch ein Grammophon und ein Radio, obwohl Himmler für derlei Zerstreuungen kaum Zeit hatte. Dennoch war der Reichsführer-SS keineswegs der mönchische Asket, den er nach außen hin verkörperte. Ribbentrop, der ihn gut kannte, fand, dass Himmler zu Unrecht als eiskalt und skrupellos galt: Gegenüber Leuten, die ihm gute Dienste leisteten, konnte er überaus großzügig sein. Tatsächlich entbehrte Heinrich Himmler durchaus nicht eines gewissen Charmes. Er verstand es, lebhaft Konversation zu machen, und was er sagte, war meistens mit einer Prise Humor gewürzt. Zwar konnte er es, genau wie der Führer, nicht leiden, wenn Leute in seiner Umgebung Zigaretten rauchten, aber er gönnte sich selbst ab und zu eine gute Zigarre. Er war auch kein Abstinenzler, sondern trank abends gern ein, zwei Gläser Rotwein. In Himmlers Waggon sah Ribbentrop eine bereits geöffnete Flasche Herrenberg-Honigsäckel auf dem Schreibtisch und eine brennende Kuba-Zigarre in einem Kristallaschenbecher. Dieser stand auf einem Brockhaus-Atlas und einem wildledergebundenen Exemplar der Bhagavad Gita, einem Buch, von dem sich Himmler, wenn überhaupt, nur selten trennte.
Als Himmler Ribbentrop erblickte, legte er den Füller mit der berüchtigten grünen Tinte weg und sprang auf.
«Ribbentrop, mein Lieber», sagte er mit seiner ruhigen Stimme und dem leichten bayerischen Einschlag, der Ribbentrop manchmal an Hitlers österreichischen Akzent erinnerte. Es gab sogar Leute, die behaupteten, Himmler ahme absichtlich Hitlers Sprechweise nach, um sich beim Führer lieb Kind zu machen. «Schön, dass Sie da sind. Ich sitze gerade an meiner Rede für morgen.»
Das war der Zweck ihrer Polenreise: Beim morgigen Besuch in Posen, der alten polnischen Hauptstadt, wo sich jetzt eine von Generalmajor Gehlen geleitete Agentenschule der Wehrmacht befand, würde Himmler vor den versammelten Gruppenführern der SS sprechen. Achtundvierzig Stunden später würde er dieselbe Rede noch einmal vor sämtlichen Reichs- und Gauleitern Europas halten.
«Und? Zufrieden?»
Himmler zeigte dem Außenminister den maschinegeschriebenen Text, an dem er den ganzen Nachmittag gearbeitet hatte und der jetzt mit Korrekturen in seiner spinnenbeinfeinen grünen Handschrift übersät war.
«Ein bisschen lang vielleicht», gab Himmler zu, «mit dreieinhalb Stunden.»
Ribbentrop stöhnte innerlich. Wenn jemand anders diese Rede hielte, Goebbels oder Göring oder selbst Hitler, würde er es ja wagen, solange ein Nickerchen zu machen, aber Himmler gehörte zu den Leuten, die einem hinterher Fragen zu ihren Reden stellten und insbesondere wissen wollten, was man für die stärksten Passagen gehalten habe.
«Aber das lässt sich nun mal nicht ändern», sagte Himmler leichthin. «Es gilt ja ein weites Feld abzudecken.»
«Das glaube ich wohl. Ich freue mich natürlich darauf, schon seit Ihrer Ernennung.»
Vor zwei Monaten erst hatte Himmler von Frank das Innenministerium übernommen, und die Posener Rede sollte demonstrieren, dass das mehr als nur eine kosmetische Veränderung war: Während der Führer bislang auf die Unterstützung des deutschen Volkes gebaut hatte, wollte Himmler klar machen, dass er sich ausschließlich auf die SS verließ.
«Danke, mein Lieber. Ein Glas Wein?»
«Ja, gern.»
Beim Einschenken fragte Himmler: «Wie geht’s Annelies? Und Ihrem Sohn?»
«Gut, danke. Und Häschen?»
Häschen war Himmlers Kosename für seine ehemalige Sekretärin Hedwig, mit der er in morganatischer Ehe lebte. Der Reichsführer-SS war immer noch nicht von seiner Frau Marga geschieden. Häschen war zwölf Jahre jünger als der jetzt dreiundvierzigjährige Himmler und stolze Mutter seines zweijährigen Sohnes Helge – bei allem guten Willen konnte Ribbentrop sich einfach nicht daran gewöhnen, Kleinkinder bei diesen neuen arischen Namen zu nennen.
«Der geht es auch gut.»
«Kommt sie nach Posen? Sie haben doch dieses Wochenende Geburtstag?»
«Ja, das stimmt. Aber nein, wir treffen uns in Hochwald. Der Führer hat uns in die Wolfsschanze eingeladen.»
Die Wolfsschanze war das Führerhauptquartier in Ostpreußen, Hochwald das Haus, das sich Himmler fünfundzwanzig Kilometer östlich des mitten im Wald gelegenen Bunkerkomplexes gebaut hatte.
«Wir sehen Sie dort kaum noch, Ribbentrop.»
«Für einen Diplomaten gibt es in einem Militärhauptquartier nicht viel zu tun, Himmler. Also bleibe ich lieber in Berlin, wo ich dem Führer nützlicher sein kann.»
«Sie haben völlig Recht, diesen Ort zu meiden, mein Lieber. Es ist schrecklich dort. Im Sommer drückend heiß und im Winter eiskalt. Gott sei Dank muss ich nicht dort wohnen. Mein Haus liegt in einer wesentlich gesünderen Gegend. Manchmal glaube ich, der Führer hält es dort nur aus, damit er das Gefühl haben kann, die Entbehrungen des deutschen Landsers zu teilen.»
«Das ist ein Grund. Und der zweite ist natürlich, dass er, solange er dort ist, nicht sehen muss, was die Bomben in Berlin anrichten.»
«Mag sein. Heute Nacht ist jedenfalls München dran.»
«Ach ja?»
«Rund dreihundert britische Bomber.»
«Guter Gott!»
«Ich habe Angst vor dem, was auf uns zukommt, Ribbentrop. Das sage ich Ihnen ganz offen. Deshalb müssen wir alles daransetzen, dass unsere diplomatischen Bemühungen zum Erfolg führen. Es ist unumgänglich, dass wir Frieden mit den Alliierten schließen, ehe sie nächstes Jahr eine zweite Front eröffnen.» Himmler zündete seine Zigarre wieder an und paffte bedächtig, bis sie richtig angeraucht war. «Hoffen wir, dass sich die Amerikaner doch noch überreden lassen, von diesem Irrsinn mit der bedingungslosen Kapitulation abzurücken.»
«Ich finde trotzdem, Sie hätten es dem Außenministerium überlassen sollen, mit diesem Hewitt zu reden. Schließlich habe ich in Amerika gelebt.»
«Ach, kommen Sie, Ribbentrop, das war doch Kanada, oder?»
«Nein. Auch New York. Ein, zwei Monate jedenfalls.»
Himmler schwieg und studierte diplomatisch das brennende Ende seiner Zigarre.
Ribbentrop strich sich das graublonde Haar glatt und versuchte, das Muskelzucken in seiner rechten Wange unter Kontrolle zu bekommen, weil es nur zu deutlich seinen Zorn auf den Reichsführer-SS verriet. Dass Himmler statt seiner Dr. Felix Kersten nach Stockholm geschickt hatte, um dort Geheimverhandlungen mit Roosevelts Sondergesandtem zu führen, machte dem Außenminister zu schaffen.
«Sie sehen doch wohl selbst, wie lächerlich es ist», insistierte Ribbentrop, «dass ich als erfahrener Diplomat einfach ausgebootet werde, von – von Ihrem Chiropraktiker.»
«Nicht nur meinem. Ich meine mich zu erinnern, dass er Sie ebenfalls behandelt hat, Ribbentrop. Mit Erfolg, wie ich hinzufügen möchte. Aber es hat zwei Gründe, dass ich Kersten gebeten habe, nach Stockholm zu fahren. Zum einen ist er selbst Skandinavier und kann sich dort bewegen. Im Unterschied zu Ihnen. Und zum anderen, na ja, Sie kennen ja Kersten und wissen, wie talentiert er ist und wie überzeugend er sein kann. Ich glaube, man kann seine Wirkung auf Menschen getrost als magnetisch bezeichnen. Es ist ihm sogar gelungen, diesen Abram Hewitt dazu zu bringen, seine Rückenschmerzen von ihm behandeln zu lassen, was natürlich einen äußerst nützlichen Deckmantel für ihre Gespräche abgibt.» Himmler schüttelte den Kopf. «Ich muss gestehen, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Kersten unter diesen Umständen tatsächlich irgendeinen Einfluss auf Hewitt erlangen könnte. Aber bislang waren meine Befürchtungen unbegründet.»
«Abram? Ist er Jude?»
«Ich weiß nicht genau. Aber wahrscheinlich schon.» Himmler zuckte die Achseln. «Aber das darf keine Rolle spielen.»
«Sie haben mit Kersten gesprochen?»
«Heute Abend, telefonisch, vor meiner Abreise aus Berlin. Hewitt hat Kersten erklärt, er halte die Aufnahme von Verhandlungen erst dann für möglich, wenn wir etwas unternommen hätten, um Hitler aus dem Weg zu räumen.»
Nachdem das Unaussprechliche ausgesprochen war, verstummten sie beide.
Schließlich sagte Ribbentrop: «Die Russen sind da längst nicht so engstirnig. Wie Sie wissen, habe ich Madame de Kollontay, die russische Botschafterin in Schweden, verschiedentlich getroffen. Sie sagt, Marschall Stalin sei schockiert, dass Roosevelt die bedingungslose Kapitulation Deutschlands gefordert habe, ohne ihn auch nur zu konsultieren. Die Sowjetunion besteht letztlich nur auf der Wiederherstellung ihrer Grenzen von vor 1940 und einer angemessenen finanziellen Entschädigung für ihre Verluste.»
«Geld», stieß Himmler verächtlich hervor. «Versteht sich, dass das das Einzige ist, was diese Kommunisten interessiert. Stalin will doch nur, dass die russischen Fabriken auf deutsche Kosten wiederaufgebaut werden. Und natürlich, dass ihm Osteuropa auf dem Silbertablett dargeboten wird. Ja, bei Gott, die Alliierten werden bald merken, dass wir das Einzige sind, was zwischen ihnen und dem Iwan steht.
Sie wissen ja, ich habe eigene Untersuchungen über die Russen angestellt», fuhr Himmler fort, «und meiner vorsichtigen Schätzung nach hat die Rote Armee in diesem Krieg bislang über zwei Millionen Tote, Gefangene und Versehrte zu verzeichnen. Das ist auch etwas, worüber ich in Posen sprechen werde. Ich gehe davon aus, dass sie im Zuge ihrer Winteroffensive noch einmal mindestens zwei Millionen Mann opfern werden. Schon jetzt meldet die SS-Division ‹Das Reich›, dass die gegnerischen Divisionen ganze Kompanien von vierzehnjährigen Knaben umfassen. Ich sage Ihnen, im nächsten Frühjahr werden sie zwölfjährige Mädchen gegen uns aufbieten. Die russische Jugend ist mir natürlich völlig egal, aber das sagt mir doch, dass ihnen Menschenleben absolut nichts bedeuten. Und es erstaunt mich immer wieder, dass die Briten und Amerikaner ein Volk, das bereit ist, zehntausend Frauen und Kinder für das Ausheben eines Panzergrabens zu opfern, als Verbündeten akzeptieren können. Wenn die Briten und Amerikaner ihr Fortbestehen darauf zu gründen bereit sind, dann weiß ich nicht, auf welcher Grundlage sie uns über reguläre Kriegführung belehren zu können meinen.»
Ribbentrop trank von Himmlers Wein, obwohl er den Sekt, den er in seinem eigenen Waggon getrunken hatte, bei weitem bevorzugte, und schüttelte den Kopf. «Ich glaube nicht, dass sich Roosevelt über die wahre Natur der Bestie, mit der er sich da zusammengetan hat, im Klaren ist», sagte er. «Churchill weiß wesentlich mehr über die Bolschewiken und sagt, er würde sich selbst mit dem Teufel verbünden, um Deutschland zu besiegen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Roosevelt wirklich eine Vorstellung von der schrankenlosen Brutalität seines Verbündeten hat.»
«Aber wir wissen doch zweifelsfrei, dass er über die wahren Verursacher des Massakers von Katyn informiert wurde», sagte Himmler.
«Ja, aber hat er es auch geglaubt?»
«Wieso hätte er es nicht glauben sollen? Die Beweise waren doch unumstößlich. Das Dossier der Wehrmacht-Untersuchungsstelle würde doch selbst den unparteiischsten Beobachter von der Schuld der Russen überzeugen.»
«Aber genau das ist ja der springende Punkt», sagte Ribbentrop. «Roosevelt ist ja wohl kaum unparteiisch. Da die Russen ihre Schuld stur abstreiten, kann Roosevelt sich dafür entscheiden, seinen eigenen Augen nicht zu trauen. Wenn er dem Dossier geglaubt hätte, hätten wir längst etwas gehört. Das ist die einzige Erklärung.»
«Ich fürchte, da könnten Sie Recht haben. Die Amerikaner glauben lieber den Russen als uns. Und es ist ja kaum möglich, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Nicht jetzt, wo Smolensk wieder unter russischer Kontrolle ist. Also müssen wir eine andere Möglichkeit finden, die Amerikaner aufzuklären.» Himmler nahm eine dicke Akte von seinem Schreibtisch und gab sie Ribbentrop, der bei dieser Gelegenheit bemerkte, dass Himmler zwei Goldringe trug, und sich kurz fragte, ob es zwei Eheringe waren, für jede Frau einer. «Ja, ich glaube, ich werde ihm das hier schicken», sagte Himmler.
Ribbentrop setzte seine Lesebrille auf und musterte die Akte. «Was ist das?», fragte er misstrauisch.
«Ich nenne es die Beketowka-Akte. Beketowka ist ein sowjetisches Arbeitslager bei Stalingrad, geführt vom NKWD. Nach der Niederlage der Sechsten Armee im Februar gerieten etwa eine viertel Million deutsche Soldaten in russische Gefangenschaft und wurden in solchen Lagern inhaftiert. Beketowka war das größte.»
«War?»
«Die Akte wurde von einem Agenten Generalmajor Gehlens beim NKWD zusammengestellt und ist gerade erst in meine Hände gelangt. Ausgezeichnete Arbeit. Sehr gründlich. Gehlen rekrutiert äußerst tüchtige Leute. Sie enthält Fotos, Zahlenaufstellungen, Augenzeugenberichte. Laut den Lagerbüchern kamen im letzten Februar etwa fünfzigtausend deutsche Soldaten nach Beketowka. Davon sind heute keine fünftausend mehr am Leben.»
Ribbentrop hörte sich nach Luft schnappen. «Sie scherzen.»
«In einer solchen Angelegenheit? Wohl kaum. Nur zu, Ribbentrop. Schlagen Sie die Akte auf. Sie werden sie ausgesprochen informativ finden.»
In der Regel versuchte der Minister, sich von den Berichten, die in der Deutschlandabteilung des Außenministeriums eingingen, fern zu halten. Sie kamen von der SS und dem SD und enthielten ausführliche Informationen über den Tod unzähliger Juden in den Vernichtungslagern des Ostens. Aber wenn es um das Schicksal deutscher Soldaten ging, konnte er sich wohl kaum heraushalten, zumal sein eigener Sohn Leutnant der Leibstandarte-SS war und zum Glück noch lebte. Wenn nun sein Sohn bei Stalingrad in Gefangenschaft geraten wäre? Er schlug die Akte auf.
Ribbentrop sah ein Foto vor sich, das ihn auf den ersten Blick an eine Illustration von Gustave Doré in Miltons Verlorenem Paradies erinnerte. Erst nach ein, zwei Sekunden begriff er, dass das hier keine nackten Körper von Engeln – oder auch nur Teufeln – waren, sondern Menschen, offensichtlich steif gefroren und sechs, sieben Mann tief aufeinander gestapelt wie Rinderhälften in einer riesigen Gefrierkammer. «Mein Gott», sagte er, als ihm aufging, dass der Leichenwall achtzig oder neunzig Meter lang war. «Mein Gott. Das sind deutsche Soldaten?»
Himmler nickte.
«Wie sind sie umgekommen? Sind sie erschossen worden?»
«Ein paar hatten vielleicht das Glück, erschossen zu werden», sagte Himmler. «Die meisten starben an Hunger, Kälte, Krankheit, Erschöpfung und mangelnder Hygiene. Sie sollten wirklich den Bericht lesen, den ein Gefangener gibt, ein junger Leutnant der sechsundsiebzigsten Infanteriedivision. Diese Aufzeichnungen wurden aus dem Lager geschmuggelt, in der irrigen Hoffnung, die Luftwaffe könnte eine Art Luftangriff fliegen und dem Elend dieser Männer ein Ende machen. Der Bericht liefert ein recht gutes Bild vom Leben in Beketowka. Ja, es handelt sich um eine durchaus bemerkenswerte Reportage.»
Ribbentrops schwachsichtige blaue Augen huschten schnell über das nächste Foto hinweg, die Nahaufnahme eines Stapels gefrorener Leichen. «Vielleicht später», sagte er und nahm die Brille ab.
«Nein, Ribbentrop, lesen Sie’s jetzt gleich», insistierte Himmler. «Bitte. Der Mann, der das geschrieben hat, ist oder war erst zweiundzwanzig, so alt wie Ihr Sohn. Wir sind es all jenen, die nicht mehr heimkehren, schuldig, zu begreifen, was sie erlitten und welches Opfer sie gebracht haben. Solche Dinge zu lesen, das wird uns die nötige Härte verleihen, um zu tun, was zu tun ist. Für menschliche Schwäche ist da kein Platz, meinen Sie nicht?»
Mit starrer Miene setzte Ribbentrop die Brille wieder auf. Er ließ sich gar nicht gern in die Enge treiben, sah aber keine andere Möglichkeit, als Himmlers Aufforderung nachzukommen und das Dokument zu lesen.
«Oder noch besser», sagte der Reichsführer, «Sie lesen mir vor, was der junge Zahler geschrieben hat.»
«Laut?»
«Ja, laut. Um ehrlich zu sein, ich habe es selbst erst einmal gelesen, weil ich es nicht über mich gebracht habe, es noch einmal zu tun. Also, lesen Sie es mir vor, Ribbentrop, und dann besprechen wir, was zu tun ist.»
Der Außenminister räusperte sich nervös und dachte an das letzte Mal, dass er ein Dokument vorgelesen hatte. Er erinnerte sich genau an das Datum: 22. Juni 1941 – der Tag, an dem er der Presse verkündet hatte, dass Deutschland in die Sowjetunion einmarschiert war. Die Ironie entging ihm nicht.
Als er mit dem Vorlesen fertig war, nahm er die Brille ab und schluckte. Heinrich Zahlers Darstellung des Lebens und Sterbens in Beketowka in Kombination mit der Bewegung des Zugs und dem Geruch von Himmlers Zigarre – ihm war ein bisschen flau. Er erhob sich schwankend, entschuldigte sich für einen Moment und ging in die Ziehharmonikaverbindung zwischen den Wagen, um ein wenig Luft zu schnappen.
Als der Minister in den Salonwagen des Reichsführers zurückkehrte, schien Himmler seine Gedanken zu lesen.
«Vielleicht mussten Sie ja an Ihren Sohn denken. Ein tapferer junger Mann. Wie oft verwundet?»
«Dreimal.»
«Das spricht sehr für Sie, Ribbentrop. Beten wir, dass Rudolph nie in russische Gefangenschaft gerät. Zumal er ja bei der SS ist. An anderer Stelle in der Beketowka-Akte geht es um die besonders mörderische Behandlung, die die Russen SS-Gefangenen angedeihen lassen. Die kommen auf die Wrangel-Insel. Soll ich Ihnen zeigen, wo das ist?»
Himmler nahm seinen Brockhausatlas und schlug die betreffende Karte auf. «Hier», sagte er und tippte mit einem wohl manikürten Fingernagel auf ein winziges Krümelchen in einem Meer von Blassblau. «In der ostsibirischen See. Da, sehen Sie? Dreieinhalbtausend Kilometer östlich von Moskau.» Himmler schüttelte den Kopf. «Überwältigend, was? Die schiere Größe dieses Landes.» Er klappte den Atlas zu. «Nein, diese Kameraden werden wir, fürchte ich, nie wieder sehen.»
«Kennt der Führer diese Akte?», fragte Ribbentrop.
«Guter Gott, nein», sagte Himmler. «Und er wird sie auch nie zu Gesicht bekommen. Wenn er von dieser Akte und den Bedingungen in den russischen Gefangenenlagern wüsste, meinen Sie, dann würde er je einen Frieden mit der Sowjetunion in Erwägung ziehen?»
Ribbentrop schüttelte den Kopf. «Nein», sagte er. «Wohl kaum.»
«Aber ich dachte mir, wenn die Amerikaner das sähen», sagte Himmler, «dann …»
«Dann könnte das helfen, einen Keil zwischen sie und die Russen zu treiben.»
«Exakt. Und vielleicht könnte es auch helfen, den von uns bereits vorgelegten Beweisen für die Täterschaft der Russen beim Katyn-Massaker mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.»
«Ich nehme an», sagte Ribbentrop, «Kaltenbrunner hat Sie bereits über den Spionage-Coup dieses Cicero informiert?»
«Die Sache mit der geplanten Konferenz der Großen Drei in Teheran? Ja.»
«Ich dachte nur – bevor Churchill und Roosevelt mit Stalin konferieren, gehen sie nach Kairo, um Tschiang Kaischek zu treffen. Das wäre doch ein guter Ort, um ihnen diese Beketowka-Akte in die Hände zu spielen.»