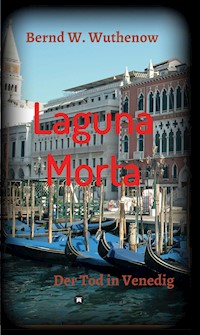3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, die das Leben eines Single für sich entdeckt hat, sich mit oberflächlichen Beziehungen umgibt, niemanden wirklich an sich heranlässt und auf einer Reise ermordet wird; ein Zeuge, der ihren brennenden Wagen löscht, dann aber vorsichtshalber verschwindet, und kurze Zeit später tot neben seiner Werkbank liegt; und schließlich ein Detektiv, der tot in seinem Wagen aufgefunden wird. Wie passt das zusammen? Der mürrische Kommissar Kurt Wießner aus dem Potsdamer Polizeipräsidium ist davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt, aber er findet lange Zeit keinen Ansatz für die Ermittlungen. Erst als der Student Udo Zack, ein Praktikant im Bankhaus Roth, Gschwender & Cie, seine Wege kreuzt, beginnt er zu begreifen, dass die Morde eines gemeinsam haben: Ihre Ursachen reichen weit in die Vergangenheit zurück. Nur allmählich offenbart sich das vielschichtige Bild eines Zusammenhanges, der unauflöslich mit dem Leben von Bernhard Winter verbunden ist, einem Rechtsanwalt, der in den Strudel der Ermittlungen gezogen wird und dabei nicht nur seine unbefriedigende Lebenssituation hinterfragt, sondern auch ein höchst mysteriöses Mandat. Dadurch gerät er nicht nur auf die Spur eines unglaublich heimtückischen Kriminalfalles, sondern findet auch zu einem wundervollen Ausweg aus seiner persönlichen Misere. "Der Praktikant" ist der Auftakt einer Reihe von Kriminalromanen um den Kommissar Kurt Wießner und seine selbstbewusste Tochter Susanne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1417
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
www.tredition.de
Bernd W. Wuthenow
Der Praktikant
www.tredition.de
© 2018 Bernd W. Wuthenow
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-6925-4
Hardcover:
978-3-7439-6926-1
e-Book:
978-3-7439-6927-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1
Als Bernhard Winter die Treppen zu seiner Wohnung hinaufstieg, war er sehr müde. Er hatte den ganzen Tag im Büro verbracht und sehnte sich nach Ruhe. Sein Tagesgeschäft glich immer mehr einer riesigen Spinne, die all seine Kraft, seine Freude und seinen Spaß am Leben aus ihm heraussaugte und ihn zum Wochenende ausspuckte wie eine ausgelutschte Hülle. Er fühlte sich wie ein alter, schwacher Mann, der sein Leben gelebt hat und nichts mehr von ihm erwartet. Dabei war es ein schöner Tag gewesen, aber das hatte er kaum wahrgenommen. Er hatte sich an nichts erfreuen können. Nicht ein einziges Mal hatte er gelacht. Alles hinwerfen, dachte er, du müsstest alles hinwerfen. Aber er kannte sich; er würde es nicht tun, wie er es auch in der Vergangenheit nicht getan hatte. Nicht einmal dafür reichte seine Kraft. Er befand sich in einem nicht enden wollenden Kreislauf der Zermürbung, der in immer mehr erschöpfte und dem er nichts entgegenzusetzen hatte.
Sein Nachbar Schrader ließ sich nicht sehen, dieser unangenehme Mensch, den seine penetrante Neugier vor die Wohnungstür trieb, wenn jemand die Treppe hochkam. Aber es war nach zwanzig Uhr, und da war er entweder schon besoffen oder verdrosch seine Frau. Schrader war klein von Wuchs, hatte eine Halbglatze und trug einem erheblichen Bauchgewölbe mit sich herum, das über seinen spindeldürren Beinen hing wie eine halb mit Wasser gefüllte Plastiktüte. Einige Male war Winter Schraders Frau begegnet, einer scheuen Frau, die meistens eine altmodische Kittelschürze trug, die knapp über ihren unförmigen Knien schloss und am Oberkörper erheblich spannte. Jedes Mal hatte sie versucht, die blauen Flecken im Gesicht mit ihrer nachlässigen Frisur zu bedecken.
Auf der letzten Stufe gähnte er ausgiebig, dann schloss der Wohnungstür auf. Als er eintrat, fiel ihm das Schlüsselbund aus der Hand. Er trat dagegen, so dass es unter der Anrichte rutschte. Er ließ es dort liegen und streifte sich die Schuhe von den Füßen. Einen Blick in den Spiegel der Flurgarderobe vermied er, weil er den alten und verbrauchten Mann darin nicht sehen wollte. Er fühlte sich klein, kraftlos und unwichtig und hatte die wenig tröstliche Gewissheit, dass es stetig bergab mit ihm ging. So konnte es nicht weitergehen, aber es ging so weiter, weil er nichts dagegen tat.
Aus der Nachbarwohnung klang ordinäres Gelächter zu ihm herüber. Es folgte eine Schimpfkanonade; dann polterte es. Das Haus war hellhörig. Manchmal war durch die Wand der Wellensittich des Nachbarn zu hören.
Winter hängte den Mantel auf, dabei fiel sein Blick auf den blinkenden Anrufbeantworter. Er drückte den Abspielknopf. Die knarzige Stimme eines Monteurs bat um einen Rückruf. Winter sah auf die Uhr. Heute würde er niemandem mehr anrufen. Er schrieb die Telefonnummer auf einen Zettel und warf ihn in seinen Aktenkoffer. Morgen würde er zurückrufen. Morgen war immer gut.
Der zweite Anrufer war Verena gewesen. Sie war der einzige Lichtblick in seinem tristen Leben. Sie hatte es geschafft, den Panzer aufzubrechen, den er sich zugelegt hatte, seit ihm seine Frau Manina, abhanden gekommen war. Ihre Stimme klang selbst auf dem Band ausgesprochen erotisch. Sie bat ihn, zurückzurufen, wenn er mochte. Aber er wollte nicht einmal das. Er warf die Manschettenknöpfe neben den Anrufbeantworter, dann machte er sich einen Kaffee, ging ins Schlafzimmer und schaltete seinen Laptop ein.
Während er auf die eingegangenen E-Mails wartete, rührte er in der Tasse. Die Werbesendungen löschte er, ohne sie zu lesen. Drei Nachrichten blieben übrig. Eine stammte von Klaus, einem früheren Kommilitonen, der in Kanada lebte. Jedes Mal, wenn Klaus ihm schrieb, beschlich Winter ein Gefühl der Wehmut und Abenteuerlust. Klaus hatte mit Winter Jura studiert, aber er hatte immer nur davon geträumt, Farmer in Kanada zu werden. Jeden Tag hatte er davon geschwärmt und war nicht müde geworden, sich das Leben auf der Farm in den schönsten Farben auszumalen, als gebe es kein erstrebenswerteres Ziel. Alle, die ihn kannten, hatten das für ein Hirngespinst gehalten, aber eines Tages hatte Klaus tatsächlich alles hingeworfen und war übergesiedelt. Er hatte sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und schließlich in einer großen Farm Unterschlupf gefunden, die ihm inzwischen gehörte.
Klaus schilderte den Alltag auf der Farm. Er tat es sehr bildlich, als sei er das reine Vergnügen. Und er bat Winter wieder einmal, seinen Urlaub doch endlich einmal bei ihm zu verbringen. Winter hatte das nie in Erwägung gezogen. Ursprünglich war es nur Desinteresse gewesen, mittlerweile aber befürchtete er, Klaus´ Leben könnte ihm derart faszinieren, dass er aus seinem Dasein, das mit austauschbaren, glücklosen Tagen gefüllt war, ausbrechen und es Klaus gleichtun könnte.
Die beiden anderen E-Mails stammten von Severin, seinem Sohn. Severin berichtete von einem Vorstellungsgespräch und tat so, als sei er bereits eingestellt. Winter wusste aus Erfahrung, dass er darauf nicht viel geben konnte. Severin war schnell begeistert und genauso schnell enttäuscht. Sein Leben war bisher alles andere als eine Erfolgsgeschichte gewesen. Er hatte die Schule kurz vor dem Abitur abgebrochen, um in einer großen Restaurantkette den Traum von einer beispiellosen Karriere zu leben. Aber daraus war natürlich nichts geworden. Danach hatte er das eine oder andere versucht und war schließlich Tischler geworden. Aber er hatte bisher keine Anstellung gefunden. Winter verband mit diesem Beruf eine angenehme Erinnerung aus Kindheitszeiten, die ihn schließlich mit der Wahl Severins versöhnt hatte: Der Vater eines Freundes war Tischler gewesen, und Winter hatte sich gern in der Werkstatt aufgehalten, in der es immer so wunderbar nach trockenem Holz und Knochenleim gerochen hatte.
Winter antwortete gleich. Er wünschte Severin, dass es klappe, dann wandte er sich der zweiten Mail zu. Das, was er las, ließ ihn erstarren. Severin hatte eine Nachricht, die an seine Mutter gerichtet gewesen war, an ihn weitergeleitet. Sie stammte von Winfried, einem früheren Freund, der inzwischen in Essen wohnte und Manina die Treue gehalten hatte. Die Einzelheiten ließen darauf schließen, dass Winfried Manina am Wochenende erwartete. Ausgerechnet Winne, dachte Winter, an dem Manina früher kein gutes Haar gelassen hatte. Wahrscheinlich wollten sie über die guten alten Zeiten tratschen.
Er erhob sich und wanderte zwischen Bett und Schreibtisch hin und her wie ein Tiger im Käfig. Die Dämmerung hatte den Raum inzwischen in diffuses Licht getaucht. Als er gegen eine Tasche trat, gab er seine Wanderung auf und ging in die Küche, schüttete den Kaffee weg, öffnete ein Bier und trank die Flasche im Stehen halb aus. Dann setzte er sich wieder an den Laptop und las die Nachricht immer wieder, bis die Buchstaben vor seinen Augen zu tanzen begannen. Manina hatte Severin den Zugang zu ihrem Postfach ganz sicher nicht gewährt, dazu war sie viel zu misstrauisch gegen jeden und alles. Hatte Severin folglich seiner Mutter über die Schulter geschaut oder das Passwort durch geduldiges Probieren ermittelt. Vielleicht war das gar nicht so aussichtslos, wie man immer annahm, schließlich folgte die Wahl eines Passwortes oft ganz pragmatischen Überlegungen und unausrottbar naheliegenden Lösungen, um es zuverlässig jederzeit reproduzieren zu können. War es möglich, sich in die Gedanken des anderen so sehr hineinzuversetzen und geduldig mit Namen, Zahlen und Zeichen zu experimentieren, um den Kreis der Lösungen einzugrenzen und auf diese Weise schließlich das Passwort zu finden?
Nimm nie etwas als unmöglich an, sagte ihm seine innere Stimme. Der Gedanke erschreckte und faszinierte ihn zugleich. Es war, als erfasse ein Feuer einen Strohballen. Winter ging ins Bad und ließ kaltes Wasser über die Hände laufen, bis sie sich rot färbten. Der Gedanke, Maninas Post lesen zu können, faszinierte ihn und ließ ihn nicht mehr los.
Winter hatte sich nach mehr als zwanzig Jahren geräuschlos aus seiner Ehe zurückgezogen und war in dieser Wohnung untergekommen. Seither stand zwischen Severin und ihm etwas Unausgesprochenes. Vielleicht hatte Severin auch Zugang zu den E-Mails seines Vaters? Was sprach dagegen, dass der Junge seinen Vater ebenso ausspähte wie seine Mutter. Was trieb den Jungen? Der Anreiz, etwas Heimliches zu tun, oder wollte er herausfinden, wie seine Eltern tickten? Wollte er wissen, was er von ihnen zu erwarten hatte oder hoffte er, auf irgendwelche Hinterhältigkeiten zu stoßen?
Winter erhob sich und tigerte durch das kleine Zimmer. Schließlich blieb er vor dem Fenster stehen und schaute auf den Spielplatz vor dem Haus. Im schwindenden Tageslicht wirkten die Spielgeräte groß und gespenstisch wie übernatürliche Gestalten. Es erschreckte ihn, dass sich ein Gedanke in ihm festzusetzen begann: Was sprach gegen den Versuch, es Severin gleichzutun? Einen Augenblick schwankte er zwischen der Überzeugung, dass es aussichtlos war, und dem Verlangen, es wenigstens zu versuchen, aber schon wenig später hatte er seine Bedenken bereits durch die Frage verdrängt, ob sein Tun irgendwelche Spuren hinterlassen würde und Manina Rückschlüsse darauf ziehen könnte, dass er dahinter steckte. Aber nicht einmal dieser Gedanke ließ in das Ganze vergessen. So muss sich jemand fühlen, der einer Sucht erlegen ist, dachte er. Es schien wie die Verletzung eines Tabus, aber er hatte sich entschieden.
Er sah aus dem Fenster. Die Spielgeräte waren jetzt nur noch schemenhaft zu erkennen. In wenigen Minuten würde sich die stockfinstere Nacht über sie legen. Er spürte, dass er zu schwitzen begann.
Er gab Maninas E-Mail-Adresse und als Passwort ihr Geburtsdatum ein. Prompt kam eine Fehlermeldung. Ganz so einfach war es also doch nicht. Er versuchte es mit dem Geburtsdatum ihrer Mutter. Auch das brachte ihn nicht weiter.
Plötzlich fuhr laut polternd ein Fahrzeug am Haus vorbei. Winter konzentrierte sich auf das Geräusch, bis es verklungen war, dann versuchte er es mit der PIN von Maninas Geldkarte und danach mit Severins Geburtsdatum, aber immer kam eine Fehlermeldung. Es ist offenbar doch nicht so einfach, wie Manina zu denken, dachte er. Seine Ideen hatten sich bereits erschöpft. Aber er konnte nicht aufhören. Inzwischen beunruhigte ihn nicht mehr das, was er tat, sondern, dass er vielleicht nicht hinter das Passwort kam.
Er duschte und blätterte die Zeitung durch, dann setzte er sich wieder an den Laptop und versuchte es mit Maninas Wagenkennzeichen.
Erst passierte gar nichts, dann aber öffnete sich ein Bild, das anders aussah. Ungläubig starrte er auf den Bildschirm. Dieses Mal war es keine Fehlermeldung. Er hatte es tatsächlich geschafft!
Der Triumph genügte ihm, und er wollte schon den Datenraum verlassen, wie ein Dieb, der plötzlich Angst vor seinem Tun bekommt und vor der Tat das Haus verlässt, aber er konnte nicht der Versuchung widerstehen, Maninas Post zu lesen und überflog den Posteingang, der inhaltsleer und enttäuschend uninteressant war. Er wollte sich schon abmelden, als sich eine neue Nachricht ankündigte. Erst überflog er sie, dann las er sie mehrmals, bis er begriff, dass er sich nicht irrte: Manina hatte für das bevorstehende Wochenende die Überwachung ihres Handys in Auftrag gegeben. Wozu, fragte er sich, es war doch sinnlos, sein eigenes Handy zu überwachen. Kein Mensch ortete sich selbst.
Plötzlich kam ihm ein ungeheuerlicher Gedanke. Was, wenn gar nicht Manina dahintersteckte, sondern jemand, der wissen wollte, wo sie sich aufhielt? Könnte Severin …
Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als die E-Mail plötzlich vom Bildschirm verschwand. Sofort befiel ihn Panik, und es schien ihm, als sehe Manina ihn durch den Bildschirm an. Der Gedanke war ihm derart unangenehm, dass er sich abmeldete.
Er schaltete den Laptop aus und lehnte sich weit zurück. Sein Blick verlor sich im Nichts.
Als Bernhard Winter erwachte, war es draußen noch stockdunkel. Der Wecker zeigte zehn Minuten nach vier Uhr. Die Gedanken an Severin und an Manina hatten ihn schlecht geschlafen und unruhig träumen lassen. Er hatte den Grundsatz, das Vergangene vergangen sein zu lassen, einer Augenblicksversuchung geopfert und fühlte sich nun, da er die Sache mit einem gewissen Abstand sah, gläsern, befleckt und missbraucht. Deshalb beschloss er, von seiner Erkenntnis keinen Gebrauch zu.
Er wälzte und wälzte sich im Bett, aber der Schlaf kehrte nicht zurück. Als es auf sechs Uhr zuging, erhob er sich, ging in die Küche, kochte Kaffee und belegte sich zwei Brote. Während er aß, gingen seine Gedanken immer wieder zu seinen gestrigen Feststellungen. Angesichts dessen, dass es so unglaublich leicht gewesen war, in Maninas Postfach einzudringen, schien ihm die öffentliche Debatte über die Bedingungen, unter denen es gestattet sein sollte, jemanden abzuhören oder elektronische Post mitzulesen, geradezu lächerlich. Was für eine grandiose Täuschung sie doch ist, dachte er. Das Gespenst des Überwachungsapparates war längst keine graue Theorie mehr. Wenn es schon ihm gelang, in ein fremdes Postfach einzudringen, welche Möglichkeiten hatten dann erst jene, der etwas davon verstanden? Der Gedanke war erschreckend.
Er ging ins Bad und duschte. Das Wasser wurde nicht richtig warm. Dann rasierte er sich und wischte die Reste des Schaums ins Handtuch. Manina hätte ihm deswegen Vorhaltungen gemacht.
Schon wieder Manina, durchfuhr es ihn. Denke nicht an gestern, mahnte seine innere Stimme, miss dein Verhalten nicht fortwährend an Vergangenem, sondern schau endlich nach vorn.
Plötzlich klingelte das Telefon. Winter hasste es, so früh angerufen zu werden, aber als er Verenas weiche Stimme hörte, spürte er sofort ein Kribbeln im Nacken. Er lief in den Flur und griff nach dem Telefon. Das Handtuch rutschte ihm von der Hüfte und legte sich um seine Füße wie ein weicher Flor.
„Guten Morgen.“
„Guten Morgen, Bernhard.“
Er sah sie vor sich, groß und schlank, mit kurzen dunklen Haaren.
„Was tust du gerade? Oder darf ich das nicht fragen?“
Natürlich durfte sie das. Verena durfte alles fragen. Wahrheitsgemäß erwiderte er, dass er nackt im Flur stehe und mit einer schönen Frau rede. Er unterbrach sich und ließ die Worte nachklingen. Als sie nicht gleich antwortete, befürchtete er, zu anzüglich gewesen zu sein. „Es ist immer wundervoll, wenn du anrufst“, schob er nach.
Jetzt kicherte sie. „Ist das wirklich wahr?“
Er konnte ihr Lächeln förmlich hören und sah ihre kleinen Grübchen in den Augenrändern vor sich. Verena war eine schöne Frau. Sie war ihm zugefallen wie eine reife Frucht. Es gab solche Zufälle, an die er vorher nicht geglaubt hatte. Auch wenn er natürlich ganz genau wusste, worauf sie hinauswollte, fragte er: „Dass jeder Tag, an dem ich deine Stimme nicht höre, trist ist, dass du eine schöne Frau bist, dass du …“
„Dass du nackt im Flur stehst“, warf sie kichernd dazwischen.
Er stellte sich vor, dass sie zur Tür hereinkäme und plötzlich vor ihm stünde. Sofort durchströmte ihn wohlige Wärme. „Wenn du nur hier wärst“, hauchte er.
Sie seufzte. „Ein wirklich schöner Gedanke, aber ich bin leider weit weg.“
Als er sie fragte, wo sie sei, erwiderte sie, dass sie in Addis Abeba festhänge.
„Dann wirst du es wohl nicht zu mir schaffen, bevor ich zu meinem miefigen Büro aufbreche“, sagte er und schob er lachend ein „schade“ hinterher.
Aber Verena ging nicht darauf ein. „Es war gestern bestimmt wieder spät“, sagte sie. „Entschuldige, dass ich angerufen hatte. Aber ich wollte dir sagen, dass ich für eine kranke Kollegin einspringen muss. Ich bin deshalb am Wochenende nicht zu Hause.“
Ihr Zögern entging ihm nicht. Es tat ihr also leid. „Wann bist du zurück?“
Es knarzte im Telefon. Es schien, als rede sie gegen einen Sturm an. Nur das Wort Sonntagabend verstand er. Er schlug ihr vor, sie vom Flieger abzuholen. Dann machte er eine kurze Pause und versprach listig, sich auch schön für sie auszuruhen.
„Au ja“, rief sie spontan, „ruhe dich für mich aus. Ich …“ Plötzlich war das Gespräch unterbrochen. Er blickte enttäuscht auf den Hörer. Verena hatte ihn schon von den entlegensten Winkeln des Erdballs angerufen, aber nur selten war die Verbindung so schlecht gewesen wie heute.
Bevor er die Wohnung verließ, schrieb er einen Zettel für den Hausmeister, dass die Dusche repariert werden müsse, warf ihn in dessen Briefkasten am Nachbarhaus und fuhr zum Büro.
Während der Fahr huschten die Gedanken unsortiert durch seinen Kopf, wie Schmetterlinge, die gaukelnd von Blüte zu Blüte wechseln und sich nicht greifen lassen. Er sah Verena vor sich, wie sie sich nackt in seinem Bett räkelte. Dann wurde das Bild von Severins Gesicht überlagert. Als er das Radio einschaltete, verschwanden die Bilder. Er stellte es wieder aus und lauschte den monotonen Fahrgeräuschen. Die Bilder kehrten zwar zurück, blieben jetzt aber unscharf.
Unmittelbar vor der Einfahrt zum Parkhaus wäre Winter beinahe mit einem Wagen kollidiert, der ihm so langsam entgegenkam, dass er glaubte, der Fahrer lasse ihm die Vorfahrt. Obwohl er sich an der Situation schuldlos fühlte, hob er entschuldigend die Hand. Dann fuhr zu seinem Stellplatz, auf dem bereits ein BMW stand. Winter beschloss, es zu ignorieren. Er verließ das Parkhaus, lief bis zum Eingang des angrenzenden Bürohochhauses und fuhr in die 12. Etage. Der fensterlose Vorraum, in dem der Aufzug hielt, war kalt und ausladend. Die Wände hatten einen schmutzigweißen Anstrich und eine Beleuchtung, die diffuses Licht gegen die Decke warf.
Auf einer Milchglasscheibe stand in schwarzen Buchstaben: »Quade und Partner. Rechtsanwälte«. Schon vor seinem Eintritt in die Kanzlei hatte sie diesen Namen getragen, und Quade war bisher nicht zu bewegen gewesen, das zu ändern. Der Partner war austauschbar. Nicht einmal das Schild musste geändert werden.
Winter hatte mehrere Jahre in einem Potsdamer Randbezirk eine Kanzlei betrieben, die nur aus ihm selbst bestanden hatte, bis ihm eines Tages völlig überraschend der Geschäftsanteil von Quades früherem Partner angeboten worden war, der im Gerichtssaal einem Herzinfarkt erlitten und damit eine geschäftliche Lücke gerissen hatte, die schnell geschlossen werden musste. Winter hatte sich diesem Angebot nicht entziehen können, obwohl er Quade menschlich nicht schätzte. Quade war ein Narzisst, aber vor allem war er ein begnadeter Jurist, der für seine Arbeit lebte und Mandanten anzog, wie Blüten die Bienen.
Zunächst hatte Winter es hingenommen, dass sich Quade gern als Chef gab, inzwischen aber ärgerte ihn, dass Quade dieses Distanzverhältnis hegte und pflegte und jedem Versuch einer Änderung widerstand wie eine knorrige Eiche dem Sturm. Mittlerweile war Winter davon überzeugt, dass sich daran nichts ändern würde, bevor Quade in den Ruhestand gehen oder, was wahrscheinlicher war, seinem früheren Partner auf gleiche Weise folgen würde. Quade betrat die Kanzlei stets als Erster, lebte, um zu arbeiten, machte selten Urlaub, arbeitete oft sogar am Wochenende und hielt das für so selbstverständlich, dass er es von Winter ebenfalls erwartete und diesen Maßstab ständig thematisierte. Winter indes erfüllte diese Erwartungen nicht nur nicht, sondern wollte es auch gar nicht. An diesem Gegensatz, der unauflöslich zwischen ihnen stand, rieben sie sich immer wieder.
Winter hatte kaum die Tür geöffnet, als auch schon die Dümen auf ihn zustürmte und ihn mit Neuigkeiten traktierte. Carola Dümen war der gute Geist der Kanzlei. Sie war Anfang fünfzig, hochgewachsen und schlank und hatte den stechenden Blick eines Adlers, dem nichts und niemand entging. Bei seinem Eintritt in die Kanzlei hatte sie Winter unmissverständlich klargemacht, dass nichts an ihr vorbeigehe, und erst als er sich nach einer Zeit des Reibens damit abgefunden hatte, dass es genau so war, hatten sie zu einem erträglichen Verhältnis gefunden. Das, was sie leistete, war durchaus beachtlich, aber ihr Alleinherrschaftsanspruch und ihre Art, ihn mit Alltäglichkeiten und Hiobsbotschaften zu bestürmen, kaum dass er sich gezeigt hatte, nervten ihn.
„Ich werde in den nächsten fünf Minuten vermutlich nicht sterben“, sagte er. „So lange hat der ganze Unsinn doch wohl noch Zeit. Der Tag hat doch gerade erst begonnen.“
Aber die Dümen spulte ihre Informationen eisern ab, ohne ihm auch nur einen guten Morgen zu wünschen. Sie drückte ihm einen Stapel Telefonnotizen in die Hand und redete unentwegt auf ihn ein. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, schloss sie.
Winter konnte diese unausrottbare Redewendung nicht ausstehen. „Der frühe Vogel“, gab er zurück, „ist mir, gelinde gesagt, scheißegal“. Aber er wusste, dass er die Wortkaskaden ertragen musste, wenn er die Frau für den Augenblick loswerden wollte. Er sah auf die Zettel. „Etwas wirklich Wichtiges haben Sie wohl nicht für mich?“
Sie stemmte die Hände in die Hüften und funkelte ihn an. „Wenn ich mir in drei aufeinander folgenden Telefonaten anhören muss, dass Sie gestern nicht zurückgerufen haben, ist das schon von einiger Wichtigkeit“, erwiderte sie vorwurfsvoll.
Winter versuchte ein Grinsen, obwohl ihm nicht danach war. „Sie sollten keinen Rückruf zusichern“, sagte er, „dann hätten Sie das Problem nicht. Ich habe niemanden etwas zugesichert, schon gar keinen Rückruf. Ich rufe nicht, Frau Dümen, ich telefoniere.“
„Wenn Sie es denn tun würden“, zischte sie.
Aber Winter war bereits im Flur verschwunden und beachtete sie nicht mehr.
Die Räume der Kanzlei lagen hintereinander wie Perlen auf einer Schnur. Winters Büro befand sich ganz am Ende. Ursprünglich war es das Archiv gewesen, aber er hatte diesen Raum beansprucht, weil er am Ende des Flures von der hektischen Betriebsamkeit des Kanzleibetriebes weitgehend verschont blieb.
Quade residierte nebenan. Gebrabbel drang durch die geschlossene Tür. Quade telefonierte wie jeden Morgen. Winter war das ganz recht; sein Partner würde ihm schon noch früh genug über den Weg laufen.
Als Winter in seinem Büro stand, sah er sich frustriert um. Irgendwann würde er jämmerlich an einer Aktenallergie zugrunde gehen, soviel stand fest. Überall lagen sie herum, diese Akten, braun, geduldig und voller Papier. Seine Arbeit war ein fortwährender Kampf gegen diese zweifelhafte Pracht und zu einem nimmer versiegenden Quell von Ärger und unerfüllten Erwartungen verkommen.
Er stellte den Koffer neben den Schreibtisch. Das abgeschabte Stück Leder enthielt auch heute nichts weiter als einen Kalender, den er nie benutzte, und einige Akten, die er seit Tagen spazieren trug, ohne einen Blick hineinzuwerfen. Er stellte den Computer an und sah die Telefonnotizen durch. Dabei dachte er daran, dass er nur noch diesen einen Tag überstehen musste, dann war endlich Wochenende. Am Sonntag würde er Verena treffen. Der Gedanke gab ihm neue Kraft. Er warf die Telefonnotizen in den Papierkorb, öffnete sein E-Mail-Fach und schickte alle Nachrichten, die eingegangen waren, zum Drucker. Sie würden ihm später mit den Akten vorgelegt werden. Später war immer gut.
Dann erhob er sich und ging in das Geschäftszimmer. In diesem Raum, dem Herz der Kanzlei, sorgten zwei Angestellte für den flüssigen Ablauf der Routine. Er begrüßte die beiden Frauen, die er mochte, weil sie durch nichts aus der Ruhe zu bringen waren, nahm einen Stapel Akten und ging zurück in sein Büro. Quade telefonierte immer noch; es schien, als wandere seine laute, sonore Stimme durch die Wände.
In den Akten lagen Briefe, die zu unterschreiben waren. Winter tat es schwungvoll und ohne vorher auch nur eine Zeile zu lesen. Dann ging er in die Küche und holte sich einen Kaffee. Aus dem Zimmer seines Partners drangen gedämpfte Gesprächsfetzen an sein Ohr. Quade hörte sich gern reden und erledigte viele Mandate telefonisch.
Den Posteingang durchzusehen, den er sich anschließend holte, war Routine. Wenn Winter den Inhalt der Akte nicht sofort gedanklich parat hatte, warf er sie kurzerhand auf den Fußboden. Um diesen Stapel, der im Laufe des Tages für gewöhnlich bedrohlich anwuchs und den er despektierlich seinen Leichenhaufen nannte, würde er sich später kümmern.
Als er den nächsten Stapel Akten aus dem Geschäftszimmer holen wollte, lief ihm die Dümen über den Weg. „Keine Anrufe und keine Mandanten“, sagte er energisch.
„Obwohl Sie da sind?“, echauffierte sie sich. „Ich kann doch die Anrufer nicht immer abwimmeln.“
„Doch, das können Sie“, erwiderte Winter betont langsam. „Es gehört sogar zu Ihren vornehmsten Aufgaben, genau das zu tun, und zwar so, dass niemand merkt, wie flott Sie schwindeln.“ Er lächelte sie an, weil er Vergnügen an ihrem entsetzten Blick hatte. „Das ist übrigens das Erste, was man Ihnen hätte beibringen sollen“, setzte er hinzu. Ihren Einwand, dass ihr das niemand mehr abnehme, wenn sie es immer wieder tun müsse, quittierte er mit einem Achselzucken. „Dann sind Sie nicht überzeugend genug. Sie sollten das üben.“ Er wusste sofort, dass diese Bemerkung an ihr nagte. Er erkannte es daran, dass sie nicht gleich reagierte.
„Wenn Sie so weitermachen“, zischte sie giftig, „haben Sie bald keine Mandanten mehr.“
„Dann sollten wir danach streben, diesen Idealzustand zu erreichen“, spottete er mit süffisantem Lächeln.
Offenbar hatte sie genug von ihm, denn sie ließ ihn einfach stehen.
Als er sich anschickte, sein Zimmer mit einem neuen Stapel Akten zu betreten, ging die Tür zu Quades Büro auf. „Du könntest mir wenigstens einen guten Morgen wünschen, statt dich wie ein Dieb an mir vorbeizuschleichen“, sagte er mit sonorer Stimme.
„Ich schleiche nicht“, erwiderte Winter, „und schon gar nicht vorbei.“ Er blieb im Türrahmen stehen, aber dann spürte er, dass ihm die Akten, der Schwerkraft gehorchend, aus den Armen gleiten und auf den Boden fallen würden, wenn er sie nicht gleich ablegte. „Du warst mit deinem Lieblingsspielzeug beschäftigt“, sagte er und hastete in sein Büro, gerade noch rechtzeitig, denn als er den Schreibtisch erreichte, glitten ihm die ersten Akten vom Stapel. Die Post rutschte heraus und vermischte sich zu einem quirligen Haufen. „Verdammte Scheiße!“, entfuhr es ihm.
„Contenance, Herr Kollege, Contenance“, meinte Quade, der ihm gefolgt war. Quade war ein großer Mann mit einem Bauchansatz. Er baute sich hinter Winter auf wie ein Turner hinter dem Reck. „Ich kann es nicht gutheißen, dass du nur noch maulst und dich selbst dann verleugnen lässt, wenn wichtige Mandanten dich sprechen wollen.“
Winter legte die Akten, die sich verselbständigt hatten, aufeinander und sagte: „Es steht dir frei, es nicht gut zu heißen. Wenn ich dauernd telefonieren wollte, wäre ich Telefonist geworden. Das bin ich aber nicht. Und meine Laune wird nicht besser, wenn du sie kritisierst.“
Quade trat ganz dicht an ihn heran und funkelte ihn an wie der personifizierte Vorwurf. „Ich sage es dir noch einmal, Bernhard: Du kannst mit wichtigen Mandanten nicht so ignorant umgehen.“
„Komm mir nicht mit damit“, gab Winter entschieden zurück, während er die verstreute Post einsammelte. „Mach dir nicht meine Gedanken, oder hast du nichts zu tun?“
„Bernhard!"
„Lass mich in Ruhe. Wahrscheinlich ist das meiner Laune zuträglicher."
Quade winkte resigniert ab. „Mit dir ist ja nicht zu reden", knurrte er und verließ das Büro.
„Dann lass es!", rief Winter ihm hinterher.
Winter hatte nun bis Mittag Ruhe. Das Telefon klingelte nicht ein einziges Mal. Entweder war die Dümen nach seinen Rüffel einsichtig geworden, oder es hatte tatsächlich niemand nach ihm verlangt. Die Ursache war ihm indes gleichgültig; was zählte, war die Tatsache, dass er nicht gestört geblieben worden war. So konnte es weitergehen.
Aber es kam anders. Die Dümen hatte ihm für den Nachmittag zwei Mandatentermine eingetragen. Das kam der Verletzung eines Rituals gleich, aber er hatte keine Wahl und brachte es hinter sich. Mehrmals ertappte er sich dabei, dass er gar nicht zuhörte. Seine Gedanken schweiften immer wieder ab, bis ihn ein Wort oder eine Geste in die Realität zurückholte. Aber seine geistige Abwesenheit blieb unbemerkt.
Als er die Gespräche überstanden hatte, war es schon nach fünfzehn Uhr und er fühlte sich genauso ausgebrannt und leer wie gestern. Er wollte nur noch nach Hause. Aber daraus wurde nichts, denn kaum hatte der zweite Mandant die Kanzlei verlassen, betrat die Dümen sein Büro und legte ihm weitere Akten vor. Misstrauisch sah er sie an. „Was soll das werden?“
„Wonach sieht’s denn aus?“, zischte sie. „Das sind Fristsachen, die heute noch erledigt werden müssen.“ Während sie die braune Pracht wie einen Fächer vor ihm ausbreitete, funkelte sie ihn missbilligend an. „Außerdem müssen Sie unbedingt noch Herrn Matzanke anrufen, bevor Sie gehen. Er hat heute schon dreimal um einen Rückruf gebeten.“
Winter sah sie fassungslos an. „Lassen Sie die Akten dort liegen“, knurrte er und forderte sie auf, die Tür von außen zu schließen.
Die Dümen verließ wortlos den Raum, nicht jedoch, ohne kräftig die Tür hinter sich zuzuschlagen.
Ausgerechnet Matzanke, dachte er. Er war einer der Vorstände eines Unternehmens, das sich mit Abfallverwertung beschäftigte und den phantasielosen Namen PAVAG führte, was für Potsdamer Abfallverwertungs-Aktiengesellschaft stand. Wenn Matzanke anrief, war sein Anliegen zwar nicht unbedingt wichtig, aber die Kanzlei arbeitete für diese Gesellschaft und erhielt dafür monatlich ein festes Honorar. Sie war also tatsächlich eine wichtige Mandantin.
Die Verbindung kam sofort zustande. „Ah, Winter“, rief Matzanke, „schön, dass Sie zurückrufen.“
Winter verdrehte die Augen. Von wegen zurückrufen, dachte er. Das, was er gerade tat, war telefonieren und nicht rufen. „Sie hatten mich gebeten, Sie zu kontaktieren“, erwiderte er.
Der Rest des Gesprächs war ein Monolog. Matzanke berichtete über seine Verhandlungen mit einer Bank, die für die geplante Modernisierung einer Müllverbrennungsanlage günstige Zinskonditionen in Aussicht stellte. Was Matzanke wollte, war Winter sofort klar, ohne dass Matzanke es aussprach: Er wollte grünes Licht für weitere Verhandlungen haben.
Winter empfand wenig Neigung, die Daten zu notieren oder sich gar zu merken. Er wusste auch so, dass das Angebot der Bank in Ordnung war. Außerdem tat Matzanke grundsätzlich nichts, was für ihn nachteilig sein könnte, denn er hatte eine ausgesprochen tief sitzende Angst vor jeder Art von persönlicher Haftung und sicherte sich immer nach allen Seiten ab.
Winter entschied sich für ein salomonisches Vorgehen. Er sagte, dass er keine rechtlichen Bedenken habe, den Sachverhalt aber noch einmal prüfen wolle, weil er so komplex sei. Es folgten noch ein paar Höflichkeitsfloskeln, die das bevorstehende Wochenende und das Wetter betrafen, dann war das lästige Telefonat beendet.
Lustlos wandte er sich den Akten zu, die ihm die Dümen vorgeworfen hatte, wie man einem Hund lieblos Trockenfutter vorwirft. Einige hatten sich inzwischen erledigt. Winter warf sie schwungvoll auf den Leichenhaufen. Drei weitere Vorgänge hatten noch ein paar Tage Zeit. Schließlich blieben zwei Akten übrig, aber es war ausgeschlossen, dass er heute noch Schriftsätze zauberte. Er lud im Computer das Muster eines Antrages auf Fristverlängerung hoch und erfand als Begründung eine Erkrankungen, druckte die Anträge aus, unterschrieb sie und schob sie in das Faxgerät, ohne sie vorher noch einmal zu lesen.
Inzwischen war von Matzanke eine E-Mail eingetroffen. Es war Winter ein Rätsel, wie der Mann das schaffte. Vielleicht brannte er so für seine Arbeit, wie Quade, wahrscheinlicher aber hatte er nichts anderes zu tun, weil er alles von Dritten erledigen ließ.
Er schrieb zurück, dass er keine Bedenken habe, falls er sich bis Montagmittag nicht gemeldet haben würde, fuhr den Computer herunter und verließ das Büro. Die Frage der Dümen, ob er Matzanke zurückgerufen habe und was denn mit den Fristsachen sei, ignorierte er. Aber das half ihm nichts. Kaum dass er die Tür zum Vorraum mit dem diffusen Licht geöffnet hatte, rief ihm die Dümen ein vorwurfsvolles: „Herr Winter!“, hinterher.
Er erschien noch einmal in der Tür. „Es ist alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledigt“, knurrte er. Dann warf er die Tür zu. Im Vorraum empfing ihn wohltuende Ruhe. Er wollte nur noch nach Hause. Er machte noch einen Umweg zum Discounter und fuhr schließlich zu seiner Wohnung, um sie bis Sonntagabend nicht mehr zu verlassen.
2
Der Sonntagvormittag war eine gute Zeit zum Reisen. Die Sonntagsfahrer hockten noch zu Hause, die Autobahnen waren für LKWs gesperrt und der Pendelverkehr hatte noch nicht eingesetzt.
Manina Winter war auf dem Weg nach Hause. Es war ein schöner Spätsommertag. Sie fuhr der Sonne entgegen, hörte ihre Lieblingsmusik und hing ihren Gedanken nach. Sie summte vor sich hin und trommelte mit den Fingern den Takt der Musik auf das Lenkrad. Das Wochenende in Essen mit Winfried, dem treuen Freund aus früheren Zeiten, hatte ihr gut getan. Sie hatten geklönt und waren wie früher um die Häuser gezogen.
Sie war beizeiten aufgebrochen, weil sie nach der Fahrt noch ein bisschen die Sonne zu genießen wollte. Während sie sich in Gedanken schon auf ihrer Liege im Garten sah, dachte sie daran, dass Severin während ihrer Abwesenheit vielleicht noch nicht alle Aufträge erledigt haben könnte, denn er war nachlässig und übersah Arbeiten selbst dann gern, wen sie ihm ausdrücklich aufgetragen wurden. Sie rief ihn an und fragte ihn, ob er die Wäsche abgenommen, seine Shirts gebügelt und den Rasen abgeharkt habe.
„Ich will aber noch zum Fußball“, murrte Severin.
Sein Zögern war Antwort genug. Es war einer ihrer unumstößlichen Grundsätze, dass jeder im Haushalt Arbeiten zu übernehmen und unaufgefordert den einen oder anderen weiteren Auftrag zu erledigen hatte. Außerdem blieb Severin genügend Zeit, sich zu erholen, schließlich hatte er die ganze Woche Freizeit. Der Junge war Anfang zwanzig und führte das nutzlose Leben eines Schnorrers, bemühte sich nicht um Arbeit, nutzte sie stattdessen aus, war antriebslos und wirklich alles andere als ein Kämpfer. Darin ähnelte er seinem Vater, der sich fatalistisch treiben ließ, statt in seiner Kanzlei durchzustarten. Severin war selbst schuld, wenn er alles vor sich herschob. Zu Hause wollte sie es gemütlich haben und nicht die Zeit bis zum Sonnenuntergang mit Hausarbeiten vergeuden, die längst erledigt sein könnten. „Es ist doch wohl selbstverständlich, dass du dich an der Hausarbeit beteiligst“, zischte sie. „Soll etwa alles allein machen?“
Die erwartete Antwort blieb aus. „Hm“, kam es nur.
Sie wartete einen Augenblick und fragte Severin, ob er sie verstanden habe. Als keine Antwort kam und sie nachhakte, ob sie sich auf ihn verlassen könne, knurrte Severin etwas, das wie ein »Ja« klang. Dann hörte sie nur noch ein regelmäßiges Tuten.
Entsetzt schaute sie auf das Handy. Es war unfassbar, dass Severin das Gespräch einfach beendet hatte. Ein solches Verhalten seiner Mutter gegenüber war unverzeihlich. Es wurde Zeit, dass sie ein klärendes Gespräch mit ihm führte.
Dass es nie mehr stattfinden sollte, ahnte sie nicht.
Als der Wecker klingelte, war er sofort hellwach. Das Hochgefühl des Bevorstehenden hielt ihn nicht länger im Bett. Er sprang auf, duschte kalt und kochte Kaffee. Stark musste er sein, stark wie sein Entschluss.
Während er frühstückte, überzeugte er sich davon, dass die Ortung des Handys tadellos funktionierte. Es bereitete ihm eine ausgesprochen tiefe Genugtuung, sie unter Kontrolle zu haben, ohne dass sie es auch nur ahnte. Er genoss es, sie zu kontrollieren, ohne dass sie es auch nur ahnte. Inzwischen wusste er alles über sie. Für ihn war sie gläsern und berechenbar.
Das kleine rote Kreuz blinkte unablässig an der gleichen Stelle. Manina Winter befand sich noch in Essen. Wahrscheinlich war sie noch bei diesem seltsamen Freund mit den Birkenstockschuhen und Jutebeuteln.
Wenig später begann sich das Kreuz zu bewegen. Wie gebannt starrte er auf den Bildschirm. Es war jetzt kurz nach neun. Er hatte gewusst, dass sie sich zeitig auf den Weg machen würde. Als das Kreuz der Autobahn zu folgen begann, machte er sich fertig. Er hatte ausreichend Zeit; es bestand kein Anlass zur Eile. Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen.
Er schob den Laptop in seinen Rucksack, legte mehrere Paar Einmalhandschuhe dazu und zog die klobigen Schuhe an, die er gestern gekauft hatte. Er würde sie nur einmal tragen und anschließend entsorgen, auch die Hose und die Jacke. Er würde keine Spuren hinterlassen. Seine Vorbereitung war perfekt; niemand würde ihm etwas nachweisen können.
Er betrat die Garage, warf den Rucksack in den Kofferraum des Wagens, einen alten Kombi, bedeckte alles mit einer braunen Decke und legte zwei abgenutzte Spankörbe darauf.
Dann fuhr er los.
Er ließ sich Zeit, als wollte er den Gedanken an das, was jetzt abspulen würde wie ein Automatismus, genüsslich auskosten. Eigentlich hatte er noch warten und alles besser fügen wollen, aber die Gelegenheit war zu günstig, um sie ungenutzt verstreichen zu lassen. Heute endlich war der Tag, die Erwartungen, die man in ihn setzte, zu erfüllen. Die Zweifel, die ihn gestern noch beschäftigt hatten, waren verflogen, als hätte es sie nie gegeben.
Gemächlich rollte er seinem Ziel entgegen. Im Radio lief leise Musik. Wenn sich der Verkehrsfunk ankündigte, stellte er lauter. Aber die Meldungen betrafen jedes Mal eine andere Strecke.
Nach wenigen Kilometern verließ die Bundesstraße und folgte einer holprigen Landstraße bis zu einem Waldstück. Er reduzierte die Geschwindigkeit und bog in einen ausgefahrenen Waldweg ein, der so trocken war, dass Staub aufwirbelte. Der Staub war Bestandteil seines Planes. Er würde alle Spuren verhüllen wie frisch gefallener Schnee.
Er fuhr bis zu einer Lichtung, stellte den Motor ab und stieg aus. Sofort umfing ihn der Geruch des Waldes, den er so mochte. Er zündete sich eine Zigarette an und sog den Rauch tief ein, während er sich auf die Umgebung konzentrierte. Außer einem leisen Grummeln, das von der Autobahn herüberkam, war nichts zu hören. Er war allein inmitten einsamer Natur.
Er legte die Kippe sorgsam in den Aschenbecher, dann startete er den Wagen und fuhr auf das Ende der Lichtung zu. Erst als tiefhängende Äste die Motorhaube berühren, wurde ein Weg sehen, der so schmal war, dass der Wagen gerade noch zwischen den Bäumen hindurch passte. Er fuhr weiter, bog scharf nach rechts ab, wendete und stellte den Motor ab. Hinter ihm schloss sich das Astwerk wie ein grüner Vorhang. Er verharrte einen Augenblick, dann stieg er aus und lauschte. Es war kein verdächtiges Geräusch zu hören.
Er nahm aus dem Kofferraum zwei Kennzeichen und tauschte sie gegen die am Auto aus. Die abmontierten Bleche legte er mit der Schrift nach unten in den Kofferraum, nahm seinen Rucksack und stellte ihn auf den Waldboden. Dann zog er das Fahrrad heraus, lehnte es an einen Baum und breitete sorgfältig die Decke über den Kofferraum aus. Er legte die Spankörbe auf die Decke, schloss sanft die Kofferklappe und betrachtete kritisch den Anblick. Er war zufrieden.
Dann nahm er den Rucksack und folgte mit dem Rad einem schmalen Pfad, der nicht weiter war als eine ausgefahrene Spur, den sich die Natur noch nicht wieder vollständig zurückgeholt hatte. Nach wenigen Minuten erreichte er eine Anhöhe, die sich wie aus dem Nichts plötzlich im Wald erhob und zu einer Brücke führte, die sich über die Autobahn spannte. Er stieg ab und schob das Fahrrad unter einen Strauch, dessen Äste den Boden berührten.
Die Brücke war gesperrt. Am Geländer hingen immer noch die Transparente mit den großen roten, handgeschriebenen Lettern: „Wir wollen keine Autobahnabfahrt“. Wenn er sich geschickt bewegte, war er von der Autobahn aus nicht sehen.
Langsam, als vollführe er ein Ritual, ging er zur Brücke hinauf. Die Sträucher, die den Weg säumten, boten nach beiden Seiten Blickschutz. Außer ihm war hier niemand, aber das konnte sich jederzeit ändern, denn die Sperrung hielt niemanden davon ab, die Brücke zu benutzen. Aber das, was er vorhatte, würde nicht lange dauern.
Er trat auf die Brücke hinaus. Unter ihm rauschte der Verkehr. Am Brückenrand lagen ein paar glatt behauene Granitsteine. Er streifte sich die Plastikhandschuhe über und wog einen von ihnen in der Hand. Er hatte nur einen Versuch; wenn der misslang, war alles vorbei. Eine weitere Chance hatte er nicht.
Er kniete sich hinter eines der Transparente, stellte den Rucksack neben sich, legte den Laptop darauf und schaltete ihn ein.
Es dauerte lange, bis die Verbindung hergestellt war, schließlich aber sah er das vertraute Blinken des kleinen Kreuzes. Sie war jetzt nicht mehr weit entfernt. Er nahm das Fernglas und beobachtete den Fahrzeugstrom. Noch in einiger Entfernung konnte er Einzelheiten erkennen. Er musste darauf vertrauen, dass es gelang. Es musste gelingen! Er durfte die Erwartungen nicht enttäuschen. Sein Blick wechselte jetzt beständig zwischen dem Fahrzeugstrom und dem sich nähernden Kreuz. Der Stein lag griffbereit neben ihm. Als das Kreuz schließlich fast auf Höhe der Brücke war, blickte er durch das Fernglas und konzentrierte sich allein auf den Fahrzeugverkehr. Alles andere um ihn herum schien er vergessen zu haben.
Da war sie! Sie fuhr, wie er es erwartet hatte, auf der Mittelspur und näherte sich schnell. Ihm blieb keine Zeit, er musste sofort handeln. Das, was er gedanklich immer wieder durchgespielt hatte, spulte er nun ab wie einen antrainierten Mechanismus. Er korrigierte seine Position etwas nach links, griff den Stein und hob ihn über die Brüstung.
Dann ließ er den Stein fallen.
Alles hatte nur Bruchteile einer Sekunde gedauert, aber er hatte das Gefühl, die Zeit sei stehengeblieben. Er zählte bis fünf, dann lief er gebückt auf die andere Seite. Das, was er durch das Loch im Transparent sah, erfüllte ihn tiefer Befriedigung: Er hatte getroffen. Der Wagen war hinter der Brücke in den Wald gerast und frontal gegen einen Baum geprallt. Aus dem Motorraum, der wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben war, schoss eine Stichflamme. Er starrte wie gebannt auf das Bild wie auf eine Theaterkulisse. Der Anblick hatte etwas Faszinierendes. Obwohl ihn seine innere Stimme drängte, schnellstens zu verschwinden, konnte er sich nicht abwenden.
Plötzlich geschah das Unfassbares: Ein Schatten huschte unter der Brücke hervor. Ein Mann lief auf das brennende Auto zu. In der Hand trug er etwas Rotes, an dem er hektisch hantierte. Noch war der Mann von der Situation völlig in Anspruch genommen, aber er konnte jeden Augenblick zur Brücke hinaufsehen und ihn entdecken. Der Gedanke lähmte ihn. Er hatte alles akribisch geplant, war den Ablauf immer und immer wieder durchgegangen, hatte alle Eventualitäten erwogen und seinen Plan immer weiter verfeinert, aber dass es einen Zeugen geben könnte, war in seinen Strategiespielen nicht vorgekommen. Der Mann stand keine dreißig Meter von ihm entfernt und sprühte Schaum auf das brennende Fahrzeug. Er vollführte einen Halbkreis um den Motorblock, aus dem es jetzt zu qualmen begann, und schwenkte einen Strahl weißen Schaumes auf die langsam versiegenden Flammen. Sein Pferdeschwanz wippte im Rhythmus der Bewegungen.
Gebückt verharrte er einen Augenblick, dann aber ergriff ihn Panik. Er sprang auf, steckte den Laptop und das Fernglas in den Rucksack und rutschte den Abhang hinunter. Unten jedoch hielt er inne. Obwohl es auf jede Sekunde ankam, bog er die Äste des Strauchwerks auseinander und sah einen Lieferwagen, der zu dem Mann gehören musste.
Er riss das Handy aus der Tasche und fotografierte den Wagen. Dann lief er, von unbändiger Angst getrieben und ohne auf Deckung oder lautlose Bewegung zu achten, davon. Er schaute weder nach links noch nach rechts. Bloß weg, dachte er. Er zerrte das Rad aus dem Gebüsch, warf sich den Rucksack über und fuhr davon.
Er hatte keinen Zweifel, dass die Frau tot war. Der Mann mit dem Pferdeschwanz war zu spät gekommen.
Er schob das Fahrrad in den Kofferraum und warf den Rucksack hinterher. Er ließ alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht, breitete weder die Decke über das Fahrrad aus, noch vergewisserte er sich an der Einmündung des Weges, dass er allein war, sondern fuhr, ohne am Hauptweg anzuhalten, zur Straße und folgte ihr einige hundert Meter. Dann bog er in einen Waldweg ein und tauschte die Nummernschilder. Die falschen Schilder vergrub er zwischen Reisig und Nadelstreu.
Als er die Bundesstraße erreichte, hörte er in der Ferne ein Martinshorn. Obwohl erst wenige Minuten vergangen sein konnten, hatte er das Gefühl, der Steinwurf läge schon eine Ewigkeit zurück. Was immer jetzt geschehen würde, die Planungsspiele hatten mit dem Fallen des Steins ihren Abschluss gefunden.
Während er auf Umwegen zurückfuhr, beruhigte er sich allmählich. Tote redeten nicht. Er hatte keinen Fehler gemacht und bezweifelte inzwischen, dass ihn dieser Mann mit dem Feuerlöscher gesehen oder gar erkannt haben könnte. Niemand konnte eine Verbindung herstellen. Er hatte es geschafft.
Er stellte den Wagen in die Garage und räumte seine Sachen heraus. Dann rief er das E-Mail-Programm Manina Winters auf, beendete die Überwachung des Handys und bezahlte die Rechnung von ihrem Konto. Er wartete auf die Kündigungsbestätigung und formatierte anschließend die Festplatte. Dann zog er Hose, Jacke und Schuhe aus und steckte alles in den Ofen im Keller. Er sah den Flammen zu, wie sie sich der einzigen Beweismittel, die es gab, bemächtigten. Dann wählte er auf dem Handy eine Nummer. Die Verbindung kam sofort zustande. Er fasste sich kurz. Erfolgsmeldungen mussten knapp und präzise sein, um ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Nein, sagte er, aber er habe alles im Griff.
Dann tat er etwas, das er nicht geplant hatte: Er führte ein zweites Telefonat und versandte anschließend das Bild vom Lieferwagen.
Im Hochgefühl des Geleisteten zog er sich in die Küche zurück und trank mit Genuss ein Bier. Der Augenblick gehörte ihm, ihm ganz allein.
Dann verließ er das Haus, überquerte die Wiese und lief an den Fichten vorbei bis zum Palisadenzaun. Eine der Palisaden wurde nur durch eine Schlaufe gehalten und ließ sich soweit verschieben, dass eine Person hindurchschlüpfen konnte. Nachdem er das Grundstück verlassen hatte, schaukelte das Brett in seine Ausgangstellung zurück.
Dichter Wald umfing ihn wie ein schützender Mantel. Allmählich fiel die Anspannung von ihm ab, und eine bleierne Müdigkeit erfasste ihn.
3
Wim Wallantin war der Herr über Bildschirme, Tastenpulte und Telefone, vor denen er mit gewichtiger Miene thronte. Er hatte eine Zeitung vor sich ausgebreitet und trank aus einer großen Tasse Kaffee. Eigentlich hieß er Wilhelm, aber niemand nannte ihn so, niemand außer seiner Frau. Wenn sie, was selten geschah, mit Nachdruck in der Stimme diesen Namen rief, wusste er, dass sich Ärger anbahnte. Man nannte ihn Wim.
Er hatte bereits einige Unfälle aufgenommen, alles kleinere Sachen ohne Personenschaden, nichts Spektakuläres, nur eben der ganz normale Kram, der sich tagtäglich ereignete. Am späten Vormittag hatte ein Mann angerufen und darüber lamentiert, dass er seinen Schlüssel im verschlossenen Wagen zurückgelassen hatte. Wim hatte ihn nachdrücklich aufgefordert, den Notruf der Polizei nicht für solche Banalitäten zu missbrauchen und dann ein Monteurfahrzeug losgeschickt. Jemand anderer hatte ihm einen Hund und zwei Kühe gemeldet, die auf der Autobahn herumliefen. Ansonsten war der Dienst bisher ruhig verlaufen.
Seine Aufgabe in der Leitstelle der Potsdamer Polizei war Routine. Sie bestand darin, Informationen schnell und präzise an die richtigen Stellen weiterzuleiten. Dafür gab es Checklisten, die ausgebreitet unter seiner Zeitung lagen.
Als die Unfallmeldung einging, blieb er gelassen. Die ständige Konfrontation mit Schicksalen hatte ihn abgestumpft. Auf der Bundesautobahn 2 in der Nähe eines kleinen Dorfes, von dem er noch nie etwas gehört hatte, war ein Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst gegen einen Baum gefahren. Er notierte die Daten und verständigte die Unfallbereitschaft, den Notarzt und, weil das Unfallfahrzeug brennen sollte, die Feuerwehr. Der Anrufer hatte zwar weder seinen Namen, noch seine Rufnummer hinterlassen, aber Wim hatte sie auf dem Display mitlesen können.
Die Angelegenheit war in weniger als zwei Minuten erledigt. Dann widmete sich dann wieder seinem Kreuzworträtsel.
Bodo Franke hatte an diesem Sonntagnachmittag Dienst in der Unfallbereitschaft. Er nahm den Anruf ähnlich gelassen entgegen. Wer ungebremst gegen einen Baum fuhr, dachte er, hatte es vermutlich nicht anders gewollt. Gemeinsam mit seinem Kollege Jan Schätzke verließ er den Autohof und machte sich auf den Weg zur Unfallstelle.
Schon von weitem sah er die Rauchsäule, die wie ein graues Fanal in den blauen Himmel strebte. Der Verkehr staute sich an der Unfallstelle, weil Feuerwehrfahrzeuge eine Spur und den Standstreifen blockiert hatten. Sie hielten hinter einem Löschzug, der unter einer Brücke stand, und Franke ging in Richtung der Rauchsäule. Er sah zwei Feuerwehrmänner mit Gasmasken, die einen leblosen Körper neben einem roten Kleinwagen auf den Boden legten und mit einer Plane bedeckten. Wer immer darunter lag, hatte den Unfall nicht überlebt.
„Mojn, mojn“, rief Franke. Er zeigte auf die Plane. „Was is‘n passiert?“
Die beiden Feuerwehrmänner streiften sich die Gasmasken von den verschwitzen Gesichtern und sahen sich an. Sie waren grundverschieden. Während der eine klein und untersetzt war und schwer an seiner Ausrüstung zu tragen schien, wirkte der andere, als sei ihm die Uniform zu eng. Der Kleine zog den Helm vom Kopf und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß aus dem Gesicht. „Wonach sieht‘s denn aus?“, fragte er. „Die Frau ist frontal gegen den Baum gerast. Wahrscheinlich war sie lebensmüde. Die Strecke ist schnurgerade. Da kommt einer nur dann von der Fahrbahn ab, wenn er es will …“
„ …oder wenn er einpennt“, ergänzte der Andere. Er hockte sich neben die Plane und zog sie glatt. „Es ist kein schöner Anblick. So etwas überlebt niemand: Alte Karre, keine Knautschzone. Es ist unverantwortlich, mit so einer Möhre loszufahren. Aber die Straßen sind voll davon.“
Franke kniete sich neben die Plane. Er zögerte einen Augenblick, dann hob er sie an. Der Anblick erschütterte ihn bis ins Mark; er übertraf alles, was er an Unfallopfern bisher gesehen hatte. Das Gesicht war nicht mehr zu erkennen. Der Kopf war regelrecht zertrümmert, als sei er mit großer Kraft eingedrückt oder gegen ein Hindernis geschleudert worden. Die Kleidung, ein ursprünglich gelber Blazer und ein weißes Shirt, waren mit Blut und Hirnmasse geradezu durchtränkt. Überall lagen Glassplitter.
Plötzlich war der kräftige Feuerwehrmann neben ihm. „Es gibt keine Bremsspur. Es ist nicht mal auszumachen, ob die Frau scharf nach rechts lenkte oder allmählich von der Fahrbahn abkam.“
„Die Frau hat nicht mehr gewollt“, mischte sich der Kleine ein. Er wischte einen Stiefel an einem Grasbüschel ab und rülpste ungeniert. „Sie war lebensmüde, wenn du mich fragst.“
„Es fragt dich aber niemand“, erwiderte sein Kollege scharf. „Vielleicht hat sie ja gepennt – wie du es ständig tust.“
Der Wortwechsel war Franke zu banal. Er betrachtete unentwegt die blutige Masse von Fleisch, Knochen und Hirn, als ließe sich in dem Anblick wie in einem offenen Buch lesen.
In diesem Augenblick geschah etwas Seltsames: Ein Sonnenstrahl fiel auf den Kopf der Toten, und es schien, als wachse eine seltsam flimmernde Reflexion wie eine Quelle kleiner Lichtbündel daraus hervor. Fasziniert starrte Franke auf das Lichtspiel. Er begriff, dass sich Glaspartikel in der blutigen Masse befinden mussten.
Er ließ die Plane zurückfallen und erhob sich. Aus dem Motorraum drang beißender Qualm. Der Aufprall hatte die Motorhaube aufgebogen. Sie hing nur noch an einem der beiden Scharniere, und es roch nach verbranntem Gummi.
„So, wie das hier qualmt, hat der Wagen doch sicher gebrannt wie eine Fackel", vermutete Franke. „Wieso hat das Feuer nicht auch den Innenraum erfasst? Und wieso ist die Karre nicht explodiert?"
Der kleine Feuerwehrmann reckte die Brust. „Das liegt vermutlich daran, dass wir so schnell gewesen sind“, sagte er.
„Unsinn“, rief der andere und versetzte seinem Kollegen einen Stoß in den Rücken. „Der Brand war bereits gelöscht, als wir eintrafen."
Franke machte große Augen. „Sag das noch mal.“
„Du hast mich schon verstanden, Kollege. Das Auto brannte nicht mehr. Monoammoniumsulfat, wenn du mich fragst.“
„Mono … was? Meinst du einen Feuerlöscher? Aber die Frau kann doch unmöglich selbst …“
„Gelöscht haben?“, fragte der Kleine und grinste. „Nie und nimmer konnte sie das. Die war hin, kaum dass sie an den Baum geknallt ist. Der Feuerlöscher ist ja auch verschwunden. Es sieht also ganz so aus, als habe einer draufgehalten, bis nichts mehr brannte.“
Franke war verblüfft. „Fragt sich nur, wer.“
„Wir haben ihn nicht“, erwiderte der kräftige Feuerwehrmann. „Hier war niemand, den wir hätten arretieren können.“
„Ihr meint, da hat einer gelöscht und ist dann abgehauen?“, fragte Franke. Aber ihm war bereits klar, dass es so war.
Der kräftige Feuerwehrmann schob seinen Helm in den Nacken. „Sieht ja wohl ganz danach aus.“ Dann zeigte er auf die Plane. „Die hätten wir übrigens gern zurück, wenn ihr hier fertig seid.“
Franke sah den Feuerwehrleuten nach. Die haben Sorgen, dachte er. Eine Frau ist auf tragische Weise ums Leben gekommen, und die haben Angst um ihre Plane.
In diesem Moment erschien sein Kollege Jan Schätzke. Er schwankte langsam auf ihn zu. In dem hohen Gras wirkte er noch kleiner, und die Uniform spannte über seinem gewaltigen Bauch.
„Wo hast’n gesteckt?“, fragte Franke.
„Telefoniert“, erwiderte Schätzke kurzatmig. Er kniete sich vor die Plane und hob sie an. „Man, das sieht ja schlimm aus. Ich dachte immer, Frauen sind die besseren Autofahrer.“
„Das sind sie ja auch“, konterte Franke energisch. „Im Prinzip jedenfalls. Wenn du mich fragst, ist an der Sache etwas faul. Das rieche ich.“
„Ach was. So sieht sowas nun mal aus, wenn eine aus dem Leben scheiden will. Wir müssen uns an die Fakten halten. Die Frau ist mit hoher Geschwindigkeit in den Wald gerast. Voll an den Baum.“ Er zuckte mit den Schultern und ließ die Plane los.
„Wenn einer nicht mehr will, zieht er einen Brückenpfeiler oder eine Mauer vor“, beharrte Bodo Franke. „Schau dir doch nur mal das Gesicht an.“
„Welches Gesicht?“ Schätzke erhob sich schnaufend. Seine Kniegelenke knackten. Er klappte ein Klemmbrett auf und begann, in einer Liste Kreuze zu machen.
Franke fühlte sich nicht ernstgenommen. „Lass bloß deine sarkastischen Sprüche! Hilf mir lieber beim Denken.“
„Damit bin ich längst fertig.“ Schätzke blätterte er eine Seite weiter. „Du könntest Fotos machen, statt zu philosophieren. Sei doch ehrlich: Du kannst den Anblick nicht ertragen.“
Franke zögerte, bevor er sagte: „Ich frage mich, wie die Glassplitter in das Gesicht gelangt sind. Die Feuerjungs meinen, der Wagen sei ungebremst gegen den Baum geknallt“, sagte er wie zu sich selbst. „Du sagst das ja auch. Der Aufprall war demzufolge so stark, dass die Glassplitter nach draußen geschleudert worden sein müssten. Das sind sie aber nicht.“
Schätzke hielt inne und schüttelte herablassend den Kopf. „Weißt du was, Bodo Franke: Das ist eine logische Folge des Aufpralls. Wach auf, und tue das, wofür du bezahlt wirst, oder willst du eine Eintrittskarte für die Kripo lösen? Man munkelt ja, dass du zu der Truppe wechseln willst. Die haben gerade auf so einen wie dich gewartet, glaub mir. Rufe die Jungs doch an. Die machen dich fertig, sage ich dir. Die falten dich zusammen wie einen Pappkarton, weil du dir da was zusammenfaselst und denen den Sonntag versaust.“
„Rede keinen Stuss!“ rief Franke. „Du musst dich doch auch fragen, warum das Gesicht so zerfetzt ist. Die Frau ist doch bei dem Aufprall aus dem Sitz nach vorn geschleudert …“
Plötzlich durchzuckte ihn ein Gedanke, und er begriff, dass er einen Denkfehler gemacht hatte. Ohne auf Schätzkes entrüstete Frage zu reagieren, wovor er denn weglaufe, lief er zum Feuerwehrfahrzeug, das sich inzwischen in Bewegung gesetzt hatte. Der Kräftige ließ die Scheibe der Beifahrertür herunter und fragte: „Was rennst ‘n so? Bringst du die Plane, oder hast du am Ende noch was entdeckt?“
Franke fragte, ob die Frau angeschnallt gewesen sei.
„Klar war die angeschnallt“, kam es aus dem hinteren Bereich des Wagens. „Alle Frauen schnallen sich an.“
„Sicher?“
„Ganz sicher.“
Franke bedankte sich und hob grüßend die Hand. Er sah dem Fahrzeug nach, während sich seine Gedanken überschlugen.
Als er wieder am Unfallwagen war, überhörte er Schätzkes missbilligende Frage, was er bloß treibe, öffnete die Fahrertür und schaute in das Innere des Unfallwagens. Überall lagen Splitter, selbst im Halbdunkel des Fußraumes.
„Und wenn du in die Karre hineinkriechst“, spottete Schätzke, während er weiter seine Kreuze machte, „du wirst nichts entdecken, das irgendjemanden interessieren könnte. Hör auf herumzuschnüffeln und tu einfach deine Arbeit. Ich habe wirklich keine Lust, hier alles allein zu machen, nur weil du Sherlock Holmes spielen musst.“
Aber Franke beachtete den Wortschwall nicht. Er ließ das Bild auf sich wirken, bis ihm schließlich doch etwas auffiel. Es war, als schäle sich aus dem Halbdunkel ein Schatten mit gleichmäßigen Rändern hervor. In dem Zwielicht sah er aus wie Strickwerk aus grober grauer Wolle, das zwischen den Pedalen lag.
Er erhob sich. „Ich brauche eine Taschenlampe.“
Schätzke schüttelte den Kopf. „Findest du nicht, dass du es jetzt übertreibst? Es ist taghell.“
Franke holte aus dem Streifenwagen eine Lampe und leuchtete den Fußraum aus. Als der Lichtstrahl auf das Graue fiel, erschauerte er. Verdammte Scheiße, dachte er und sagte wie zu sich selbst. „Ich hab´ geahnt, dass hier was nicht stimmt.“
Schätzke sah verächtlich zu ihm herunter. „Das hätte ich dir auch sagen können“, erwiderte er. „Bei dir stimmt was nicht. Was ist es denn? Sag‘s schnell und gib dann endlich Ruhe. Ich muss dir doch nicht sagen, was hier wirklich wichtig ist.“
Franke erhob sich. Er trug die Taschenlampe wie ein Knüppel in der Hand und sagte ernst: „Das war kein Verkehrsunfall, es sieht nur so aus. Du kannst mit dem Schreiben aufhören. Das war kein Selbstmord. Und ein Unfall war es auch nicht.“
Schätzkes zog die Mundwinkel nach unten. „Wonach sieht’s denn deiner Meinung nach aus?“
Franke hielt ihm die Taschenlampe hin. „Schau es dir an. Es liegt neben dem Bremspedal und ist nicht zu übersehen. Nicht mal für dich!“
Schätzke hob abwehrend die Hände. „Nun mach es doch nicht so theatralisch. Sage mir einfach, was es ist, ich glaube dir schon.“
„Ein Pflasterstein.“
Während sich Schätzke sich von der Entdeckung überzeugte, wählte Franke auf seinem Handy eine Nummer. Während er sprach, drehte er sich zur Brücke. Dabei fiel sein Blick auf ein Transparent, das am Geländer der Brücke hing. Fassungslos starrte er darauf.
Sie hatten sofort den gleichen Gedanken. „Verdammter Mist“, grunzte Franke, nachdem er das Telefonat beendet hatte. „Das war totsicher kein Verkehrsunfall.“
Kurt Wießner verbrachte den Sonntag zu Hause. Es war seit vier Wochen sein erster freier Tag. Er schlief, bis es wirklich nicht mehr ging, frühstückte ausgiebig auf der Terrasse und beschloss anschließend, gar nichts zu tun. Im Schatten der Hecke liegend versuchte er, an nichts zu denken. Aber es gelang ihm nicht. Zu viele Dinge durchgeisterten seinen Kopf: Seine Arbeit, an die er eigentlich zuletzt denken wollte, seine Tochter Susanne, die er anrufen sollte und die er viel zu selten sah, und sein Haushalt, den er genauso vernachlässigte wie seinen Garten. Auf Anhieb fielen ihm fünf Arbeiten ein, die seit Wochen auf Erledigung warteten. Aber er sah nur in das Laub des alten Apfelbaums in den Himmel und beschloss, nichts zu tun, sondern die Erkenntnis zu genießen, dass es angenehm war, zu faulenzen. Es war Sonntag, und er hatte sich das Nichtstun redlich verdient.
Die Wärme machte ihn schläfrig. Er schloss die Augen. Beinahe wäre er eingeschlafen, wenn sich nicht ein lästiges Insekt angeschickt hätte, seine Nase zu erkunden. Mehrmals verscheuchte er den lästigen Kriecher mit der Hand, bis das Tier schließlich aufgab und wegflog.
Die ersehnte innere Ruhe stellte sich jedoch nicht ein. In der Ferne hupte ein Auto, dann hörte er das Geräusch eines herannahenden Drachenfliegers, der über ihm zu kreisen schien. Immer am Sonntag, dachte Wießner. Er wusste, dass es mit der Nachmittagsruhe nichts werden würde. Er konnte nicht abschalten.
Wenig später wusste er, dass es wirklich vorbei war, denn er hörte plötzlich ein Geräusch, das unangenehm war wie Nadelstiche in die Fingerkuppe. Er konnte es nicht ignorieren, denn es wiederholte sich hartnäckig und beherrschte ihn sogar aus der Ferne. Das Handy würde immer und immer wieder klingeln, bis er abnahm.
Grummelnd erhob er sich und ging ins Haus. Für einen Augenblick war Ruhe, dann aber klingelte es erneut. Es war besser, er brachte es hinter sich.
„Wer stört?“, blaffte er übergangslos. Was er zu hören bekam, machte ihn sofort zornig. „Seid ihr nicht Manns genug, das selbst zu klären?“, fragte er. „Das ist doch nichts für uns.“ Dann legte er auf.
Er wollte nicht glauben, dass man ihm jetzt schon wegen eines Verkehrsunfalls die so selten vergönnte Sonntagsruhe raubte. Sollten sich doch die Jungs von der Rechtsmedizin darum kümmern. Wenn die etwas fanden, konnte er sich der Sache immer noch annehmen. Dass er devot mit „Herr Kriminalhauptkommissar“ angesprochen worden war, änderte an seinem Unmut nichts. Solche Todesfälle waren zwar tragisch, aber erst einmal nichts für die Mordkommission. Seit Wochen war er jeden Tag im Präsidium gewesen. Jederzeit konnte das Wetter umschlagen und in den Herbst übergehen. Wer wusste schon, wann wieder ein so wundervoller Tag sein würde, an dem er frei hatte.
Kurt Wießner war dreiundfünfzig Jahre alt und geschieden. Er war groß, neigte zur Körperfülle und hatte lichtes graues Haar. Er war wegen einer Trotzreaktion Polizist geworden; sein Vater hatte gewettert und damit gedroht, ihn zu enterben, falls er diesen Plan nicht sofort aufgab. Was kümmert mich mein Erbe, hatte Wießner trotzig gedacht und war in die Polizeischule eingetreten. Der Vater hatte seine Drohung zwar sofort wahrgemacht, aber es war ganz anders gekommen. Der jähzornige Alte war nämlich zeitig gestorben von seiner Witwe beerbt worden. Und als sie nach langer, elender Krankheit verstorben war, hatte sie Wießner das Haus hinterlassen. Seither wohnte er in dem Elternhaus, das ihm sein Vater missgönnt hatte.
Seit zehn Jahren leitete Kurt Wießner die Mordkommission im Potsdamer Polizeipräsidium. Er hatte es sich abgewöhnt, bei jedem Todesfall, zu dem er gerufen wurde, von einem Mord auszugehen. Trotzdem blieb ihm nichts anderes übrig, als der Sache nachzugehen.
An der Unfallstelle war eine Fahrbahn gesperrt. Wießner musste sich am Stau vorbeidrängen, der inzwischen mehrere Kilometer weit zurückreichte. Schon von Weitem sah er die Schaulustigen auf der Autobahnbrücke. Sie drängten sich am Brückengeländer, als hindere sie eine Meute wütender Hunde daran, weiterzugehen. Es war immer das Gleiche: Die Neugier der Menschen war unausrottbar und für die Ermittlungen hinderlicher als Platzregen.