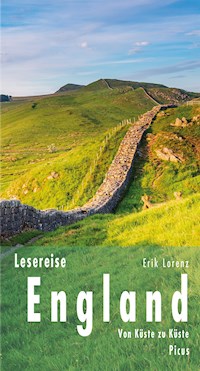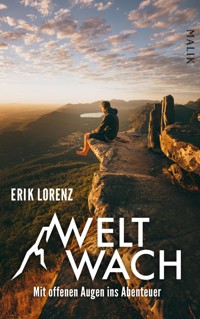Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Preis der Hoffnung
- Sprache: Deutsch
September 1941. Im Auftrag der britischen Geheimorganisation SOE landet Mathieu Trudeau mit einem Agententeam in Nordfrankreich. Ihre Aufgabe: der Aufbau eines französischen Widerstandsnetzwerks, das die Kriegsproduktion der deutschen Besatzungsmacht sabotieren soll. Doch nach ihrem Fallschirmabsprung geht alles schief: Die Agenten werden von deutschen Soldaten erwartet, an die sie verraten wurden. Mathieu gelingt die Flucht. Noch erschüttert von seinem verheerenden Misserfolg, erfährt er kurz darauf vom Aufbau einer geheimen Panzerfabrik, deren Produktion das militärische Kräfteverhältnis entscheidend zugunsten der Deutschen beeinflussen könnte. Mathieus Ziel ist nun klar: Unter allen Umständen will er einen Weg finden, die Fabrik aus dem Untergrund heraus zu zerstören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
EINS
Der Absprung, den sie planten, war gewagt. Sie sprangen blind. Ins Dunkle. Ins Ungewisse. Keine Signallichter, die für den Piloten die richtige Stelle kennzeichneten, keine Widerstandsgruppe, die die sechs Agenten nach ihrer Ankunft verstecken würde. Nichts. Niemand. Seit der deutschen Invasion und Besatzung weiter Teile Frankreichs waren bereits fünfzehn Monate vergangen, doch es gab noch keinen Ring aus Geheimdienstagenten, der sie empfangen würde. Es gab nur sie.
Aber ihnen lief die Zeit davon. Je länger sie hier oben kreisten, desto größer war die Gefahr, dass sie entdeckt wurden.
Mathieu öffnete den Sprungdeckel seiner Taschenuhr und hielt sie in das schwache Licht, das eine flackernde Lampe in den Frachtraum warf. Zwei Uhr morgens. Der Whitley-Bomber kreiste schon seit einer halben Stunde über dem Gebiet, in das sie abspringen wollten.
Viel zu lange.
„Ich gebe uns noch höchstens fünf Minuten“, rief er, „dann springen wir!“
„Wir müssen das Zielgelände eindeutig identifizieren“, entgegnete Léon, der Waffenspezialist des Teams. Er saß gegenüber von Mathieu auf dem Boden des Flugzeugrumpfes. „Alles andere ist zu riskant, Capitaine.“
Mathieu knetete seine Finger und dachte erneut darüber nach, was sie am Boden erwarten mochte, wenn sie irgendwo im Nirgendwo landeten statt im Zielgebiet. Léon hatte recht. Die Gefahren waren unkalkulierbar. Aber hier oben zu bleiben, war keine Alternative.
„Noch zwei Minuten!“, rief Mathieu mit einem Blick auf seine Uhr, stand auf und ging gebückt in Richtung Cockpit. Er streckte die Arme aus und hielt sich an den Wänden fest. Mit dem Fallschirmgurtzeug, dem Fluganzug und seinem Gepäck, das er in den Anzug gestopft hatte, konnte er sich kaum bewegen. Er hatte das Gefühl, als würde er bergab laufen. Verringerte der Pilot entgegen seiner Anweisung die Flughöhe? Auch wenn es keine Fenster gab, spürte er, dass der lange, kastenförmige Rumpf sich zur Nase hin senkte.
Er ging über den Bombenraum hinweg, zwischen den Flügeln und durch eine Tür in einer Trennwand hindurch, vorbei am Funker zum Cockpit. Es war eng hier vorn. Mathieu beugte sich über die Sitzlehne des Piloten und studierte die Anzeigen. Er wollte sich vergewissern, ob ihre Flughöhe wie von ihm angeordnet einhundert Meter betrug. Sie stiegen sogar leicht, und er erinnerte sich, dass die seltsame Flughaltung mit der Nase nach unten eine spezielle Eigenschaft der Whitley war. Dann schaute er nach draußen: Direkt vor ihm, unterhalb des Cockpits, befand sich der Drehturm mit dem Maschinengewehr. Links und rechts davon dröhnten die Motoren. Schräg hinter ihm waren die beiden großen, dicken Tragflächen. Das Querruder an der linken Tragfläche bewegte sich nach oben, der Flügel wurde nach unten gedrückt, das Flugzeug begann eine langgezogene Kurve.
Schon wieder.
Der Copilot, der zugleich Navigator war, spähte in die Nacht hinaus und schüttelte den Kopf. Er drehte sich auf seinem beweglichen Sitz abwechselnd in Richtung Heck, wo sich der Kartentisch befand, und in Richtung Bug, um nach draußen zu schauen. Er verglich die Linien, Farben und Symbole auf dem Papier mit den Schemen, die er in der Dunkelheit unter sich erahnte, versuchte Geländemerkmale zu erkennen, die Orientierung schaffen konnten. Einen Hügel vielleicht oder einen Feldweg oder ein Gebäude.
Die Verdunkelung, die über Nordfrankreich verhängt worden war, verbarg mögliche Anhaltspunkte vor ihren Blicken. Sie hatten eine Vollmondnacht gewählt, und die Wettervorhersage hatte einen klaren Himmel versprochen. Doch schon als sie den Ärmelkanal zur Hälfte überquert hatten, waren sie an den ersten Nebelfetzen vorbeigeflogen. Nun verdeckten über ihnen dichte Wolkenberge den Mond: Wo sein kaltes Licht die Nacht hätte erhellen sollen, war nur Dunkelheit, durchsetzt mit grauen Ahnungen.
Es war nicht zu leugnen: Ihr Plan ging nicht auf. Aber umkehren kam für Mathieu nicht infrage.
„Was ist los?“, rief er Pilot und Copilot zu – er musste schreien, um den Lärm der Motoren zu übertönen.
„Östliche Winde müssen uns abgetrieben haben“, antwortete der Copilot. „Außerdem leichter Leistungsabfall im Steuerbordmotor. Wir haben gegengesteuert, müssen aber von der Route abgekommen sein.“
Mathieu legte seine Stirn in Falten. Die Piloten suchten nicht nur vergebens das Zielgebiet, sie kannten auch ihre eigene Position nicht. Diese berechneten sie mit einer Methode, die schon dann ungenau war, wenn alles problemlos verlief: mithilfe der Richtung, in der sie geflogen waren, ihrer Geschwindigkeit und der Zeit, die seit dem Start verstrichen war. Auf der Grundlage dieser drei Parameter konnten sie ungefähr bestimmen, wo sie sich befanden – aber nicht, wenn Wind oder ein Leistungsabfall in einem der Motoren sie vom Kurs abbrachte.
So oder so war der fortwährende Abgleich der Berechnungen mit den tatsächlichen Geländemerkmalen unerlässlich. Dazu mussten sie allerdings etwas sehen.
Doch der Mond ließ sich nicht blicken.
„Sehen Sie irgendwas?“, fragte Mathieu. „Eine größere Straße? Eine Flussbiegung? Ein Waldstück? Eine Bahnlinie?“
Der Pilot schüttelte den Kopf. „Wir sind über ländlichem Gebiet. Vor ein paar Minuten haben ein paar schwache, einzelne Lichter geleuchtet. Auf dem Land nehmen es manche Leute mit der Verdunkelung nicht ganz so genau. Mein Gefühl sagt mir, dass wir in der Nähe sind.“
„Gut. Wir springen jetzt.“
„Geben Sie uns noch zehn Minuten! Wir finden es! Am Horizont haben wir eine Gemeinde gesehen – es könnte La Chapelle-d'Armentières sein.“
Mathieu überlegte. Warten und weitersuchen? Sie hatten längst die Region Nord-Pas-de-Calais im nördlichsten Zipfel Frankreichs erreicht, nahe der Grenze zu Belgien. So viel stand fest. Und irgendwo dort unten befand sich das sorgsam ausgewählte Zielgebiet für ihren Absprung. Aber auch diese Gegend würde keine Sicherheit garantieren: Ins Unbekannte sprangen sie in jedem Fall.
„Nein. Wir sind schon zu lange hier oben.“
„Capitaine, wir geben unser Bestes“, drängte der Copilot. Sein ganzer Körper war angespannt. „Wir brauchen nur einen einzigen Anhaltspunkt. Hier ...“, er tippte auf die Michelin-Karte, auf der die Zentrale in der Baker Street das Zielgebiet markiert hatte, „... dieser Wald zum Beispiel. Sobald wir den finden ...“
„Ich weiß“, sagte Mathieu. „Aber die Zeit ist um.“ Er klopfte ihm auf die Schulter, befahl dem Piloten, die Geschwindigkeit zu drosseln, und kehrte in den Frachtraum zurück. „Bereitmachen!“
„Haben wir das Zielgebiet entdeckt?“, fragte Léon.
„Wir können nicht ewig unsere Kreise ziehen“, sagte Mathieu, ohne auf die Frage einzugehen. „Das Dröhnen der Motoren ist über Kilometer zu hören.“
„Capitaine ...“, begann Léon erneut, doch Mathieu schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab und befahl: „Bereitmachen, jetzt!“
„Ich muss protestieren! Wenn wir etwas höher fliegen würden, wäre der Motorenlärm weniger auffällig, und wir könnten ...“
„... vom feindlichen Radar erfasst werden!“ Mathieu fixierte erst ihn und dann die anderen Agenten und sagte: „Wir werden nicht höher fliegen. Wir werden springen. Nun machen Sie sich bereit!“
Mathieu setzte seinen Helm auf, ging ins hintere Drittel des Rumpfes und gab dem Absetzer ein Zeichen. Dieser schob einige Bretter zur Seite, die ein rundes Loch im Boden freigaben. Darüber hing eine rote Lampe. Etwas Wind wirbelte in den Frachtraum und verdrängte den für Militärflugzeuge typischen leicht öligen Geruch. Mathieu fröstelte. Unter sich sah er in die dunklen Tiefen, die schon die Piloten vergeblich zu durchdringen versucht hatten. Ahnungen, Schatten, Umrisse. Obwohl das Bild, das sich ihm bot, so undeutlich war, elektrisierte es Mathieu. Dies war Frankreich. Das Land, in dem sein Vater geboren wurde und wo er selbst den schönsten Teil seiner Jugend verbracht hatte, bevor er nach Großbritannien zurückgekehrt war. Frankreich, das Land, das für ihn stets die wahre Heimat geblieben war. Das Land, das nun in einem braunen Sumpf zu versinken drohte, wenn nicht ein Wunder geschah.
Er hatte Angst. Ja, er fürchtete sich – vor der Größe der Aufgabe und der Vielzahl an Möglichkeiten, daran zu scheitern. Aber er hatte sich in seinem Leben nie von Angst beirren lassen, sondern immer das getan, was er für richtig hielt, und das würde er auch jetzt tun.
Er warf einen Blick zurück auf die Agenten, die ihn begleiteten und sich nun hinter ihm aufreihten. Etienne, ehemaliger Korrespondent einer Pariser Tageszeitung, Léon, Spezialist für Waffen und Sprengstoffe, Kylian, mit achtzehn Jahren der Jüngste im Team, Yann, der Funker, und Pierre, der ehemalige Lehrer, dessen Zwillingsbruder vor einem halben Jahr vor seinen Augen von einem deutschen Offizier erschossen worden war, weil er ihm bei einer Wohnungsdurchsuchung nicht schnell genug aus dem Weg gegangen war.
Mit diesen Männern begab er sich in die größte denkbare Gefahr.
„Bereit?“, rief er ihnen zu.
„Bereit!“, antworteten sie im Chor.
„Yann, Sie zuerst!“
Der Absetzer hakte eine meterlange Aufziehleine von Yanns Fallschirm mit einem Verschlusspin in ein Metallgestell ein. Der Funker trat an die Öffnung im Boden. An der Decke über dem Loch baumelte ein drahtloser Kurzwellen-Funksender, verpackt in zwei unhandlichen Taschen aus Schaumstoff. In der einen befand sich der Transmitter mit seinen Morsetasten und der Batterie, in der anderen steckte der Empfänger. Mathieu befestigte die Taschen mit einem Riemen an Yanns Gurtzeug.
„Fertig!“, rief der Absetzer und klopfte Yann auf die Schulter. „Viel Glück.“ Die Lampe schaltete auf grün. Yann schob sich mit den Händen nach vorn und verschwand durch das Loch.
Nun war Mathieu an der Reihe. Er zog den Riemen seines Helms straff. Der Absetzer hakte seine Aufziehleine ins Metallgestell. Mathieu setzte sich an die Öffnung und ließ die Beine herunterbaumeln. Ein Gefühl der Aufregung erfasste ihn. Das Abenteuer begann. Er beugte sich nach vorn und atmete mit aller Kraft ein, damit die klare Luft seine Lungen füllen konnte. Dann sprang er. Die Aufziehleine straffte sich und öffnete den Rucksack mit dem Fallschirm. Nach einem kurzen freien Fall blies der Windstrom den Fallschirm auf, und mit einem kräftigen Ruck landete Mathieu in den Fangleinen, die ihn mit der weißen Halbkugel über ihm verbanden.
Er blickte nach oben, um zu überprüfen, dass sich der Fallschirm korrekt geöffnet hatte, doch er sah nur einen großen, grauen Schatten. Der Wind riss an seinem Anzug, seinem Gurtzeug, seinem Helm und seinen Beinen. Das Motorengeheul der Whitley entfernte sich rasch. Zurück blieb das sanfte Rascheln des Seidenschirms über ihm.
Es konnten kaum fünfzehn Sekunden vergangen sein, als sich aus der Dunkelheit unter ihm Strukturen herauslösten, einzelne dunkelgraue Punkte und Linien im Schwarz, die sich rasch miteinander verbanden und zu einer Oberfläche wurden. Ein Feld! Mathieu blieben nur wenige Augenblicke, um sich auf den Aufprall vorzubereiten. Er zog die Knie an, presste die Arme an den Körper, spannte jeden Muskel an.
Ein Schlag, der durch seinen ganzen Körper ging, dann war es vorbei. Mathieu rollte sich ab und blieb einen Moment liegen. Der Fallschirm flatterte kurz, fiel in sich zusammen und glitt langsam zu Boden. Mathieu lauschte. War da noch ein fernes Dröhnen der Motoren? Nein, das Flugzeug war schon zu weit weg. Kein Laut war zu hören. Es war die Stille, die in seinen Ohren lärmte.
Er legte das Fallschirmgurtzeug und den Helm ab, öffnete die Reißverschlüsse, die an beiden Seiten seines Fluganzugs angebracht waren, und zog die wenigen Besitztümer hervor, die er mitgenommen hatte: eine graue Tweedjacke, eine braune Flanellhose, einen Fotoapparat, Geld, Papiere. Das war alles. Reisegepäck gab es bei einem Fallschirmsprung nicht.
Die Dunkelheit war weniger vollkommen, als es aus der Luft den Anschein gemacht hatte: Schwaches, von den Sternen und dem Mond zurückgeworfenes Licht sickerte durch die Wolkendecke und erlaubte einen ungefähren Blick auf die nächsten paar Meter. Trotzdem gab es keinen Anhaltspunkt für die richtige Richtung. Mathieu folgte seinem Gefühl. Im Laufen zog er den Fallschirm hinter sich her und atmete dabei den würzigen Geruch feuchter Erde ein. Das Feld war frisch gepflügt. Große, lehmige Erdbrocken erschwerten das Gehen. Außerdem hatte er vor dem Absprung alte, dicke Socken über die Schuhe gezogen, um sie vor Schlamm zu schützen, der später womöglich Aufmerksamkeit geweckt hätte. Durch die Socken fand er noch weniger Halt.
Als er den von Gestrüpp begrenzten Feldrand erreichte, keuchte er und hielt inne. Mit allen Sinnen versuchte er seine Umgebung zu ergründen und ein Gefühl für sie zu entwickeln. Ein sanfter Lufthauch, der an einem gewöhnlichen Tag unbemerkt geblieben wäre. Der dezente Geruch von Erde. Ein fernes Säuseln von Blättern und Halmen.
Er löste einen kleinen Spaten, den er an seinem rechten Bein festgebunden hatte, grub ein Loch, legte den zerknüllten Fallschirm hinein und schaufelte Erde darauf, bis nichts mehr vom Seidenstoff zu sehen war.
Plötzlich hörte er ein leises Ächzen, im Wechsel mit dem Knacken dünner Zweige. Langsam ging er in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Nach Yann und ihm war laut Plan Kylian gesprungen. Anschließend sollte die Maschine einen Kreis drehen und die verbleibenden drei Agenten abwerfen. Damit hatte Mathieu vermeiden wollen, dass die sechs Mann, in einer Reihe abgeworfen, zu weitläufig verteilt werden könnten und einander nicht wiederfinden würden.
Wahrscheinlich hatte er Yann oder Kylian gehört, aber er konnte sich natürlich nicht sicher sein. Vorsichtshalber zog er seine Pistole. Wieder ein Knacken, dieses Mal lauter. Wenige Sekunden später sah er eine Gestalt, die sich durch das Dickicht kämpfte.
„Kylian?“, flüsterte er und bahnte sich seinen Weg durch die Zweige ins Geäst hinein. Anstelle einer Antwort hörte er Knurren und Fluchen. Das war Kylian, eindeutig.
„Kommen Sie schon!“, sagte Mathieu und steckte die Pistole ein. Er ergriff Kylians Hand und zog ihn hinter sich her aufs Feld.
Kylian folgte auf unsicheren Beinen. „Nicht so schnell“, sagte er und stützte sich mit den Händen auf den Oberschenkeln ab.
„Geht es Ihnen gut?“
Kylian hustete und spuckte aus. Mathieus Augen hatten sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Er sah schemenhaft, wie Kylian sich mit den Fingern übers Gesicht fuhr. Vermutlich war es von den Zweigen zerschrammt. „Harte Landung“, sagte Kylian. „Aber das ist ja nicht weiter verwunderlich, wenn man aufs Geratewohl ins Nirgendwo springt.“
Mathieu ignorierte den Vorwurf. „Helfen Sie mir mal mit dem Fallschirm“, sagte er. Die beiden zerrten ihn aus dem Dickicht und vergruben ihn am Feldrand.
„Können Sie laufen?“, fragte Mathieu.
Kylian nickte.
„Dann gehen wir jetzt los. Wir müssen die anderen finden“, sagte Mathieu. Er und die anderen Agenten hatten vor Beginn der Mission einen Treffpunkt bestimmt – einen verlassenen Bauernhof im Herzen ihres Zielgebiets. Sollten sie das Zielgebiet jedoch verfehlt haben, konnte es Tage dauern, bis das Team wieder vollständig war.
Mathieu und Kylian gingen am Gestrüpp entlang, bis sie auf einen Pfad gelangten, der zwischen zwei Feldern verlief. Vorsichtig bewegten sie sich durch die Dunkelheit. Auf ebenen Wegabschnitten kamen sie zügig voran, an anderen Stellen mussten sie mit den Füßen die Löcher und Grasbüschel ertasten, um nicht zu stolpern. Bald hatte Mathieu jedes Gefühl dafür verloren, wie weit sie schon gelaufen waren.
Als der Pfad eine schmale Pflasterstraße kreuzte, knipste Mathieu seine Taschenlampe an und schirmte den Strahl so mit der Hand ab, dass nur ein schwacher Lichtkegel blieb. Ein kleiner, handgeschnitzter Holzwegweiser verriet, dass es rechts nach Verlinghem ging. Die meisten Wegweiser waren abgebaut worden – einige von den Franzosen, um den deutschen Invasoren die Orientierung zu erschweren, und weitere von den Besatzern, um sich vor Eindringlingen wie Mathieu und seinem Team zu schützen. War dieser übersehen worden? Oder diente er der Irreführung? Mathieu beschloss, von Ersterem auszugehen. Er kannte den Namen und vermutete, dass sie sich nördlich des Dorfes befanden.
„Der Treffpunkt liegt in dieser Richtung“, sagte er und deutete geradeaus, wo der Pfad jenseits der Kreuzung als breiter Feldweg verlief. In der Mitte wuchs eine üppige Grasnarbe, links und rechts davon war die Erde etwas abgesenkt und ebener. Eine alte Spur von Traktoren und Wagen, offenbar seit Jahren ungenutzt.
Kylian spähte in die Dunkelheit. „Sind Sie sicher?“
„So sicher, wie ich unter den Umständen sein kann.“ Mathieu schaltete die Lampe aus.
Rasche Schritte näherten sich ihnen von rechts, schwere Schuhe auf den Pflastersteinen. Mathieu hielt Kylian zurück.
„Capitaine! Sind Sie das?“
„Yann?“
„Ja. Gott sei Dank habe ich Ihr Licht bemerkt.“
Mathieu atmete auf. „Gut, Sie zu sehen. Kommen Sie.“
Die drei überquerten die Pflasterstraße und liefen weiter durch die Nacht. Yann berichtete, dass der Transmitter-Koffer bei der Landung einen Schlag abbekommen habe. „Ich fürchte, der Funksender ist beschädigt.“
Mathieu fluchte leise.
Kylian fluchte etwas lauter. „Ist Ihnen bewusst, was das bedeuten kann? Keine Kommunikation mit London! Das heißt, wir können keine Unterstützung anfordern und keine Informationen übermitteln. Wir sind doch so schon ungeschützt genug.“
„Ich weiß, was es bedeutet“, sagte Yann.
„Wie können Sie dann so ruhig bleiben? Es war Ihre Aufgabe ...“
„Er ist ruhig“, zischte Mathieu, „weil dies weder die richtige Zeit noch der richtige Ort ist, sich zu empören. Also seien Sie still.“ Als Mathieu seinen Blick wieder geradeaus richtete, blieb er abrupt stehen und packte Kylians und Yanns Arme, um sie ebenfalls zum Halten zu bewegen. Einige Dutzend Meter vor ihnen erahnte er im nächtlichen Grauschwarz eine noch dunklere Masse. Sie hatte keine klaren Konturen, war vor seinen Augen flüchtig wie ein Schatten im Augenwinkel, der verschwindet, wenn man genauer hinschaut.
„Seht ihr das?“, flüsterte er. Die anderen beiden strengten ihre Augen an, sahen aber offenbar nichts. „Vorsichtig weiter“, wisperte Mathieu.
Ein Umriss entstand. Ein menschlicher Umriss. Mathieu griff zur Pistole und entsicherte sie. Dann schlich er weiter. Er hoffte, anhand des Ganges einen seiner Leute zu erkennen, bevor der Unbekannte sie bemerkte. Aber dafür musste er ihn besser sehen. Plötzlich machte der Schatten einen Satz nach links und sprang über einen niedrigen Erdwall, der den Weg vom Feld abgrenzte. Mathieu und die anderen suchten auf ihrer Seite des Walls Deckung. Gebückt schlichen sie vorwärts.
„Verteilt euch!“, flüsterte Mathieu. Er bedeutete Yann vorauszugehen und Kylian, sich zurückfallen zu lassen. Mathieu selbst schob sich behutsam vorwärts.
Als der Abstand zu Yann und Kylian so groß war, dass er sie gerade noch wahrnehmen konnte, blieb er stehen und wisperte, kaum hörbar: „Bulldogge.“ Er lauschte, drehte den Kopf ein wenig, lauschte erneut. Nichts. „Bulldogge!“, wiederholte er etwas lauter. Und horchte.
„Winston“, sagte eine Stimme in gepresstem Flüsterton auf der anderen Seite des Walls, wenige Meter entfernt. Mathieu richtete sich auf. Er ließ die aufgestaute Luft langsam entweichen, sicherte die Pistole und steckte sie weg.
„Ich bin es“, sagte der Schatten, als er über den Erdwall kletterte. Jetzt erkannte Mathieu Léons Stimme.
„Wir hätten Sie um ein Haar erschossen“, herrschte Kylian ihn an. Léon schenkte ihm keine Beachtung. Als Kylian sich vor ihm aufbaute, schob er ihn zur Seite und sagte: „Scheint, als seien wir fast vollständig, Capitaine. Ich hatte schon befürchtet, heute Nacht niemanden mehr zu finden. Irgendeine Idee, wo Etienne und Pierre stecken könnten?“
Kylian drängte sich zwischen Léon und Mathieu und sagte: „Er ist nicht mehr der Capitaine – er heißt Lucas. Wir sind jetzt in Frankreich, und je schneller Sie umdenken, desto besser für uns alle!“
Mathieu seufzte leise. Die Zusammensetzung seines Teams würde die Mission zusätzlich erschweren. Dem Funker Yann war er schon vor Monaten als Soldat in Gondecourt begegnet, aber Léon und Kylian kannte er erst seit ein paar Tagen. Nicht einmal die Ausbildung hatten sie gemeinsam absolviert. Besonders Kylian war ihm unsympathisch. Er war aufmüpfig und diskutierfreudig – und insgesamt der übellaunigste Achtzehnjährige, dem er je begegnet war. Auf ihn würde er achtgeben müssen, damit er nicht die Nerven der anderen strapazierte. Aber er hegte keinen Groll gegen die Baker Street, die den jungen Mann mit seinen offensichtlichen Charakterschwächen seinem Team zugeteilt hatte. Man musste Abstriche machen. Die Leute standen nicht gerade Schlange, um im besetzten Frankreich unter den Augen der deutschen Besatzer ein Widerstandsnetzwerk aufzubauen und die Kriegsproduktion zu sabotieren. Immerhin hatte Kylian sich bei der Ausbildung nicht nur als aufsässig, sondern auch als talentiert im Umgang mit Waffen und als mutig erwiesen. Das hatte der Leiter der nachrichtendienstlichen Spezialeinheit Special Operations Executive, SOE, in deren Auftrag sie hier waren, Mathieu persönlich versichert.
Der Weg endete an einem verlassenen Bauernhof. Hier, auf einem angrenzenden Feld, hätten sie landen sollen, und hier würden sie sich nun versammeln. Mathieu hielt nach Anzeichen Ausschau, dass Etienne und Pierre schon eingetroffen waren.
Kurz bevor sie das Gehöft erreicht hatten, sahen sie geradeaus Lichter. Worte wurden gerufen, hastig und gepresst. Lichtstrahlen von Taschenlampen wanderten hin und her. Und sie näherten sich den Agenten. Mathieu und seine Leute verbargen sich hinter einem Gebüsch. Die Männer mit den Taschenlampen kamen näher, sie waren zu viert. Einer von ihnen ließ seinen Lichtstrahl über einen anderen huschen, der sich – offenbar auf Deutsch – darüber beschwerte, geblendet worden zu sein. Der störende Lichtkegel wanderte in eine andere Richtung.
Dieser kurze Moment hatte genügt, damit Mathieu am Kragen des geblendeten Soldaten zwei kleine Siegrunen sehen konnte.
Das Abzeichen der Waffen-SS.
Die Deutschen waren an ihnen vorbeigegangen. Mathieu zog seine Pistole und schlich vorsichtig bis an das alte Wohnhaus des Bauernhofes heran. Die anderen folgten ihm, drückten sich an das rissige Gemäuer und verschmolzen in der Dunkelheit damit. Keine Schatten, keine Umrisse. Ein Moment relativer Sicherheit. In der Richtung, aus der sie gekommen waren, sahen sie immer noch die Lichter der Taschenlampen. Wie Leuchtkäfer tanzten sie in der Nacht.
Mathieu und seine Leute schlichen um das Wohnhaus herum und erreichten den Hof, um den sich weitere Gebäude gruppierten. Links schienen sich einige Ställe zu befinden, gegenüber von der Einfahrt stand ein großes quadratisches Haus, von dem Mathieu keine Einzelheiten erkennen konnte. Keine Fenster, keine Verzierungen. Vermutlich eine Scheune.
Erneut hörten sie Stimmen – und erneut klangen die Worte deutsch. Waren die Soldaten umgekehrt? Oder gab es noch mehr von ihnen?
Mathieu deutete geradeaus. „Dort hinein!“, flüsterte er. Sie überquerten den mit hohem Gras bewachsenen Innenhof. Aus der Nähe erkannte Mathieu, dass das Dach der Scheune eingebrochen war. Auch die Gemäuer waren zum Teil eingestürzt. Eine Tür gab es nicht, aber ein Holztor, von dem nur noch ein paar modrige Bretterreste in den Angeln hingen. Ein Stück rechts davon klaffte eine mehrere Meter breite Öffnung in der Wand. Mathieu wollte gerade hindurchschlüpfen, als Kylian ihn am Arm festhielt: „Wir sollten um die Scheune herumgehen. Wenn sie zwischen uns und den Boches liegt, können wir vielleicht fliehen!“
„Wir wissen aber nicht, wo genau die Boches sind“, sagte Mathieu.
„Und wir wissen nicht, wie viele es sind“, fügte Léon hinzu. „Wir sollten hierbleiben.“
„Hier finden sie uns aber“, sagte Kylian.
„So oder so müssen wir erst Etienne und Pierre aufsammeln“, entgegnete Mathieu.
„Aber nicht unter den Augen der Deutschen!“ Kylian klang zunehmend aufgebracht. „Die beiden werden sich schon in Sicherheit bringen. Alles andere wäre zu gefährlich.“
„Gefährlich wäre, wenn wir uns nicht an die Abmachung halten, schutzlos durchs offene Gelände irren und hoffen, dass uns das Licht der Taschenlampen nicht streift“, meinte Mathieu und befreite sich aus Kylians Griff. „Wir bleiben hier!“ Er trat über Ziegelgeröll und Schutt der eingestürzten Wand ins Innere der Scheune. Das wenige Gepäck, das er in der Armbeuge getragen hatte, ließ er auf den Boden fallen und sah sich um. Holzbalken lagen wild gestapelt wie riesige Mikadostäbe. Auch um sie herum wuchs hohes Gras. Ohne Dach und ohne Boden war vom Gebäude nicht mehr als eine schutzlose Hülle übrig. Über sich sah er zwischen den Wolken, die sich immer mehr auflösten, einzelne blass leuchtende Sterne.
Er blieb stehen, als er ein leises Stöhnen vernahm. Er versuchte in der Dunkelheit zwischen Balken, Schutthügeln und Gras etwas zu erkennen. Wieder das Stöhnen.
„Mathieu ... sind Sie das?“
Jetzt konnte Mathieu zuordnen, von wo es kam. Er machte ein paar rasche Schritte und kniete nieder. Hier lag, angelehnt an einen der Holzbalken, Etienne.
„Ja, wir sind hier“, sagte Mathieu. „Was fehlt Ihnen?“
„Bin direkt neben dem Bauernhof gelandet. Es war perfekt. Konnte ihn schon aus der Luft sehen. Ich war mir sicher, dass es sich um den richtigen Hof handelte. So viel Schwein muss man haben!“ Er lachte erstickt und hustete.
„Was fehlt Ihnen?“, fragte Mathieu erneut.
„Habe mir das Bein gebrochen. Ich habe auf Sie gewartet, aber dann kamen die Soldaten. Ich konnte bis hierher kriechen. Jetzt kann ich nicht mehr.“ Etienne verzog das Gesicht und stöhnte. „Ich habe mir dieses Bein schon einmal gebrochen, aber die Schmerzen waren kein Vergleich zu denen, die ich jetzt habe. Ich bin erledigt.“
„Unsinn! Wir werden Ihr Bein schienen und Sie in Sicherheit bringen. Dann rufen wir ein Flugzeug, das Sie zurück nach London bringt.“ Mathieu erinnerte sich, dass der Transmitter Yann zufolge beschädigt war und sie womöglich nicht mit London kommunizieren konnten. Er sagte Etienne nichts davon.
„Ich werde ein Hindernis sein, sonst nichts“, sagte Etienne. „Sie müssen mich hierlassen. Bringen Sie sich in Sicherheit.“
„Das kommt nicht in Frage. Wir ...“
Eine Hand legte sich auf Mathieus Schulter. Er drehte sich um. Es war Kylian. „Sie sind hier“, flüsterte er und deutete zur vom Hof abgewandten Seite der Scheune.
„Rühren Sie sich nicht von der Stelle“, sagte Mathieu zu Etienne und folgte Kylian. Durch ein paar Risse im Gemäuer erspähte er sechs wandernde Taschenlampenstrahlen. Die Soldaten liefen in parallelen Linien das Feld ab, systematisch und geduldig. Einer von ihnen bückte sich und hob etwas vom Boden auf. Im Licht der Lampe erkannte Mathieu ein großes Stück Stoff. Etiennes Fallschirm. Ihm hatte die Kraft gefehlt, ihn zu verbergen, und nun hatten sie ihn gefunden. Und damit Gewissheit erlangt, dass das, was sie suchten, hier war.
Mathieus Gedanken arbeiteten. Die Soldaten waren nicht auf Patrouille. Sie waren nicht zum Aufklären oder Erkunden hier, nicht zum routinemäßigen Durchkämmen von feinddurchsetztem Gelände. Dafür suchten sie zu gründlich. Sie waren nicht zufällig hier. Sie suchten etwas Bestimmtes. Sie suchten ... Mathieu und sein Team.
Die Erkenntnis traf Mathieu wie ein Schlag.
Woher wussten sie von ihnen? Hatten sie sie gesehen? Das Flugzeug gehört? Es auf dem Radar erfasst? Unwahrscheinlich, denn dann hätten die Flakbatterien geschossen. Und der Suchtrupp wäre nicht so rasch vor Ort gewesen.
Ein neuer Gedanke bildete sich in Mathieus Kopf, und er bereitete ihm ein flaues Gefühl im Magen. Hatten die Deutschen schon vorher von ihrer Ankunft gewusst? War sein Team verraten worden?
Er ließ seinen Blick über das Innere der Scheune schweifen, über die Schatten und Umrisse seiner Leute.
Für welchen von ihnen würde ich meine Hand ins Feuer legen?, dachte Mathieu. Er zögerte, bevor er sich die Antwort eingestand. Für keinen. Dafür kenne ich sie zu wenig. Und doch habe ich mich in ihre Hände gegeben. Weil ich keine andere Wahl habe, wenn ich meine Pflicht erfüllen will.
Das schlechte Gefühl in seinem Magen breitete sich aus. Sein Blick fiel auf Kylian, der neben ihm stand und die Deutschen beobachtete. Er war schon die ganze Zeit rastlos und gereizt. Mathieu glaubte, den Grund zu kennen: Kylian hatte in Großbritannien eine hochschwangere Frau zurückgelassen. Kurz vor der Abreise hatte es Komplikationen gegeben. Mathieu hatte erwartet, dass er einen Rückzieher machen würde, aber bei aller Sorge und Anspannung hatte Kylian nicht für eine Sekunde Zweifel gezeigt, dass er an der Mission teilnehmen würde. Sein Pflicht- und Ehrgefühl, seine Liebe zu Frankreich waren stärker gewesen als die Sorge um seine Frau und sein Kind, und Mathieu hatte ihm dafür Anerkennung gezollt. Anfangs hatte er geglaubt, es seien jugendlicher Abenteuergeist und mangelndes Verantwortungsbewusstsein, die ihn seine Mission über das Wohl seiner Familie stellen ließen, doch schließlich war er zu dem Ergebnis gelangt, dass er ihm damit Unrecht tat. Sie alle stellten ihre Aufgabe über ihr persönliches Wohlergehen, sonst wären sie nicht hier.
Aber was war die Aufgabe, die Kylian so wichtig war?
War es die gleiche Aufgabe, für die Mathieu hergekommen war? Oder war es ein anderes Motiv, für das er seine Frau zurückgelassen hatte?
Die Soldaten blieben in der Nähe, schritten über die Felder, die den Bauernhof umgaben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch den Bauernhof selbst durchsuchten.
Etienne stöhnte erneut auf. Mathieu riss sich von seinen Gedanken los. Er konnte im Moment nichts anderes tun, außer wachsam zu sein. „Yann, geben Sie ihm ein Stück Stoff zum Draufbeißen“, befahl er leise und spähte wieder durch die Wand nach draußen. Auf dem Feld trafen sich zwei kleine Suchtrupps. Sie berieten sich, zeigten hierhin und dorthin. Der Strahl einer Lampe richtete sich auf die Scheune und schien Mathieu genau ins Gesicht. Er rührte sich nicht. Er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnten. Aber er wusste auch, dass der Soldat die Taschenlampe als eine Art Zeigestock nutzte.
Und er zeigte auf die Scheune.
Die Soldaten setzten sich in Bewegung und kamen auf die Scheune zu. Mathieu wich von der Wand zurück. „Helfen Sie Etienne auf!“, flüsterte er. „Wir müssen hier raus!“ Etienne nahm sich das Stoffknäuel aus dem Mund und winkte ab. „Nie im Leben“, sagte er. „Wenn ihr mich anrührt, brülle ich wie am Spieß. Ihr müsst mich hierlassen. Ich kann nicht.“
Mathieu ignorierte ihn. „Yann, Sie stützen ihn auf der linken Seite. Ich nehme die rechte.“
„Capitaine, hören Sie mir zu!“, flehte Etienne. „Denken Sie an das, was wir erreichen wollen, und daran, was wir dafür aufgegeben haben. An die Gefahr, in die wir uns alle begeben haben. Machen Sie nicht alles zunichte. Sorgen Sie nicht dafür, dass ich alles zunichtemache. Das dürfen Sie mir nicht antun. Sie müssen an die Mission denken.“
Mathieu atmete tief durch. Etienne hatte recht. Die Soldaten waren schon auf der Stirnseite der Scheune. Sie hatten die Hälfte des Weges zum Hof und damit zum Scheuneneingang zurückgelegt. Er reichte Etienne die Hand. „Es tut mir leid.“ Etienne nickte schweigend, mit aufeinandergepressten Lippen.
Mathieu wandte sich an die anderen: „Raus jetzt! Vielleicht können wir noch entwischen.“ Er setzte sich in Richtung der Toröffnung in Bewegung.
„Wir sollten hierbleiben“, entgegnete Léon und hielt Mathieu fest.
„Keine Zeit für Diskussionen!“, sagte Mathieu irritiert. „Wir gehen, das ist ein Befehl!“
Er riss sich los, doch Léon packte ihn erneut. „Es ist zu spät! Sie sind schon zu nah! Wir sollten uns verstecken und hoffen, dass sie an uns vorbeigehen!“ Mathieu ballte die Fäuste. Léon setzte ihrer aller Leben aufs Spiel.
Ein Lichtschein fiel für den Bruchteil einer Sekunde ins Innere der Scheune. Durch die Öffnung in der Mauer, durch die sie hereingekommen waren, sah Mathieu weitere Taschenlampen. „Verstecken Sie sich!“, flüsterte er, zog Kylian hinter sich her und verbarg sich mit ihm an der Mauer links von der Öffnung. Léon bezog rechts davon Stellung. Yann versteckte sich bei Etienne im Gras zwischen den Balken.
Mathieu ließ sich mit dem Rücken an der Wand niedersinken, bis er saß, lehnte sich nach links und schaute vorsichtig um die Ecke. Er hielt die Luft an. Die Soldaten waren auf dem Hof und kamen näher. Er blickte zu Kylian. Der Junge hockte rechts neben ihm und rührte sich nicht. Dann spähte Mathieu wieder auf den Hof hinaus. Einer der Soldaten schob einen anderen Mann vor sich her. Mathieu konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber die Körperhaltung ließ keinen Zweifel: Es war ein Gefangener. Das musste Pierre sein. Mathieu gefror das Herz. Die Soldaten waren nur noch wenige Schritte entfernt. Sie nutzten den Agenten als Schutzschild.
Mathieu wurde sich bewusst, dass er Kylian zu lange aus den Augen gelassen hatte, und ließ den Blick wieder zu ihm schweifen. Wenn Kylian einen Verrat plante, musste er jetzt handeln. Aber er war noch immer regungslos. In seinen Augen glaubte Mathieu Angst zu sehen. Angst wovor? Vor der Unberechenbarkeit der Situation? Oder doch vor den Soldaten?
Dann hörte Mathieu ein Klicken.
Er wandte den Blick von Kylian ab und sah zur anderen Seite der Öffnung. Léon kauerte nicht mehr an der Wand. Er war aufgestanden und richtete seine Pistole auf sie.
„Keine Bewegung“, sagte er. Dann rief er den Deutschen zu: „Wir sind hier!“
ZWEI
Léon stand breitbeinig neben der Öffnung in der Wand und blickte abwechselnd zu Mathieu und Kylian an der Mauer und zu Yann und Etienne tiefer in der Scheune.
Mathieu erwog, sich auf Léon zu stürzen. Es hatte einen Moment gegeben, eine Sekunde nach dem Klicken, in dem er Léon hätte überraschen und überwältigen können. Vielleicht. Jetzt war Léons Pistole auf ihn gerichtet, und Léon stand, und sie saßen. Der Moment war vorüber.
„Hier!“, rief Léon erneut.
Die ersten drei Soldaten traten mit gezogenen Pistolen in die Scheune. Pierre und seine Wache blieben draußen.
„Aufstehen!“, befahl einer von ihnen, ein SS-Oberscharführer, wie Mathieu am Rangabzeichen der Schulterstücke erkannte. Mathieu und Kylian erhoben sich. Die Soldaten entwaffneten sie und brachten sie nach draußen. Sie mussten sich auf die Wiese setzen. Ausgerechnet jetzt brach der Mond durch die Wolken und beschien die Szenerie. Einer der Soldaten band Mathieu, Kylian und Yann, der zu ihnen geführt wurde, die Hände hinter den Rücken zusammen.
In der Scheune hörte Mathieu Etienne schreien, unterbrochen von lauter werdenden Rufen auf Deutsch, das er bruchstückhaft verstand: „Du sollst aufstehen! Steh auf!“ Mathieu presste die Zähne aufeinander. Er beobachtete, wie zwei Soldaten den heulenden Etienne an seinen Armen durch das Loch in der Wand hinter sich herzerrten. Die Beine stießen an Ziegel, schleiften über den kleinen Schuttberg und durch das Gras. Das Leid seines Kameraden war kaum zu ertragen, aber Mathieu wandte den Blick nicht ab. Seine Aufmerksamkeit, die Qual, die er durchs bloße Zusehen erlitt, war die einzige Solidarität, die er leisten konnte.
In der Mitte des Hofes, bei den anderen Gefangenen, ließen die Soldaten Etienne los. Er fiel zu Boden und konnte sich nicht einmal mehr unter seinen Schmerzen krümmen. Reglos blieb er liegen und wimmerte.
„Durchsucht sie“, wies der Oberscharführer seine Soldaten an. Dann wandte er sich an einen Funker, den Mathieu anhand eines einzelnen Blitzes an seinem linken Ärmel als solchen erkannte: „Gib Dieter Bescheid, dass er zurückkommen und das Pack abholen soll.“
Die Soldaten nahmen ihnen Portemonnaies, Papiere und persönliche Gegenstände ab. Bei Kylian fanden sie ein Klappmesser, bei Mathieu ein dickes Bündel 1000-Franc-Scheine – insgesamt eine Million. Mit dem Geld, das ihnen die SOE mitgegeben hatte, hatten sie die ersten Wochen und Monate im Untergrund finanzieren sollen. Ein Soldat, ein Hüne, dessen Kopf beinahe völlig kahl war und im Mondlicht glänzte wie ein polierter Holzapfel, pfiff anerkennend. „Hier haben wir einen wohlhabenden Burschen“, sagte er.
„Wer davon ist Mathieu Trudeau?“, fragte der Oberscharführer Léon. Mathieu zuckte zusammen, als er den Deutschen seinen Namen sagen hörte. Wochenlang war er darauf gedrillt worden, seine Identität zu vergessen, sobald er einen Fuß auf französischen Boden setzte, und zu dem Menschen zu werden, den sich die SOE für ihn ausgedacht hatte. Nacht um Nacht war er in der Trainingsschule aus dem Schlaf gerissen und in der Dunkelheit angeschrien worden, immer wieder, von einer Stimme, die seinen Namen wissen wollte, die wissen wollte, wann er geboren wurde, welcher Arbeit er nachgehe und wer seine Eltern seien. Erst als die richtige Antwort innerhalb der ersten Sekunde kam, ohne jedes Zögern und Nachdenken, waren seine Ausbilder zufrieden gewesen. „Lucas Bonnet“, hatte er schließlich zurückgeschrien, „Buchhändler aus Paris!“
Mathieu begriff kaum das Ausmaß des Verrats. Es war keine Nachlässigkeit, kein Versprecher, der ihnen zum Verhängnis geworden war, sondern ein geplanter, hinterhältiger Verrat.
Die Deutschen hatten nicht nur gewusst, dass sie hier landen würden. Sie wussten offenbar alles.
Gab es Hinweise, die er übersehen hatte? Léon hatte im Flugzeug energischer als die anderen darauf gedrungen, genau über dem Zielgebiet abzuspringen. Er hatte genau dort landen wollen, wo die Deutschen sie erwarteten. Aber sonst? Mathieu fielen keine Anzeichen ein.
„Er hier“, sagte Léon und zeigte auf Mathieu. „Er ist der Anführer.“
Der Oberscharführer baute sich vor Mathieu auf und schaute auf ihn herab. „Hallo Herr Trudeau. Freut mich, Sie kennenzulernen, wenn auch unter eher unangenehmen Umständen. Ich habe viel von Ihnen gehört.“ Der Oberscharführer, der einwandfreies Französisch sprach, lächelte. Er war ein kleiner, schmaler Mann, dessen scharfes Profil sich im spärlichen Licht klar abzeichnete. Die Nase war schmal und lang, das Kinn spitz.
„Ich bin Oberscharführer Emil Blenke“, sagte er, streckte die Hand aus und beugte sich nach vorn, bis sein Gesicht nur wenige Zentimeter von Mathieus entfernt war. Seine Augen blitzten erfreut. Er genoss seinen Triumph sichtlich. Mathieu verzog keine Miene.
„Ach“, sagte Blenke und tat, als würde er erst jetzt Mathieus Fesseln bemerken, „bitte entschuldigen Sie! Wie taktlos von mir.“
Er zog seine Hand zurück und richtete sich auf. „Sie sind also der uns angekündigte Besucher. Sie sind also der Mann, der hergekommen ist, um sich hier umzusehen und ein bisschen Unruhe zu stiften. Wie schön, dass Sie tatsächlich gekommen sind! Ich hatte schon befürchtet, Sie könnten es sich anders überlegen.“
Seine Stimme war sanft und liebenswürdig. Er ging langsam um Mathieu herum, bis er hinter ihm stand. Mathieu widerstand dem Drang, sich umzusehen, sondern schaute weiter geradeaus ins Leere, scheinbar ganz in sich zurückgezogen. Tatsächlich konzentrierte er sich mit jeder Zelle seines Körpers auf den Mann hinter sich. Er spürte, wo und in welchem Abstand er stehengeblieben war, er lauschte auf seinen Atem, lauerte auf Unregelmäßigkeiten, auf ein plötzliches Luftholen, das einen Angriff ankündigen konnte.
„Ich hoffe, es gefällt Ihnen bislang bei uns“, fuhr Blenke fort und vollendete den kleinen Kreis, den er gelaufen war. „Wobei Sie vermutlich der Auffassung sind, dass uns nicht ganz der richtige Ausdruck ist, nicht wahr? Jedenfalls nicht so, wie ich ihn meine. Denn es ist ja Ihr Frankreich! Sie mutiger Patriot. Aber was Sie denken, spielt nun keine große Rolle mehr.“
Ohne Vorwarnung trat Blenke Mathieu mit seinem Stiefel in den Bauch. Mathieu krümmte sich und kippte nach vorn ins feuchte Gras. „Ich fürchte leider, Ihr Aufenthalt bei uns in Lille wird Ihnen nicht besonders gut bekommen“, sagte Blenke, packte ihn von hinten am Kragen und riss ihn zurück. „Es sei denn, Sie versüßen ihn sich ein wenig. Das liegt bei Ihnen. Unser gemeinsamer Freund Léon konnte mir nicht alle Informationen geben, die mich interessieren. Aus irgendeinem Grund scheinen Sie ihm nicht vollständig vertraut zu haben. Oder vertrauen Sie niemandem? Das wäre ein Jammer, denn wie trist wäre dann Ihr Leben? Was ist Freundschaft ohne Vertrauen? Und was ist Leben ohne Freundschaft? Herr Trudeau, wenn Sie mögen, bin ich Ihr neuer Freund.“
Blenke, der so ruhig sprach, als säße er an einem Winterabend in der wohligen Wärme eines Kamins, schaute mit dem boshaftesten warmherzigen Lächeln auf ihn herab, das Mathieu je gesehen hatte.
„Was sagen Sie? Soll ich Ihr Freund sein? Ich wäre womöglich der einzige.“
Aus halbgeschlossenen Augen beobachtete Mathieu, wie Blenke langsam, regelrecht genüsslich, die Pistole aus dem Halfter zog.
„Sie sind der stille Typ, das ehrt Sie. Ich mag keine Klatschtanten, keine Schwadronierer, keine Plappermäuler. Aber so langsam sollten Sie Ihr Maul aufmachen.“ Blenke trat an Mathieus Seite und hielt ihm die Pistole an den Kopf. „Sie wollten nach Lille, das weiß ich“, sagte er und steckte den Lauf in Mathieus linkes Ohr. „Wer sind Ihre Kontaktpersonen in Lille? Und wann erwartet London Ihren ersten Statusbericht?“
Mathieu dachte an den Transmitter, der Yann zufolge beschädigt, wenn nicht gar zerstört war. Er hoffte, dass der Funker recht behielt und dass das Gerät nicht mehr zu gebrauchen war. Andernfalls konnte Blenke, wenn er bei einer gründlicheren Durchsuchung ihrer Sachen die Codes fand, in ihrem Namen falsche Nachrichten nach London senden. Er würde Verabredungen für weitere Agenten vereinbaren können, die in Frankreich landen sollten, würde falsche Kontaktpersonen übermitteln können, die in Wirklichkeit deutsche Agenten wären, er würde das gesamte, noch sehr lose Widerstandsnetz unterwandern können. Die Folgen konnten verheerend sein.
Blenke ergriff wieder das Wort: „Sie sollten meine Geduld nicht auf die Probe stellen. Vertrauen Sie mir. Ich kann alles mit Ihnen tun, was ich will, aber verlangt es mich danach, meine Befugnisse auszureizen? Nein! Ich wünsche nur Ihre Kooperation.“
Blenke drückte den Pistolenlauf immer fester in Mathieus Ohr. Es schmerzte, aber Mathieu war entschlossen, nicht zu antworten. Er wusste, es würde weder ihm noch seinen Leuten helfen. Mit ein paar Antworten würde sich der Deutsche nicht zufriedengeben. Er würde ihn foltern, so oder so, bis er das letzte Quäntchen Information aus ihm herausgepresst hatte. Und Mathieus erstes Wort würde dafür den Startschuss markieren.
Endlich zog Blenke den Pistolenlauf heraus. Beinahe glaubte Mathieu, sein Gegner habe aufgegeben, da hielt dieser die Pistole dicht neben Mathieus Ohr und schoss in die Luft. Einen Augenblick lang befürchtete Mathieu, sein Hirn sei explodiert. Er schrie auf, versuchte die Hände hochzureißen, aber die Fesseln hinderten ihn, und er kippte zur Seite um. Das Echo des Schusses verhallte in der Nacht, doch Mathieu vernahm es kaum. Hände zerrten an ihm und richteten ihn wieder auf. Er hörte nichts außer einem ohrenbetäubenden Tosen. Langsam kam er zu sich. Das Dröhnen in seinem Kopf klang etwas ab, verschwand aber nicht. Blenkes Worte drangen wie durch einen Schleier zu ihm durch.
„Irgendein Schriftsteller hat mal geschrieben, Vertrauen sei das Gefühl, einem Menschen sogar dann glauben zu können, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle lügen würde. Ich weiß nicht, was ich an Ihrer Stelle täte, Herr Trudeau, aber ich möchte Ihnen vertrauen können. Denn das ist Ihre einzige Chance, am Leben zu bleiben. Ich möchte Ihnen glauben können. Helfen Sie mir dabei.“
Mathieu schwitzte. Sein Brustkorb fühlte sich so eng an, dass er kaum Luft holen konnte. Wie lange konnte er die Taktik des Schweigens noch durchhalten? Und wohin sollte sie führen? Früher oder später würde Blenke die Geduld verlieren, Mathieu und seine Leute verladen und sie in irgendeinen Folterkeller schaffen. Dort würde er seine schmutzige Arbeit aufnehmen.
Mathieu durfte das nicht zulassen. Ihre Mission durfte nicht scheitern – zu viel hatten Großbritannien und er darin investiert. Er hatte sich in der Kunst der geheimen Kriegsführung ausbilden lassen, insbesondere der Sabotage von Fabriken, Eisenbahnen und militärischen Ausrüstungslagern. Er hatte gelernt, wie man einen Kommandoposten aufbaute, in der Bevölkerung Leute rekrutierte und sich ihre Unterstützung sicherte, wie man Empfangskomitees für Agenten und Equipment organisierte, wie man mit Waffen und Sprengstoff umging, wie man einen Funksender bediente, wie man einen Menschen mit einem einzigen Schlag töten konnte. Die wenigen Ressourcen, die Großbritannien in diesen schweren Zeiten aufbringen konnte, waren genutzt worden, um wenige Männer wie ihn auszubilden, die in feindlichem Gebiet Ziele für Sabotageaktionen aufspüren und die Aktionen dann durchführen sollten. Bei der Abreise aus Großbritannien war Mathieu klar gewesen: Entweder er würde in Frankreich seinen Auftrag ausführen, oder er würde bei dem Versuch sterben.
Und nun war der entscheidende Moment gekommen.
Mathieu hob den Blick und ließ ihn nach links und rechts schweifen, um zu sehen, wo sich die Soldaten befanden. Es waren zwischen fünfzehn und zwanzig Mann, die teils die anderen Gefangenen bewachten und teils weitläufig über die Wiese verteilt standen.
„Dornröschen erwacht!“, rief Blenke und klatschte erfreut in die Hände.
Mathieu verschränkte die Beine zum Schneidersitz, lehnte sich nach vorn und schraubte sich in einer raschen Bewegung in den Stand. Noch bevor Blenke verblüfft aufkeuchen konnte, warf Mathieu sich mit aller Wucht gegen ihn und rempelte ihn um. Beide landeten der Länge nach auf dem Boden. Die Landung war hart, da Mathieu sich nicht abfangen konnte, aber er verschwendete keine Zeit, sondern krümmte sich blitzschnell zusammen, zog die auf dem Rücken gefesselten Hände unter den Füßen nach vorn und verschränkte sie vor dem Bauch ineinander. Er verpasste Blenke einen gezielten Schlag auf die rechte Niere, woraufhin dieser seufzte und benommen liegen blieb. Erst jetzt reagierten die anderen Soldaten. Ein Ruf ertönte, ein Schuss wurde abgefeuert, der jedoch sein Ziel verfehlte. Mathieu zog ein Messer aus Blenkes Gürtel, zerschnitt seine Fesseln und stand auf.
Inzwischen waren seine Leute ebenfalls mühsam auf die Beine gekommen und warfen sich auf ihre Wachen, die aufgrund der Dunkelheit wertvolle Sekunden brauchten, um zu begreifen, was geschah. Neue Schreie und Schüsse ertönten. Mathieu stürmte auf Blenkes Funker zu, der etwas abseits stand und mit seiner Waffe dorthin zielte, wo Yann und Kylian mit ihren Wachen rangen. Mathieu schlug ihm seine Faust mit aller Kraft von hinten in den Hals. Der Funker brach zusammen und rührte sich nicht mehr. Mathieu schnappte sich seine Pistole, zielte auf einen Soldaten, der neben dem wehrlosen Etienne stand, und feuerte. Der Soldat riss die Hände hoch und ging zu Boden.
Mathieu lief in die Mitte des Hofes, dorthin, wo Yann und Kylian mit noch immer gefesselten Händen kämpften. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Soldaten sie überwältigten. Er rannte an Pierre vorbei, der vergeblich versuchte, auf die Beine zu kommen. Im Laufen gab er einen Schuss in die Gruppe um Pierre ab, und rannte weiter auf Yann und Kylian zu. Strahlen von Taschenlampen zuckten durch die Nacht. Mathieu hörte Schüsse krachen, aber die Schützen wagten offenbar nicht, mitten ins undurchsichtige Gerangel zu feuern, aus Angst, ihre eigenen Leute zu treffen. Ein Soldat, der gerade auf Kylian einschlug, schien gemerkt zu haben, dass Mathieu von hinten heranstürmte, denn er wirbelte herum, doch da traf ihn schon Mathieus Ellenbogen ins Gesicht, brach ihm die Nase und trieb ihm das Nasenbein ins Gesicht. Er war auf der Stelle tot.
Mathieu durchschnitt erst Kylians und dann Yanns Fesseln. „Befreien Sie Pierre“, sagte er zu Yann und reichte ihm das Messer. Aus dem Augenwinkel bemerkte er von Weitem einen Lkw, der auf dem Feldweg heranholperte. Er sollte sie abtransportieren – und brachte zweifellos weitere deutsche Soldaten.
Da traf ein Faustschlag Mathieu ins Gesicht. Er taumelte zurück, schmeckte Blut. Vor ihm stand Léon. Mathieu machte einen weiteren Schritt zurück und ließ kraftlos die Pistole sinken. Léon holte erneut zum Schlag aus, doch Kylian warf sich gerade rechtzeitig auf ihn und rang ihn nieder. Mathieu kniff die Augen zusammen, hob die Pistole und legte auf Léon an. Er konzentrierte sich mit jeder Faser seines Körpers darauf, für einen Sekundenbruchteil einen freien Schuss zu bekommen. Doch Léon und Kylian wälzten sich wie ein Klumpen aus Kleidern, Armen und Beinen im hohen Gras.
Ein wütender Schrei erklang neben Mathieu. Einer Ahnung folgend warf er sich zu Boden, rechtzeitig bevor ein Pistolenlauf aufblitzte und ein Schuss krachte. Mathieu schoss zurück, doch auch er verfehlte das Ziel. Der Soldat rannte mit ausgestrecktem Arm auf Mathieu zu. Erneut schrie der Deutsche wie in Rage, aber es fiel kein weiterer Schuss, und der Uniformierte warf die Pistole fort, die offenbar leer geschossen war. Mathieu feuerte durchs hohe Gras, das seine Sicht behinderte, aber der Mann lief weiter. Für einen weiteren Schuss blieb keine Zeit.
Mathieu stand auf, aber er ahnte, dass er der Wucht des heranstürmenden Soldaten nichts entgegenzusetzen haben würde. Er wollte noch ausweichen, doch es war zu spät. Der Aufprall riss ihn von den Füßen und presste ihm die Luft aus der Lunge. Die beiden Männer landeten hart auf dem Boden, rappelten sich gleichzeitig auf und standen einander gegenüber. Im kalten Mondlicht erkannte Mathieu in seinem Gegner jenen glatzköpfigen Hünen, der ihm das Geld abgenommen hatte. Er war größer und stärker als Mathieu, dessen einzige Chance Geschwindigkeit war. Und in Geschwindigkeit war er geschult worden. Bevor der Soldat reagieren konnte, streckte Mathieu die Finger der rechten Hand aus und ließ den Arm in einer seitlichen Bewegung nach außen schnellen. Er warf sein ganzes Körpergewicht in den Schlag, den er dem Hünen mit der Handkante direkt unter dem Adamsapfel verpasste. Erneut gingen beide zu Boden, aber dieses Mal blieb der Soldat liegen.
Mathieu erhob sich und stand auf wackeligen Beinen da. Oberscharführer Blenke erschien vor ihm, eine Taschenlampe in der Hand, die kleinen Augen aufgerissen, das Gesicht zu einer hasserfüllten Fratze verzogen. Doch jetzt, da er vor dem Agenten stand, verebbte seine Wut auf einen Schlag. Blenke zauderte. Er war ein kleiner Mann, und sein Pistolenhalfter war leer. Er war offenbar nicht so feige, dass er zurückgewichen wäre, aber sein Mut reichte auch nicht, um anzugreifen. Mathieu befreite ihn aus dem Dilemma. Er stieß ihn kräftig vor die Brust, sodass er stürzte und auf dem Rücken landete. Mathieu stellte sich neben ihn, hob das rechte Bein und ließ seinen schweren Stiefel mit aller Kraft auf Blenkes rechtes Knie niedersausen. Mathieu spürte ein Knirschen und Knacken, einen Widerstand, der nachgab. Blenke riss den Kopf zurück und kreischte.
Mathieu schaute sich um. Blut sickerte ihm aus einer Platzwunde auf der Stirn über die Augen, aber in der allmählich heraufziehenden Dämmerung sah er trotzdem, dass die SS die Oberhand gewonnen hatte. Dort, wo Pierre gegen die Übermacht gekämpft hatte und wohin er Yann geschickt hatte, standen und rannten verwirrte und aufgebrachte Soldaten. Pierre und Yann sah er nicht. Auch Kylian entdeckte er nicht mehr. Mathieu vermutete, dass sie irgendwo im hohen Gras lagen.
Der Lkw war fast da. Er ratterte direkt auf die Einfahrt zum Hof zu. Die Scheinwerfer sprangen auf und ab und durchschnitten die Dunkelheit. Mathieu zögerte. Was sollte er tun? Seinen Leuten helfen? Konnte er das überhaupt? Er war sich bewusst, dass er das zweite Mal zögerte. Beim ersten Mal hatte eine einzige Sekunde gereicht, um Léon den Verrat zu ermöglichen. Er musste sich entscheiden, schnell.
Ein Anflug von Übelkeit überkam ihn, als er erkannte, dass es nun an ihm war, einen Verrat zu begehen. Er konnte nur seine Kameraden verraten – oder die Mission. Und damit Großbritannien.
Mathieu machte einen zögerlichen Schritt in Richtung Scheune, dann spurtete er los. Er musste das Richtige tun. Er musste an die Mission denken. Geduckt lief er um die Scheune herum und auf das Feld zu. Schon bald würden die Soldaten feststellen, dass einer der Gefangenen entkommen war. Sie würden nach ihm suchen. Und wenn sie in die richtige Richtung schauten, würden sie seinen Umriss auf dem offenen Feld über hunderte Meter sehen können. Dennoch musste er es versuchen.
Unter dem dumpfen Rauschen in seinem linken Ohr hörte er hinter sich die leiser werdenden Rufe der Soldaten.
Ein glühender Speer aus Schmerz jagte durch Emil Blenkes Körper, bis er mit einem grellen Blitz in seinem Kopf explodierte. Schwarze Wolken waberten um ihn und beraubten ihn seiner Sicht. Blenke brüllte. Er stöhnte und wälzte sich auf die Seite. Kaum ein Dutzend Meter entfernt kniete ein Sanitäter neben einem Oberschützen, dem Blut aus dem Hals sickerte. „Hierher!“, rief Blenke. „Behandeln Sie mich!“
Der Sanitäter folgte dem Befehl. Er stellte seine Sanitätstasche neben Blenke ab und untersuchte sein Bein. „Sorgen Sie dafür, dass die Schmerzen aufhören“, stöhnte Blenke. Neben ihm röchelte der angeschossene Oberschütze langsam seine letzten Atemzüge.
Der Sanitäter schnitt Blenkes Hosenbein auf und tastete sein Bein mit unsicheren Fingern so vorsichtig ab, dass Blenke es kaum spürte. „Haben Sie so was schon mal gemacht?“, brachte Blenke zwischen zusammengepressten Lippen hervor. „Was ist denn nun?“
„Ich fürchte, Ihr Bein ist gebrochen und Ihre Kniescheibe zertrümmert“, sagte der Sanitäter.
„Und? Sie sollen dafür sorgen, dass es nicht mehr wehtut!“
„Das ist hier leider nur eingeschränkt möglich. Ich kann Ihnen eine Tablette mit einer schwachen Opiumzubereitung verabreichen, aber die Wirkung setzt erst in einigen Minuten ein und ...“
„Geben Sie sie mir, los! Geben Sie mir gleich zwei!“
Blenke schluckte die Tabletten und sah sich um. Der Lkw war angekommen, zusätzliche Einheiten schwärmten über den Hof. „Kuhn!“, rief Blenke.
„Ich bin hier, Oberscharführer.“ Blenke drehte den Kopf in die andere Richtung und sah neben sich Rottenführer Hermann Kuhn stehen, den nicht nur größten und kräftigsten, sondern auch zuverlässigsten Soldaten seiner Einheit. Seine Stimme klang seltsam röchelnd, und er hatte die rechte Hand auf seinen Hals gelegt.
„Habt ihr sie erwischt?“, fragte Blenke.
„Ich habe mir gerade einen Überblick verschafft, Oberscharführer. Drei unserer Männer sind tot, vier verletzt. Zwei Agenten sind tot. Einer scheint entkommen zu sein.“
„Wo ist Trudeau?“
„Er ist derjenige, den wir noch nicht gefunden haben.“
Blenke fluchte.
Ein Sturmmann trat vor. „Ich glaube, ich habe einen Schatten in Richtung Scheune rennen sehen, Oberscharführer.“
„Was steht ihr dann hier rum?“, brüllte Blenke. „Wir müssen ihn finden! Folgt mir!“ Blenke stützte sich mit den Armen ab und kam in eine sitzende Position. Rottenführer Kuhn reichte ihm einen Arm, doch Blenke schlug ihn fort. Er drückte sich langsam hoch, bis er schwankend und stöhnend stand, das gesamte Gewicht auf das linke Bein verlagert. Doch schon beim ersten Schritt stürzte er schreiend zu Boden. Rottenführer Kuhn wollte ihm erneut aufhelfen, aber wieder schlug Blenke seine Hand fort. „Fassen Sie mich nicht an!“ Für eine Sekunde versuchte Blenke, sich wieder aufzurichten, dann ließ er sich atemlos zurücksinken. „Also gut! Sucht ihn ohne mich. Los, los!“
„Zu Befehl!“
Kuhn und der Sturmmann schnappten sich den gefangenen Agenten mit dem gebrochenen Bein und schleppten ihn, gefolgt von ein paar weiteren Soldaten, um die Scheune herum, aus Blenkes Gesichtsfeld. Blenke hörte ein gelegentliches Stöhnen des Gefangenen, dann Stille. Nun konnte er dessen Pein nachvollziehen. Mitgefühl hatte er deshalb trotzdem keines.
Durch die Distanz und die Scheune gedämpft, aber in der Stille der Morgendämmerung doch verständlich, hörte Blenke Kuhns Rufe in etwas ungelenkem Französisch. „Trudeau! Zeig dich! Wir wissen, dass du dich hier irgendwo versteckst! Komm raus, oder wir erschießen deinen Kumpel!“
Die Schmerzen waren kaum zu ertragen. Blenke jammerte und fluchte. Eben hatte er die Diagnose des zerstörten Knies noch abgetan, aber jetzt bildete sich in seinem Kopf die Frage, was sie für ihn bedeuten konnte. Panik wallte in ihm auf. Was, wenn sein Bein unwiderruflich ruiniert war, jetzt, hier in Frankreich, wo seine Karriere endlich Fahrt aufzunehmen schien? Erst vor einigen Wochen war er zum Oberscharführer befördert worden, hatte nach Jahren des Stillstandes wieder Hoffnung geschöpft und Pläne gefasst. Er hatte Großes vor, wollte Hauptscharführer werden und schließlich einen Offiziersrang erhalten. All sein Denken war darauf ausgerichtet. Es war unvorstellbar, dass ein einziges Missgeschick den Lohn aller Mühe gefährden sollte. Allein der Gedanke schnürte ihm die Kehle zu.
Als Rottenführer Kuhn und die Soldaten unverrichteter Dinge zurückkehrten, war Blenkes Entschlossenheit so weit gewachsen, dass er erneut versuchte aufzustehen. Er verzog das Gesicht, stöhnte und keuchte und versuchte, die Schmerzen zurückzudrängen, die ihn überwältigen wollten. Der Wille, Trudeau dingfest zu machen, überwog seine Abneigung, Hilfe anzunehmen. „Kuhn, geben Sie mir Ihre Hand.“
Der Rottenführer half ihm auf und stützte ihn von rechts. Es gelang Blenke, stehenzubleiben. Ein weiterer Soldat trat hinzu und fasste Blenke unter der linken Schulter.
„Wer ist der Zweite in der Kommandohierarchie?“, wandte sich Blenke an Léon, der sich abseits gehalten hatte.
„Einen zweiten gibt es nicht“, erklärte Léon.
„So ein Sauhaufen!“ Blenke sah sich auf dem Hof um. „Lebt vom Rest noch einer?“
„Der dort“, sagte Kuhn und deutete auf einen schmalen Mann mit roten Haaren.
„Kylian Benoit“, fügte Léon hinzu.
„Nehmt ihn mit“, sagte Blenke und stöhnte. „Jetzt vorwärts!“ Halb trugen ihn die Soldaten, halb hüpfte er. Der Weg um die Scheune herum erschien ihm furchtbar weit. Er geriet außer Atem und schwitzte. Aber er schaffte es.
Sie erreichten die andere, dem Feld zugewandte Seite, wo, bewacht von drei Soldaten, noch der Gefangene mit dem gebrochenen Bein lag. Die Soldaten schafften einen zerbrochenen Holzbalken aus der Scheune herbei. Blenke setzte sich darauf und blickte aufs Feld hinaus. Er suchte nach einer menschlichen Gestalt, die sich an die Erde schmiegte und sich im konturenarmen Dämmerlicht vor ihnen verbergen wollte.
Doch er entdeckte keine. Natürlich nicht. Seine Soldaten hatten bereits nach Trudeau gesucht und ihn nicht gefunden.
Und doch musste er hier irgendwo sein.
„Wo bist du?“, murmelte Blenke. Er hasste die Nacht. Er hasste die Dunkelheit. Er hasste es, nicht richtig sehen zu können, in seiner Wahrnehmung beschränkt zu sein. Nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erfassen zu können, kam einem unakzeptablen Kontrollverlust gleich. Er drängte die aufflammende Wut zurück und versuchte, sich auf das Feld zu konzentrieren.
Keine Spur von Trudeau.
„Hat sich irgendwas gerührt?“, fragte er die Soldaten, die den Gefangenen mit dem gebrochenen Bein bewacht hatten.
„Nichts.“
„Die Scheune wurde durchsucht?“ Dieses Mal wandte er sich wieder an Rottenführer Kuhn.
„Jawohl, Oberscharführer.“